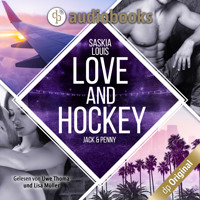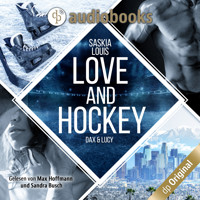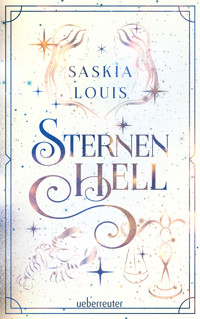9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe ist immer ehrlich … oh Gott, das könnte zum Problem werden! Im humorvollen Liebesroman "Ich will dies, das und dich" lernt die herrlich unperfekte Svea Nussbaum durch ihre ganz persönliche Vorsatzliste fürs neue Jahr nicht nur ehrlich zu sich selbst und anderen zu sein, sondern auch die Magie wahrer Liebe kennen. Svea Nussbaum ist 31 Jahre alt, unglücklich verliebt … und nicht immer ganz ehrlich. Was sie leider zur Meisterin unangenehmer Situationen und Ausreden macht. Doch nach einem mehr als peinlichen Silvesterabend hat sie genug. Sie schreibt eine lange Liste an Vorsätzen, die persönlicher kaum sein könnte. Dumm nur, dass sie versehentlich anstelle eines Arbeitsdokuments ebendiese Liste an den CEO der Firma schickt, die sie eigentlich als Kunden gewinnen soll. William Grant ist alles, was sie nicht ist. Ehrlich, erfolgreich … und ganz anders, als Svea erwartet hätte. Denn nicht nur betraut der charmante Firmenchef sie dennoch mit der Leitung des Projekts, sondern schickt ihr darüber hinaus auch eine eigene Liste an Vorsätzen. Und plötzlich findet sich Svea in der merkwürdigsten Abmachung ihres Lebens wieder … "Mit Witz, Charme und viel Liebe erobert Saskia Louis mein Herz und ich will es nie wieder zurück. Eine witzige und auch tiefgründige Geschichte über die Magie der Gegensätze und der Macht der guten Vorsätze." - April Dawson Mit unfassbar viel Witz, Charme und Emotionen sowie einem wundervollen Happy End sorgt die originelle Liebeskomödie von Saskia Louis nicht nur für viele heitere Lesestunden, sondern regt auch zum Nachdenken an. Was würde denn zum Beispiel auf Ihrer Vorsatzliste fürs nächste Jahr stehen …?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Saskia Louis
Ich will dies, das und dich
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Svea Nussbaum ist 31 Jahre alt, unglücklich verliebt … und nicht immer ganz ehrlich. Was sie leider zur Meisterin unangenehmer Situationen und Ausreden macht. Doch nach einem mehr als peinlichen Silvesterabend hat sie genug. Sie schreibt eine lange Liste an Vorsätzen, die persönlicher kaum sein könnte. Dumm nur, dass sie versehentlich anstelle eines Arbeitsdokuments ebendiese Liste an den CEO der Firma schickt, die sie eigentlich als Kunden gewinnen soll. William Grant ist alles, was sie nicht ist. Ehrlich, erfolgreich … und ganz anders, als Svea erwartet hätte. Denn nicht nur betraut der charmante Firmenchef sie dennoch mit der Leitung des Projekts, sondern schickt ihr darüber hinaus auch eine eigene Liste an Vorsätzen. Und plötzlich findet sich Svea in der merkwürdigsten Abmachung ihres Lebens wieder …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Danksagung
Prolog
Wenn man heulend, regendurchnässt und mit blutender Platzwunde am Kopf an einer Bushaltestelle endet, die einem mithilfe von künstlerisch wertvollem Graffiti die Worte Fuck you entgegenschreit, muss man irgendwann im Leben die falsche Abzweigung genommen haben. In meinem Fall war es womöglich nicht nur eine.
Wo soll ich anfangen? Ich schätze, alles begann mit meinem kleinen Problem: Ich lüge zu viel.
Es ist keine große Sache. Es sind meistens nur Kleinigkeiten. Notlügen, die ich einbaue, ohne es zu merken. Wie zum Beispiel, dass ich zu spät zur Arbeit gekommen bin, weil meine Bahn ausgefallen ist.
Okay, nein, das ist gelogen.
Erstens: Ich merke es immer, wenn ich lüge. Weil ich es mit Absicht tue.
Zweitens: Wenn ich zu spät komme, rutschen mir Dinge heraus wie: »Mein Hamster ist gestorben, und ich musste ihn noch kurz im Garten begraben, und dann konnte ich vor lauter Tränen meine Schaufel nicht finden, und … Es tut mir leid, was habe ich verpasst?« Ich habe einen Hamster – mittlerweile meinen siebten, wenn man all meinen Notlügen Glauben schenkt –, aber ich besitze keinen Garten. (Natürlich nicht. Ich wohne in der Kölner Innenstadt und gebe monatlich mehr für meine Miete aus als in fünf Jahren für Klamotten.)
Drittens: Es sind nicht nur Kleinigkeiten. Ab und zu sind es auch ein wenig größere Sachen. Und ein wenig ist eigentlich auch nicht korrekt. Das sage ich nur, damit es nicht so schrecklich klingt.
Gut, für den Fall, dass die nächsten Geständnisse ein schlechtes Licht auf mich werfen könnten: Ich bin kein schlechter Mensch. Das ist ausnahmsweise die Wahrheit. Ich kann Richtig und Falsch unterscheiden. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem mir mit dem Fegefeuer gedroht wurde, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Engel saßen im Fernseher und verrieten es meinen Eltern, wenn ich unerlaubterweise Videokassetten ansah. Mein Opa persönlich warf Blitze aus dem Himmel, wenn ich Süßigkeiten aus dem Schrank stahl und meine Zähne nicht putzte.
Meine kleine Schwester kam sehr schnell dahinter, dass das Schwachsinn war, aber ich habe, bis ich zehn war, im Fernseher nach besagten Engeln gesucht und mir den ein oder anderen Stromschlag geholt.
Das tut jetzt gar nichts zur Sache. Wie gesagt: Ich kann Richtig und Falsch unterscheiden. Gut und Böse dank all der Disneyfilme, die ich gesehen habe, auch. Ich helfe blinden Leuten in den Bus, spende an Greenpeace, erkläre meiner Mutter geduldig, wie sie eine E-Mail mit Anhang verschickt und würde für meine beste Freundin ein Jahr lang auf Schokoladenkuchen verzichten. Alles in allem bin ich ein guter Mensch. Es ist nur das Lügen. Ansonsten ist mein moralischer Kompass wirklich intakt.
Schön. Da ich mir das jetzt vom Herzen geredet habe, können wir zu den größeren Lügen kommen, die ich schon verbreitet habe: Zum Beispiel habe ich meiner Schwester erzählt, dass ich Jugendliche dabei beobachtet hätte, wie sie sich an ihrem Küchenfenster zu schaffen machten und es aufbrachen, sodass ihr geliebter Wellensittich abhauen konnte. Dabei war es meine beste Freundin Elisa, die die Blumen meiner Schwester gegossen und vergessen hat, den Käfig sowie das Fenster zu schließen.
Okay, nein. Ich war es. Ich hatte alle Pflanzen meiner Schwester während ihres Urlaubs gekonnt umgebracht und ihren Wellensittich noch dazu. Auch wenn ich mir bis heute nicht sicher bin, ob Flying Louie wirklich das Zeitliche gesegnet oder irgendwo im Grüngürtel seine eigene Familie gegründet hat und sehr glücklich ist. (Aber wahrscheinlich lüge ich mir damit ebenfalls nur was vor.)
Ich hatte vorgehabt, Karla die Wahrheit zu sagen. Wirklich. Aber sie wirft mir seit zwanzig Jahren bei jeder Gelegenheit an den Kopf, wie verantwortungslos und schusselig ich doch sei, und ich hatte ihr nicht noch mehr Zündstoff geben wollen. Die Lüge ist mir so rausgerutscht, und im nächsten Moment war sie schon zur Polizei gestapft, um Anzeige gegen die nichtexistierenden Jugendlichen zu erstatten und … ja, dann war es irgendwie zu spät gewesen.
Wie auch immer. Die Lüge lastet seitdem auf mir, aber ich habe mich damit arrangiert. Ich zünde jedes Mal eine Kerze für Flying Louie an, wenn ich einer Kirche einen Besuch abstatte. Was relativ häufig ist. Na ja, einmal im Jahr eben. Zu Weihnachten, mit meiner Familie. Ich glaube nicht an Gott und bin schon vor zwei Jahren aus der Kirche ausgetreten, auch wenn meine Eltern natürlich keine Ahnung davon haben. Doch das zähle ich zu den kleinen Notlügen. Denn meine Mutter würde einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich ihr beichten würde, dass meine Zweifel an Gott und der Bibel daher rühren, dass ich keine Engel im Fernseher hatte finden können.
Okay, wo war ich? Ach, ja, die größeren Lügen.
Mein Vermieter denkt, dass ich Autorin bin und der zweite Name auf meinem Klingelschild mein Pseudonym ist. Dabei ist es Elisas Nachname, die seit zwei Jahren mit mir zusammenwohnt, obwohl Herr Henning ausdrücklich gesagt hat, dass er keine WGs in seinem Gebäude haben will. Und letztens hat mein Boss gefragt, wer schon in Neuseeland gewesen ist und optimalerweise auch unglaublich gern campen geht. Er hat jemanden gesucht, der wertvolles Insiderwissen für den Auftrag einer neuseeländischen Outdoorfirma besitzt.
Meine Hand ist von ganz allein nach oben geschossen. Obwohl ich in meinem Leben noch nicht näher an Neuseeland herangekommen bin als beim Essen einer Kiwi und der Gedanke, in einem Zelt auf dem Boden zu schlafen, für mich in etwa so erquickend wie ein Brief vom Finanzamt ist.
Aber was ist mir anderes übrig geblieben? Ich brauche den Auftrag, damit ich in meinem Job endlich weiterkomme. Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt und arbeite seit einem Jahr als Junior Project Managerin für eine Marktforschungsfirma, die Unternehmen hilft, ihre Produkte und Dienstleistungen optimal nach den Bedürfnissen ihrer Zielgruppen auszurichten. Trotz meines Titels durfte ich noch kein einziges Projekt leiten, obwohl ich meinen Master in Markt- und Medienforschung mit 1,7 abgeschlossen habe und mir beim Einstieg versichert worden ist, dass ich sehr schnell mehr Verantwortung übernehmen würde.
Das Ganze ist noch ein wenig tragischer, weil die Hälfte wieder gelogen ist. Ich bin bereits dreißig – schön, einunddreißig! –, arbeite tatsächlich seit fünf Jahren dort, und mein Abschlusszeugnis trug die Note 1,3. Keine Ahnung, warum ich selbst deswegen lüge. Unterm Strich bin ich verdammt gut in meinem Job. Das ist die Wahrheit. Ich schwöre auf meinen Hamster Skippy den Siebten.
Und wahrscheinlich wäre ich längst zur Senior Project Managerin befördert worden, wenn der Sohn vom Boss nicht bei uns angefangen und innerhalb von sechs Monaten die einzig freie Senior-Executive-Stelle in den Allerwertesten geschoben bekommen hätte. Aber sicherlich hat er sich die Stelle dank seiner harten Arbeit, nicht seiner DNA, verdient.
(Was offensichtlich Schwachsinn ist, der Typ kann eine PowerPoint-Präsentation nicht von Mario Kart unterscheiden – das Spiel, das er die Hälfte seiner Arbeitszeit auf seiner Switch zockt.)
Zu sagen, dass ich deswegen frustriert bin, wäre ebenfalls gelogen, denn ich bin fuchsteufelswild und würde den Kerl gern jeden Tag mit Schildkrötenpanzern abwerfen. Echten, versteht sich. Da das jedoch strafrechtlich eine Grauzone ist und auch der Artenschutz vermutlich etwas dagegen hätte, begnüge ich mich damit, ihm Hamsterköttel in seine geliebten brasilianischen Kaffeebohnen zu mischen, die er mit niemandem teilen will. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir meinen Hamster einzig und allein aus dem Grund gekauft.
Ich bin nicht stolz darauf, aber … Okay, ich bin ein wenig stolz drauf. Immerhin verstecke ich seit einem Jahr unbemerkt Nagetier-Exkremente in einer für jeden zugänglichen Kaffeeküche. Das ist schon eine beachtliche Leistung.
Doch als mein Boss mich gefragt hat, ob die Beförderung seines Sohnes für mich in Ordnung sei, ich würde auf jeden Fall die nächste freie Stelle bekommen, habe ich nur gelächelt und genickt. Wie ein verdammter Wackeldackel.
Also ja: Meine Hand ist bei der Frage nach Neuseeland-Erfahrung nach oben geflogen, und die letzte Woche habe ich damit verbracht, mir Wikipedia-Artikel über den Inselstaat und Camping durchzulesen. Letzteres war keine anregende Lektüre, wenn ich das bemerken darf.
So, das ist es. Mein kleines großes Problem. Ich lüge zu viel und weiß es und kann nicht damit aufhören. Aber das ganze Lügen macht mich weder glücklicher noch zufriedener. Das Gegenteil ist der Fall. Denn irgendwann habe ich den Überblick darüber verloren, was ich wem erzählt habe und wie man durchs Leben kommt, ohne wie wild zu flunkern. Auch wenn ich das wirklich ändern will.
Ja. Das ist eigentlich alles, was man über mich wissen muss, um zu verstehen, wie ich an besagter verregneter Bushaltestelle der Hölle enden konnte.
Okay, nein, das ist gelogen. Das waren viel zu wenig Informationen. Aber ich greife vorweg. Fangen wir doch mit Silvester an. Denn das Ende des Jahres ist immer auch ein Anfang. Die Möglichkeit, alles besser zu machen. Der Tag, den ich jedes Jahr nutze, um darüber nachzudenken, was ich richtig und falsch in meinem Leben mache. Jedes Jahr am 31. Dezember nehme ich mir eine Stunde Zeit, um eine Liste der Dinge zu schreiben, die ich verbessern will. Die ich umsetzen will, um die fantastischste Version meiner selbst zu werden.
Es ist klar, worauf das hinausläuft, oder?
Denn ja. Das ist natürlich gelogen. Ich habe noch nie eine solche Liste geschrieben. Doch es gibt immer ein erstes Mal.
Kapitel 1
Ernsthaft, Elisa? Du hast zwanzig Vorsätze fürs nächste Jahr?« Ungläubig ließ ich ihre Liste auf unseren Wohnzimmertisch fallen. »Ist das nicht ein wenig exzessiv?«
»Zwanzig ist nicht soo viel«, meinte sie leichthin, beugte sich vor und glitt mit ihrem Zeigefinger an den einzelnen Punkten hinab. »Außerdem habe ich nur die wichtigen Dinge aufgeschrieben.«
»Steppen zu lernen, ist also wichtig?«, fragte ich zweifelnd.
»Lea kann steppen, und ich habe ihr versprochen, dass ich versuche, mich mehr für ihre Interessen zu begeistern«, erwiderte sie schulterzuckend.
»Ich bin mir sicher, dass deine Freundin verstehen wird, wenn du keine Zeit dafür hast, Steppen zu lernen, da du schon damit beschäftigt bist …« Ich linste auf ihre Liste und las laut: »Eine aussterbende Tierart zu retten, deine eigene Butter zu stampfen und Origamikunst zu erlernen.«
Elisa winkte ab. »Ist doch egal, ob ich die ganze Liste schaffe. Zumindest weiß ich, was ich erreichen möchte. Es ist psychologisch wertvoll, sich die Ziele für seinen nächsten Lebensabschnitt von der Seele zu schreiben! Ich habe damit meine Gedanken geordnet und meinen Willen gestärkt. Du solltest das auch tun, Svea. Mit mentaler weißer Weste ins neue Jahr starten.«
Ich zog eine Grimasse. Elisa machte nach sechs Jahren Psychologiestudium endlich ihre Therapeutenausbildung, und seitdem waren eine Menge Dinge psychologisch wertvoll. »Ich hab keine Zeit, eine alberne Liste zu erstellen«, meinte ich kopfschüttelnd. »Ich muss den Tisch zu Ende decken, die Gäste sind gleich da.«
Elisa seufzte, stand jedoch von der Couch auf, um mir in die Wohnküche hinterherzuwuseln und dabei zu helfen, Besteck aus der Schublade zu bergen. »Warum genau kommen deine Eltern noch mal hierher, um Silvester zu feiern?«
»Ich bin damit dran. Wir rotieren jedes Jahr«, erinnerte ich sie.
»Ich weiß, aber es ist lächerlich, hier zu feiern. Deine Schwester hat ein Haus, deine Eltern haben ein Haus – wir haben diese Winzwohnung.«
Das hatte Karla auch gesagt und großzügig angeboten, dieses Jahr noch einmal Gastgeberin zu spielen. Doch ich hatte nichts davon hören wollen. Ich war ein vollwertiges Mitglied der Familie, und ich würde ein vollwertiges Silvester-Dinner veranstalten.
»Überhaupt«, fuhr Elisa fort. »Normale Familien verbringen Weihnachten zusammen, nicht Silvester.«
»Wir sind nicht normal!« Ich lief hastig zum Tisch, auf dem bereits die Teller mit zu Schwänen gefalteten Servietten standen, die mich zwei Stunden gekostet hatten, weil das Youtube-Tutorial absolut unverständlich gewesen war. »Papa und Karla haben jedes Jahr das Weihnachtskonzert mit der Philharmonie. Silvester ist unser Ausweichtermin.«
»Ja, ich weiß, aber ich dachte, dieses Jahr wäre vielleicht anders. Weil Karla doch das Baby bekommen hat und dein Vater in Rente gegangen ist?«
Schnaubend positionierte ich das Besteck parallel zum Teller, sorgsam darauf bedacht, dass es sich in der richtigen Reihenfolge und im exakt gleichen Abstand zueinander befand. Als ob meine jüngere Schwester sich von einer kleinen Schwangerschaft und einem neugeborenen Sohn davon abhalten lassen würde, weiterhin eine glänzende Karriere hinzulegen. Und mein Vater würde erst dann in Rente gehen, wenn seine Finger anfingen zu zittern und er zu schwach wurde, ein Cello zu halten.
»Nichts hat sich geändert«, erklärte ich Elisa geduldig, denn so war es. Seit dreißig Jahren hatte sich nichts geändert.
»Na gut«, sagte meine Freundin gedehnt, reichte mir die letzte Gabel an und betrachtete dann den ausgezogenen Tisch, der fast unser ganzes Wohnzimmer einnahm. »Es sieht aber echt toll aus. Man merkt, dass du dich reingehängt hast, Svea.« Sie nickte beeindruckt, dann betrachtete sie mich grinsend. »Nur für deine Eltern? So kenne ich dich gar nicht.«
Ich zuckte die Schultern, und Hitze arbeitete sich meinen Hals hinauf. »Ach, es sind nicht nur meine Eltern. Karla und ihr Mann und … noch wer anderes kommen auch«, meinte ich beiläufig.
Nicht beiläufig genug.
Elisa hob die Augenbrauen und lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Küchenanrichte, während ich nachsah, ob die Flammen unter den Wärmebehältern des Essens noch brannten.
»Aha«, machte meine beste Freundin kritisch. »Und wer anderes hat nicht zufällig verträumte blaue Augen und Haare in der Farbe eines karibischen Sandstrands?«
Ich wandte den Blick ab. Es war wirklich unfair, dass sie mich einfach ungefragt zitierte. »Möglich«, sagte ich vage.
Elisa stöhnte laut und legte den Kopf in den Nacken. »Oh, komm schon, Svea! Das kann nicht dein Ernst sein. Du kannst ihm nicht schon wieder hinterherrennen.«
Nein, nicht schon wieder. Immer noch. »Ich habe keine Ahnung, wovon du redest«, sagte ich lässig. »Und musst du nicht langsam mal gehen? Lea wartet doch bestimmt auf dich.«
»Lenk nicht vom Thema ab!« Elisas Zeigefinger landete zielsicher auf meiner Brust. »Das muss ein Ende haben, Svea!«
»Es hat ja nicht einmal einen Anfang gehabt, wie soll es dann ein Ende haben?«, verteidigte ich mich sofort. »Und du kennst ihn nicht so, wie ich es tue. Er ist der perfekte Mann!«
Schnaubend schüttelte sie den Kopf. »So etwas gibt es gar nicht. Den perfekten Mann.«
»Natürlich sagst du das: Du stehst auf Frauen.«
»Ich sage es, weil es wahr ist! Niemand ist perfekt.«
Das behaupteten nur Leute, die Leon nicht kannten. Er war der Bruder meines Schwagers und blonde, eins dreiundneunzig große Vollkommenheit.
Ich hatte ihn vor sechs Jahren auf der Geburtstagsparty meiner Schwester kennengelernt. Keiner der Männer, die da gewesen waren, hatte mir sonderlich Beachtung geschenkt. Nicht, während Karla im Abendkleid aus dem Stegreif auf ihrer Geige ein paar Takte des Violinkonzerts in D-Dur op. 77 von Brahms spielte. Doch dann war da Leon gewesen mit seinem schiefen Lächeln, der mich gefragt hatte, ob ich ein Glas Punsch haben wolle – und ob es wohl dreist wäre, als Nächstes ein Stück von David Guetta zu fordern.
Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen.
Na ja, für mich. Für ihn nicht. Für ihn war es, soweit ich wusste, gar nichts gewesen. Aber wir hatten uns gut verstanden, uns darüber ausgelassen, wie schrecklich klassische Musik war (eine kleine Lüge meinerseits, ich war nun einmal die Tochter meines Vaters und weinte jedes Mal, wenn jemand die ersten Takte von Mozarts »Kleiner Nachtmusik« anspielte), und dass wir beide nicht verstanden, wie Marvel noch weitere Filme produzieren konnte (jaja, ebenfalls gelogen, Iron Man war mein damaliger Screensaver). Wir waren Freunde geworden. Keine superguten Freunde, die sich jeden Tag sahen und genau wussten, was im Leben des anderen passierte, aber … Freunde eben.
Freunde, die einmal zusammen im Bett gelandet waren.
»Svea. Du rennst ihm seit fünf Jahren hinterher«, sagte Elisa gequält.
»Das stimmt nicht!« Es waren sechs.
»Doch! Genauso ist es. Und ihr habt nur eine einzige Nacht miteinander verbracht. Eine betrunkene Nacht.«
Ich seufzte schwer und wollte mir fahrig durch die Haare streichen, als mir einfiel, dass ich sie bereits kunstvoll hochgesteckt hatte. Verärgert ließ ich die Hand sinken. »Es war eine verdammt gute Nacht! Und damals war er eben noch nicht bereit für eine Beziehung. Heute sieht das vielleicht anders aus.«
»Er wird niemals bereit sein, weil du niemals bereit dafür sein wirst, ihm zu sagen, dass du ihn magst und mehr willst. Du wirst ewig auf ihn warten und jedem anderen tollen Kerl nicht einmal eine Chance geben«, stellte Elisa ernst fest.
Sie traf da einen wunden Punkt. Denn eine der größeren Lügen, die ich vergessen hatte zu erwähnen, war: »Na klar können wir das Ganze vergessen. Es war nur ein Ausrutscher. Ich halte es auch für das Beste, wenn wir Freunde bleiben.«
Aber was sagte man dem Mann, in den man heillos verliebt war, wenn er einen bat, die gemeinsame Nacht geheim zu halten? Weil sie zu besonders für ihn war, um sie mit jemand anderem zu teilen – er mich aber auch nicht als Freundin verlieren wollte, weshalb es eine einmalige Sache bleiben musste?
Eben. Man sagte genau das, was ich gesagt hatte.
»Ich warte nicht auf ihn«, stellte ich scharf klar. »Und ich vergebe eine Menge Chancen, aber bisher hat mich noch niemand überzeugt.«
Aber ernsthaft, wer konnte auch mit einem Mann konkurrieren, der über die Feiertage Clown auf der Kinderkrebsstation spielte, mit achtundzwanzig ein eigenes Online-Versand-Business aufgebaut und außerdem ein Sixpack hatte?
Elisa blies ihre Wangen auf und schüttelte mehrfach den Kopf. Doch Gott sei Dank fiel ihr Blick auf die Uhr über der Spüle, bevor sie sich überlegen konnte, wie sie meine eindeutige Lüge kommentieren sollte. »Mist, ich muss wirklich los«, sagte sie widerwillig. »Aber dieses Gespräch ist noch nicht beendet, hörst du? Wir reden da morgen noch mal drüber!«
»Super, ich freu mich drauf«, erwiderte ich überschwänglich. Elisa würde morgen viel zu verkatert sein, um sich freiwillig mit dem anstrengenden Thema meines Liebeslebens zu beschäftigen.
Sie schnaubte, so als wüsste sie genau, dass ich auf ihren heutigen Alkoholkonsum baute, während sie sich die Schuhe anzog. »Hey, und lass dich heute Abend nicht zu sehr von Karla ärgern, okay?«
»Ich versuch’s, aber ich kann nichts versprechen«, antwortete ich ehrlich. Karla hatte einfach eine Art, die mir jedes Mal unter die Haut ging. Und nicht auf die gute Weise.
»Wunderbar.« Sie richtete sich auf, warf den Wintermantel über und zog mich in eine Umarmung. »Guten Rutsch dir – und überleg dir das mit der Liste an Vorsätzen! Mir hat das echt geholfen, meine Gedanken zu ordnen.«
»Mhm«, machte ich, konnte jedoch nicht weitersprechen, denn ein Klingeln an der Tür unterbrach mich.
Mein Herz machte einen Hüpfer, und meine Handflächen wurden feucht. Nervös strich ich sie an dem blauen Satinstoff meines Kleides ab, das auf meiner Haut juckte.
Ich hatte Leon schon seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen, und ich wollte ihn von den Socken hauen. Aber das konnte ich nicht, wenn ich verschwitzt und rotbäckig aussah, also atmete ich konzentriert ein und aus, um mich mental darauf vorzubereiten.
»Wie sehe ich aus?«, fragte ich Elisa leise, in der Hoffnung, ein Kompliment abzubekommen, das meinen Herzschlag beruhigte.
Meine Freundin musterte mich nachdenklich, bevor sie meinte: »Du siehst nicht aus wie du, aber schön.«
Düster sah ich sie an. »Na, vielen Dank auch!«
Sie schnalzte mit der Zunge. »Du weißt, wie ich das meine.«
Ja, natürlich wusste ich das.
Ich machte es mir normalerweise nicht zur Gewohnheit, im Abendkleid zu Hause herumzuhängen. Wenn ich vollkommen ehrlich war, fühlte ich mich einfach nicht wohl in schicker Kleidung. Mein etwas zu kurviger Körper wurde ihr nicht gerecht, und ich war prädestiniert dafür, innerhalb der ersten fünf Minuten des Essens zu kleckern.
Doch Karla schlug jedes Jahr vor, uns für Silvester schick zu machen, und … ja, ich log und sagte, dass das eine klasse Idee sei. Weil ich ihr nicht den Spaß verderben wollte.
»Du bist cool und klug und witzig, Svea«, murmelte Elisa an meinem Ohr. »Hör also auf, dir so viele Gedanken zu machen.«
Dankbar drückte ich sie noch einmal an mich. »Erwähnte ich, wie sehr ich dich vergöttere?«
Sie grinste breit. »Ach, ein paar Mal öfter könntest du es mir schon sagen«, erwiderte sie leichthin – im nächsten Moment öffnete sie die Tür.
Ich hätte nicht nervös sein müssen, denn es war nicht Leon, der vor der Tür stand. Es waren meine Eltern.
»Hallo, Herr und Frau Nussbaum. Sehr schön, Sie wiederzusehen«, begrüßte Elisa sie. »Ich bin leider auf dem Sprung, wünsche Ihnen aber schon mal ein frohes Neues und einen wundervollen Abend noch dazu.« Sie lächelte breit, winkte den beiden zu und drängte sich dann an ihnen vorbei in den Flur und die Treppe hinunter.
»Liebe Güte, die Elisa ist auch immer auf Trab«, bemerkte meine Mutter amüsiert, bevor sie mich umarmte. »Schön, dich zu sehen, Motte!«
Ich seufzte innerlich, als auch mein Vater mich mit meinem alten Spitznamen begrüßte, drückte ihn jedoch ebenso fest an mich wie Mama. Mir hätte es weniger ausgemacht, als Flatterinsekt bezeichnet zu werden, doch sie meinten mit Motte nicht das Tier, sondern die mittelalterliche Burg. Weil ich als Achtjährige mal verkündet hatte, dass ich Ritter werden wollte, eher kompakt gebaut gewesen war und die Eigenart gehabt hatte, meine Halloween-Süßigkeiten bis auf den Tod zu verteidigen. Und mit einunddreißig noch immer »Mittelalterliche Burg« genannt zu werden, war nur halb so süß, wie man meinen könnte. Klar, alle dachten, sie sprachen vom Insekt, aber ich wusste, dass es nicht so war, und das war schlimm genug. Aber das konnte ich ihnen natürlich nicht sagen, ohne ihre Gefühle zu verletzen.
»Kommt rein«, meinte ich, trat beiseite und winkte sie durch den schmalen Flur in unseren Wohnbereich. »Das Essen ist schon fertig, wir können also sofort anfangen, wenn die anderen da sind.«
»Oh, das riecht himmlisch«, schwärmte meine Mutter, lief zum Herd und lugte unter eine der silbernen Servierglocken. »Liebe Güte, Motte, hast du das alles selbst gekocht?«
»Japp, stand stundenlang in der Küche.«
Die Worte verließen meinen Mund, bevor ich sie aufhalten konnte. Sie waren sarkastisch gemeint gewesen, aber meine Mutter verstand Sarkasmus ebenso gut wie die technischen Feinheiten eines E-Mail-Anhangs. Und bevor ich sie darauf hinweisen konnte, wurden ihre Augen anerkennend groß, und mein Vater meinte: »Mensch, Svea. Das ist ja echt toll von dir.« Also blieb ich bei der Lüge. Es war einfacher so, und ich freute mich, dass sie mir zutrauten, Ente à l’Orange zu kochen, obwohl das von meinem Standpunkt aus undenkbar war.
Erstens, weil ich Vegetarierin war und mir allein der Geruch schon den Magen umstülpte, ganz zu schweigen von dem Gedanken, mit der Hand Orangen in ein totes Tier zu stopfen. Und zweitens, weil ich den Tag über gar keine Zeit zum Kochen gehabt hätte. Ich war damit beschäftigt gewesen, die Wohnung aufzuräumen, mich selbst hübsch zu machen, die sexistischen Bronzefiguren aufzustellen, die meine Mutter mir jedes Jahr zu Weihnachten schenkte (ich hatte einmal gelogen und behauptet, dass ich sie inspirativ und wunderschön fand, und bekam seitdem jedes Jahr eine), und das Poster über der Couch von der Serie Dark mit dem Poster eines Gemäldes von Kandinsky auszutauschen (ein Geschenk von Karla, damit ich auch endlich etwas Kultur in meine Wohnung bekam). Nichts gegen Kandinsky, aber wenn ich mir eine Reihe bunter Farben und Formen ansehen wollte, schaute ich im Kindergarten nebenan vorbei.
Wann hätte ich also bitte vier Stunden lang eine Ente zubereiten sollen, von der ich nichts essen würde? Elisa hatte mir einen Vogel gezeigt, als der Cateringservice mit dem Vogel gekommen war. »Du isst seit zehn Jahren kein Fleisch mehr, warum solltest du es servieren?«
Weil meine Eltern Fleisch liebten. Weil meine Schwester und ihr Mann Fleisch liebten. Weil Leon Fleisch liebte. Weil ich sie beeindrucken wollte. Ganz einfach.
»Und Menschenskinder, der Tisch ist auch famos«, stellte mein Vater begeistert fest. »Diese Schwäne … Wo hast du das denn gelernt?«
»Ach, hab es irgendwo aufgeschnappt und dachte spontan, wäre doch ganz hübsch«, sagte ich lächelnd und verfluchte mich im selben Moment.
Es wäre vollkommen in Ordnung gewesen, mit Youtube zu antworten. Aber nein, ich hatte ja leger und cool sein müssen. Es war nur … Karla wusste bestimmt, wie man Serviettenschwäne bastelte. Sie hätte auch keine hübschen neuen Dessertlöffel kaufen müssen, weil ihre aussahen, als hätten sie mit ihren besten Freunden Rost und Fleck auf der Wiese hinterm Haus gespielt.
Gott sei Dank klingelte es in diesem Moment wieder an der Tür, denn mein Kopf war beim Gedanken daran spürbar rot angelaufen.
»Ich mach auf«, sagte ich hastig und verschwand im Flur, bevor meine Eltern mir zuvorkamen. Denn ich war eine gute Gastgeberin und … Shit, ich hätte ihnen was zu trinken anbieten sollen. Egal, das konnte ich gleich immer noch machen.
Mein Zwerchfell zog sich aufgeregt zusammen, und ich atmete ein letztes Mal tief durch, bevor ich die Tür aufzog.
»Svea, so schön, hier zu sein!«, begrüßte mich meine Schwester, zog mich in einer hastigen Umarmung an sich und lief mit Babyschale im Anschlag an mir vorbei. Ich erhaschte nur einen kurzen Blick auf den supersüßen, bereits selig träumenden Noah. Denn ja, der Kleine schlief jeden Abend um Punkt halb acht ein und dann brav die ganze Nacht durch. Er war mindestens ebenso perfekt wie seine Mutter. Allerdings hatte er mich noch nie in seinem Leben kritisiert – solange freudiges Ansabbern nicht zählte. Ich liebte ihn also zu Tode.
»Dito«, bemerkte Tim, ihr Ehemann, lächelte und klopfte mir auf die Schulter, bevor er ebenfalls in den Flur trat … Und da stand er. Leon. In schwarzem Anzug, der sich perfekt an seine breiten Schultern schmiegte, seine blonden Haare in sexy Surfermanier verwuschelt und ein schalkhaftes Glimmen in den Augen. Mein Körper wollte seufzen, doch ich hielt ihn davon ab.
»Hey«, sagte ich stattdessen nur atemlos. »Na, wie geht es dir? Lange nicht gesehen.«
»Ja, stimmt.« Er kratzte sich das glatte Kinn. »Ein paar Wochen, oder?«
Acht Wochen und zwei Tage – aber wer zählte schon mit? »So ungefähr«, meinte ich lächelnd und ermahnte meinen Puls dazu, langsamer zu schlagen, bevor schwarze Punkte anfingen, vor meinen Augen zu tanzen.
»Auf jeden Fall schön, dich zu sehen«, sagte Leon, lächelte mich schief an und zog mich in eine feste Umarmung.
Ich konnte seine harte Brust selbst durch seinen Mantel hindurch spüren, und mein Herz flatterte so nervös, dass ich den Spitznamen Motte heute womöglich fast verdient hatte. Ich sog die Luft und seinen Geruch nach teurem Aftershave ein, und möglicherweise rollten meine Augen dabei etwas in den Hinterkopf. Gott, dieser Mann …
»Boah, ich hatte einen beschissenen Tag, aber jetzt geht es mir wieder besser«, meinte er, ließ mich los und zwinkerte mir zu.
Ich öffnete den Mund, um zu fragen, was so schrecklich an seinem Tag gewesen war, doch er sprach sowieso bereits weiter.
»Ich hatte einen Termin mit einem riesigen Kunden, wir hatten uns eigentlich auf einen sechsstelligen Betrag geeinigt, und da wollte er im letzten Moment den Deal killen! Aber, ganz ehrlich, nicht mit mir! Wir hatten das Ganze schon per Handschlag geregelt, und unter Businessmännern zählt ein Handschlag etwas.«
Ich nickte, auch wenn ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung hatte, worüber er redete. Leon war sehr leidenschaftlich, was seine Arbeit anging, vergaß aber manchmal, genauere Infos zu seinen Deals zu geben, sodass man ihm schlecht folgen konnte. Es war verständlich. Er war immer recht beschäftigt, seine Arbeit verlangte ihm viel ab. Er musste eben mit dem Kopf woanders sein, um das Business zu schaukeln. Weshalb er auch nie viel Zeit für sein Privatleben hatte.
Was ich auf seinen Wortschwall antworten musste, wusste ich trotzdem. »Du kriegst es schon hin«, meinte ich warm.
»Ja?« Er kratzte sich den Kopf. »Wieso denkst du das?«
»Weil du fantastisch bist und es immer hinkriegst, Leon«, stellte ich lachend fest.
Er grinste. »Dagegen kann ich nicht argumentieren. Danke.«
»Svea, hast du noch Platz in deinem Kühlschrank?«, wollte Karla wissen, die ihren Mantel aufgehängt hatte und auf eine Auflaufform in Tims Händen deutete. »Ich hab Mandelpudding mitgebracht. Extra für dich!«
Betreten kratzte ich mir den Kopf. Ja, ich log eine Menge, aber bei manchen Dingen musste ich die Wahrheit sagen. Weil wortwörtlich mein Leben davon abhing. »Ähm, ich bin gegen Mandeln allergisch, Karla.«
»Ah.« Sie runzelte die Stirn. »Mist. Ich wusste doch, dass Mandeln etwas mit dir zu tun haben. Sorry.«
Ich winkte ab. »Gar kein Problem«, meinte ich leichthin. Sie vergaß es nicht mit Absicht. Das wusste ich. Sie hatte einen Sohn, einen zeitaufwendigen und stressigen Job, ein Haus und einen Ehemann … Es war schwer, an alles zu denken. »Aber ja, im Kühlschrank ist noch Platz.«
»Wunderbar.« Sie gestikulierte Tim, den Nachtisch wegzupacken, bevor sie auf ihren hohen Schuhen grazil in den Wohnraum glitt und unsere Eltern mit einem Küsschen auf die Wange begrüßte. Die hatten allerdings nur strahlende Augen für ihren putzigen Enkel, dem die Geräuschkulisse völlig egal schien. »Oh, wie süß. Sind die Möbel neu?«, wollte Karla dann wissen und nickte zu dem alten, roten Sofa und den zusammengewürfelten Stühlen, die um den Esstisch herumstanden. »Dieser Trash-Chic ist ja total in.«
Ich konnte mich nur mühsam davon abhalten, die Augen zu verdrehen. Ich liebte Karla, aber sie nahm meistens weder ihre Umgebung noch die Emotionen ihrer Mitmenschen wahr. Und meine Möbel waren seit einem Jahrzehnt dieselben! Doch jedes Mal, wenn sie zu Besuch kam, machte sie irgendein hanebüchenes Kompliment dazu, wie heruntergekommen sie doch waren. Aber ich mochte sie! Sie waren eine bunte Mischung aus Flohmarktfunden und Ikea-Katalog und hatten ihren ganz eigenen Charme. Niemand hatte so ein Wohnzimmer wie Elisa und ich. Es war … etwas Besonderes.
Also ignorierte ich Karla und fragte stattdessen laut: »Möchte irgendwer was trinken? Ich habe Champagner gekauft.«
»Oh, wunderbar, Motte!«, verkündete meine Mutter, die noch immer das schlafende Baby betüddelte, das einfach weiterträumte. Meine Güte, wäre ich nur so unbeeindruckt von meiner Familie wie mein Neffe.
»Sehr gern«, stimmte Tim zu. »Welche Marke ist es denn?«
Keinen Schimmer. Musste ich nachgucken. »Ähm. Die, deren Namen man nicht aussprechen kann?«, sagte ich leichthin, bevor ich zum Kühlschrank ging, um die Flasche zu bergen.
»Warte, ich helfe dir«, bot Leon an und trat hastig zu mir in die Küche.
Amüsiert hob ich die Augenbrauen. Ich brauchte keine Hilfe. Ich konnte selbst einen Korken knallen lassen und eine Flüssigkeit in Gläser füllen. Es war trotzdem süß von ihm, also ließ ich mir die Flasche abnehmen und nickte breit lächelnd. »Klar.«
»Mann, es riecht schon köstlich«, rief mein Vater. »Fangen wir direkt mit dem Essen an?«
»Warum nicht?«, meinte ich schulterzuckend und reihte die Gläser auf der Theke auf.
»Möchtest du gleich das erste Stück Ente, Svea? Als Gastgeberin steht es dir zu«, sagte meine Mutter freundlich.
»Sie ist Vegetarierin, Silke«, erinnerte Leon sie und füllte die Gläser. Dankbar sah ich ihn an.
»Ah, stimmt.« Das Gesicht meiner Mutter erhellte sich. »Das heißt, du isst nur Hühnchen, richtig?«
»Nein, Mama, sie isst nur Gemüse«, meinte Karla lachend, bevor sie mich fragend ansah. »Aber ich dachte, das machst du nur, um Gewicht zu verlieren.« Ihr Blick glitt an meinem Körper hinunter, und mein Herz sank eine Etage tiefer. »Wenn du Probleme dabei hast, ich kann gern meinen Fitnesstrainer mit dir teilen.«
Mein Kiefer spannte sich an, und meine Finger zuckten, sodass ich fast eines der Champagnergläser fallen ließ, doch ich behielt das Lächeln auf dem Gesicht. »Nein, danke«, sagte ich knapp. »Ich komm schon klar.«
»Sie sieht vollkommen okay aus«, sprang mein Vater ein. »Viele Männer mögen lieber was zum Anfassen, Motte. Mach dir also gar keine Gedanken.«
Mein Kopf stand kurz davor zu platzen, und ich wollte etwas sagen, mich verteidigen. Aber die Worte standen mir quer im Rachen.
So war es jedes Mal. Wäre ich mit meinen Freunden unterwegs gewesen, wären mir hundert kluge und witzige Comebacks eingefallen. Doch bei meiner Familie fühlte ich mich … ideenlos? Scheiße, mir fiel nicht einmal in Gedanken das richtige Wort für das ein, was ich ausdrücken wollte!
»Essen wir«, würgte ich deswegen nur hervor. »Ich dachte, wir machen eine Art Buffet, jeder nimmt seinen Teller mit und holt sich, was er will.«
»Oh, sehr schöne Idee!«, lobte mich Karla. »Wie in einer Mensa.«
Ich biss die Zähne aufeinander. In einer Mensa würde es kein verdammtes Essen geben, das mich zweihundert Euro gekostet und fast in die roten Zahlen getrieben hatte! Doch ich nickte nur und stürzte das Glas Champagner herunter, das Leon mir reichte. Meine Familie war noch keine zehn Minuten hier, und trotzdem fühlte ich mich schon so gestresst, dass mein linkes Augenlid anfing zu zucken.
Ich hatte mir solche Mühe gegeben! Der Tisch sah wunderschön aus, das Essen roch – na ja, nicht für mich, aber sicherlich für Fleischesser – fantastisch, und die Servietten waren verdammte Schwäne! Ich wusste wirklich nicht, was ich besser hätte machen sollen und …
Ach, egal. Der Abend konnte immer noch fantastisch werden! Ich sollte den Mut nicht verlieren. Bis Mitternacht lagen noch vier Stunden vor uns, die Zeit würde ich nutzen.
Kapitel 2
Dreieinhalb Stunden später flog mir nur eine einzige Frage im Kopf herum: Wie lang konnten vier Stunden bitte sein? Einstein hatte recht. Zeit war relativ. Es war nicht so, dass das Dinner ein Reinfall war. Es war nur … anstrengend. So anstrengend, dass ich mir wünschte, ich könnte einfach mit Noah den Platz tauschen und ebenfalls selig in meinem Bettchen schlafen. Auch wenn ich auf das Babyfon verzichten würde, da ich im Schlaf manchmal redete.
Das Essen an sich war ganz nett. Da meine ganze Kohle für die Ente draufgegangen war, musste ich mich mit Kartoffeln und Bohnen begnügen. Aber das war in Ordnung, zumindest der Rest der Gruppe sah sehr zufrieden aus. Sie lobten mich alle für meine Kochkünste, bewunderten die Serviettenschwäne, sprachen sich für mein künstlerisches Auge beim Kandinsky-Poster aus. Jeder am Tisch gab mir eine Menge Komplimente, doch keines sorgte dafür, dass ich mich wirklich gut fühlte. Denn sie komplimentierten nur Dinge, die nicht wirklich Ich waren. Niemand bewunderte die Schallplattenuhr über der Spüle, die ich selbst gebaut hatte. Keiner kommentierte mein Tiramisu, das ich tatsächlich selbst gemacht hatte, da sie zu beschäftigt damit waren, Karla für ihren Mandelpudding zu loben, der bestimmt lecker war. Ich würde es jedoch nie erfahren.
Aber ich war selbst schuld.
Ich konnte sie nicht belügen und mich dann darüber ärgern, dass sie auf meine Lügen reinfielen. So funktionierte es nicht. Und während ich meinem Schwager, meiner Mutter und Leon dabei zuhörte, wie sie über ihre Geschäfte und Geld und Anlagestrategien fachsimpelten, und ab und zu Worte von Karla und Papa aufschnappte, die natürlich über die Philharmonie, den neuen Dirigenten und den Erfolg des Weihnachtskonzerts sprachen, entstand ein kleiner, fester Knoten in meiner Brust.
Ich machte irgendetwas falsch in meinem Leben. Ich sollte mich mit meiner eigenen Familie am Tisch nicht so … verloren fühlen. Die eine Hälfte (Leon zählte ja im weitesten Sinne und in meinen Träumen dazu) hatte ihren kleinen Finanz- und Geschäftsclub. Die andere ihren professionellen Musikerclub.
Und ich? Ich aß meine Kartoffeln, lachte ab und zu und betete zu den Engeln in meinem Fernseher, dass niemand mich fragte, ob ich denn endlich befördert worden war und mir somit bald eine größere Wohnung leisten könnte. Diese Frage war nämlich sehr beliebt unter meinen erfolgsorientierten Verwandten. Meine Eltern waren keine Snobs, das durfte man nicht falsch verstehen, sie waren nur … snobistischer als ich.
»Sag mal, spielst du noch, Svea?«, wollte mein Vater auf einmal wissen.
Ich zuckte überrascht zusammen, blinzelte und versuchte, mich daran zu erinnern, worüber sie gerade gesprochen hatten. »Ähm … was? Spielen?«
»Violine, Svea«, sagte Karla ungeduldig und schüttelte amüsiert den Kopf. »Hast du wieder in deiner Traumwelt gesteckt?«
»Oh, nein, ich … habe ich nicht.« Ich räusperte mich und faltete die Hände auf dem Tisch. »Klar. Violine. Ja. Ab und zu spiele ich noch, aber nein, nicht mehr wirklich.«
Es war eine Lüge. Ich spielte jede Woche mehrere Stunden. Ohne Publikum. Nur für mich. Weil es mir beim Nachdenken und dabei half, stressige Tage zu vergessen. Aber wenn ich das zugegeben hätte, hätten sie mich vermutlich noch aufgefordert, etwas vorzuspielen, und Papa und Karla waren verdammte professionelle Streicher. Natürlich würde ich nicht vor ihnen spielen.
»Danke übrigens für eure Geschenke«, sagte ich, um vom Thema abzulenken. »Ich hab mich sehr gefreut.«
»Oh, kein Problem«, meinte Karla und zuckte bescheiden die Schultern. »Ich weiß doch, wie sehr du Schokolade liebst – und sie ist das Beste, was man derzeit auf dem Markt bekommen kann. Sehr teuer, aber nur erlesene Zutaten. Ich hoffe, du isst nicht alles auf einmal.« Sie lachte, und ich lächelte ebenfalls, wenn auch etwas gezwungen.
Ich würde überhaupt nichts von der überteuerten Schokolade essen, wenn ich keinen anaphylaktischen Schock erleiden und einen grausamen Tod sterben wollte. Denn natürlich waren Mandeln darin!
»Hab ich euch schon erzählt, was Tim mir geschenkt hat?«, fragte Karla und sah ihren Ehemann verliebt an, bevor sie seine Hand auf dem Tisch drückte. »Ein romantisches Wellnesswochenende an der Mosel. Wirklich, wir sind vier Jahre verheiratet, und es fühlt sich trotzdem an wie am ersten Tag.«
»Awww«, machten alle, mich eingeschlossen. Es war keine Lüge! Ich fand es wirklich goldig.
»Mann«, meinte Leon. »Ihr seid so süß miteinander. Wenn ich irgendwann mal bereit bin, mich fest zu binden, will ich genau das haben, was ihr habt.«
Mein Herz stolperte in meiner Brust, bevor es auf die doppelte Größe heranwuchs. Er wollte … das, was Karla und Tim hatten? Das Haus, das gemeinsame Kind, die Bilderbuchliebe? Vor fünf Jahren wären diese Worte aus seinem Mund undenkbar gewesen, aber jetzt … jetzt hatte er sie gesagt.
Meine Handflächen wurden feucht, und meine Mundwinkel zuckten. Ich hatte recht! Er entwickelte sich weiter. Vielleicht … Vielleicht würde er irgendwann …
»Sag mal, Svea, kann ich dich kurz auf dem Balkon sprechen?«, unterbrach Leon meine Gedanken.
Schlagartig wurde mein Mund trocken. »Allein?«, fragte ich unbeholfen.
Er nickte.
Oh Gott. Hatte er meine Gedanken gelesen? Hatte ich sie womöglich laut ausgesprochen? Das machte ich manchmal, wenn ich nervös war, ohne es zu merken. Doch da kein anderer mich beachtete, schloss ich das aus. »Klar«, sagte ich, rieb mit dem Zeigefinger über einen Fleck auf meinem Kleid – ich hatte mehr als fünf Minuten durchgehalten, aber nicht um viel! – und stand unbeholfen auf, sodass ich beinahe den Stuhl umwarf.
Karla kommentierte das mit einem Seufzen, während meine Mutter sagte: »Aber beeilt euch, es ist gleich zwölf.«
»Dauert nicht lang«, versicherte Leon ihr, bevor er mich, eine große, warme Hand in meinem Rücken, zum Balkon geleitete, der direkt vom Wohnzimmer abging. Meine Haut prickelte dort, wo er mich durch den Stoff hindurch berührte, und meine Knie wackelten.
Oh, großer Gott, reiß dich zusammen, Svea!
Mein Körper gehorchte mir nicht. Aber warum sollte er auch? Mein Rumpf wollte nicht so viele Sit-ups machen, wie ich von ihm verlangte, und mein Gesicht das Blut nicht daran hindern, ständig in meine Wangen zu steigen – warum sollten meine Knie eine Ausnahme sein?
Gott sei Dank standen draußen zwei Gartenstühle. Ich sank auf den linken und Leon nahm den rechten.
»Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Svea?«, wollte er stirnrunzelnd wissen.
Mein Magen machte einen Hüpfer. Wieso fragte er das? »Keine Ahnung, so … fünf Jahre?« Sechs, es waren sechs.
»Richtig.« Er nickte abwesend, bevor er den Kopf wandte und mich anlächelte. »Ich weiß noch, wie du auf Karlas Geburtstagsparty standest in deinem schwarzen Kleid. Du sahst ziemlich verloren aus.«
Blau. Das Kleid war blau gewesen. Aber bei dem diesigen Licht damals waren die Farben vielleicht schwer zu unterscheiden gewesen. »Ich war verloren«, sagte ich lachend und rieb über meine kalten Arme. Das heutige Kleid war ebenso wenig für Dezembertemperaturen gemacht wie sein blauer Vorgänger damals. »Es wurde sich über nichts anderes als klassische Musik und Orchester unterhalten.«
Und eigentlich hätte ich bei jedem dieser Themen gut mitreden können, doch Karlas Gäste hatten alle so schick ausgesehen, so selbstsicher gewirkt, und ich hatte mich schlichtweg nicht getraut, eine Unterhaltung anzufangen.
»Oh ja, ich erinnere mich.« Leon grinste. »Mann, ich verstehe manchmal wirklich nicht, worüber Karla redet. Also, sie ist toll und alles … aber ja.«
Meine Mundwinkel zuckten. Ich wusste genau, was er meinte.
Leon seufzte schwer, sein Atem eine weiße Wolke in der kühlen Luft, und ließ den Blick über die Hausdächer vor uns schweifen. Elisa und ich wohnten im vierten Stock, und die Aussicht war der Grund gewesen, warum ich mich damals in die Wohnung verliebt hatte. Man konnte mitten in der Stadt wohnen und sich trotzdem frei fühlen.
»Weißt du, wie man am Ende des Jahres auf alles, was man erreicht hat, zurücksieht und dann merkt, dass einem etwas fehlt?«, murmelte Leon abwesend.
Ich schluckte, und meine Lippen kribbelten. »Ja«, wisperte ich.
Er holte tief Luft und sah mir im nächsten Moment fest in die Augen. »Svea, ich würde dich gern etwas Wichtiges fragen.«
Oh Gott. Es passierte. Panik und Vorfreude stiegen in mir hoch, und auf einmal wusste ich nicht, wo ich meine Hände hintun sollte. In meinen Schoß, auf die Armlehne … oder vielleicht auf Leons Bein? Nein, das war zu früh. Zu viel.
Zu früh und zu viel … nach sechs Jahren?!
»Aber ich war nicht sicher, ob ich so direkt sein kann«, fuhr Leon fort.
Ich nickte und versuchte zwanghaft, mich auf sein Gesicht und nicht auf meine eigenen sich überschlagenden Gedanken zu konzentrieren. Das hier war wichtig.
»Du kannst mich alles fragen«, sagte ich nervös und friemelte an meinem Kleidersaum herum, während Gänsehaut meine Arme hinaufkletterte. Aber das könnte auch an der Kälte liegen. Okay, nein. Es lag an Leons intensivem Blick, der seine Iriden verdunkelte.
»Das weiß ich«, antwortete er lächelnd. »Aber manche Fragen stellt man eher als andere.«
Mein Herzschlag beschleunigte sich, und meine Finger verkrampften sich um den Stoff. Ich konnte nicht fassen, dass das passierte! Wie lange hatte ich darauf gewartet? Ich wusste es nicht, es … Oh, doch. Sechs Jahre!
Leon räusperte sich und beugte sich vor, während ich von drinnen meine Eltern, Tim und Karla laut von zehn herunterzählen hörte. Es war kurz vor Mitternacht, das neue Jahr wurde eingeläutet, und ich saß mit Leon auf meinem Balkon … und er würde mich gleich küssen.
Ich wusste, dass es so war. Ich spürte seinen Atem auf meinem Gesicht, hörte mein Herz laut in meinen Ohren schlagen.
»Sechs … Fünf … Vier …«
»Ja?«, hauchte ich, falls er vergessen hatte, dass er mir eine Frage hatte stellen wollen.
»Drei …. Zwei … Eins …«
Ich schloss die Augen, atmete tief durch …
»Kannst du mir dabei helfen, einen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit zu erstellen und die Ergebnisse auszuwerten?«
»Frohes neues Jahr!«, schrien alle aus dem Wohnzimmer. Doch ich hörte sie kaum. Ich riss die Augen auf, starrte Leon mit geöffneten Lippen an und fragte mich, ob ich mich verhört hatte.
»Ich meine, du musst natürlich nicht!« Er kratzte sich den Nacken und lachte nervös auf. »Du weißt, ich bitte nicht gern um Hilfe, und es wäre mir unangenehm gewesen, es vor den anderen zuzugeben, aber ich könnte dein Expertenwissen gut gebrauchen, also …«
»Oh, doch. Klar«, sagte ich hastig, und meine Worte fühlten sich wie Wattebäusche in meinem Mund an. »Gar kein Problem, ich … ähm, frohes neues Jahr!«
»Oh, ja!« Er lachte laut, umarmte mich kurz und klopfte mir auf den Rücken. »Und Mann, danke, das wäre toll.«
»Mhm«, machte ich perplex und tätschelte ebenfalls seinen Rücken, auch wenn meine Finger taub waren. Diesmal vor Kälte.
Neben uns erhellten bunte Raketen den schwarzen Himmel, Jubelschreie drangen durch die Nacht … und ich fühlte mich wie die letzte Idiotin. Was hatte ich erwartet? Dass er plötzlich, nachdem wir uns zwei Monate lang nicht gesehen hatten, zu Sinnen kam und endlich bemerkte, dass wir perfekt zusammenpassten? Nein, natürlich nicht.
Ich kniff die Augen zusammen und verfluchte mich im Stillen, während er mich losließ und ins Wohnzimmer zurückkehrte, um auch dem Rest ein frohes neues Jahr zu wünschen.
Ich bewegte mich jedoch nicht. Ich blieb wie erstarrt auf dem Stuhl sitzen und sah den Raketen dabei zu, wie sie Feinstaub in den Himmel schleuderten. Dann lachte ich trocken auf und legte mir eine Hand an die Stirn.
Ich war lächerlich. Mann, was für ein wundervoller Start ins neue Jahr. Es konnte nur besser werden, oder?
Kapitel 3
Der nächste Morgen war noch viel schlimmer.
Was zu vierzig Prozent daran lag, dass mir der vergangene Abend unfassbar peinlich war und ich inständig hoffte, dass Leon nicht mitbekommen hatte, dass meine Augen geschlossen gewesen waren. Zu sechzig Prozent daran, dass ich meine Sorgen in Tequila ertränkt hatte.
Die Kopfschmerzen, die mir den Schädel aufschlitzten, als ich mühsam meine Augen öffnete, waren kein guter Start ins neue Jahr. Das schwere Herz in meiner Brust und der Kloß in meinem Hals ebenso wenig. Stöhnend presste ich beide Hände auf mein Gesicht.
Ich war so lächerlich. So absolut lächerlich. Ich war einunddreißig, steckte in meinem Job fest, war besessen von einem Kerl, der nichts von mir wissen wollte, und belog immer noch rechts und links meine Eltern. Als wäre ich ein Teenager!
Gott, so konnte das nicht weitergehen. Ich konnte mich nicht nach jedem Besuch meiner Familie hundeelend fühlen. Ich konnte nicht ewig der Idee von Leon und mir hinterherrennen. Ich konnte nicht mehr so tun, als wäre es okay, dass ich immer noch nicht befördert worden war. Der gestrige Abend war eine einzige Tortur gewesen. Einer meiner persönlichen Tiefpunkte. Was stimmte nicht mit mir?
Stöhnend sank ich tiefer in die Kissen, bevor ich nach der Wasserflasche neben meinem Bett griff und die Hälfte davon hinunterstürzte. Das half gegen die aufwallende Übelkeit in meinem Magen, aber nicht gegen das Gefühl des absoluten Versagens, das mich seit gestern nicht mehr losließ.
Es reichte. Ich musste irgendetwas ändern. Es war schon wieder ein Jahr vergangen, und ich hatte mich nicht von der Stelle bewegt. Ich konnte mich nicht in weiteren 365 Tagen noch immer an diesem Punkt befinden. Ich war unzufrieden mit … Ach, Mist, ich konnte es nicht einmal richtig benennen. Mein Kopf und mein Leben waren ein einziges Chaos und – Moment.
Was hatte Elisa gesagt? Sie hatte ihre Gedanken geordnet, indem sie eine Liste ihrer Vorsätze fürs neue Jahr verfasst hatte. Das neue Jahr hatte zwar im Prinzip schon angefangen, aber dafür war es noch nicht zu spät. Ich glaubte nicht wirklich, dass es mir helfen würde, aber es war zumindest einen Versuch wert.
Bestimmt richtete ich mich im Bett auf, zog meinen Laptop vom Nachttisch und kniff wegen der plötzlichen Bewegung stöhnend die Augen zusammen, während kleine Männchen in meinem Schädel ein Glockenspiel auspackten und anfingen, grell darauf herumzuklimpern. Meine Blase machte sich auch bemerkbar. Okay, erst auf die Toilette, dann in die Dusche, die Peinlichkeit des letzten Abends abwaschen, Kopfschmerztablette einwerfen, Rest-Tequila mit Cornflakes aufsaugen und dann mein Leben neu entwerfen.
Als ich mich dreißig Minuten später wieder ins Bett fallen ließ, fühlte mein Mund sich zwar nicht mehr so an, als würde eine Katze darin leben, aber mein Kopf war immer noch so schwer wie mein Herz. Aber hey, dafür war die Liste ja da! Gedanken ordnen, Herz erleichtern, Leben umschmeißen.
Mit frischem Optimismus fuhr ich den Laptop hoch und öffnete ein neues Word-Dokument, dem ich den hübschen Namen Revolution, Baby_Vorsätze Neues Jahr gab, bevor ich es auf meinem überfüllten Desktop speicherte, den ich wirklich mal aufräumen sollte. Oh, super, das konnte ich auf die Liste schreiben!
Die ersten, wichtigsten Punkte hatte ich mir bereits unter der Dusche überlegt, also legte ich direkt los.
Leon meine Gefühle gestehen – oder ihn vergessen. (Denn ganz ehrlich, Svea, es wird langsam albern! Entweder er mag dich, oder er mag dich nicht. Krieg deinen Hintern hoch, leg dir einen Plan zurecht und erobere ihn, verdammt noch mal! Du guckst nicht umsonst all diese Netflix-Liebesfilme, die einem genau erklären, wie man es nicht machen sollte. Daraus musst du doch gelernt haben.)
Weniger Lügen. Bei allem. (Außer bei der Sache mit Elisa als Zweitmieterin, nachher wird sie noch rausgeworfen.)
Das blöde Kandinsky-Poster wegwerfen, damit ich nicht dazu hingerissen werde, deswegen zu lügen – und Mama erklären, dass ihre pornografischen Figuren keine Kunst, sondern beleidigend für den menschlichen Körper sind. (Sanft natürlich, bin ja kein Unmensch.)
Karla bitten, sich endlich zu merken, dass ich gegen Mandeln allergisch bin! (Damit sie mich nicht aus Versehen umbringt und zum Einzelkind wird … Mhm, vielleicht sollte das lieber an erster Stelle stehen. Überlebenswichtige Dinge sollten vielleicht eine höhere Priorität haben?)
Da ich schon bei meiner Schwester bin: Karla erzählen, dass ich es war, die Flying Louie aus Versehen durchs Fenster hat entwischen lassen. (Davor über Wellensittiche informieren und Louies Überlebenschancen ausrechnen. Wie viel Kälte vertragen die Dinger? Wir haben hier lauter Halsbandsittiche, die quietschfidel sind. Vielleicht geht es Louie wirklich gut?)
Mama und Papa beichten, dass ich nicht an Gott glaube. (Das vielleicht erst an ihrem Sterbebett? Wäre taktvoller und dann irgendwie themenrelevanter? Aber auch grausam, oder?)
Mama und Papa sagen, dass ich den Spitznamen Motte hasse. Ich bin keine Burg und möchte auch keine sein!
Mama und Papa erklären, dass ich wirklich Vegetarierin bin und sie aufhören müssen, mir Fleisch anzudrehen oder ein ganzes Hähnchen zu grillen, wenn ich zu Besuch komme. Das ist einfach nur Verschwendung!
Boss sagen, dass ich eine Beförderung verdient habe. Nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren, jetzt! Ich erledige die Hälfte der Arbeit seines unbrauchbaren Sohnes Stupid-Steffen und krieg trotzdem Zwanzigtausend weniger im Jahr!
Aufhören, besagtem Sohn Hamsterköttel in den brasilianischen Kaffee zu mischen – es ist Skippy nicht fair gegenüber, ihn derartig zu benutzen.
Meinem Kollegen Seb verraten, dass die Geheimzutaten in den leckeren veganen Keksen, die ich backe, Ei und Kuhmilch sind.
…
Ich hielt gerade mit dem Cursor über der Zwölf inne, als ein heller Pington und ein kleiner Briefumschlag in der rechten unteren Ecke des Desktops eine E-Mail ankündigten. Das hier war technisch gesehen mein Arbeitscomputer, aber unser Boss bestand darauf, dass wir die Geräte mit nach Hause nahmen, damit wir in dringenden Fällen schnell reagieren und wichtige Mails unserer arbeitswütigen Kunden auch nach Geschäftsschluss beantworten konnten. Doch am Feiertag eine Geschäftsmail zu erhalten, war dennoch eine Besonderheit.
Stirnrunzelnd klickte ich auf den Umschlag, und eine Nachricht vom Chef persönlich ploppte auf.
Ganz vergessen, Svea, leitete mein Boss wie immer direkt die Mail ein.
Der CEO der Outdoorfirma, der wir morgen früh pitchen, möchte vorab unsere Angebots- und Preisliste. Gern als Word-Datei, damit er sich noch Notizen machen kann. Du hattest da schon was vorbereitet, oder? Könntest du die so schnell wie möglich an [email protected] schicken?
Hoffe, du bist gut reingerutscht,
Harald
Seufzend massierte ich meine schmerzenden Schläfen. Richtig. Morgen früh wurde ich bei der neuseeländischen Outdoorfirma erwartet, in deren Meeting ich mich mit meiner gefälschten Begeisterung fürs Zelten und ihr Heimatland geschmuggelt hatte.
Oh, das musste direkt mit auf die Liste.
Ich wechselte zum offenen Word-Dokument und fügte hinzu:
Chef beichten, dass ich eigentlich die schlechteste Wahl für den Account von Revolution G bin, da ich die unsportlichste Person bin, seit eine Mülltonne auf Skier gespannt und ihr ein Basketball zugeworfen wurde. Außerdem finde ich Zelten furchtbar und weiß über Neuseeland lediglich, dass sie große Bäume, lebensunfähige Vögel und fantastischen Wein haben. Ich sollte mir meine Beförderung mit der Wahrheit, nicht mit weiteren Lügen verdienen. (Andererseits: Ich habe sie verdammt noch mal verdient, weil Stupid-Steffen keine Ahnung von nichts hat, außer, wie er die Regenbogenbahn bei Mario Kart am besten meistert! Punkt vielleicht wieder streichen? Ich weiß, was ich tue, ist doch egal, ob es um Sport geht oder nicht – und auf der Arbeit und in der Liebe ist alles erlaubt. Oder wie war das noch?)
Oh, apropos …
Sport treiben! Vielleicht neue sportliche Interessen entwickeln? (Haha, ich hab Sport und Interesse in einem Satz verwendet, das ist doch schon mal was, oder?)
Ich nahm grinsend die Finger von der Tastatur, studierte die bisherigen Punkte und nickte zufrieden. Ich fühlte mich tatsächlich besser. Keine Ahnung, ob ich all diese Vorsätze wirklich in die Tat umsetzen würde, aber zumindest war mir jetzt klar, womit ich unzufrieden war: Arbeit, Privatleben, Familie.
Also mit allem, was das Leben ausmachte. Fantastisch.
Stöhnend ließ ich den Kopf gegen mein Bett sinken, bevor ich schwer durchatmete, die Liste schloss und auf dem unübersichtlichen Desktop nach dem Angebot suchte, das ich tatsächlich schon für Revolution G vorbereitet hatte – denn ich war, wie erwähnt, gut in meinem Job!
Frustriert biss ich die Zähne aufeinander und öffnete das Word-Dokument, um es noch einmal kurz zu überfliegen und sicherzugehen, dass das Ganze übersichtlich und tippfehlerfrei war. Doch ich war zufrieden, schloss es wieder und kopierte die Mail-Adresse von William Grant. Ich war bisher noch nicht persönlich mit ihm in Kontakt getreten, laut meinem Chef wäre er mit seinem Multimillionen-Euro-Business jedoch einer der größten Fische, die wir jemals an Land gezogen hatten – vorausgesetzt, der Pitch morgen verlief gut.
Revolution G – das G stand für Green – hatte vor vierzig Jahren als Zwei-Mann-Firma in Neuseeland begonnen. Zwei Kerle, die Outdoor-Führungen aller Art anboten, aber darauf achteten, die Natur intakt zu halten und die Tierwelt nicht zu stören. Dann waren sie dazu übergegangen, Outdoorkleidung sowie Ausrüstung aus nachhaltigen Materialien herzustellen, bahnbrechende Schuhtechnologien zu entwickeln, und mittlerweile hatte Revolution G über fünfzig Filialen weltweit, Hauptsitz jedoch in Deutschland, da der Gründer sich in eine Deutsche verliebt hatte und ihr nach Europa gefolgt war. So hieß es zumindest auf der Website.
Da das Unternehmen bereits vor vierzig Jahren gegründet worden war, rechnete ich also damit, dass der CEO ein älterer Herr war, der Höflichkeit schätzte. Also tippte ich:
Sehr geehrter Herr Grant,
anbei das speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Firma zugeschnittene Angebot, das wir Ihnen morgen gern im Detail unterbreiten werden.
Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen, und freue mich darauf, Sie morgen persönlich kennenzulernen!
Mit freundlichen Grüßen
Svea Nussbaum
Ich rieb mir über die Augen, gähnte und klickte auf die kleine Büroklammer in der Mailleiste, bevor ich auf dem Desktop nach dem passenden Dokument Revolution G_Angebotsübersicht suchte. Ah, da war es: Revolution … yadda, yadda … und gesendet.
Gähnend legte ich den Laptop auf die Matratze neben mir, schloss die Augen und streckte die Arme über den Kopf. Ich fühlte mich schon viel besser. Ich hatte die Liste angefertigt, schon eine Mail verschickt und somit weiter auf meine Beförderung hingearbeitet. Ich hatte mir eine Pause verdient. Den Rest des Tages würde ich auf der Couch auskatern, Netflix schauen und darüber nachdenken, wie ich die Liste in die Tat umsetzen konnte. Vor allem, wie ich Leon beweisen konnte, dass ich seine Traumfrau war. Zu dieser Zeit nächstes Jahr würde mein Leben nicht mehr dasselbe sein – Revolution, Baby! In der Tat. Wäre doch gelacht, wenn ich …
Augenblicklich saß ich kerzengerade im Bett.
Moment.
Revolution, Baby. Revolution … Shit, das war der Name meiner Liste!
Oh nein.
Nein, nein. Nein!
Mein Herz sprang mir in den Hals, und panisch zog ich den Laptop wieder heran. Revolution G – Revolution, Baby … Ich hatte die Zeile nicht zu Ende gelesen! Nur überflogen. Was, wenn … wenn … Oh Gott, wo waren die gesendeten Nachrichten? Mit zitternden Fingern glitt ich über das Touchpad, suchte nach besagter Mail …
»Nein!«
Schockiert starrte ich auf meinen Bildschirm. »Oh Gott, nein!« Meine Stimme rutschte eine Oktave höher, und mein Herz stockte. »Gib sie zurück!«, keuchte ich panisch. »Gib die Mail sofort zurück!« Ich schüttelte den Laptop, doch natürlich spuckte er mir meine E-Post nicht wieder aus. Sie war schon längst durch die Tiefen des Internets zu einem anderen PC gewandert. »Nein!«, rief ich lauter und ließ den Laptop erschrocken auf mein Bett fallen. »Scheiße! Nein, nein, nein!«
Doch egal, wie oft ich das Wort wiederholte, es war trotzdem passiert. Ich hatte einem völlig Fremden die privateste Liste geschickt, die ich jemals geschrieben hatte! Noch dazu einem fremden, millionenschweren CEO, den wir als Kunden gewinnen wollten. Der mir meine Beförderung sichern sollte.
»Nein.« Ich schlug beide Hände über dem Mund zusammen, um mich aktiv davon abzuhalten zu hyperventilieren. Warum war mein Desktop nicht ordentlicher? Warum benannte ich meine Dokumente nicht vernünftiger? Warum hatte ich verkatert eine Mail schreiben müssen?
Scheiße, was tat ich?
Der Fremde – William Grant – durfte die Liste niemals lesen! Niemand durfte sie lesen!
Mir wurde schlecht, und hastig zog ich den PC wieder zu mir heran, bevor ich eilig anfing, eine weitere Mail zu schreiben. Es war Feiertag, vermutlich checkte er seine Mails gar nicht am Feiertag. Er war alt, er würde viel schlafen und sich morgen alles in Ruhe ansehen wollen. Ich würde ihm einfach eine zweite Mail mit dem richtigen Anhang senden und ihn darum bitten, den ersten zu ignorieren. Ja. Das würde genügen. Er würde sicherlich meine Privatsphäre wahren.
Du würdest es nicht, Svea …, murmelte eine gehässige Stimme in meinem Kopf.
»Ja? Nun, ich bin offensichtlich ein schlechterer Mensch als Herr Grant!«, sagte ich laut und schickte Mail Nummer zwei ab. »Er will den Planeten retten. Ich will weniger lügen. Das ist kein Vergleich!«
Ich glaubte mir.
Okay, nein, das war gelogen. Ich hatte leichte Zweifel an meinen Worten. Aber die Hoffnung starb zuletzt, oder?
Ich stöhnte laut und schlug mir mit der Faust gegen die Stirn. Oh Gott, niemand würde einer Verrückten, die Hamsterköttel in den Kaffee ihres direkten Vorgesetzten mischte, einen Auftrag anvertrauen. Dabei brauchte ich diesen Job! Es war meine Chance zu beweisen, dass ich als Projektleitung geeignet war und meine Beförderung verdient hatte.
So ein verdammter Kackmist! Was konnte ich tun, um sicherzustellen, dass der CEO von Revolution G niemals diesen Anhang las? Was konnte ich …
Abrupt hielt ich inne, denn die Lösung lag auf der Hand. Die meisten Leute hatten eine geschäftliche E-Mail-Adresse, zu der sie nur innerhalb ihres Büros Zugang hatten – damit sie die Arbeit nicht mit nach Hause nahmen. Alles, was ich tun musste, war, morgen vor William Grant an seinem Büro zu sein und ihn persönlich darum zu bitten, die Mail ungelesen zu löschen. Falls er noch nicht da war und ich Zugang zu seinem Computer bekam, könnte ich das Löschen natürlich persönlich übernehmen … Aber nein, ich würde ihn erst einmal darum bitten, bevor ich plante, etwas Illegales zu tun.
Ja. Einen Versuch war es wert. Mein Herzschlag beruhigte sich etwas, und tief atmete ich ein und aus. Alles würde gut werden. Niemand würde jemals von der Liste erfahren.
Kapitel 4
Ich lag die halbe Nacht wach. Las die Liste wieder und wieder, um zu entscheiden, wie schlimm es wohl wäre, wenn der CEO von Revolution G das Dokument öffnete … und verging vor Scham bei dem Gedanken daran, dass er es wirklich tat.
Ich wollte ihn als Kunden gewinnen! Hatte professionell und souverän auftreten wollen. Aber wie konnte ich das, wenn er wusste, dass ich den Wellensittich meiner Schwester umgebracht hatte? Und was, wenn er ein Mann Gottes war und meine Ungläubigkeit anstößig fand?
Aber vielleicht … ganz vielleicht war William Grant ja ein freundlicher, älterer Herr, der darüber lachen und mir dann ein Karamellbonbon aus seiner Jackentasche anbieten würde.
Ich hoffte es. Die Website der Firma gab außer dem Namen nichts über den CEO