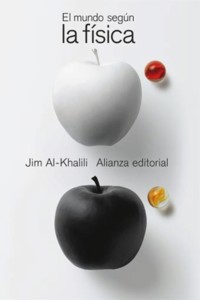9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wer stürzte lange vor Kopernikus das heliozentrische Weltbild? Ibn al-Shatir. Wer beschrieb als Erster den Blutkreislauf? Ibn al-Nafees. Wer war vor Leonardo das erste Universalgenie? Abu Rayan al-Biruni. Im 9. Jahrhundert gründete der Kalif von Bagdad das legendäre "Haus der Weisheit", das fortan zum Weltzentrum der Gelehrsamkeit wurde. Hier wurden die großen Werke der Antike - Galen, Hippokrates, Platon, Aristoteles und Archimedes - vor dem Vergessen bewahrt, grundlegende Erkenntnisse der Astronomie, Mathematik, Medizin und Zoologie gewonnen. Der bekannte britisch-irakische Wissenschaftshistoriker Jim al-Khalili erzählt die faszinierenden Geschichten dieser Pioniere der Wissenschaften und vom einzigartigen Goldenen Zeitalter arabischer Gelehrsamkeit, ohne die unsere abendländische Kultur so nicht existieren würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jim al-Khalili
Im Haus der Weisheit
Die arabischen Wissenschaften als Fundament unserer Kultur
Sachbuch
Über dieses Buch
Die Tinte des Gelehrten ist heiliger als das Blut des Märtyrers.Der Prophet Mohammed
Über 700 Jahre galt Arabisch als die »lingua franca« der Wissenschaften. Ob Algebra, Medizin, Physik, Astronomie oder Philosophie, viele der großen Disziplinen verdanken wesentliche ihrer Erkenntnisse oder gar ihre Entstehung arabischen Gelehrten. Wie es dazu kam, warum es in einer bestimmten Epoche zu solch einer Blüte der Gelehrsamkeit kommen und warum sie in Vergessenheit geraten konnte, stellt der bekannte britisch-irakische Wissenschaftshistoriker Jim al-Khalili anhand der großen Gelehrten der arabischen Welt und ihrer Arbeit beeindruckend dar. Er lässt das einzigartige Goldene Zeitalter der arabischen Gelehrsamkeit in all seiner Pracht wiederauferstehen und zeigt auf eindrückliche Weise, warum ohne sie unsere abendländische Kultur so nicht existieren würde.
Es ist an der Zeit, dass der Westen mehr über die arabischen Fundamente seiner Kultur weiß und dass sich die islamische Welt seines großen Erbes bewusst wird. Jeder, der dieses Buch liest, versteht warum.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Werner Forman Archive/Scala, Florenz.
Graphiken: Peter Palm, Berlin
Die englische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
›Pathfinders. The Golden Age of Arabic Science‹
im Verlag Allen Lane, Penguin Group, London.
© 2010 Jim al-Khalili
Für die deutsche Ausgabe:
© 2011 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401337-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Vorwort
Eine Anmerkung zu arabischen Namen
Eine Bemerkung zum Begriff »arabische Wissenschaft«
1 Ein Traum von Aristoteles
2 Der Aufstieg des Islam
3 Übersetzung
4 Der einsame Alchemist
5 Das Haus der Weisheit
6 Großforschung
7 Zahlen
8 Algebra
9 Der Philosoph
10 Der Arzt
11 Der Physiker
12 Der Prinz und der Almosenempfänger
13 Andalusien
14 Die Revolution von Maragha
15 Niedergang und Renaissance
16 Wissenschaft und Islam heute
Verzeichnis der Wissenschaftler
Zeittafel: Die islamische Welt von der Antike bis zur Moderne
Bildnachweis
Für Julie
Wer einen neuen Weg findet, ist ein Wegbereiter, selbst wenn andere später den Pfad noch einmal finden müssen; und wer seinen Zeitgenossen vorausgeht, ist ein Vorreiter, auch wenn noch Jahrhunderte vergehen, bevor er als solcher erkannt wird.
Nathaniel Schmidt, Ibu Khaldun
Vorwort
Sargon, König von Akkad, Wächter von Ishtar, König von Kish, gesalbter Priester von Anu, König des Reiches; er besiegte Uruk und riss seine Mauern nieder. Während dieser Schlacht nahm er Lugalzaggisi, König von Uruk, gefangen und brachte ihn an einer Hundeleine zum Tor von Enlil.
Antiker Text
Eine Autostunde südlich von Bagdad liegt die Ortschaft Hindiyya. Dort verbrachte ich meine letzten glücklichen Jugendtage, bevor ich den Irak 1979 endgültig verließ. Seinen Namen trägt der Ort nach dem Hindiyya-Staudamm, der 1913 von den wenig später abgedankten Osmanen quer über den Euphrat gebaut wurde. An die Brücke habe ich eine dauerhafte, eindringliche Erinnerung. An kühlen Herbsttagen schwänzte ich nachmittags zusammen mit meinen drei besten Freunden Adel, Khalid und Zahr il-Din die Schule, dann gingen wir über die Staumauer zu dem Touristenhotel am gegenüberliegenden Ufer. Dort kauften wir uns ein Sechserpack Farida-Bier und setzten uns ans Wasser, um über Fußball, Philosophie, Filme und Mädchen zu diskutieren.
Jene glücklichen Tage stehen in dramatischem Gegensatz zu einem zweiten Bild, das sich eindringlich in mein Gedächtnis einprägt hat. Das geschah 1991, während des ersten Golfkrieges. Ich weiß noch genau, wie ich in einer Nachrichtensendung der CNN Aufnahmen von einem Feuergefecht in Hindiyya sah: Eine einsame, verängstigte Frau war über die Staumauer gegangen und dabei zwischen die Fronten geraten. Für die meisten Zuschauer war dies sicher nur eine von vielen Szenen, die den Schrecken des Krieges in einem weit entfernten Land zeigten. Ich aber erkannte die Szenerie sofort wieder, und damit wurde das Elend des Landes, das ich zwölf Jahre zuvor hinter mir gelassen hatte, traurige Realität. Ich selbst war Dutzende von Malen an der Stelle vorübergegangen, an der diese hilflose Frau jetzt stand.
Aber das war am anderen Ende der Welt. Bis heute, da ich diese Zeilen schreibe, war ich noch nicht wieder im Irak. Ich sage »da ich diese Zeilen schreibe«, denn ich schließe eine Stippvisite irgendwann in der Zukunft, wenn ich alter Feigling es für ausreichend ungefährlich halte, nicht aus.
Der Autor (vordere reihe, Mitte, mit Tafel) auf einem Klassenfoto im letzten Grundschuljahr in Saddat al-Hindiyya.
Ich verließ den Irak in einem für die islamische Welt folgenschweren Jahr. Damals, 1979, unterzeichneten der Ägypter Anwar Sadat und der Israeli Menachem Begin in Washington einen Friedensvertrag; im Iran wurde die erste islamische Republik ausgerufen, nachdem der abgesetzte Schah nach Kairo geflüchtet war; die heilige Stadt Mekka erlebte ein Feuergefecht, mit dem ein fundamentalistischer Aufstand niedergeschlagen und Hunderte von Pilgern getötet wurden; die Sowjetunion besetzte Afghanistan; und in der US-Botschaft in Teheran begann die iranische Geiselkrise. In diesem Durcheinander hatte Saddam Hussein das Präsidentenamt im Irak von Feldmarschall Muhammad Hassan al-Bakr übernommen, wodurch das Leben für den Großteil der Bevölkerung im Land erheblich trostloser wurde. Meine Angehörigen und ich trafen Ende Juli – genau zwei Wochen nach Saddams Machtübernahme – im Großbritannien Margaret Thatchers ein. Wie sich herausstellte, waren wir gerade noch rechtzeitig entkommen, denn wenige Monate später erklärte Saddam dem Iran den Krieg. Hätten wir das Land in jenem Sommer nicht verlassen, mein Bruder und ich wären zweifellos eingezogen worden und hätten in jenem sinnlosen, entsetzlichen Krieg kämpfen müssen. Dass ich dann heute noch am Leben wäre und meine Geschichte erzählen könnte, bezweifle ich. Mit unserer britischen Mutter und unserem schiitisch-muslimischen Vater, der persischer Abstammung war und in den 1950er Jahren im Irak mit der kommunistischen Bewegung geliebäugelt hatte, waren mein Bruder und ich als »unerwünscht« gebrandmarkt, und wir wären sicher zu entbehrlichem Kanonenfutter geworden.
Der Bezirk Karradat Merriam in Bagdad, wo der Autor geboren wurde. Das Gebiet liegt wenige Kilometer flussabwärts von al-Ma’muns Palast.
Seither ist es offenbar mit dem Leben im Irak ständig bergab gegangen. Seit meiner Jugend in den 1960er und 1970er Jahren, als das Leben dort für ein Kind aus der Mittelschicht angenehm und relativ einfach war, haben sich die Verhältnisse dramatisch gewandelt. Mein Vater, ein in Großbritannien ausgebildeter Elektroingenieur, war als Offizier in der irakischen Luftwaffe tätig. Da er an verschiedenen Orten im ganzen Land eingesetzt wurde, waren wir es gewohnt, regelmäßig umzuziehen. Anfang der 1970er Jahre jedoch verfügte die herrschende Baath-Partei, man könne Irakis mit britischen Ehefrauen in den Streitkräften plötzlich nicht mehr trauen. Nun musste mein Vater, der mittlerweile im Rang eines Majors stand, zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben eine zivile Arbeit finden. Er bekam schon bald eine Stelle als leitender Ingenieur bei dem Chemieunternehmen Ma’mal al-Harir in Hindiyya, das Rayon-Kunstfasern herstellte. Wir wohnten ein paar Jahre in Bagdad, bevor wir schließlich nach Hindiyya zogen, um meinem Vater das tägliche Pendeln zu ersparen. Für mich war das kein Problem. Ich fand schnell Freunde und gründete meine neue Fußballmannschaft, die Rayon Dynamos (das schäbige Trikot mit der Nummer 9, das ich damals trug, habe ich heute noch). Zusammen mit meinem Bruder schaltete ich am Samstagnachmittag den BBC World Service ein, um die englischen Fußballergebnisse zu hören. Der World Service bildete in unserem Haus sogar eine mehr oder weniger ständige Geräuschkulisse. Wenn möglich, besuchte ich regelmäßig die Bibliothek des British Council in Bagdad und besorgte mir Nachschub an englischen Büchern. Außerdem wuchs ich in dem Wissen auf, dass das Leben in einer Diktatur erträglich war, solange man den Kopf gesenkt hielt und nicht einmal im privaten Kreis die Regierung oder die Baath-Partei kritisierte.
Der Autor (links) und sein Bruder auf dem Balkon ihrer Wohnung im Bagdader Bezirk al-Mansur Mitte der 1960er Jahre.
Es war immer ein fröhlicher Ausflug für meine Familie und mich, wenn wir zu den hängenden Gärten von Babylon eine Autostunde südöstlich von Hindiyya fuhren. Die Ruinen dieses mythischen Ortes hatten für mich kaum etwas Geheimnisvolles, war ich doch bei Klassenfahrten schon oft dort herumgestreunt. Aber trotz der nicht gerade eindrucksvollen Ruinen und meiner aus Vertrautheit geborenen Gleichgültigkeit verlor ein solcher aufregender, unterrichtsfreier Tag nie seinen Reiz, und die archäologische Stätte strahlte nach wie vor etwas Machtvolles aus – flüsternd erzählte sie vom Glanz einer Zeit, die so unbegreifbar lange vergangen war. Einmal stießen wir bei einem Familienausflug – ich war gerade erst im Teenageralter – auf zwei Backsteinbrocken. Sie waren jeweils so groß wie eine Faust und trugen auf einer Seite eindeutig antike Keilschriftzeichen. Die Frage, ob mein Bruder, meine Mutter oder ich die Steine aufhob, ist bis heute Gegenstand eines humorvollen Familienstreits. Jedenfalls versteckte meine Mutter sie ganz unten in unserem Picknickkorb, und wir schmuggelten sie nach Hause.
Das klingt jetzt vielleicht nach einem empörenden Fall von Altertumsdiebstahl. Natürlich hätten wir einen solchen nationalen Schatz den örtlichen Behörden oder sinnvollerweise vielleicht besser dem Museum in Bagdad übergeben sollen. Aber wir behielten sie. Zu unserer Verteidigung kann ich anführen, dass ähnliche mit Keilschrift versehene babylonische Ziegelsteine überall um uns verstreut waren. Und im Vergleich mit den Schäden, die später in den Ruinen von Babylon angerichtet wurden – in den 1980er Jahren durch Saddam Husseins erstaunlich vulgären Wiederaufbau des Ishtar-Tores und 2003 durch die US-Streitkräfte, die einen ganzen Abschnitt einer der kostbarsten archäologischen Stätten der Welt dem Erdboden gleichmachten, um einen ebenen Landeplatz für Hubschrauber und einen Parkplatz für schwere Militärfahrzeuge zu schaffen – erscheint unser Diebstahl relativ harmlos.
Erst vor kurzem bat ich meinen Bekannten Irvine Finkle, den Kurator für das antike Mesopotamien am British Museum, sich die beiden Brocken einmal anzusehen. Er bestätigte, dass sie aus dem 7. Jahrhundert v.u.Z. und der Regierungszeit des Königs Nebukadnezar II. stammten, also aus der Periode, in der die Hängenden Gärten gebaut wurden. Die Symbole sind offenbar Bruchstücke einer häufig vorkommenden Inschrift, die da lautet: »Nebukadnezar, König von Babylon, der für Esagila und Ezida sorgt [die Tempel der babylonischen Götter Marduk und Nabu], ältester Sohn von Nabopolassar.«
Das 7. Jahrhundert v.u.Z. mag sich für Europäer und erst recht für Amerikaner sehr altertümlich anhören, aber nach den archäologischen Maßstäben des Irak ist die Regierungszeit Nebukadnezars eigentlich das Mittelalter. Manchmal kann man es sich kaum vorstellen: Das Erbe derer, die sich heute im Irak darum bemühen, etwas Ähnliches wie ein normales Leben zu führen, reicht über 7000 Jahre bis zur Geburt einiger der allerersten Zivilisationen auf der Erde zurück. Die Überreste der Ubaid-Kultur im südlichen Irak wurden von Archäologen auf die Mitte des 6. Jahrtausends v.u.Z. datiert; die nachfolgende Uruk-Zivilisation, in deren Verlauf das Rad erfunden wurde und die auch andere technische Fortschritte wie das Verschmelzen von Metallen, die Töpferscheibe, das Siegel, die Form für Ziegelsteine und den Plan des Tempels miterlebte, wurde auf ungefähr 4100 v.u.Z. datiert. In Uruk machten die Menschen auch eine Erfindung, die vielleicht noch wichtiger war als das Rad: Hier gab es zum ersten Mal eine Schrift.
Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte.
Der erste mächtige Vorfahre der heutigen arabischen Bevölkerung des Irak war Sargon, der Semitenkönig der Akkader, der im 24. Jahrhundert v.u.Z. die Sumerer besiegte. Über Sargon weiß man nur wenig, aber vermutlich gründete er nicht weit vom heutigen Bagdad die neue Hauptstadt Akkad.
Schon wenig später erstreckte sich sein Reich vom Mittelmeer im Westen bis nach Persien im Osten, und er trug den Titel »König der vier Weltteile«.
Auf die Akkader folgte die Dynastie von Ur. Die Stadt Ur im Süden des Irak war nach Schätzungen um 2000 v.u.Z. zur größten Stadt der Welt herangewachsen und hatte mehr als 60 000 Einwohner. Von dort stammte angeblich Abraham, der Patriarch der drei großen monotheistischen Religionen: Judentum, Christentum und Islam.
Die erste Dynastie der Babylonier nahm ihren Anfang nicht lange danach. In ihrem Verlauf begegnet uns der größte aller antiken Könige im Irak: Hammurabi, der mehr als 40 Jahre lang regierte, nämlich von 1792 bis 1750 v.u.Z. Während seiner Herrschaft gab es die ersten Schulen der Welt und das erste geschriebene Gesetzbuch. Von allen großen Herrschern, die auf Hammurabi folgten – und das waren viele – reichte 1000 Jahre lang keiner an seine Leistungen heran; mit ihm vergleichbar war erst der Assyrerkönig Assurbanipal, der in der Nähe der heutigen Stadt Mosul im Norden des Landes die große Bibliothek von Ninive gründete.
Der Niedergang der irakischen Eigenherrschaft begann einige hundert Jahre vor der Geburt Christi und war der Beginn von mehr als zwei Jahrtausenden einer nahezu ununterbrochenen Besetzung von außen: durch Perser, Griechen, Mongolen, Türken und für kurze Zeit – von 1917 bis 1921 – die Briten; danach wurde der moderne irakische Staat geboren. Das große Abassidenreich, das von 750 bis 1258 u.Z. erhalten blieb, sollte man sicherlich nicht als Besatzungsmacht betrachten. Seine Kalifen waren aber über lange Zeit hinweg nur die Marionetten ausländischer Königshäuser, insbesondere im 10. und 11. Jahrhundert der persischen Bujiden und der türkischen Seldschuken.
Die erste persische Herrschaft in dem Land, das Mesopotamien genannt wurde (vom griechischen »Land zwischen zwei Flüssen« – Tigris und Euphrat – was im Wesentlichen dem heutigen Irak entspricht), endete 333 v.u.Z. mit der Niederlage gegen Alexander den Großen. Nach dem Tod Alexanders teilten seine Generäle das große Reich unter sich auf: Ägypten fiel an Ptolemäus, der von Alexandria aus herrschte, Asien kam unter die Herrschaft von Seleukos, der im Nordwesten Syriens seine neue Hauptstadt Antiochia errichtete. Die Stadt spielte später eine entscheidende Rolle für die Weitergabe wissenschaftlicher Kenntnisse von den Griechen an die Araber.
Als Anfang des 7. Jahrhunderts u.Z. der Islam aufkam, war der Mittlere Osten, wie wir ihn heute nennen, zwischen dem persischen und dem byzantinischen Reich aufgeteilt. Mit der von Arabien ausgehenden Ausbreitung der neuen Religion entwickelte sich jedoch ein mächtiges Reich, und mit ihm kamen eine blühende Zivilisation und ein prachtvolles Goldenes Zeitalter.
Die Geschichte der Region – und auch des Irak selbst – ist angesichts derart langer Zeiträume eine viel zu große Leinwand, als dass ich sie bemalen könnte. Stattdessen möchte ich mit diesem Buch etwas anderes tun: Ich mache mich an die ohnehin ehrgeizige Aufgabe, eine bemerkenswerte Geschichte zu erzählen; es ist die Geschichte eines Zeitalters, in dem große Genies die Grenzen des Wissens derart erweiterten, dass ihre Arbeiten die Zivilisation bis heute prägen.
Schon seit einiger Zeit ist es mein sehnlicher Wunsch, diese Geschichte einem größeren Publikum zu erzählen. Dass ich es jetzt tue, liegt an meiner Überzeugung, dass sie heute besonders zeitgemäß ist und großen Widerhall finden kann: Wir sollten untersuchen, was das kulturelle und wissenschaftliche Denken des Abendlandes den Arbeiten zu verdanken hat, die arabische und persische, muslimische, christliche und jüdische Denker und Wissenschaftler vor 1000 Jahren leisteten. In den Zeittafeln, die man in populärwissenschaftlichen Berichten über die Wissenschaftsgeschichte findet, haben in der Regel zwischen der Zeit der alten Griechen und der europäischen Renaissance keine größeren wissenschaftlichen Fortschritte stattgefunden. In dieser Zwischenzeit, so erzählt man uns, befanden sich Westeuropa und – so wird damit unterstellt – auch die übrige Welt 1000 Jahre lang im dunklen Mittelalter.
In Wirklichkeit war das Arabische für eine Zeit von 700 Jahren die internationale Sprache der Wissenschaft. Es war die Sprache des Korans, des heiligen Buches des Islam, und damit auch die Amtssprache des riesigen islamischen Reiches, das sich Anfang des 8. Jahrhunderts u.Z. von Indien bis nach Spanien erstreckte.
Ich muss auch von vornherein darauf hinweisen, dass ich es mir nicht zur Aufgabe gemacht habe, die Wissenschaftsgeschichte der ganzen Welt zu behandeln. Mir ist sehr wohl bewusst, welche reichhaltigen, vielfältigen wissenschaftlichen Errungenschaften in anderen Regionen – insbesondere in China und Indien – erzielt wurden; über diese beiden prachtvollen Kulturen wurden schon viele Bücher geschrieben – und viele weitere werden zweifellos noch verfasst werden. Aber das ist nicht meine Geschichte.
Für mein Vorhaben war es eine große Hilfe, dass ich kürzlich die BBC-Fernsehserie Science and Islam produzieren konnte. Anders als in der Serie genieße ich aber in diesem Buch den Luxus, sowohl die wissenschaftliche Seite als auch die damit verbundenen sozialen, politischen und historischen Einflüsse und Folgen gründlicher untersuchen zu können. Die umfangreichen Reisen, die ich während der Produktion der Serie in der islamischen Welt unternahm, waren in zweierlei Hinsicht nützlich. Erstens – und das war vermutlich am wichtigsten – machten sie das Thema für mich auf eine ganz andere Weise lebendig als die vielen Bücher und Fachartikel, in denen ich zuvor gewühlt hatte. Und zweitens verschafften sie mir die Gelegenheit, Wissenschaftler und Historiker aus ganz unterschiedlichen Umfeldern kennenzulernen und meine Gedanken mit ihnen zu diskutieren. Ich hoffe, ich lasse ihnen in diesem Buch Gerechtigkeit widerfahren.
Natürlich wird manch einer den Verdacht hegen, dass ich, der ich im Irak aufgewachsen bin, die muslimische Welt durch eine rosarote Brille sehe, dass ich ein voreingenommener Parteigänger bin und allen zeigen will, was für eine großartige, aufgeklärte Religion der Islam ist. Als Atheist habe ich aber am Islam kein spirituelles, sondern ein kulturelles Interesse. Wenn also das Glaubenssystem des Islam ohne den Ballast der falschen Vorstellungen und Fehlinterpretationen vieler heutiger Muslime und Nichtmuslime in meinem Bericht in einem positiven Licht erscheint, dann ist es eben so.
Der Begriff »Islam« weckt heute zweifellos in den Ohren vieler Nichtmuslime auf der ganzen Welt ein bequemes, negatives Klischee, das im Gegensatz zu unserer abendländisch-säkularen, rationalen, toleranten, aufgeklärten Gesellschaft steht. Vor dem Hintergrund einer solchen bequemen Einstellung mag man unter Umständen nur schwer anerkennen, dass vor 1000 Jahren die umgekehrte Rollenverteilung herrschte. Man denke nur an die Kreuzzüge: Welche Seite war damals die aufgeklärtere, die kultivierte, die »gute«? Selbst jene in der westlichen Welt, die sich des Beitrages der muslimischen Welt zur Wissenschaft vage bewusst sind, neigen häufig zu dem Gedanken, dort seien nur Wissenschaft und Philosophie der Griechen noch einmal aufgekocht worden, wobei ein seltsames kleines bisschen Originalität hinzukam und wie ein orientalisches Gewürz den Geschmack verbesserte. Ein dankbares Europa hätte demnach eifrig sein Erbe wieder für sich beansprucht, nachdem es in der Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts aus seinem langen Schlaf erwacht war.
Ich werde viele Fragen behandeln, von denen Wissenschaftshistoriker schon lange fasziniert sind. Einige davon lauten: Wie viele wissenschaftliche Kenntnisse besaßen die Araber tatsächlich? Wie wichtig waren die Beiträge von persischer Kultur, griechischer Philosophie und indischer Mathematik? Wie und warum erlebte die wissenschaftliche Gelehrsamkeit unter der Schirmherrschaft mancher Herrscher eine solche Blütezeit? Und, vielleicht am interessantesten: Warum und wann ging dieses Goldene Zeitalter zu Ende?
Als praktizierender Wissenschaftler und Humanist bin ich überzeugt, dass die »wissenschaftliche Methode«, wie wir sie nennen, und das Wissen, dass die Menschheit aus der rationalen Wissenschaft bezieht, uns viel mehr zu bieten haben als nur »einen Weg, die Welt zu betrachten«. Der von Vernunft und Rationalität getragene Fortschritt ist definitionsgemäß etwas Gutes; Wissen und Aufklärung sind stets besser als Unwissen. Während meiner Kindheit im Irak lernte ich in der Schule große Denker wie Ibn Sina (Avicenna), Al-Kindi und Ibn al-Haitham (Alhazen) nicht nur als entfernte historische Gestalten kennen, sondern als meine geistigen Urahnen. Im Westen haben sicher viele schon einmal beispielsweise von dem persischen Gelehrten Ibn Sina gehört. Viele andere große Namen jedoch sind mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Selbst im Irak begegneten mir diese Gestalten nicht im naturwissenschaftlichen Unterricht, sondern im Fach Geschichte. Der Grund: Auch in der muslimischen Welt werden Naturwissenschaften heute nach abendländischen Prinzipien unterrichtet. Dass Kinder in Europa lernen, Kopernikus, Galilei und Kepler seien die Väter der Astronomie gewesen und vor ihnen habe es nichts Erwähnenswertes gegeben, ist nicht verwunderlich; enttäuschender ist es aber, dass man den Kindern in der muslimischen Welt das Gleiche beibringt. Würden sie nicht vielleicht die Ohren spitzen und dem Unterricht aufmerksamer folgen, wenn sie erfahren würden, dass die meisten Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, arabische Namen tragen? So sind beispielsweise die Namen von fünf der sieben Hauptsterne im Sternbild des Großen Bären (auch Ursa Maior oder Großer Wagen genannt) arabischen Ursprungs: Dubhe, Megrez, Alioth, Mizar und Alkaid.
Die Wissenschaftler, die in diesem Buch vorkommen, waren sowohl im buchstäblichen wie auch im übertragenen Sinn wahre Wegbereiter. Das Zitat zu Beginn des Buches über den Gelehrten Ibn Chaldun lässt sich aber auf alle anwenden, deren Geschichten und Leistungen ich erwähne. Sie alle betraten Neuland, indem sie das Wissen der Menschheit vorantrieben, und doch sind die meisten von ihnen vergessen.
Die Weitergabe wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere in Mathematik und Astronomie (die von den Historikern als »exakte« Wissenschaften bezeichnet werden), ist eines der leistungsfähigsten Hilfsmittel, wenn man Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen aufbauen will. Andere Bereiche unseres Denkens, darunter Religion und Philosophie, werden langsamer übermittelt und dringen erst allmählich in eine Kultur ein, um sie zu beeinflussen. Die exakten Wissenschaften dagegen erfordern die unmittelbare Nutzung von Abhandlungen und anderen geschriebenen Arbeiten, so dass wir aus ihnen viel über die Verhältnisse der jeweiligen Zeit erfahren können. Und auch wenn meine Motive, ein vollständiges Bild der arabischen Wissenschaft zusammenzustellen, sich nicht von denen eines Historikers unterscheiden, sollte ich doch betonen, dass mein Hauptinteresse dem Ursprung und der Entwicklung von Wissenschaft selbst gilt. Aus diesem Grund kümmert es mich eigentlich nicht, ob die fragliche Wissenschaft von Griechen, Christen, Muslimen oder Juden betrieben wurde. Ich werde zwar ein Kapitel der Frage widmen, wie das islamische Reich die Wissenschaft der Griechen und anderer Kulturen erbte, vor allem aber geht es mir in diesem Buch um die Gedanken auf den Gebieten von Naturwissenschaft, Medizin, Philosophie und Mathematik, die im Islam des Mittelalters entstanden und heranreiften.
Für mich als theoretischen Physiker, der vor allem mit der inneren Funktionsweise des Atomkerns vertraut ist, war dies eine erfreuliche, erfrischende Unternehmung. Besonders freut es mich, dass ich viele Tatsachen aufdecken konnte, die andere entweder übersehen haben oder sie einer breiten Leserschaft nicht beschreiben mochten.
Die Entstehung dieses Buches dauerte drei Jahre. Während dieser ganzen Zeit befand ich mich auf einer unbarmherzig steilen, aber auch ungeheuer bereichernden Lernkurve. Bei den Recherchen und bei der Weiterbildung halfen mir viele Menschen; manche von ihnen sind Experten für arabische Wissenschaft, andere steuerten nachdenkliche Kommentare und hilfreiche Ratschläge bei. Sie alle lieferten Beiträge zu diesem Buch und halfen mir, es zu einem Werk zu machen, auf das ich ungeheuer stolz bin. Zuallererst danke ich meiner Frau Julie für ihre unermüdliche Ermutigung und Begleitung. Große Dankbarkeit schulde ich auch meinem Agenten Patrick Walsh und Will Goodlad, meinem Lektor bei Penguin Press; beide teilten meine Begeisterung für das Thema und halfen mir, meine anfangs schwerfälligen, zaghaften, vorläufigen Entwürfe zu einem selbstsicheren Endprodukt zu machen, das, so hoffe ich, sowohl wahrheitsgetreu als auch lesbar ist. Weiterhin danke ich Afifi al-Akiti, Ali al-Azzawi, Nader al-Bizri, Salim al-Hassani, Faris al-Khalili, Salima Amer, Amund Bjørnøs, Derek Bolton, Paul Braterman, Anna Croft, Misbah Deen, Okasha El Daly, Kathryn Harkup, Ehsan Masood, Peter Pormann, George Saliba, Mohammed Sanduk, Simon Schaffer, Andrea Sella, Paul Sen, Karim Shah, Adel Sharif, Ian Stewart, Rim Turkmani, Tim Usborne und Bernardo Wolf. Ihnen allen bin ich zutiefst dankbar.
Eine Anmerkung zu arabischen Namen
Viele Personen, die uns in diesem Buch begegnen werden, haben beeindruckend lange Namen; diese bestehen nicht nur aus dem Vor- und Familiennamen, sondern dazwischen stehen auch die Namen von Vater und Großvater. Außerdem tragen sie häufig einen laqab (Spitznamen) oder eine nisba als Hinweis auf Charakter, Beruf oder Herkunft; wer aus Bagdad stammt, nennt sich dann vielleicht »al-Baghdadi«. Manche sind sogar unter dem Namen ihres ältesten Sohnes bekannt. Das Wort Abu bedeutet »Vater von«. Hat ein Mann keine Kinder, wird sein Vorname häufig mit einer bekannten Gestalt aus der arabischen oder islamischen Geschichte in Verbindung gebracht, die einen Sohn hatte. Bei vielen schiitischen Muslimen wird der Name Ali immer mit dem Imam Ali und seinem Sohn Hussein in Verbindung gebracht. Wenn ein Mann also Abu Hussein heißt, trägt entweder sein ältester Sohn den Namen Hussein, oder er ist einfach ein Ali ohne Söhne.
Der Mathematiker al-Khwarizmi heißt zum Beispiel mit vollem Namen Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi; sein Vorname lautet demnach Muhammad, aber sein Sohn heißt Abdullah, und der Name seines Vaters ist Musa (Moses), ibn bedeutet »Sohn des«. Manchmal wird er auch als Muhammad ibn Musa bezeichnet, bekannter ist er aber unter dem Namen al-Khwarizmi, der an seinen Geburtsort Khwarizm (das heutige Chiwa in Zentralasien) erinnert.
Die gemeinsame Sprache, die heute in der ganzen arabischen Welt gebräuchlich ist, wird als Hocharabisch bezeichnet. Es ist das Arabisch des Korans und der gebildeten Schichten. Die Dialekte sind aber von Land zu Land sehr unterschiedlich. Manche Buchstaben werden anders ausgesprochen: Das j wird im Irak »dsch« ausgesprochen, in Syrien wie im französischen bonjour und in Ägypten wie ein g. Die arabischen Dialekte unterscheiden sich aber nicht nur in der Aussprache, sondern oft enthalten sie auch ganz verschiedene Wörter. Das Wort für »ja« lautet im Irak beispielsweise ii und in Ägypten aywa; im Hocharabischen lautet es na’am. Ich erwähne das, weil sich das Hocharabische als Sprache des Korans seit 1400 Jahren nicht verändert hat, so dass die Schriften der frühen arabischen Gelehrten heute ebenso einfach zu verstehen sind wie damals.
Für die Zeitangaben gibt es mehrere Konventionen; ich habe diejenige gewählt, deren sich heute die meisten Historiker bedienen. In den ersten Kapiteln, in denen ich über die Wissenschaft der Antike berichte, musste ich die Abkürzung »v.u.Z.« (vor unserer Zeitrechnung) verwenden. Zahlen, die nicht diese Kennzeichnung tragen, bedeuten »u.Z.« (unserer Zeitrechnung). Aus Gründen der Straffung habe ich die muslimischen Hijri-Jahreszahlen – nach dem Kalender, der 622 u.Z. beginnt – nicht aufgeführt.
Eine Bemerkung zum Begriff »arabische Wissenschaft«
In diesem Buch gebrauche ich den Begriff »arabische Wissenschaft« in einem sehr weit gefassten Sinn. Ich meine damit nicht nur die Wissenschaft, die von Menschen arabischer Abstammung betrieben wurde, und verzichte deshalb ausdrücklich darauf, sie als »Wissenschaft der Araber« zu bezeichnen. Damit würde ich die Erörterung zwangsläufig auf die Bewohner Arabiens (des heuten Saudi-Arabien sowie des südlichen Syrien und Mesopotamiens) beschränken, von denen viele außerhalb der Städte ohnehin einfache Wüstenstämme und Beduinen sind. Mit »arabischer Wissenschaft« meine ich, dass sie von Menschen betrieben wurde, die politisch unter der Herrschaft der Abassiden standen: Ihre Amtssprache war Arabisch, oder zumindest fühlten sie sich verpflichtet, ihre wissenschaftlichen Texte auf Arabisch zu verfassen, der Lingua franca der Wissenschaft im Mittelalter. Zu einem großen Teil fanden die wissenschaftlichen Arbeiten anfangs (im 9. und 10. Jahrhundert) im heutigen Irak statt, genauer gesagt in den Städten Basra, Kufa und – am wichtigsten – Bagdad.
Viele Wissenschaftlerpersönlichkeiten, die uns auf unserem Weg begegnen werden, beispielsweise Al-Biruni und Ibn Sina, waren Perser und empfanden oftmals eine Abneigung gegen die Araber. In unserem Zusammenhang ist aber von Bedeutung, dass auch sie den größten Teil ihrer Werke nicht auf Persisch, sondern auf Arabisch verfassten. Wir können noch nicht einmal feststellen, dass sämtliche wissenschaftlichen Arbeiten von Muslimen ausgeführt wurden, und das trotz der unbezweifelbaren Tatsache, dass eine solche rasante Zunahme der Kreativität ohne die Ausbreitung des Islam nicht möglich gewesen wäre – warum, werde ich später genauer erläutern. Viele wichtige Beiträge stammten insbesondere in der Anfangszeit der Abassidenherrschaft, als viele griechische Texte übersetzt wurden, auch von Christen und Juden. Aber auch sie teilten mit ihren muslimischen Herrschern eine gemeinsame Kultur, zu der Sitten, Denkweisen, Erziehung und Sprache gehörten.
Wenn ich von »arabischen« Wissenschaftlern spreche, meine ich damit also nicht, dass sie unbedingt in den heutigen arabischen oder arabischsprachigen Ländern geboren und aufgewachsen waren und sich selbst als Araber betrachtet hätten. Was sie einte, war vielmehr die arabische Sprache. Deshalb beziehe ich auch die großen persischen Wissenschaftler in meine weitgefasste Definition mit ein.
Ein schönes Beispiel, an dem dieser Punkt deutlich wird, ist der Astronom Ptolemäus aus Alexandria, der um 150 u.Z. das Almagest verfasste, einen der wichtigsten astronomischen Texte aller Zeiten. Wer bezweifelt, dass die Arbeit von Persern wie Al-Biruni und Ibn Sina zu Recht als Teil der arabischen Wissenschaft betrachtet wird, kann die Arbeiten eines Ägypters wie Ptolemäus nicht der griechischen Wissenschaft zurechnen. In Wirklichkeit ist aber allgemein anerkannt, dass Ptolemäus’ Arbeiten nicht weniger zur Wissenschaft des antiken Griechenland gehören als die eines Euklid, Archimedes oder Aristoteles.
Natürlich kann man die Frage stellen, ob es eher angemessen wäre, nicht von arabischer, sondern von islamischer Wissenschaft zu sprechen. Das habe ich aus drei Gründen nicht getan. Den ersten habe ich bereits genannt: Nicht alle wichtigen wissenschaftlichen Fortschritte wurden von Muslimen erzielt. Bevor der Islam sich im 7. Jahrhundert ausbreitete, war der Mittlere Osten vorwiegend christlich. Die beiden wichtigsten Glaubensgemeinschaften waren dabei die Nestorianer (vorwiegend in den Städten Hira im Süden des Irak sowie Edessa und Antiochia im Norden Syriens) und die Monophysiten (die über ganz Syrien, Anatolien und Ägypten verbreitet waren). Darüber hinaus praktizierte man in großen Teilen der Region vor dem Islam die alten Religionen des Mazdaismus und Zoroastrismus oder sogar den Buddhismus. Deshalb waren viele führende Gestalten im Goldenen Zeitalter der arabischen Wissenschaft keine Muslime. Hunayn ibn Ishaq, der größte aller Übersetzer in Bagdad, war Nestorianer und konvertierte nie zum Islam. Weitere christliche Wissenschaftler, die im 9. Jahrhundert in Bagdad lebten, waren der Astronom Yahya ibn abi Mansur sowie die Ärzte Jibril ibn Bukhtishu und Yuhanna ibn Masawayh. Auch viele jüdische Philosophen und Wissenschaftler, unter ihnen der Übersetzer Sahl al-Tabari, der Mediziner Ishaq ibn Amran und der Astronom Masha’allah, leisteten wichtige Beiträge zum Geistesleben von Bagdad. Ebenso wenig können wir außer Acht lassen, wie viele Beiträge jüdische Gelehrte aus Andalusien vom 8. bis 11. Jahrhundert und in späterer Zeit leisteten, beispielsweise der große mittelalterliche jüdische Philosoph und Arzt Maimonides, der in Córdoba geboren wurde, den größten Teil seines Lebens aber in Ägypten verbrachte.
Der zweite Grund ist die Tatsache, dass der Islam heute von mehr als einer Milliarde Menschen auf der ganzen Welt praktiziert wird. Die Thematik dieses Buches erstreckt sich aber nicht auf das wissenschaftliche Erbe muslimischer Staaten wie Pakistan oder Malaysia, die auch von der indischen und chinesischen Wissenschaft beeinflusst wurden. Mein Thema ist enger gefasst.
Natürlich können wir die arabische Wissenschaft nicht in ihrem Zusammenhang verstehen, wenn wir uns nicht mit der Frage beschäftigen, in welchem Umfang die Religion des Islam das wissenschaftliche und philosophische Denken beeinflusste. Die arabische Wissenschaft war während ihres gesamten Goldenen Zeitalters untrennbar mit der Religion verbunden; das Bedürfnis der ersten Gelehrten, den Koran zu interpretieren, war sogar ihre Triebkraft. Außerdem wurde die Politik in Bagdad zu Beginn der Abassidenherrschaft von den Mu’taziliten beherrscht, einer Bewegung islamischer Rationalisten, die Glauben und Vernunft in Einklang bringen wollten. Dies führte zu einer Atmosphäre der Toleranz, in der wissenschaftliche Forschung gefördert wurde.
Vielfach wurde die Ansicht vertreten, die wissenschaftliche Kreativität sei in der islamischen Welt so kurzlebig gewesen, weil sie innerhalb der islamischen Gesellschaft mit den religiösen Lehren in Konflikt geriet, eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt in den Arbeiten des muslimischen Theologen al-Ghazali fand (der, was seine Bedeutung für die islamische Lehre angeht, die gleiche Stellung einnimmt wie Thomas von Aquin für das Christentum). Die Blütezeit vieler wissenschaftlicher Disziplinen jedoch, darunter Mathematik, Medizin und Astronomie, setzte sich noch lange nach al-Ghazali fort.
Der dritte Grund, warum ich der Versuchung widerstehe, mein Thema als islamische Wissenschaft zu bezeichnen, ist die unglückselige wissenschaftsfeindliche Haltung mancher heutiger Muslime (die sich aber natürlich nicht auf Muslime beschränkt). Es ist ein trauriger Gedanke, dass eine Minderheit der islamischen Gelehrten unserer Zeit offensichtlich nicht mit dem wissbegierigen Geist ihrer Vorväter ausgestattet ist. Für die Gelehrten im Bagdad früherer Zeiten standen Religion und Wissenschaft nicht in Konflikt. Die damaligen Denker hatten eine klare Vorstellung von ihrem Auftrag: Der Koran verlangte, dass sie al-samawat wa-l-ard (Himmel und Erde) studierten, um den Beweis für ihren Glauben zu finden. Der Prophet selbst hatte seine Anhänger angehalten, »von der Wiege bis zum Grabe« nach Wissen zu streben, ganz gleich, wie weit die Suche sie führen würde: »Wer sich zur Suche nach Wissen auf die Reise begibt, wandert auf Allahs Weg zum Paradies.« Natürlich war mit diesem Wissen (’ilm) vor allem die Theologie gemeint, aber in der Frühzeit des Islam bestand nie eine klare Trennung zwischen religiösen und nichtreligiösen gelehrten Bestrebungen.
Die scheinbar so bequeme Vereinbarkeit von Wissenschaft und Religion während der Abassidenherrschaft steht in krassem Gegensatz zu den Spannungen zwischen rationaler Wissenschaft und vielen verschiedenen Glaubensrichtungen in der Welt unserer Tage. Unsere modernen Ängste gab es im Bagdad der Frühzeit nicht. Man kann natürlich die Ansicht vertreten, dass die Wissenschaft jener Zeit selbst nicht sonderlich weit vom Aberglauben entfernt war – eine Mischung aus Metaphysik und Volksglauben, die sich einfacher in theologische Gedanken einbauen ließ. Wie wir aber noch genauer erfahren werden, hatten die arabischen Wissenschaftler im Vergleich zu vielen griechischen Philosophen viel weniger abstrakte Vorstellungen; sie standen vielmehr auf einer Grundlage, die stark der modernen naturwissenschaftlichen Methode ähnelte: Man vertraute auf handfeste empirische Befunde, Experimente und die Überprüfbarkeit von Theorien. Viele von ihnen lehnten beispielsweise Astrologie und Alchemie ab: Diese seien kein Teil der wahren Wissenschaft und etwas ganz anderes als Astronomie und Chemie.
Klar ist, dass es in der muslimischen Bevölkerung unserer Zeit ein breites, kontinuierliches Spektrum verschiedener Einstellungen gegenüber der Naturwissenschaft gibt; und alle diese Einstellungen sind zweifellos ehrlich gemeint. Diejenigen, die die Bedeutung der Wissenschaft erkennen und sie von der Religion trennen können, würden behaupten, dass »der Koran uns sagt, wie man in den Himmel kommt, aber nicht wie der Himmel funktioniert«. Viele gläubige muslimische Naturwissenschaftler halten es für ihre religiöse Pflicht, sich aus einer empirischen, rationalistischen wissenschaftlichen Perspektive um Kenntnisse über das Universum zu bemühen. Ausgestattet mit solchen neugefundenen Kenntnissen, können sie dann zu den Worten des Korans zurückkehren und darauf hoffen, für diese ein weiter reichendes, tiefgreifenderes Verständnis zu entwickeln als vor ihrer wissenschaftlichen Erleuchtung. Damit habe ich kein Problem, denn in diesem Fall hat der Glaube keinen Einfluss darauf, wie sie ihre wissenschaftliche Arbeit betreiben. Erst wenn der Prozess sich umkehrt, läuten die Alarmglocken: Wenn man das Argument hört, es sei nicht notwendig, die Welt um uns herum unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu verstehen, weil alles, was wir jemals wissen müssen, ohnehin bereits im Koran geschrieben steht.
Letztlich kann es so etwas wie eine islamische oder muslimische Wissenschaft nicht geben. Wissenschaft lässt sich nicht durch die Religion derer charakterisieren, die sie ausüben, wie die Nazis es versuchten, als sie im Deutschland der 1930er Jahre Albert Einsteins große Errungenschaften als »jüdische Wissenschaft« verächtlich machten. Mit dem Begriff »islamische Wissenschaft« könnten diejenigen, die ähnlich rassistische Vorstellungen haben, ihre Bedeutung herunterspielen. Genau wie es keine »jüdische Wissenschaft« oder »christliche Wissenschaft« gibt, kann es auch keine »islamische Wissenschaft« geben. Es gibt schlicht und einfach nur Wissenschaft.
Im Zusammenhang mit dem von mir gewählten Begriff »arabische Wissenschaft« habe ich (abgesehen davon, dass er bei der Bevölkerung des heutigen Iran, Usbekistan oder Turkmenistan, die alle im Goldenen Zeitalter die Heimat großer Gelehrter waren, unpopulär sein könnte) nur eine Befürchtung: Selbst wenn man ein wissenschaftliches Zeitalter nach der Sprache benennt, die damals zur Kommunikation diente, ist das problematisch. Schließlich bezeichnen wir auch die wissenschaftlichen Errungenschaften der europäischen Renaissance nicht als »lateinische Wissenschaft«. Und noch seltsamer wäre es, die Wissenschaft unserer Zeit »englische Wissenschaft« zu nennen. Dennoch ist es mein Eindruck, dass »arabisch« im Vergleich zu »islamisch« ein ehrlicheres, weniger problematisches Attribut für diese Wissenschaft ist. Und irgendeinen Namen muss ich ihr geben, um sie von der griechischen Wissenschaft, der indischen Wissenschaft oder der Wissenschaft der europäischen Renaissance zu unterscheiden – die Bedeutung all dieser Begriffe ist ganz klar; ständig von der »Wissenschaft, die von den Gelehrten im Goldenen Zeitalter des Islam praktiziert wurde« zu sprechen, ist – da wird mir wohl jeder zustimmen – ein wenig umständlich.
1Ein Traum von Aristoteles
Man behauptet … der Kalif Harun al-Rashid habe in der Nacht einmal seinen Wesir gerufen und ihm gesagt: Wir wollen miteinander in die Stadt gehen und hören, was es in der Welt Neues gibt; wir wollen die Leute über die Urteile der Richter ausfragen und den absetzen, über den man sich beklagt, und den belohnen, den man lobt.
Aus der ›Geschichte der drei Äpfel‹, Tausendundeine Nacht
Der Bezirk Bab al-Sharqi im Zentrum Bagdads verdankt seinen Namen – er bedeutet »Osttor« – den mittelalterlichen Befestigungen der Stadt. Er war ein Teil der Mauer, die vermutlich ungefähr in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts errichtet wurde. Während der kurzen britischen Herrschaft am Ende des Ersten Weltkrieges diente das Torhaus als Garnisonskirche (und die Briten bezeichneten es als Südtor, weil das einzige andere erhaltene Tor, das Bab al-Mu’azzam, weiter nördlich lag). Von den mittelalterlichen Mauern und dem Osttor ist heute nichts mehr übrig; mir ist Bab al-Sharqi als heißer, stinkender, lauter, belebter und vom Verkehr verstopfter Platz in Erinnerung geblieben, mit schäbigen Lebensmittelbuden und Secondhand-Schallplattenläden rund um den Busbahnhof und die Taxistände. Aber der Name erinnert noch daran, wie diese stolze Stadt sich in den Jahren, nachdem man sie 762 u.Z. als neues Machtzentrum des Abassidenreiches gegründet hatte, ausweitete und wandelte. Bagdad ist gewachsen und geschrumpft und erneut gewachsen, wobei der Regierungssitz sich im Laufe der Jahrhunderte von einer Seite des Tigris zur anderen verlagerte, weil verschiedene Herrscher jeweils den geeignetsten Platz zum Bau ihrer prächtigen Paläste suchten. Wenn wir uns in die Geschichte der Stadt vertiefen, stellen wir fest, dass ihre heutigen Bewohner mit dem, was sie an Leid erdulden müssen, in guter Gesellschaft sind. Keine andere Stadt auf Erden musste über die Jahrhunderte so viel Tod und Zerstörung aushalten wie Bagdad. Andererseits war sie als Hauptstadt eines der größten Weltreiche auch ein halbes Jahrtausend lang die reichste, größte, stolzeste und auch hochmütigste Stadt der Erde.
Genau 1200 Jahre nach ihrer Gründung kam ich in einer Bagdader Klinik zur Welt. Sie liegt in Karradat Mariam, einem Schiitenviertel mit einer großen christlichen Gemeinde, nur einen Steinwurf entfernt von der heutigen »Grünen Zone« am anderen Ufer des Flusses. Das Krankenhaus liegt ein paar Kilometer südlich von der Stelle, wo einer der berühmtesten Herrscher Bagdads im Jahr 786 u.Z. geboren wurde. Er hieß Abu Ja’far Abdullah al-Ma’mun. Dieser rätselhafte, faszinierende Kalif, halb Araber, halb Perser, ist in meiner Geschichte eine zentrale Gestalt: Er sollte in der langen Reihe der islamischen Herrscher zum größten Schirmherrn der Wissenschaft werden und sorgte dafür, dass die beeindruckendste Phase der Gelehrsamkeit seit der griechischen Antike ihren Anfang nahm.
Um zu verstehen, wie und warum es zum Goldenen Zeitalter kam, müssen wir uns ein wenig näher mit den Motiven und der Psyche der frühislamischen Gesellschaft und ihrer Herrscher beschäftigen. Wir müssen genau untersuchen, welche inneren und äußeren Faktoren die Periode prägten und beeinflussten. Aber bevor wir uns ernsthaft auf den Weg machen, möchte ich diesen bemerkenswerten Herrscher vorstellen.
Al-Ma’mun war nicht der einzige Kalif, der Gelehrsamkeit und Wissenschaft förderte, aber mit Sicherheit war er der kultivierteste, leidenschaftlichste und begeisterungsfähigste. Wie kein anderer islamischer Herrscher vor oder nach ihm schuf er ein Umfeld, das originelle Gedanken und freimütige Diskussionen begünstigte. Er war der Sohn des zumindest im Westen noch berühmteren Kalifen Harun al-Rashid (763–809) – der Name bedeutet übersetzt »Aaron der Gerechte« –, der in den Geschichten aus 1001 Nacht sehr häufig vorkommt (siehe Farbtafel 2). Al-Rashid erweiterte das Abassidenreich im Norden bis nach Konstantinopel und unterhielt diplomatische Beziehungen zu China sowie zu dem europäischen Kaiser Karl dem Großen, mit dem er häufig Gesandte austauschte. Sie erkannten einander als mächtigste Männer ihrer jeweiligen Kulturkreise an, und die diplomatischen Verbindungen zwischen ihnen trugen zum Aufbau enger Handelsbeziehungen bei. Karl der Große schickte »friesische« Stoffe nach Bagdad und glich damit das »Zahlungsbilanzdefizit« aus, das durch die europäische Vorliebe für Seide, Bergkristalle und andere Luxusgüter aus dem Abassidenreich entstanden war. Al-Rashid seinerseits ließ Karl dem Großen zahlreiche Geschenke zukommen, unter anderem einen Elefanten und eine komplizierte Wasseruhr aus Messing, beides Objekte, über die der europäische Kaiser verblüfft gewesen sein muss. Über al-Rashids Reichtum gibt es viele Geschichten; insbesondere seine Schmucksammlung war legendär.[1] Für eine berühmte Perle namens al-Yatima (»Waisenperle«) soll er 70 000 Golddinare bezahlt haben. Karl der Große seinerseits schenkte ihm den vermutlich größten Smaragd der Welt.
Harun al-Rashid und der Barbier im türkischen Bad; Ölgemälde aus dem 15. Jahrhundert.
Al-Rashid hatte ein persönliches Interesse an den vielen Feldzügen gegen das benachbarte byzantinische Reich, gegen das er während seiner gesamten Herrschaft militärisch vorging. Im Jahr 797 erklärte sich die unterlegene Kaiserin Irene bereit, als Zeichen ihrer Unterwerfung eine große Geldsumme an al-Rashid zu bezahlen. Als ihr Nachfolger, der Kaiser Nikephoros I., die Zahlung einbehielt, erklärte al-Rashid ihm erneut den Krieg, und 805 siegten die arabischen Streitkräfte in der Schlacht von Krasos in Phrygien (westliches Anatolien) gegen den byzantinischen Kaiser. Im folgenden Jahr drang al-Rashid noch einmal nach Kleinasien vor, dieses Mal mit mehr als 135 000 Mann. Nikephoros wurde derart gedemütigt, dass er sich bereitfand, einen jährlichen Tribut von 30 000 Nomismata (byzantinischen Goldmünzen) zu bezahlen.[2]
Einem weiteren Bericht zufolge schickte Nikephoros 50 000 Dirham[3] an al-Rashid als Lösegeld für eine Sklavin, die dieser während der Invasion von 806 gefangen genommen hatte. Die Frau war offenbar mit Nikephoros’ Sohn verlobt, und das Angebot des Kaisers an Bagdad war Teil einer größeren Austauschaktion, in der es auch um Brokatstoffe, Falken, Jagdhunde und Pferde ging.
Zu Hause in Bagdad war al-Rashid jedoch ein schlechter Verwalter; seinen Erfolg verdankte er der Tatsache, dass die Staatsangelegenheiten von einer mächtigen persischen Familie gelenkt wurden, den Barmakis (im Westen Barmakiden genannt). Unter al-Rashids Herrschaft erlebte das islamische Reich seine größte Machtfülle; viele Historiker und Dichter haben diese Periode im Laufe der Jahrhunderte immer wieder als Höhepunkt des Goldenen Zeitalters von Bagdad bezeichnet. Eine solche Sichtweise entsprang allerdings zum größten Teil der Nostalgie für eine vergangene Ära, denn wenig später bekam das Reich bereits seine ersten Risse. Für eine Stadt, die noch für 500 Jahre die wichtigste der Welt bleiben sollte, war es bemerkenswert: Der Verfall ihrer Pracht begann, wie wir in Kürze genauer erfahren werden, schon 50 Jahre nach ihrer Gründung. Al-Rashid war mit ziemlicher Sicherheit der Nutznießer einer sentimentalen Verherrlichung, die seither fast immer ausnahmslos betrieben wurde.
Al-Ma’mun (786–833) kam in dem Jahr zur Welt, in dem sein Vater Kalif wurde. Seine Mutter Marajil, eine persische Sklavin und Konkubine, war ursprünglich als Kriegsgefangene nach Bagdad gekommen. Sie war die Tochter des persischen Rebellenführers Ustadh Sis, der von den Abassiden in Khorasan im heutigen Ostiran besiegt worden war. Marajil arbeitete in der Küche von al-Rashids Palast. Wie die Historiker unfreundlicherweise aufzeichneten, bestand al-Rashids arabische Ehefrau Zubayda darauf, dass er als Buße für eine verlorene Schachpartie mit der hässlichsten und schmutzigsten Sklavin aus der Küche schlief. Nach viel Bettelei erklärte er sich einverstanden und hatte Geschlechtsverkehr mit Marajil; diese brachte daraufhin Abdullah zur Welt, seinen ersten Sohn, dem er den Titel al-Ma’mun (»der Vertrauenswürdige«) verlieh. Marajil starb kurz nach der Entbindung, und al-Ma’mun wurde der Obhut der Familie Barmaki anvertraut.
Nachdem Harun al-Rashid das Kalifat übernommen hatte, zog er aus dem Palast seines Vaters an das östliche Flussufer in den großartigen Qasr al-Khuld (»Palast der Ewigkeit«), den sein Großvater Kalif al-Mansur, der Gründer Bagdads, erbaut hatte. Sechs Monate nach der Geburt von al-Ma’mun brachte Zubayda einen zweiten Sohn des Kalifen zur Welt, der den Namen al-Amin erhielt (787–813). Die beiden Jungen sollten in ganz unterschiedlichen Welten aufwachsen. Zubayda war wie al-Rashid von reiner, adeliger arabischer Abstammung – sie war eine Enkeltochter von al-Mansur und damit al-Rashids Cousine; ihr Sohn al-Amin war damit der natürliche Thronfolger, denn sein Halbbruder war der Sohn einer persischen Sklavin. Wie nicht anders zu erwarten, bestand zwischen al-Ma’mun und seiner Stiefmutter keine sonderlich enge Beziehung, aber sein Vater liebte ihn mit Sicherheit; in vielen Berichten ist davon die Rede, wie er als kleiner Junge in den wunderschönen Palastgärten und am Ufer des Tigris mit dem Kalifen spielte.
Als junger Mann lernte al-Ma’mun den Koran auswendig, studierte die Frühgeschichte des Islam, rezitierte Gedichte und beherrschte die gerade heranreifende Disziplin der arabischen Grammatik. Außerdem studierte er Arithmetik und ihre Anwendung zur Berechnung von Steuern und Vermächtnissen. Und was am wichtigsten war: Er war ein hervorragender Student der Philosophie und Theologie oder, genauer gesagt, des kalam, wie es auf Arabisch heißt, einer Form der dialektischen Debatte und Argumentation. Die muslimischen Theologen der Frühzeit stellten fest, dass die Methoden des kalam sie in die Lage versetzten, ihren Standpunkt in theologischen Diskussionen mit christlichen und jüdischen Gelehrten zu verteidigen, die in ihrer Nachbarschaft lebten und in der Verfeinerung ihrer Diskussionskunst einen Vorsprung von mehreren Jahrhunderten hatten: Sie hatten die Werke von Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles studiert, historischer Gestalten aus dem antiken Griechenland, deren Namen der junge al-Ma’mun mit Sicherheit kannte. Wahrscheinlich waren einige ihrer Werke sogar bereits ins Arabische übersetzt worden. Al-Ma’muns Interesse für das kalam sollte später für seine lebenslange Wissenschaftsleidenschaft eine große Rolle spielen.
Zu Beginn des 9. Jahrhunderts lernte der halbwüchsige Prinz die Metropole Bagdad auf dem Höhepunkt ihrer Pracht kennen: eine riesige, wunderschöne Stadt, gekennzeichnet durch die Kuppeln und Bogengänge ihrer berühmten, raffinierten abassidischen Architektur. Obwohl Bagdad erst 40 Jahre alt war, war es bereits die größte Stadt der Welt – manchen Schätzungen zufolge hatte sie mehr als eine Million Einwohner.[4] Was die Fläche anging, war sie sicher größer als Rom, Athen oder Alexandria in ihren besten Zeiten; Bagdad hatte Dutzende von üppigen Palästen vorzuweisen, in denen die Familienangehörigen des Kalifen sowie seine Generäle und Wesire wohnten.
Wegen der turbulenten späteren Stadtgeschichte ist vom Bagdad der Abassiden heute praktisch nichts mehr erhalten. Man sollte daran denken, dass es im Gegensatz zu den Regionen anderer, weit älterer Städte wie Rom und Athen im Irak keine Steinbrüche gab (im Norden und Westen des Landes fanden sich allerdings früher beträchtliche Kalkstein- und Marmorvorkommen). Sämtliche Gebäude Bagdads, auch die Paläste, wurden vorwiegend aus sonnengetrockneten Lehmziegeln erbaut und waren deshalb gegenüber den regelmäßigen Angriffen von Invasionsarmeen, Feuer und Überschwemmung wesentlich empfindlicher. Einen Eindruck vom Ausmaß der Paläste vermittelt uns allerdings eines der wenigen noch erhaltenen Bauwerke aus der frühen Abassidenzeit.[5] Es wird Palast von Ukhaidhir genannt, und seine Ruinen stehen knapp 200 Kilometer südlich von Bagdad (siehe Farbtafel 11). Ich erinnere mich noch lebhaft an die Schulausflüge dorthin, auf denen meine Freunde und ich völlig unbeaufsichtigt auf den schmalen, mehr als 20 Meter hohen Umfassungsmauern um die Wette liefen. Der Palast war ursprünglich in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts als Ruhesitz für ein reiches Mitglied der Kalifenfamilie erbaut worden.
Der im 8. Jahrhundert entstandene Abassidenpalast von Ukhaidir südlich von Bagdad.
Die meisten Paläste von Bagdad standen an beiden Ufern des Tigris, aber nicht alle dienten Wohnzwecken. Der Großwesir (von dem arabischen Wort wazir = Minister) Ja’far al-Barmaki, auch er eine vertraute Gestalt aus 1001 Nacht , errichtete in einem unbebauten, abgelegenen Teil im Osten Bagdads den Vergnügungspalast al-Ja’fariyya (»Palast des Ja’far«). Dieser wurde später zu al-Ma’muns Residenz und zum Mittelpunkt des Stadtviertels Dar al-Khilafa (»Heim der Monarchie«), das einen ganzen Komplex aus Palästen und luxuriösen Wohnhäusern umfasste. Ja’far war zum Privatlehrer des jungen al-Ma’mun berufen worden, und ihm schreibt man das Verdienst zu, in dem zukünftigen Kalifen die Liebe zum Lernen und zur Gelehrsamkeit geweckt zu haben.
Der Abassidenkalif Harun al-Rashid und Karl der Große; Ölgemälde von Julius Köckert (1827–1918).
Die Paläste und auch viele andere wichtige Verwaltungsgebäude waren hohe, vielgeschossige Bauwerke. Oftmals waren sie von reichverzierten Wetterfahnen gekrönt, auf denen berittene Krieger als Symbol für die Macht des Kalifen dargestellt waren. Ein Bericht erzählt beispielsweise davon, wie Angehörige einer festgenommenen Rebellengruppe versuchten, aus dem Thronsaal des Kalifen zu entkommen: Nachdem ihnen klargeworden war, dass sie die Leibwächter nicht besiegen konnten, sprangen sie aus einem Fenster und stürzten neun Stockwerke tief auf dem Hof in den Tod.
In den Häusern der Reichen diente Marmor allgemein als Material für Säulen, Steinfußböden und Treppenhäuser, die hinunter in den Garten oder zu den Flussufern führten. Die verputzten Wände der Häuser waren mit reichverzierten Wandteppichen verkleidet, die Fußböden zierten Keramik- oder Marmorfliesen, und in den Wintermonaten wurden hübsche Teppiche ausgelegt, die man während der sommerlichen Hitze wieder entfernte. Die Familie saß auf bestickten Kissen, die man auf den Fußboden legte. Die Zimmer im Erdgeschoss öffneten sich häufig auf einer Seite zu einem zentralen Innenhof, in dem manchmal ein kleiner Springbrunnen stand. Die Küche lag häufig im Keller, wurde aber durch ein Metallgitter, das im Boden des Innenhofs eingelassen war, belüftet. In der sommerlichen Hitze schliefen die Familien nachts auf dem Flachdach, und die nachmittägliche Siesta verbrachte man in den kühlen Kellerräumen (sirdab).
Die ärmeren Einwohner Bagdads dagegen wohnten in überfüllten, mehrstöckigen Gebäuden, deren Etagen durch Balken aus Palmenstämmen getrennt waren; diese waren viel haltbarer als der Lehm und die sonnengetrockneten Ziegelsteine, welche die Wände bildeten und die Gebäude zusammenhielten. In einem Bericht aus dem 9. Jahrhundert beklagt sich ein Vermieter aus Bagdad – wie alle Vermieter vor und nach ihm – über seine Mieter:
Sie laufen ständig Gefahr, das Haus abzubrennen, denn sie kochen auf dem Dach, mindern den Wert des Anwesens, indem sie die Abflüsse verstopfen, reißen Türen heraus, zerstören Schlösser und Scharniere und stampfen ihre Wäsche auf dem Fußboden statt auf dem Stein, der für diesen Zweck bereitsteht. Ihre Kinder graben Löcher im Garten, schlagen Stöcke in die Wände und zerbrechen die hölzernen Regale. Und wenn sie ausziehen, stehlen sie alles, was sie tragen können, einschließlich der Leitern und der Wasserkrüge.[6]
Im Großen und Ganzen war es eine gut verwaltete Stadt: Die breiten Straßen und Boulevards wurden sauber gehalten und gefegt, und ein kompliziertes Kanalsystem sorgte dafür, dass das Wasser des Tigris zu den Stadtbewohnern gelangte. Die Luft war geschwängert vom kräftigen Geruch einheimischer und importierter Gewürze und Duftstoffe, und entlang der Flussufer hing der unverkennbare Geruch einer lokalen kulinarischen Spezialität: shabbut, gegrillter Süßwasserkarpfen, der noch heute beliebt ist.
Der Autor (zweiter von links) als Kind mit seiner Familie an der Abu Nou’was-Straße am Tigris (1971).
Zu meinen eigenen, angenehmsten Kindheitserinnerungen aus dem modernen Bagdad gehören die schwülheißen Sommerabende, die wir mit meiner Familie draußen auf der Abu-Nuwas-Straße verbrachten (siehe Farbtafel 9), einer baumbestandenen Promenade, die nach einem der berühmtesten Dichter Bagdads, einem Zeitgenossen von al-Ma’mun, benannt ist. Sie zieht sich am Ostufer des Tigris mit seinen Parks und Cafés entlang und war immer ein beliebter Treffpunkt. 1000 Jahre zuvor erfreuten sich die Familien von Bagdad zweifellos ganz ähnlicher Spaziergänge am Flussufer.
Aber zum Bagdad meiner Jugend und dem Bagdad der Jugendzeit von al-Ma’mun gibt es auch eine andere, traurige Parallele. In beiden Fällen stand der Stadt das Schicksal bevor, unter den Zerstörungen eines Krieges zu leiden, der ihre friedliche Schönheit zunichtemachte, einen großen Teil der Infrastruktur zerstörte und die Pracht in Trümmer legte. In beiden Fällen endeten die Jahre von Krieg und Elend auf die gleiche Weise: mit der Absetzung des jeweiligen Herrschers. Im Jahr 1980, nach vielen Jahren der Grenzstreitigkeiten, erklärte Saddam Husseins Irak dem Iran den Krieg. Der nun folgende, sinnlose Krieg dauerte acht Jahre und forderte auf beiden Seiten das Leben von einer Million junger Männer. Noch Schlimmeres sollte wenige Jahre später folgen: Im Jahr 1991, als Reaktion auf Saddams Invasion in Kuwait, bombardierten US-Kampfflugzeuge die irakische Hauptstadt. Dann aber warteten sie weitere zehn Jahre – lange genug, damit er seine Machtbasis wieder aufbauen und seinen Völkermord fortsetzen konnte, während die Bevölkerung unter der Erniedrigung lähmender internationaler Sanktionen litt. Erst 2003 kehrten sie zurück und führten ihre Aufgabe zu Ende.
1200 Jahre zuvor war al-Ma’mun selbst – älter, weiser und rücksichtsloser als der ahnungslose junge Student aus Ja’far – persönlich für die Zerstörung verantwortlich, die über seine Stadt hereinbrach.
Als es an der Zeit war, dass al-Rashid einen Erben bestimmte, soll er lange und eingehend nachgedacht haben, bevor er sich schließlich für den jüngeren und weit weniger begabten al-Amin entschied, in dessen Adern aber reines arabisches Blut floss. Als der Kalif 802 mit seinen beiden halbwüchsigen Söhnen auf der Pilgerreise nach Mekka war, gab er offiziell bekannt, welche Nachfolgerechte den beiden nach seinem Tod zufallen sollten: al-Amin sollte Nachfolger im Kalifat von Bagdad werden, und al-Mamun sollte über die östlichen Provinzen des Reiches in Khurasan herrschen und seinen Sitz in der Stadt Merw haben (die heute in Turkmenistan liegt). Die Treueschwüre, mit denen seine Söhne gelobten, sich an seine Wünsche zu halten (heute werden sie als Protokolle von Mekka bezeichnet), wurden in Schriftstücken aufgezeichnet, die man zusammenrollte, in Schachteln legte und in der Ka’aba unterbrachte.[7] Als weiteren Teil der umfassenden Nachfolgeregelung sollte al-Rashids dritter und jüngster Sohn al-Mu’tasim (794–1842) Gouverneur von Kleinasien werden und für den Schutz der Reichsgrenze gegen die Byzantiner sorgen.
Al-Rashid wusste sehr wohl, dass der Halbperser al-Ma’mun den besseren Herrscher abgeben würde: Er war intelligenter, entschlossener und mit einem besseren Urteilsvermögen ausgestattet. Aber sein Umfeld und insbesondere seine Ehefrau Zubayda setzten ihn unter Druck, den eher einfältigen, zügellosen al-Amin zu benennen. Nachdem er seine Entscheidung getroffen hatte, wurde klar, mit welcher Entschlossenheit al-Rashid seine Wünsche durchsetzte. Er schloss die einflussreiche persische Familie Barmaki von der Macht aus und ging sogar so weit, seinen treuen Wesir Ja’far, der natürlich ein enger Vertrauter al-Ma’muns war, hinrichten zu lassen.[8]
Es scheint aber so, als sei Khurasan, das Geschenk al-Rashids an seinen ältesten Sohn, mehr als nur ein Trostpreis gewesen. Die Provinz hatte eine hohe Symbolkraft, denn von dort war Mitte des 8. Jahrhunderts die Revolution der Abassiden ausgegangen, die schließlich zur Machtübernahme von den Umayyaden, der ersten islamischen Dynastie, geführt hatte. Außerdem erhielt al-Mamun offenbar die absolute Macht über Khurasan, was ihm die Möglichkeit verschaffte, sich gegen seinen Bruder zu erheben. Hatte ihr Vater vorausgesehen, dass es so kommen würde? Hatte al-Rashid alles sorgsam so eingefädelt, dass es aussah, als würde er al-Amin begünstigen, um seine Frau und die Abassidenfamilie ruhigzustellen, während er gleichzeitig für al-Mamun eine Hintertür offen ließ, so dass dieser die Macht an sich reißen konnte, wenn er es wünschte? Mit Sicherheit kann man das nicht sagen; al-Rashids Motive müssen Gegenstand von Vermutungen bleiben. Es wurde die Spekulation geäußert, er habe bereits auf der berühmten Pilgerreise im Jahr 802 ernste Zweifel an al-Amins Eignung gehabt.
Im Jahr 805 brach in Khurasan ein Aufstand aus. Die Bewohner der Provinz erhoben sich gegen den Gouverneur und protestierten gegen unerträglich hohe Steuern. Die Lage verschlechterte sich schleichend, und 808 war al-Rashid gezwungen, persönlich mit seinem Sohn al-Ma’mun an der Spitze einer Armee nach Osten zu reiten, um die Rebellion niederzuschlagen. Obwohl al-Rashid erst Anfang vierzig war, erkrankte er durch die Strapazen der langen Reise quer über Berge und durch Wüsten, und schließlich starb er unterwegs. Mit seinem Tod änderte sich das ganze Kolorit des Feldzuges, denn nun übernahm al-Ma’mun automatisch das Gouverneursamt in diesem unsicheren Teil des Reiches. Der größte Teil der Armee seines Vaters desertierte jedoch, und die Soldaten kehrten zu ihren Familien nach Bagdad zurück. Dieser Rückschlag erwies sich für den 23-jährigen al-Ma’mun als nebensächlich: Nachdem er den Aufstand erfolgreich niedergeschlagen hatte, ging er sofort daran, seine Machtbasis zu festigen. Dabei half ihm sein enger Vertrauter und Berater al-Fadl ibn Sahl, ein Perser, der als Wesir an die Stelle von Ja’far aus der Familie Barmaki getreten war. Er senkte die hohen Steuern in der Provinz, was sich als höchst populärer politischer Schachzug erwies. Außerdem riet ihm al-Fadl mit nachdrücklichen Worten, sein öffentliches Ansehen zu verbessern. Al-Ma’mun war dafür bekannt, dass er guten Wein und die Gesellschaft schöner Sklavinnen liebte, aber wenn er gegenüber dem gerade erst eingesetzten al-Amin Anspruch auf das Kalifat von Bagdad erheben wollte, musste er sich als frommer Muslim zeigen. Währendessen baute er langsam und systematisch seine neue Armee auf, deren Soldaten er in ganz Zentralasien rekrutierte.
Zu Hause in der Hauptstadt ließ der neue Kalif die Muskeln spielen und bemühte sich darum, seine Autorität im Osten zu festigen. Er stellte die Funktion seines Bruders als Gouverneur von Khurasan in Frage und verlangte, dieser solle die Steuereinnahmen nach Bagdad schicken. Außerdem rief er diejenigen Armeeangehörigen, die al-Ma’mun gegenüber loyal geblieben waren, zurück und benannte sogar seinen eigenen Sohn anstelle seines Bruders als seinen unmittelbaren Nachfolger.
Sehr schnell wurde der bewaffnete Konflikt zwischen den Brüdern unvermeidlich. Al-Ma’mun hatte das Glück, dass der loyale und höchst kompetente persische General Tahir in seinen Diensten stand: Dieser errang vor den Toren des heutigen Teheran einen ersten Sieg über al-Amins Armee und verschaffte al-Ma’mun damit die Kontrolle über große Teile Persiens. Al-Amin war nun zunehmend besorgt und appellierte vergeblich an seinen Bruder, er solle Vernunft annehmen und die Wünsche ihres Vaters respektieren; dann wandte er sich an seine Untertanen, um – vor allem unter den Arabern in Syrien – neue Soldaten anzuwerben. Aber al-Ma’muns Armee zog immer weiter nach Westen und stand im April 812 schließlich vor den Toren Bagdads. Damit begann die große Belagerung der Hauptstadt. Mittlerweile hatten die meisten Teile des Reiches außerhalb der unmittelbaren Umgebung von Bagdad sich bereits zu Verbündeten von al-Ma’mun erklärt.
Über ein Jahr hielt der belagerte Kalif der Armee seines Halbbruders und Thronanwärters, der weiterhin in Merw residierte, stand. Anfangs erhielt al-Amin von der Bevölkerung der Stadt, die nun in der Falle saß, unerwartete Unterstützung: Sie kämpfte mit groben, selbstgemachten Waffen gegen die gutausgerüsteten und gutausgebildeten Soldaten aus Khurasan. Tahir schien anfangs nicht in der Lage zu sein, die Verteidigung Bagdads zu überwinden, und er verstand auch nicht, welche Triebkraft hinter dem neuerwachsenen Widerstand aus der Stadt stand. Al-Amin, der im Qasr al-Khuld am Flussufer gewohnt hatte, zog sich hinter die befestigten Mauern der alten Stadtbefestigung zurück, die sein Urgroßvater al-Mansur, der Gründer Bagdads, errichtet hatte. Während Tahirs Streitkräfte durch die riesige Metropole vorrückten und dabei Mauern und Gebäude mit Katapulten angriffen, setzten al-Amins Leute ganze Stadtviertel in Brand, um die Feinde aufzuhalten. Als Tahir an den Mauern der Runden Stadt anlangte, lag Bagdad zum größten Teil in Trümmern.
Der Dichter Abu Tamman, der im 9. Jahrhundert in Bagdad lebte, schrieb: »Der Todesbote hat sich erhoben, um Bagdad zu betrauern.« Er verglich die Stadt mit »einer alten Frau, deren Jugend sie verlassen hat und deren Schönheit dahingeschwunden ist«.[9] Angesichts der langen, blutigen Geschichte, die Bagdad seit jener Zeit noch erleben sollte, hört es sich seltsam an, dass sie schon ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung als »alte Frau« bezeichnet wurde.
Nach einer Belagerung von mehr als einem Jahr löste sich das Patt schließlich auf: Im Herbst 813 überredete Tahir die Kaufleute der Stadt, die Pontonbrücken über den Tigris zu zerstören, die den Verteidigern als entscheidende Verbindungswege gedient hatten. Das nun folgende Chaos bot der versammelten Armee aus dem Osten die Möglichkeit zum Angriff. Al-Amin, der die Niederlage kommen sah, befolgte den Rat seiner engsten Vertrauten: Diese überzeugten ihn davon, dass er in Zukunft die Gelegenheit zu einem Gegenschlag gegen seinen Bruder haben würde, wenn er in den Norden des Landes flüchtete und sich von dort nach Syrien oder Ägypten begab, wo er eine neue Machtbasis organisieren konnte. Aber Tahir hatte offensichtlich Wind von dem Plan bekommen: Er schickte den Soldaten, die noch loyal zu al-Amin standen, eine Botschaft und drohte ihnen, zur Vergeltung nicht nur ihren Besitz innerhalb Bagdads zu zerstören, sondern auch ihre Anwesen auf dem Land, wenn sie al-Amin nicht von seiner Entscheidung abbrachten. Wenig später wurde al-Amin von seinen Beratern »überzeugt«, dass es nützlicher sei, sich zu ergeben – eine Entscheidung, die sich für ihn als tödlich erweisen sollte.
Die Ursache des Bürgerkrieges war zwar al-Rashids schlecht durchdachte Entscheidung über die Nachfolge – al-Amin war nie aus dem Holz einer großen Führungsgestalt geschnitzt –, er machte aber auch deutlich, dass das Abassidenreich erste Risse bekam. Es ging dabei nicht nur um die persönliche Rivalität zwischen den Brüdern, sondern auch um einen Konflikt zwischen unterschiedlichen politisch-religiösen Strömungen, die sich bereits während der vorausgegangenen Herrschaftszeit gezeigt hatten; al-Amin hatte das Schwergewicht auf Traditionen und arabische Kultur gelegt, während al-Mamun, der neuen philosophischen Denkrichtungen und äußeren Einflüssen aufgeschlossen gegenüberstand, sich die Unterstützung persischer Intellektueller gesichert hatte und ein überzeugter Anhänger des Mu’tazilismus war, einer rationalistischen Bewegung, die der wörtlichen Bedeutung des Koran ergebnisoffene Fragen und Untersuchungen gegenüberstellte.
Der mittelalterliche Historiker al-Mas’udi berichtet, wie al-Amins Mutter Zubayda ihrem Sohn ein übles Schicksal vorausgesagt hatte: In drei verschiedenen Träumen erschien ihr jeweils eine andere Frau und beschrieb die zukünftige Herrschaft ihres Sohnes als despotisch, korrupt, schwach, ungerecht und übermäßig verschwenderisch. Jedes Mal wachte Zubayda in panischem Entsetzen auf. In einer letzten Vision traten alle drei Frauen gleichzeitig auf und verkündeten ihre schrecklichste Prophezeiung: Sie beschrieben nicht nur sehr anschaulich al-Amins gewaltsamen Tod (den er trotz seiner Unterwerfung unter Tahir erleiden sollte), sondern sie verteidigten ihn auch als passendes, glorreiches Ende.