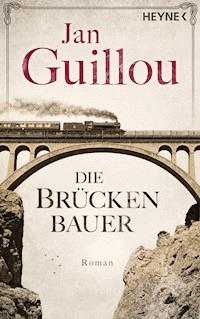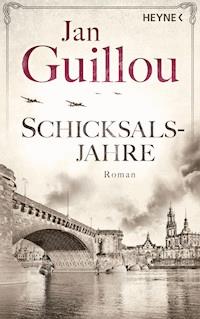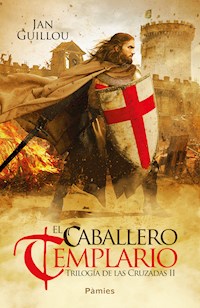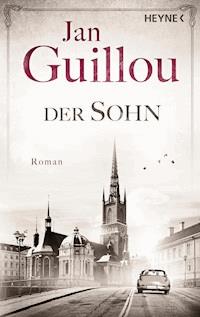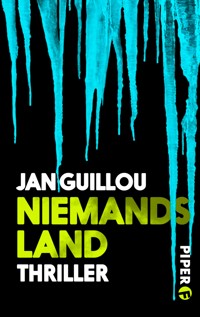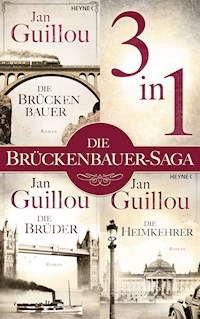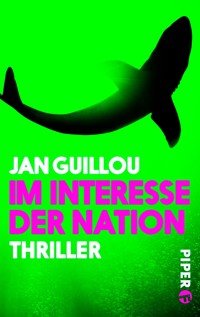
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sowjetischer Überläufer verrät dem schwedischen Geheimdienst Beunruhigendes: Schon seit Jahren betreibt Russland bewaffnete Unterwasserstationen in der Ostsee, die jederzeit die schwedische Küste angreifen könnten. Damit bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen, die der Kalte Krieg geschürt hat. Eine diplomatische Lösung des Problems kommt für die militärische Führung nicht infrage, stattdessen läuft die "Operation Big Red" an. Hamilton alias »Coq Rouge« ist der Mann der Stunde, denn er ist nicht nur ein exzellenter Unterwasserkämpfer, sondern auch ein kluger und umsichtiger Taktiker. Der schwedische Bestsellerautor Jan Guillou schickt seinen Helden in politische Gewässer, deren Untiefen sich erst nach und nach offenbaren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hans-Joachim Maass
ISBN 978-3-492-98042-5
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © 1988 Jan Guillou Titel der schwedischen Originalausgabe: »I nationens intresse«, Norstedts Förlag, Stockholm 1988 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1992 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © solarseven / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2003
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
1
Maria Szepelinska-Adamsson hatte noch neunzig Sekunden zu leben. Dabei hatte der Mann, der ihr den Rücken zuwandte – demonstrativ, wie sie meinte –, keinerlei Absicht, ihr weh zu tun.
Er blickte aus dem Fenster, obwohl es dort nichts geben konnte, was ihn interessierte; da waren nur der schwarze Fluß, ein verlassener Park in winterlicher Dunkelheit auf der anderen Seite und fünf Weiden, deren niedrigste Äste fast bis zum Wasser reichten. Im Sommer war es anders, aber jetzt war es Winter und Nacht.
Von seinem Gesicht konnte sie nur sehen, wie die Kiefermuskeln sich bewegten, als würde er bei jedem Wort die Zähne zusammenbeißen. Er hatte ihr mehr als deutlich zu verstehen gegeben, daß er ihr nicht mehr antworten würde. Er weigerte sich zu reagieren, was immer sie sagte.
Hätte sie mehr von ihm gewußt, hätte sie nur etwas davon geahnt, was bei den künftigen Ermittlungen der Polizei im Mittelpunkt stehen würde, hätte sie ihren plötzlichen Impuls ganz sicher unterdrückt. Aber jetzt war es, als wollte sie ihn zu einer Reaktion zwingen. Vermutlich war es nur das.
Auf dem Glastisch neben ihr lagen ein Holzbrett mit den Überresten einer ungarischen Salami und das japanische Küchenmesser aus spezialgehärtetem Molybdänstahl, das er ihr bei seinem letzten Besuch mitgebracht hatte. Sie nahm das Messer an sich und hielt es in der Hand, während sie ihn von neuem zu einer Antwort zu zwingen versuchte. Doch er kehrte ihr nur den Rücken zu, eine undurchdringliche Mauer aus Schweigen. Als sie das Messer hob und mit ein paar eiligen Schritten auf ihn zuging, ließ sie einen kurzen Schrei der Wut oder der Verzweiflung hören, damit er sich umdrehte.
Maria Szepelinska-Adamsson, die 34Jahre alt wurde, hatte keine Zeit mehr zu begreifen, was geschah. Es ist zweifelhaft, ob sie überhaupt noch Schmerz spürte. Sie war jedoch schon bewußtlos, bevor sie auf dem Fußboden landete. Und dort, auf dem weißen, handgewebten Teppich, strömte das Leben jetzt schnell und unwiderruflich aus ihr heraus. Etwa ein halber Liter pro Pulsschlag.
Die Schnittwunde an ihrem Hals reichte bis zum Nackenwirbel.
Er stand lange über sie gebeugt und hielt das Messer fest umfaßt. Er hatte das Gefühl, als wären große Teile des Gehirns in einem plötzlichen Kurzschluß ausgeschaltet worden; er begriff, was rein äußerlich geschehen war, verstand jedoch nicht den Zusammenhang.
Schließlich riß er sich aus seiner Lähmung, ging drei Meter weiter und ließ sich schwer in einen der weißen Ledersessel fallen. Neben ihm stand ein Telefon, und er streckte zunächst die Hand aus, um anzurufen, entschied sich jedoch mitten in der Bewegung anders, als er entdeckte, daß er das Messer noch immer in der Hand hielt.
Er legte das Messer auf den Glastisch und blieb dann mehr als eine Stunde regungslos sitzen, während sein Blick von der toten Frau zum Telefon und weiter zu dem Messer auf dem Glastisch wanderte. Neben dem Messer sah er einen kleinen Blutfleck, der schon geronnen war, als er endlich einen Entschluß faßte.
Er stand hastig auf und ging in die Küche. Am besten mit dem Abwasch beginnen. Im nachhinein würde niemand entscheiden können, ob vor oder nach dem Mord abgewaschen worden war, und jetzt verschwanden seine sämtlichen Fingerabdrücke von Porzellan, Gläsern und Besteck. Als er mit dem Abwasch fertig war, wischte er systematisch alle Flächen ab, mit denen er hätte in Berührung kommen können, als sie gemeinsam den Tisch gedeckt hatten. Dann nahm er ein paar Teller und einige Bestecke vom Trockengestell, wickelte sie in ein Handtuch, trug sie zu der toten Frau ins Wohnzimmer und stempelte die Gegenstände abwechselnd mit ihren linken und rechten Fingerspitzen.
Als er Teller und Bestecke in das Trockengestell zurückgelegt hatte, nahm er einen feuchten Lappen und ging wieder ins Wohnzimmer. Er brauchte gut eine halbe Stunde, um alle Flächen abzuwischen, in deren Nähe er sich hätte befinden können. Diesmal hatte er das Schlafzimmer nicht betreten, was die Arbeit erleichterte. Als er auch Flur und Badezimmer von Spuren gereinigt hatte, begann die nächste Phase.
Es war wichtig, daß er nichts übereilte, daß er sich Zeit nahm und nachdachte, was das weitere Vorgehen betraf.
Es war zu spät, ein Sexualverbrechen zu arrangieren. Die gerichtsmedizinische Untersuchung würde ohne Zweifel alles ans Licht bringen, was nach dem Eintritt des Todes mit dem Körper geschehen war, und außerdem wollte er sie nicht so erniedrigend behandeln, wie es dafür nötig gewesen wäre.
Sie war tot, ermordet von einem Experten in Sachen Gewalt, ohne jede Spur eines Kampfes. Das war der Eindruck, den der Tatort im Augenblick machte. Alles sprach dafür, daß der Mörder ein Mann war, und zwar ein Mann seiner Sorte. Beruflich war es nie seine Aufgabe gewesen, doch wußte er genug über die Methoden der Kollegen, einen Tatort zu untersuchen, um sich in groben Zügen für eine Verbrechensform zu entscheiden.
Er setzte sich eine Weile in den weißen Ledersessel und betrachtete die Szene, während er sich andere Möglichkeiten als die des irren Sexualmörders durch den Kopf gehen ließ. Dann entschied er sich, ging langsam in die Küche und nahm das Messer, das er auf die Spüle gelegt hatte, hüllte es in paar Blätter Küchenkrepp, nahm es mit in den Flur und steckte es in die Außentasche seines Mantels. Dann zog er ein paar Lederhandschuhe an, die für den schwedischen Winter eigentlich zu dünn, für sein Vorhaben jedoch bestens geeignet waren.
Langsam, still und systematisch stellte er das Wohnzimmer auf den Kopf. Die beiden Stehlampen legte er hin, als wären sie umgestoßen worden, die eine zertrat er behutsam und die andere ließ er brennend liegen, als wäre sie umgefallen, ohne beschädigt zu werden. Behutsam kippte er einen der Sessel um, zertrat mit dem Fuß einen kleineren Tisch, setzte sich dann in den weißen Ledersessel und betrachtete die Szene erneut. Noch blieb einiges zu tun.
Er schaute seine Schuhsohlen an. Nein, da war kein Blut, er hatte es sorgfältig vermieden, in den etwa einen Quadratmeter großen Blutfleck zu treten, der jetzt auf dem weißen Teppich einzutrocknen begann. Blieb noch der eigentliche Kampf.
Er ging wieder in den Flur und zog das Messer aus der Manteltasche. Es war abgewaschen und abgetrocknet, und das Blut, das möglicherweise noch an der Klinge klebte, würde nur unterm Mikroskop zum Vorschein kommen. Von den Tatortspezialisten, die sich bald einfinden würden, würde keiner auf die Idee kommen, in dem neuen Schnitt, den der Mörder zu tun gedachte, nach Blutspuren zu suchen. Der Täter ging ins Wohnzimmer zurück und stellte sich mit dem Rücken vor den umgekippten Sessel. Dann beugte er sich nach hinten, als wollte er zu einem Messerstich ausholen, und hielt mitten in der Bewegung inne, um einen langen Schlitz in das Leder des Sessels zu schneiden. Dann schob er mit dem Fuß den großen pakistanischen Teppich zusammen; nach einigem Experimentieren sah es aus, als hätte sich jemand auf dem Teppich abstützen wollen, um dann in einer hastigen Bewegung auszurutschen. Der Täter kam zu dem Schluß, daß er jetzt mit dem Wohnzimmer und der Küche fertig war.
Das Schlafzimmer befand sich in perfekter Ordnung, und das sollte auch so bleiben. Er hatte reichlich Zeit, mehr als zehn Stunden, bis er sich wieder zum Dienst einfinden mußte. Durch die Schlafzimmerwand hörte er, wie in der Nachbarwohnung das letzte Fernsehprogramm des Abends lief.
Er brauchte nicht mehr als eine halbe Stunde, um festzustellen, daß sich im Schlafzimmer nichts von Interesse befand. Blieb noch die unangenehmste Arbeit, das letzte Zimmer der Wohnung, ein kombiniertes Bibliotheks- und Arbeitszimmer.
Eine Längswand war voller Bücher. Die meisten in polnischer oder russischer Sprache, und überdies war es Fachliteratur auf Gebieten, die der Täter kaum beherrschte.
Die Tote war Elektronikingenieurin gewesen. Sie hatte ihre Ausbildung zunächst an der Universität Krakau und dann als Stipendiatin an der Universität Leningrad erhalten. Diese letzte Angabe hatte sie den Kollegen von der Sicherheitspolizei natürlich verschwiegen, als es um ihre Aufenthaltsgenehmigung für Schweden ging. Das war vermutlich richtig gewesen, denn sonst hätte sie nur schlafende Hunde geweckt.
Auf dem Schreibtisch lagen einige Arbeitsaufzeichnungen, die sie offenbar von ihrem Job bei Ericsson mit nach Hause genommen hatte. Die Gleichungen und Berechnungen sagten dem Täter nichts. Die Schreibtischschubladen waren abgeschlossen.
Die Schlösser sahen unkompliziert und nicht sonderlich stabil aus. Dennoch hielt er es für besser, die Schubladen aufzubrechen.
Er ging in die Küche und holte sich ein Hackmesser. Ein paar Minuten später hatte er die Schubladen aufgebrochen. Er entleerte sie in drei verschiedene Haufen auf dem Teppichboden und warf das Hackmesser daneben.
Dann sortierte er die Gegenstände. Drei Dinge kamen ihm besonders interessant vor: eine Schmuckschatulle in rotem Leder, ein in polnischer Sprache geschriebenes Tagebuch und ein Fotoalbum.
Er legte das Tagebuch beiseite, nachdem er besorgt festgestellt hatte, daß es, was ihn betraf, aktuell genug war. Dann blätterte er eine Zeitlang in dem Fotoalbum. Er sah lauter unbekannte Menschen und wußte, daß von ihm kein Bild dabeisein konnte. Einer der lächelnden Männer konnte ihr früherer Mann sein. Sie stand auf einem Segelboot. Der Hintergrund erinnerte an die Stockholmer Schären, ja, tatsächlich, das Großsegel trug schwedische Bezeichnungen. Und neben ihr stand ein Mann, der eher schwedisch als polnisch aussah. Vermutlich war es Adamsson.
Andere Bilder der Toten hatten mit ihrer Vergangenheit in Polen zu tun. Der Täter riß vier Fotos mit polnischen Motiven heraus und hinterließ einige Spuren, die sichtbar machen sollten, daß die Bilder herausgerissen worden waren. Er legte die Fotos neben das Tagebuch, das er mitzunehmen gedachte, und leerte dann die Schmuckschatulle aus. Er rührte jedoch nichts an. Den Wert ihres Schmucks schätzte er auf mindestens 50000 Kronen, doch wahrscheinlich lag er höher.
Sonst schien in dem streng und geschmackvoll möblierten Arbeitszimmer nichts von Interesse zu sein, obwohl er noch eine weitere Stunde dem Legen falscher Spuren widmete. Als er das Arbeitszimmer mit dem Tagebuch und den Fotos verließ, machte er das Licht nicht aus. Dann ließ er sich erneut in den weißen Ledersessel fallen und ging im Kopf noch einmal alles durch.
Jetzt führten die Spuren nach Polen, in die Vergangenheit der Toten. Das einzige Motiv, das sich ausschließen ließ, war ein Raubüberfall. Das entsprach nicht seiner Absicht. Der Täter überlegte zwar, ob er ihren gesamten Schmuck vielleicht mit Ausnahme eines vergessenen Rings an sich nehmen und ihn in das schwarze Flüßchen vor dem Haus werfen sollte. Es widerstrebte ihm jedoch. Die Tote hatte einen Sohn, der bei seinem Vater in der Nachbarstadt lebte und sie eines Tages beerben würde. Teile des Schmucks waren offenkundig ältere polnische oder deutsche Arbeiten, die Erbstücke sein mußten. Sie hatte das einmal beiläufig erwähnt. Nein, so wollte er sich nicht verhalten.
Also kein Raubmord und kein Sexualverbrechen. Blieben noch Möglichkeiten, die mit ihrer polnischen Vergangenheit zu tun hatten. Das Morddezernat und vermutlich auch die Beamten des Reichskriminalamts würden eine ungeheuer komplizierte Arbeit darauf verwenden, herauszufinden, welche Fotos in solcher Hast herausgerissen worden waren, als er das Gesuchte gefunden hatte.
Sie hatte also ihren Mörder gekannt und ihn deshalb in die Wohnung gelassen, denn im Wohnzimmer standen zwei Weingläser und eine ausgetrunkene Flasche, die auf den Fußboden gefallen war. Auf der Weinflasche und dem einen Weinglas, das jemand sorgfältig abgewischt hatte, gab es keine Fingerabdrücke. Auf dem anderen Glas nur die Fingerabdrücke der Toten.
Der Täter stand auf und ging zu der umgestoßenen Stehlampe, der einzigen Beleuchtung des Raums, setzte den Fuß auf den Schirm und zertrat ihn. Dann blieb er lange in der Dunkelheit sitzen und versuchte, an nichts zu denken. In der Dunkelheit fühlte er sich geborgener.
Nachdem im Haus kein Geräusch mehr zu hören war, ging er in den Flur, zog sich den Mantel an und vergewisserte sich, daß er das Messer zusammen mit dem Tagebuch und den Fotos in die Manteltasche gesteckt hatte. Nein, er hatte nichts vergessen.
Bevor er die Wohnungstür öffnete, rieb er den Türgriff mit seiner behandschuhten Hand ab und ging dann in die Dunkelheit hinaus. Er schaltete die Treppenhausbeleuchtung nicht ein und wiederholte im Dunkeln die gleiche Prozedur am Außengriff der Wohnungstür. Er drückte leise die Tür zu, ließ das Sicherheitsschloß einschnappen, ging dann langsam und vollkommen leise die Treppe hinunter und trat durch die Tür auf die Straße. Es schneite.
Seine Fußspuren würden in einer halben Stunde nicht mehr zu sehen sein, und den Wagen hatte er mehrere hundert Meter entfernt auf der anderen Seite der Brücke geparkt. In den Fassaden auf der anderen Seite waren immer noch einzelne Fenster erleuchtet. Es war jedoch so gut wie ausgeschlossen, daß jemand ihn zufällig sehen würde, und selbst wenn es wider Erwarten geschähe, würde dieser Jemand nur einen etwas mehr als mittelgroßen Mann in einem dunklen Mantel und ohne Kopfbedeckung sehen, der ohne sonderliche Eile seiner Wege ging. Zudem würden mehrere Tage vergehen, bevor die Beamten des Morddezernats nach Hinweisen dieser Art suchen würden. Als er um die Ecke bog, blickte er zum Straßenschild hinauf, obwohl er sehr gut wußte, daß er von der Garvaregatan in die Sandgatan einbog. Kein Mensch war zu sehen, und auf der anderen Seite leuchtete ein einziges Schild – Schwedischer Gewerkschaftsbund, Bezirk Östergötland.
Er ging langsam die Straße hinunter in Richtung Brücke und las an dem hohen Rathausturm die Uhrzeit ab. Es war halb zwei Uhr nachts.
Er blieb kurz vor der Brücke stehen und blickte zu dem Fuß- und Radweg hinunter, der am Ufer entlang und unter der Brücke hindurchführte. Noch immer kein Mensch in der Nähe. An einer Hauswand entdeckte der Täter ein Messingschild mit schwarzem Text. Es verriet, daß Norrköpings Baumwollweberei von 1853-1964 hier Fabrik und Verwaltung gehabt hatte. Das Werk war 1964 stillgelegt worden. 1969 hatte man die Fabrikhallen abgerissen. Warenzeichen des Unternehmens war ein Hahn gewesen.
Damals war dies ein Arbeiterviertel. Jetzt lagen einige der teuersten Wohnungen der Stadt hier, und eine davon hatte er gerade verlassen.
Wenn er sich entschloß, sich nicht erwischen zu lassen, würde ihm das auch gelingen. In seinem Beruf geriet man nicht so leicht in Mordverdacht. Aber die Entscheidung konnte warten, bis er Zeit gefunden hatte, die Angelegenheit zu durchdenken. Bis auf weiteres handelte er nur methodisch und mechanisch wie ein Polizist. Ohne seine Mitwirkung würden sie ihn nie festnageln können. Die Entscheidung lag völlig in seiner Hand.
So dachte er. Dann hörte er auf zu denken und schlenderte langsam über die Brücke. Die schwarze Wasserfläche war spiegelglatt und völlig leer, und am fünften Weidenbaum ein Stück weiter ragte ein Bootssteg ins Wasser. Noch immer kein Mensch zu sehen.
Er hatte nur noch fünfundsiebzig Meter bis zu seinem Parkplatz. Er war nach 18Uhr gekommen, als das Parken kostenlos war, so daß seine Anwesenheit nicht einmal von dem Parkautomaten registriert worden war.
In dem Moment, in dem er am Lenkrad saß, den Zündschlüssel drehte und den Defroster einschaltete, wurde über die künftige Mordermittlung entschieden. Jedoch nicht hier, sondern an einem ganz anderen Ort, in einem anderen Land, in einem anderen Teil der Welt.
Und da es somit im Interesse der Nation liegen würde, daß die Ermittlungen im Fall Maria Szepelinska-Adamsson nicht zu Ende geführt wurden, würde man sie auch nicht zu Ende führen.
Doch das hatte sehr wenig mit der kriminalistischen Erfahrung des Mörders zu tun, auch nicht mit seinem Geschick, falsche Fährten zu legen.
Die schwedische Botschaft in Kairo ist zwar ein relativ neuer Bau in hellgelbem Klinker, doch wenn man von den drei großen, verrußten Kronen an der Außenwand absieht, erinnert das Gebäude eher an eine arabische Festung des Mittelalters oder an eine Burg aus der Zeit der Kreuzfahrer. In diplomatischen Kreisen Kairos ist dieser festungsähnliche Botschaftsbau ein ständiger Anlaß zu Scherzen; die Pointen leben meist davon, daß gerade die schwedische Botschaft kaum je von schiitischen Fanatikern gestürmt oder angegriffen werden dürfte. In der Politik des Nahen Ostens spielt Schweden nur eine untergeordnete Rolle, und zudem hat das Land kaum Feinde, die diese Bezeichnung verdienen. Und dennoch dieser Botschaftsbau, der den Eindruck erweckt, als wäre er uneinnehmbar.
Der Schein trügt jedoch. Nur von der Straße aus erweckt die Botschaft den Eindruck einer Festung: durch das schwarze, schmiedeeiserne Tor, das Schilderhäuschen und die kleinen, wie Schießscharten wirkenden Fenster, hinter denen man Armbrustschützen des Mittelalters auf der Lauer zu liegen glaubt.
Die Straße heißt Muhammed Mahzar und liegt auf der Ostseite der Insel Gezira. Die Insel wird auf beiden Seiten vom Nil umschlossen und hat die gleiche soziale Bedeutung wie etwa Djurgärden in Stockholm; es ist eine Oase inmitten der Großstadt mit Parks und Sportklubs. Am bekanntesten ist der Gezira Sporting Club. Dort Mitglied zu werden ist schwieriger, als mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet zu werden. Und natürlich ist der Stadtteil Zamalek auf Gezira die Adresse, die man haben sollte, wenn man sich der ersten Gesellschaft Kairos zurechnen will.
Die Lage der schwedischen Botschaft ist also allein schon durch die Adresse in Zamalek ausgezeichnet. Überdies ist die Straße Muhammed Mahzar die letzte richtige Straße am Ostufer der Insel. Das Botschaftsgrundstück reicht fast bis zum Nilufer hinunter. Man kann sich mit den Ellbogen auf eine niedrige Steinmauer stützen und in den schwarzen, träge dahinfließenden Strom blicken. Von der Steinmauer, die das Botschaftsgrundstück abgrenzt, verläuft noch ein drei bis vier Meter breiter Uferstreifen, auf dem Unbekannte Bananen und Gemüse anbauen, bis zum Wasser, wo das Papyrusschilf beginnt. Dieser Gemüseanbau ist vermutlich illegal, aber kaum eine Angelegenheit für schwedische Behörden.
Von der Muhammed Mahzar aus verläuft an der hohen, unüberwindlichen Mauer auf der Nordseite des Botschaftsgeländes entlang eine schmale Gasse. In dieser Gasse halten ein oder zwei bewaffnete Posten der ägyptischen Sicherheitskräfte Wache, die sämtliche Botschaften der Hauptstadt bewachen.
Wohn- und Repräsentationsräume des Botschafters liegen in einer Villa auf dem Botschaftsgelände, durch einen Rasen vom eigentlichen Botschaftsgebäude getrennt und mit Aussicht auf den Fluß. Im Erdgeschoß hat der Botschafter ein privates kleines Arbeitszimmer, in das er sich am Abend gewöhnlich zurückzieht.
Dort saß er jetzt. Er war allein, da seine Familie sich in Schweden aufhielt. Er hatte drei Gin-Tonic getrunken und war leicht beschwipst. Die französischen Türen zum Garten standen offen. Von Zeit zu Zeit ließ die sanfte Brise das Laub der großen Mangobäume an der Mauer rascheln. Auf der anderen Seite des Nils glitzerte es in den neuen Hochhäusern, die seine Aussicht so radikal verändert hatten. Die schwierige Arbeit dieses Abends verursachte ihm Unbehagen. In drei Monaten würde das Schwedische Kulturinstitut in Kairo eine Schwedische Woche abhalten. Seine Majestät der König und Königin Silvia hatten ihr Erscheinen zugesagt, wogegen nicht viel zu sagen war. Das war wohl in Ordnung. Das Programm sollte jedoch hauptsächlich mit schwedischem Volkstanz, Ballett und einigen postmodernen Schriftstellern gefüllt werden, was immer darunter zu verstehen war. Ein Pianist sollte Chopin und Peterson-Berger spielen.
Gegen Volkstanz, das Königspaar und Peterson-Berger war kaum etwas einzuwenden, aber Ballett und Chopin hatten erstens sehr wenig mit Schweden zu tun, zweitens fiel den meisten europäischen Nationen bei ihren Kulturwochen nichts Besseres ein, und drittens verabscheuen Araber Ballett oder finden es bestenfalls komisch, um nicht zu sagen lächerlich. Es wäre besser, ein paar schwedische Lyriker einzuladen, wobei es keinerlei Rolle spielte, wenn sie auf schwedisch lasen. Derlei begriff man zu Hause einfach nicht. Das Ballett ist in der arabischen Welt eine verlachte Kunstform, während Poesie in höchster Achtung steht. Die Frage war jetzt, wie er das in dem Bericht darstellen sollte, den er in den nächsten Tagen absenden mußte.
Er meinte, hinten an der Mauer zum Fluß ein scharrendes Geräusch zu hören, aber er war zu sehr mit der Ballett-Frage beschäftigt, um sich auf das Geräusch zu konzentrieren. Statt dessen ging er zu seiner kleinen Hausbar und goß sich einen weiteren Gin-Tonic ein, jedoch ohne Eis. Das Eis war geschmolzen. Für Kairoer Verhältnisse war es ein ungewöhnlich warmer Winter.
Als er sich umdrehte, stand ein Mann mittleren Alters mit europäischem Aussehen und einem schlammverschmierten, zu kleinen Mantel zwischen den französischen Fenstern im Raum.
»Guten Abend, Herr Botschafter. Sie sind doch der Botschafter des Königreichs Schweden, hoffe ich?« sagte der Unbekannte in mühsam erkämpftem Englisch mit kräftigem slawischem Akzent.
Die meisten Männer hätten an Erland Rickfors’ Stelle die so plötzlich entstandene Situation als unbehaglich oder bedrohlich empfunden. Ein kräftiger Mann mit grauen, kurzgeschorenen Haaren hatte sich an den Wachposten der Botschaft vorbeigeschlichen, war über die Mauer geklettert und in das private Arbeitszimmer des Botschafters eingedrungen, noch dazu nach Mitternacht. Möglicherweise wurde die Furcht des Botschafters durch die drei Gin-Tonic betäubt, doch was am Ende sein Verhalten bestimmte, war eher die absurd komische Situation, die sich – wie immer die Fortsetzung geraten mochte – gutartig zu entwickeln schien. Erland Rickfors liebte es, auf neue, am liebsten komische Geschichten zu stoßen, die er weitererzählen konnte.
»O ja, ich bin der schwedische Botschafter«, lächelte er. »Was darf ich Ihnen anbieten? Whisky, Gin oder vielleicht Wodka? Das Eis ist mir leider ausgegangen.«
Wenn der Mann tatsächlich ein Verrückter war, war es am besten, das Problem in aller Ruhe zu lösen.
»Wodka ist ausgezeichnet. Bitte kein Wasser und kein Eis«, erwiderte der andere, ohne sich zu bewegen.
»Na bitte. Dann setzen Sie sich doch erst mal«, sagte der Botschafter und drehte sich zu seiner Hausbar um. Er holte eine Flasche russischen Wodka hervor und goß ein Wasserglas voll ein, da er die Nationalität seines unbekannten Gastes schon erraten hatte.
Dennoch fiel es ihm schwer, sein Erstaunen zu verbergen, als er mit den Gläsern in der Hand zu seinem Arbeitsplatz zurückkehrte. Der andere hatte den lehmverschmierten Mantel ausgezogen und sich auf einen Stuhl direkt vor dem Schreibtisch gesetzt. Der Botschafter war zwar kein Uniform-Experte, aber zwei Dinge offenbarten sich ihm sofort. Der Mann trug die Uniform der sowjetischen Marine und mußte ein sehr hoher Offizier sein. Auf der linken Brustseite der Uniformjacke waren Auszeichnungen in verschiedenen Farben befestigt, die eine Fläche von fast hundert Quadratzentimetern bedeckten.
»Bitte sehr, skål, und seien Sie willkommen. So heißt das in unserem Land«, sagte der Botschafter und reichte dem Fremden das Wodkaglas, während er sich setzte. Die beiden sahen sich in die Augen und tranken.
»Ich bin Vizeadmiral Gennadij Alexandrowitsch Koskow und hergekommen, um in Ihrem Land um politisches Asyl nachzusuchen«, sagte der Russe ohne Umschweife und stellte sein geleertes Wodkaglas vor seinem sprachlosen Gastgeber mit einem Knall auf den Tisch.
Der Botschafter ertappte sich dabei, daß er mit offenem Mund dasaß und vor sich hin starrte. Er erhob sich ohne ein Wort, nahm das Glas des Russen, wanderte zur Hausbar, füllte es von neuem und brachte es seinem ungebetenen Gast zurück. Es war eine dieser Situationen im Leben, die man hinterher mit Worten wie »tausend Dinge schossen mir durch den Kopf« zu beschreiben pflegt.
»Ich muß Ihnen natürlich eine Reihe von Fragen stellen, Herr Vizeadmiral. Lassen Sie mich gleich darauf hinweisen, daß Sie sich zwar auf schwedischem Territorium befinden, doch das bedeutet für Sie keinerlei Garantie. Ich habe das uneingeschränkte Recht, Sie aus dem Haus zu weisen und den ägyptischen Behörden zu übergeben. Ich wünsche, daß Sie sich dessen bewußt sind, bevor ich mir Ihre Gründe anhöre. Ich möchte auch betonen, daß mir sowohl Zeitpunkt als auch Ort für einen solchen Schritt schlecht gewählt zu sein scheinen.«
Er machte eine Pause, um die Wirkung seiner Worte zu beurteilen. Doch der Vizeadmiral lächelte nur, durch die versteckte Drohung anscheinend unberührt, und wartete offenbar darauf, daß der Botschafter seinen Gedankengang zu Ende brachte.
»Na also«, fuhr der Botschafter fort, »weshalb hier und jetzt, und was bringt Sie zu der Annahme, wir würden Ihrem Antrag entsprechen?«
Der Vizeadmiral gab ein kurzes und konzentriertes Bild der Lage. Als ein Teil des Bemühens, die Beziehungen der Sowjetunion zu Ägypten zu verbessern, finde im Augenblick ein Flottenbesuch in Alexandria statt. Er, Koskow, habe sich vor zehn Stunden abgesetzt. Er habe sich einfach ein Taxi genommen und sei die zweihundert Kilometer nach Kairo gefahren. Der Taxifahrer habe sich angesichts einer Anzahl amerikanischer Geldscheine sehr entgegenkommend gezeigt. Unter anderem habe er den zivilen Mantel besorgt und sei dann ein paar Stunden in Kairo an verschiedenen Botschaftsgebäuden vorbeigefahren, bis es dunkel wurde. Dann hätten sie sich vor der amerikanischen Botschaft getrennt. Der Taxifahrer sollte glauben, daß er, Koskow, die amerikanische Botschaft aufsuchen wolle, denn es werde natürlich zu einigen Nachforschungen kommen, wenn sich herausstelle, daß einer der Befehlshaber der sowjetischen Marineeinheit vermißt werde. Man könne ja die Möglichkeit nicht ausschließen, daß die Behörden des Taxifahrers habhaft würden und aus dessen Angaben den naheliegenden Schluß zögen, daß sich der verschwundene Vizeadmiral bei den Amerikanern aufhalte.
Der Vizeadmiral machte eine Pause und fuhr fort: »Im Augenblick weiß in Kairo außer uns beiden also niemand, was geschehen ist. Wenn die schwedischen Behörden sich dafür entscheiden, mein Asylgesuch abzulehnen und mich an die ägyptischen Behörden auszuliefern, wären die Folgen für mich Rücktransport in die Sowjetunion und vermutlich die Todesstrafe, doch ich sage das nur für den Fall, daß dieser Umstand für die Entscheidung Schwedens von Bedeutung sein sollte.« Ein feines Lächeln umspielte die Lippen des Russen. »Es gibt jedoch noch weitere Gründe, die bedeutend schwerer wiegen als die humanitären, falls man die Angelegenheit mit schwedischen Augen betrachtet.«
Der Russe verstummte erneut und wartete auf die Frage, die sich aus dem Gesagten ergab.
»Und was sollten das für Gründe sein, wenn ich fragen darf?« wollte der Botschafter wissen. Der Russe wartete einen Moment, bevor er antwortete.
»Ich bin stellvertretender Oberbefehlshaber der Marine und Chef des Zweiten Direktorats in Kaliningrad. Verstehen Sie, was das bedeutet, Herr Botschafter?«
»Aufrichtig gesagt, nein. Nun ja, das sagt mir nur, daß Sie folglich in der größten und von unserem Land aus gesehen nächstgelegenen sowjetischen Marinebasis eine wichtige Funktion haben. Sie sind ein hohes Tier in der sowjetischen Marine, was sich übrigens auch aus Ihrer Uniform ergibt. Na und?«
»Als Chef des Zweiten Direktorats bin ich für sämtliche Diversionsverbände der Marine und der Marineinfanterie verantwortlich. Verstehen Sie jetzt?«
»Nein, ich bin leider ein sehr zivil veranlagter Mensch. Wie heißen diese Verbände noch, wie sagten Sie?«
»Diversionsverbände. Lassen Sie es mich etwas ziviler ausdrücken. Es handelt sich um Sabotage- und Störaktionen der Verbände, die Sie nicht ganz korrekt als ›Spetsnaz‹ bezeichnen. Es handelt sich um taktische Unterwasseroperationen, und zwar von Mini-U-Booten, wie Sie sie nennen. Kurz, ich bin für alle Operationen dieser Art auf dem Territorium Ihres Landes verantwortlich, oder vielmehr, ich war es, bis ich durch diese Tür trat. Verstehen Sie jetzt, wovon wir sprechen?«
Der Botschafter blieb zunächst stumm. Er fühlte sich plötzlich unfaßbar betrunken, war sich aber sicher, richtig gehört zu haben. Ihm war klar, daß die Worte, die er soeben vernommen hatte, bedeuteten, daß er nicht einmal unter Aufbietung seiner ganzen Phantasie die Konsequenzen der Tatsache beurteilen konnte, daß der Mann in dem lehmverschmierten Regenmantel vor kurzem sein Zimmer betreten hatte. Vorausgesetzt, daß alles den Tatsachen entsprach.
»Woher soll ich wissen, daß Sie die Wahrheit sagen?« fragte er so beherrscht wie möglich.
»Das können Sie nicht wissen. Auf Grund Ihrer Stellung können Sie das auch gar nicht beurteilen.«
»Was sollen wir tun? Was schlagen Sie vor?«
»Sehr einfach. Nur Sie und ich wissen, daß ich hier sitze. Lassen Sie uns als ersten Schritt versuchen, den Kreis, der hier in Ägypten Bescheid weiß, auf uns zwei zu beschränken. Als nächsten Schritt nehmen Sie mit den entsprechenden Behörden in Ihrem Land Kontakt auf, warten deren Anweisungen ab, und dann wird sich das Ganze schon lösen lassen, denke ich. Ist dies Ihre Privatwohnung?«
»Ja.«
»Haben Sie Gästezimmer?«
»Ja, im Obergeschoß. Aber was soll ich denn nach Stockholm melden? Was meinen Sie? Namen, Dienstnummer und Dienstgrad, oder was?«
»Lassen Sie mich einen Brief an Ihre militärische Führung schreiben. Schicken Sie ihn mit der Diplomatenpost nach Hause. Wenn man in Stockholm den Brief gelesen haben wird, wird es keine Zweifel geben. Meine Informationen sind für Ihre Nation von allergrößter Bedeutung. Das wird aus meinem Schreiben hervorgehen.«
»Es dauert noch drei Tage, bis wir unsere Diplomatenpost abschicken können, ich meine, ohne unnötiges Aufsehen zu erregen. Verschlüsselt und per Funk könnte ich das Ganze schon morgen früh senden.«
»Davon möchte ich ganz entschieden abraten. Wir hören Ihren Funkverkehr routinemäßig ab. Das eine oder andere bleibt zwar nicht im Netz hängen, aber im Moment wäre es ein wenig leichtsinnig, dieses Risiko einzugehen. Warten Sie lieber noch ein paar Tage. Bedienen Sie sich der Diplomatenpost. Sie müssen nämlich verstehen, Herr Botschafter, daß die Regierung meines Landes mich hier herausholen wird, wenn sie erfährt, wo ich mich aufhalte, und zwar ohne Rücksicht auf diplomatische oder sonstige Konsequenzen. Überdies unabhängig davon, ob dabei mehrere Menschen, Sie selbst eingeschlossen, sagen wir … zu Schaden kommen. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Um so dringender, keine Zeit zu vergeuden. Wir verwenden bei unserem Funkverkehr Computercodes, die …«
Der Botschafter blieb mitten im Satz stecken. Er hatte geantwortet, ohne zu Ende zu denken, was die versteckte Drohung des Russen bedeutete. Er wohnte momentan allein in der Dienstvilla, da seine Frau in Schweden war, um bei ihrer Mutter zu sein, die im Sterben lag. Doch der Russe hatte sein Zögern offenbar mißverstanden.
»Sie müssen verstehen, Herr Botschafter, ja, entschuldigen Sie, wenn ich sage, wie es ist, aber es hat zu meinen dienstlichen Obliegenheiten gehört, Teile Ihres militärischen und diplomatischen Funkverkehrs abzuhören, zu entschlüsseln und zu ordnen. Und im Hinblick auf die jetzige Situation … tja, selbst wenn meine Landsleute jetzt glauben, was ich sehr hoffe, daß ich mich bei den Amerikanern aufhalte, wird in der nächsten Zeit der gesamte diplomatische Funk- und sonstige Verkehr von Kairo von allergrößtem Interesse sein. Im übrigen spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre Meldungen per Telex oder Kurzwelle übermitteln. Können wir uns nicht lieber auf Diplomatenpost einigen? Und zwar an dem gewohnten Tag?«
Der Botschafter nickte. Er fühlte sich matt und ganz leer im Kopf. Plötzlich erstaunte er seinen Gast, weil er schrill auflachte und dabei den Kopf schüttelte. Sein großes Problem hatte an diesem Abend bis vor kurzem darin bestanden, wie man ein paar postmoderne Romanautoren durch einige herkömmliche Lyriker ersetzen sollte, und wie er seinen Vorgesetzten beibringen sollte, daß man bei der kommenden Kulturwoche in Kairo lieber auf Ballett verzichten solle. Was sich jetzt abzeichnete, war so weit von der gewohnten diplomatischen Routine entfernt, daß er es am liebsten mit einer Art Naturkatastrophe verglichen hätte. Er zweifelte nicht im mindesten mehr daran, daß der grauhaarige, kurzgeschorene russische Seebär tatsächlich der war, für den er sich ausgab.
Der Botschafter traf im stillen schnell drei Entscheidungen. Zwei davon waren klug, eine katastrophal. Erstens würde er den Gast in einem der jederzeit beziehbaren Gästezimmer unterbringen, die am selben Flur im Obergeschoß lagen, wo er und seine Frau ihr Schlafzimmer hatten. Zweitens würde er, wie sein Gast vorgeschlagen hatte, auf jeden Funkverkehr mit Stockholm verzichten und statt dessen sowohl seinen eigenen Bericht als auch den Brief des Vizeadmirals an die militärische Führung Schwedens per Diplomatenpost nach Hause schicken.
Drittens würde er schon am nächsten Tag erste Verbindung mit seinem gewohnten Kontaktmann beim ägyptischen Sicherheitsdienst aufnehmen, der für die Wünsche ausländischer Botschaften zuständig war. Der Botschafter hegte keinerlei Zweifel, daß die Ägypter bereit sein würden, den Russen so schnell wie möglich außer Landes zu expedieren. Das Problem duldete keinen Aufschub, und je eher man es in Angriff nahm, um so besser: Der Russe mußte Ägypten verlassen und auf dem schnellsten Weg nach Schweden gebracht werden.
Überdies wäre diese Lösung in diplomatischer Hinsicht das korrekteste Vorgehen. So würde Schweden nicht hinter dem Rücken der Ägypter handeln, was zur Beeinträchtigung der Beziehungen führen konnte.
Der Botschafter teilte dem Russen seine ersten beiden Entscheidungen mit, und dann gingen sie gemeinsam ins Obergeschoß. Zum Erstaunen des Botschafters bat der Gast, die mehr als halbvolle Flasche mit russischem Wodka mitnehmen zu dürfen.
»Sie müssen verstehen, Herr Botschafter, ich bin sehr traurig und habe vor, genau das zu tun, was ich schon als junger Mann tat, wenn ich traurig war, nämlich saufen. Wenn Sie jemanden singen hören, machen Sie sich keine Sorgen, das bin nur ich.«
Es war fast zwei Uhr am Freitagmorgen ägyptischer Zeit, als sich die beiden Männer oben im Schlafzimmerflur trennten. Zu Hause in Schweden war es eine Stunde nach Mitternacht.
Auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers in Norrköping lag Maria Szepelinska-Adamsson. Der größte Teil ihres Bluts lag in einem erstarrten Kuchen vor ihrem Gesicht.
Im obersten Stockwerk eines vierstöckigen Hauses an der Kommendörsgatan in Stockholm war das vor kurzem gegründete Unternehmen Hamilton Data System AB dabei, sich zu installieren. Das blankpolierte Firmenschild aus rostfreiem Stahl mit schwarzem Relieftext war unten an der Haustür soeben angebracht worden.
Für einen außenstehenden Besucher – und zu gegebener Zeit würden sie sich in großer Zahl einfinden – gab es an den hell eingerichteten Räumen mit italienischem Design, dem der Außenwelt zugewandten Gesicht des Unternehmens, nichts Ungewöhnliches oder Merkwürdiges zu sehen. Nicht einmal die Teile des Büros, zu denen Außenstehende keinen Zutritt erhalten würden, zeigten etwas anderes als ein soeben gegründetes EDV-Unternehmen. Ein Computerexperte wäre möglicherweise zu dem Schluß gekommen, daß die Geräte, ausschließlich der Marke IBM, für ein auf einfachere Buchhaltungsprogramme und Beratungsaufträge spezialisiertes Unternehmen reichlich teuer und kompliziert waren.
Es war Carl Gustav Gilbert Hamiltons neuer Arbeitsplatz. Man hatte ihn vor kurzem zum Korvettenkapitän befördert, aber er trug niemals Uniform. Das tat auch keiner seiner Kollegen beim SSI, dem geheimsten Teil des militärischen Nachrichtendienstes Schwedens.
Nach außen war er Chef des Unternehmens, was auch kein Wunder war, da er juristisch dessen Eigentümer war und die Firma seinen Namen trug. Das Arrangement war außerordentlich praktisch. Er hatte persönlich etwa sechs Millionen Kronen investiert, die von den Streitkräften dann mit entsprechender Genehmigung der sogenannten »Nachrichtendienst-Revision« an ihn zurückgezahlt worden waren. Hingegen gab es nichts, was die Streitkräfte des Landes sichtbar mit dem Unternehmen in Verbindung brachte. Es erschien vielmehr als eine völlig logische Konsequenz aus Carls ziviler Ausbildung an der University of California in San Diego sowie seinen guten finanziellen Verhältnissen.
Die möglichen Verluste des Unternehmens auf dem kommerziellen Markt sowie Carls persönliches Gehalt wurden auf dem gleichen Weg erstattet wie die Investitionskosten. Dabei war beabsichtigt, daß das Unternehmen sich zu gegebener Zeit selbst tragen sollte. Über die Verwendung eines eventuellen Gewinns hatte man noch nicht entschieden, und Carls Vorschlag, ihn als Gratifikation an die Angestellten auszuzahlen – sowohl an die Zivilangestellten als auch an das rein militärische Personal –, war auf grundsätzliche Einwände gewerkschaftlicher Art gestoßen. Andererseits war diese Frage nicht sonderlich dringend, da ein Gewinn im Lauf der nächsten Jahre undenkbar erschien.
Man hatte zivile Bürozeiten eingeführt. Die Arbeit begann folglich um Punkt 9Uhr. Carl fand sich regelmäßig um 8.55Uhr ein, so auch an diesem Freitagmorgen, als er in seiner Eigenschaft als Chef durch die äußeren Teile des Büros spazierte, um in dem Moment zum Untergebenen zu werden, in dem er durch die codegesicherte und getarnte Tür trat, die zu seinem eigentlichen Arbeitsplatz führte. Sein Chef war Kapitän zur See; in dieser neuen Sektion des schwedischen Nachrichtendienstes hatten Marineoffiziere ein deutliches Übergewicht.
Bei oberflächlicher Betrachtung schien Carl sich in seiner neuen Arbeit wohl zu fühlen, und seine periodisch auftretenden Depressionen kämpfte er mit hartem Willen und noch mehr Arbeit nieder. Seinem Chef, dem Kapitän zur See, war es nicht entgangen, daß Carl von Zeit zu Zeit mehrere Tage hintereinander stumm dasaß, in seine Arbeit versunken. Jedoch erschien es nicht unnatürlich, daß ein Mann, dessen Ausbildung sich hauptsächlich auf die Feldarbeit konzentriert hatte, Datenanalyse und -verarbeitung langweilig fand. Das war jedoch ein Mißverständnis, das auf völliger Verkennung von Carls Gefühlen beruhte. Carl hatte unangenehme Erinnerungen an seine Feldarbeit, und das, womit er sich jetzt beschäftigte, erschien sowohl ihm selbst als auch seinem speziell abkommandierten Psychiater als Balsam für die Seele.
Jedenfalls war er jetzt zu Hause. Er war dem Irrenhaus oben auf Kungsholmen entronnen, der Sicherheitspolizei, für die er aus mancherlei Gründen drei Jahre hatte arbeiten müssen. Jetzt war er das, was er von Anfang an hätte sein sollen, von dem Moment an, als der Alte ihn während der Marinetaucherausbildung in Karlskrona buchstäblich aus dem Wasser gefischt hatte. Jetzt war er Offizier beim militärischen Nachrichtendienst und der künftige Chef der besonderen Operationsabteilung. In einigen Jahren würde diese Operationsabteilung mit ihrer Arbeit beginnen können. Dann würde er vermutlich zum Fregattenkapitän befördert werden. So schien alles aufs beste geordnet zu sein.
Als der Alte zum erstenmal vorgeschlagen hatte, man solle Carl einen Psychiater besorgen, hatte sich Carl heftig gewehrt. Doch der Alte nahm sich einen Abend lang Zeit, und am Ende gelang es ihm, Carl zu überzeugen.
Sie saßen auf der Apfelplantage in Kivik am Kamin; es war Carls dritter Besuch innerhalb kurzer Zeit. Beiden fiel es leicht zu verstehen, warum ihr Verhältnis einer Vater-Sohn-Beziehung immer ähnlicher geworden war. Denn erstens war Carl sozusagen die Schöpfung des Alten, die Umsetzung einer Idee, die der frühere Chef schon zu einer Zeit gehegt hatte, in der das SSI noch IB geheißen hatte. Denn die Stärke des schwedischen Nachrichtendienstes – Auswertung offener Quellen sowie Nachrichtenspionage – war genauso leicht zu erkennen wie dessen Schwäche. Schweden fehlten kompetente field operators, Personal, das dem Feind draußen auf dem Feld die Stirn bieten konnte. Die Sicherheitspolizei oder die Polizei, wie der Alte sie abfällig nannte, hatte für mehr als den einen oder anderen politischen Flüchtling oder ein Gejammer in der Presse über die Hinterhältigkeit der Russen weder Zeit noch Interesse übrig. Im übrigen widmete man sich hauptsächlich der Aufgabe, linksorientierte Ausländer zu jagen; und das mit ganz besonderem Nachdruck, seitdem ein Polizeipräsident, ein meschugger Polizeipräsident, wie der Alte ihn nannte, sich in den Kopf gesetzt hatte, hinter dem Mord an Olof Palme stecke eine Verschwörung politischer Flüchtlinge kurdischer Nationalität.
Damals, vor zehn Jahren, als sie sich zum erstenmal auf der Apfelplantage in Kivik getroffen hatten, war es leicht gewesen, Carl zu überreden. Der Staat würde eine fünfjährige Universitätsausbildung in San Diego bezahlen, Hauptfach elektronische Datenverarbeitung, während Carl gleichzeitig unter Wahrung vollständigen Stillschweigens verpflichtet wurde, sich auf der Sunset Farm ausbilden zu lassen; das ist ein sehr schöner Name für eine der grausamsten Ausbildungsanstalten der Welt, an der die amerikanische Bundespolizei und die US Navy eine sehr kleine und handverlesene Elite von field operators in Dingen ausbildete, die sich ein normaler schwedischer Nachrichtenmann nie vorstellen könnte.
Carl war der Prototyp, das erste Exemplar dieser neuen schwedischen Waffengattung, und als Waffe war er ein sehr überzeugender Erfolg geworden. Und das wiederum hatte aus dem Blickwinkel des Alten den Vorzug, daß der Widerstand aus der konservativen Ecke in der militärischen Führung verstummt war. Zwei von Carls Nachfolgern, die der gleichen Operationsabteilung angehören sollten wie er selbst, befanden sich schon seit drei Jahren in Kalifornien.
Soweit war alles gut. Es war ein Triumph für die Theorie des Alten, daß der Feind am Boden kontrolliert und bekämpft werden müsse, auch auf dessen eigenem Territorium, und nicht von den genormten Büroräumen des gewöhnlich nur zeitunglesenden offenen Nachrichtendienstes aus.
Doch der operative Triumph hatte auch eine schwer zu bewältigende menschliche Seite. Carls Kampferfahrung hatte starke Spuren hinterlassen, nicht nur auf seinem Körper, dessen Wunden normal verheilt waren, sondern auch in seiner Seele. Und das war ihm anzusehen.
Seine Schwierigkeiten hingen nicht greifbar mit dem etwas gewalttätigen Ende der ersten Operation zusammen, wie der Alte mit betonter Untertreibung die Konfrontation Carls mit vier israelischen Spezialisten in einer Villa in Täby beschrieb, die Carl bei einem Schußwechsel getötet hatte. Carls Selbstanklagen in dieser Hinsicht hatten vor allem damit zu tun, daß er zu spät gekommen war – denn die Israelis hatten zu diesem Zeitpunkt schon die meisten ihrer Opfer liquidiert.
Hingegen kehrte Carl immer wieder von neuem auf das Ende des deutschen Unternehmens zurück. Er hatte – im Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe von schwedischem und bundesdeutschem Sicherheitsdienst – ein halbes Jahr mit einer falschen Identität in der Bundesrepublik gelebt, und es war ihm gelungen, bis ins Zentrum der Terroristenorganisation RAF vorzudringen. Dann hatte er, wie beabsichtigt, die Männer der GSG 9 zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort geführt. Insoweit war alles in Ordnung gewesen.
Nicht in Ordnung war gewesen, daß Carl sich einerseits hereingelegt fühlte, und andererseits, daß er sich selbst die Schuld an dem gab, was dann geschah. Die Deutschen hatten nicht geplant, wie er sich als Schwede ein wenig naiv vorgestellt hatte, die Terroristen einzufangen, um sie dann nach gut demokratischer Verfahrensweise vor Gericht zu stellen. Der deutsche Plan lief auf eine Art Endlösung hinaus, darauf, die Terroristen auszulöschen. Was auch geschehen war. In Anwesenheit Carls.
Eine der RAF-Terroristen hieß Monika, und Carl behauptete, sie hätten einander nahegestanden, was vielleicht sogar den Tatsachen entsprach. Aufgrund einer bestimmten Mechanik des Handlungsablaufs hatte es der Zufall gewollt, daß ausgerechnet Carl sie erschossen hatte. Es war zwar in der denkbar besten Absicht geschehen, nämlich um einen französischen Kollegen zu schützen. Doch Carl hatte dieses Ereignis, wie es schien, nie überwunden. Immer wieder sprach er von ihren letzten gemeinsamen Augenblicken, erzählte, wie er Monika in die Augen geblickt habe, als das Projektil sie durchschlug, wie er den Schuß sorgfältig gezielt abgegeben habe, um sie nicht zu töten, wie aber diese verfluchte GSG 9 dann … Ja, und so weiter. Der Alte hatte die Geschichte schon hundertmal gehört, jedenfalls kam es ihm so vor.
Das Problem war für den Alten nicht neu. Zwar war der schwedische Nachrichtendienst in seinem Ehrgeiz recht erfolgreich gewesen, sich von spektakulären Zusammenstößen dieser Art fernzuhalten. Es war zwar zu gelegentlichen Feuergefechten gekommen, doch beschränkten sich die eigenen Verluste auf einen einzigen Mann. Doch mit Personal, das mit streng geheimem Material befaßt war, durfte niemand sprechen. Carl war nicht verheiratet und lebte als Millionär und Geschäftsmann in der EDV- und Immobilienbranche. Da an seiner Professionalität nicht zu zweifeln war – in dieser Hinsicht hegte der Alte keinerlei Verdacht –, sprach er mit keinem Menschen über seine Funktion in der Landesverteidigung oder über seine erschütternden Erfahrungen.
In einem früheren Fall hatte der Alte den Einsatz eines vertrauenswürdigen Psychiaters empfohlen, da selbst ein medizinischer Laie sich leicht ausrechnen konnte, daß ein innerer Druck dieser Art ungesund war. Ein derart belasteter Mann brauchte einen Menschen, mit dem er sprechen konnte. Überdies wohnte der Alte neuerdings überwiegend unten in Kivik in Schonen, und Carl konnte nicht jederzeit zu ihm kommen, um offen zu reden.
»Versuch doch mal, die Sache praktisch zu sehen«, hatte der Alte gesagt. »Es geht doch nicht darum, daß du einen Seelenklempner brauchst. Du brauchst einen Menschen, mit dem du reden kannst, jemanden, mit dem du sprechen darfst, das ist alles. Na ja, du brauchst ja nicht unbedingt auf operative und organisatorische Details einzugehen, aber du verstehst doch, was ich meine?«
Das hatte geholfen. Diese Möglichkeit, sich einmal auszusprechen, eine Art Gesprächstherapie, hatte Carl sicher gutgetan. Sie hatte ihm einigen Druck von der Seele genommen. Im Falle Monikas hatte sie wohl auch die Schuldgefühle verringert und es ihm erleichtert, das schwer erträgliche äußere Bild von sich selbst auszuhalten, das er aus dienstlichen Gründen allen Menschen in seiner Nähe vermitteln mußte: daß er ein Mann war, der zu der Zeit, in der man es zu sein hatte, ein Oberschicht-Radikaler gewesen war, der aber jetzt den Übergang zu Aktien, Immobilien, Steuerplanung und Computern geschafft hatte und sich so kleidete und so wohnte, wie es einem Mann mit derart zeitgemäßen Interessen zusteht. Diese Entwicklung erstaunte jeden ehemaligen Freund, dem er zufällig begegnete, wenn sie ihn nicht anekelte. Für alte Clartéisten und Palästina-Aktivisten mußte all das schwer erträglich sein. Carl vermittelte den Eindruck, daß er jetzt einer anderen Welt angehörte, was ja auch der Fall war.
Sein Problem jedoch, ein Problem, das größer war als der Tod Monikas, saß noch tiefer. Es gab schwarze Löcher in ihm, die ihn erschreckten, Fallen, denen er mit dem Selbstvertrauen des geschickten Jägers ausweichen zu können glaubte. Er hatte eigentümliche nächtliche Phantasien, die er seinem Psychiater nie verriet; die er mit dem ganzen Geschick seiner Ausbildung verbarg, die ihn darauf getrimmt hatte, nichts von sich preiszugeben, was er nicht preisgeben wollte. Doch da war etwas in ihm, was Alpträume hervorzwingen konnte. Er war einmal sogar in die Nähe des Gedankens geraten, daß eine kleine, ständig wachsende Geschwulst von Irrsinn in ihm wucherte, doch den Gedanken hatte er schnell in das schwarze Loch zurückgeprügelt.
Er war sich sehr wohl der Tatsache bewußt, daß er ein Mann von ungewöhnlicher Selbstbeherrschung war, und in diese Selbstkontrolle setzte er sein ganzes Zutrauen.
Jetzt beschäftigte er sich also mit nachrichtendienstlicher Tätigkeit beim Sicherheitsdienst. Er näherte sich dem Ende seines Arbeitstages, zu dem er seinem nächsthöheren Vorgesetzten seine zusammenfassende Analyse und einen eigenen operativen Vorschlag vorlegen mußte.
Nachrichtendienstliche Tätigkeit beim Sicherheitsdienst ist als Begriff fast ein Paradox und als Funktion eine Umschreibung dessen, wie ein Nachrichtendienst in den Tätigkeitsbereich des Sicherheitsdienstes eindringt. In diesem Fall jedoch war Carls Tätigkeit nach allen Regeln und Vorschriften des Dienstes berechtigt und sanktioniert.
Der Sicherheitsdienst, das heißt die Sicherheitsabteilung der Reichspolizeiführung, jammerte schon seit mehreren Jahren über die Fahrten sowjetischer Fernlaster im Land. Diese LKWs traten auf sehr rätselhafte Weise in Erscheinung, hielten sich unangenehm oft auf kleinen Nebenstraßen auf, weit weg von den großen Überlandstraßen, in einigen Fällen sogar in der Nähe hochgesicherter militärischer Anlagen, und die allgemeine Hypothese lief darauf hinaus, daß hier militärische Spionage betrieben werde. Und diese zu bekämpfen, so wurde argumentiert, sei Sache der Polizei.
Dieselbe Polizei hatte sich, von dem Gejammere in der Presse einmal abgesehen, jedoch nicht in der Lage gesehen, Fernlaster nach Belieben zu verfolgen. In dieser Hinsicht hatten sich sowohl knappe Haushaltsmittel als auch gewerkschaftliche Einwände gegen allzu viele Überstunden als entscheidend erwiesen. Vereinzelt, etwa bei Verkehrsunfällen, hatte die Polizei die Gelegenheit genutzt, einen der mit einem TIR-Schild versehenen Fernlaster zu öffnen, weil sie hoffte, beispielsweise funktechnische Anlagen zu finden. Es war jedoch nie gelungen, etwas Ungewöhnliches zu entdecken. Einigen ausländischen Quellen ließ sich entnehmen, daß man einige Fahrer auf frischer Tat ertappt hatte; sie hätten Brückenhöhen und ähnliches gemessen, was man im Zusammenhang mit Aufmarschplänen für Panzertruppen und motorisierte Infanterie sehen konnte. Jedoch fehlten Beweise jeder Art, und in einem demokratischen Land dürfen sogar Lastwagen mit der Aufschrift SOVTRANSAVTO in kyrillischer Schrift herumfahren, wo es ihnen beliebt.
Als EDV-Mann verstand sich Carl besser auf die Software, das heißt auf die Kunst, Programme zu entwickeln und Programme zu deuten, als auf die Hardware, die Geräte. So konnte er etwa seine Stereoanlage nur mit Mühe selbst reparieren.
Jedoch war es ihm relativ leicht gelungen, und zwar mit Hilfe von Zoll und Grenzpolizei, ein Programm zu erstellen, mit dessen Hilfe die sowjetischen Fernlaster ein Jahr lang beobachtet wurden, ihr Zeitplan, ihre verschiedenen Fahrer, ihr Gewicht bei Ein- und Ausreise und ihre ungefähren Fahrtrouten.
Die Schlußfolgerungen waren noch etwas unsicher und überdies wenig sensationell, da sie mit einer der üblichen Arbeitshypothesen übereinstimmten: Wie gewohnt mißtrauten die Russen offen zugänglichen Quellen. Wie gewohnt verwandten sie eine erstaunliche Mühe darauf, sich Informationen zu verschaffen, die sie in jeder normalen Buchhandlung hätten kaufen können, am leichtesten durch das Studium einer Straßenkarte des Königlichen Automobilklubs. Sie machten Belastungsproben, fuhren probeweise alternative Strecken ab, kontrollierten mit großem Einsatz sowohl die Telefonbücher wie die topografischen Karten des Generalstabs. Bei einem Vergleich – falls sie sich diese Mühe machten würden sie herausfinden, daß diese öffentlich zugänglichen Angaben mehr als ausreichend waren. Sogar die Flugplätze des Landes finden sich auf Karten, die man in jeder Buchhandlung erstehen kann.
Vermutlich hatte jeder Fahrer bei jeder Reise einen so begrenzten Aufgabenbereich, daß er für den Fall der Festnahme ohne schriftliche Notizen auskommen konnte, die nur unnötiges Aufsehen erregen würden. Auffallend war, daß etliche Fernlaster nach der Fahrt durch Schweden den Heimweg über die DDR wählten.
Wenn man etwa Fernlaster von der Sowjetunion in die DDR fahren lassen will, darf man davon ausgehen, daß das schwedische Straßennetz besser ist als das polnische. Der Umweg über die Nordroute jedoch ist in jeder Hinsicht unwirtschaftlich, und überdies treiben die Devisenkurse die Kosten für diesen Umweg in astronomische Höhen.
Carls Programm ergab die Tendenz, daß die Eindrücke einer halbjährigen Beobachtung sich bei fortgesetzter Ausspähung bestätigen würden. Damit ergab sich die entscheidende Frage, ob man mit Phase zwei beginnen sollte, was Carl empfahl.
Phase zwei bedeutete, daß einzelne Fernlaster bei ihrem ersten Grenzübertritt nach Schweden mit einem Funksender versehen werden sollten. Soweit gab es keine Probleme.
In technischer Hinsicht gab es jedoch zwei total verschiedene Möglichkeiten. Manche Funksignale lassen sich dazu verwenden, von verfolgenden Wagen und einigen vorherbestimmten Stationen aus die exakte Reiseroute diskret zu ermitteln. Ein anderer Typ von Funksender, der zwar sperriger war, jedoch ein Funksignal senden konnte, das sich nur wesentlich schwerer auffangen und deuten ließ, konnte an ein Satelliten-Überwachungssystem angeschlossen und so vom Weltraum aus überwacht werden. Das bedeutete aber, daß man die amerikanischen Kollegen um Amtshilfe bitten mußte. Und das war keine operative Frage, sondern eher eine diplomatische, möglicherweise sogar eine Regierungsangelegenheit.
Die zweite Variante bot eine interessante Möglichkeit. Mit einem an ein Satellitensystem angeschlossenen Sender konnte man die Fernlaster selbst auf sowjetischem Territorium weiterverfolgen. Immerhin machte es einen Unterschied, ob deren Endstation eine Obstzentrale in Leningrad war oder ein Panzerregiment auf der Halbinsel Kola.
Ein mögliches Verfahren, das Carl andeutete, sah so aus: In einem ersten Stadium die Sender zu entfernen, wenn der betreffende Fernlaster das Land verließ. Erst später würde man sich auf den Versuch einlassen können, die Lastwagen mit den versteckten Sendern in die Sowjetunion fahren zu lassen. Dieser zweite Vorschlag, so stand zu erwarten, würde bei den Amerikanern keine große Begeisterung erwecken. Immerhin bestand das Risiko, daß die so exportierten Sender nicht in den Westen zurückkehrten. In diesem Fall wären die Erkenntnisse teuer erkauft, vor allem dann, wenn die Arbeitshypothese – daß die Russen sich nämlich mit nichts anderem beschäftigten als der Kontrolle der Angaben in Telefonbüchern und in Straßenkarten des Königlichen Automobilclubs – sich als die undramatische Wahrheit erweisen sollte.
Wie auch immer: Eine Fortführung der Arbeit auf dem gegenwärtigen Programmniveau würde vermutlich keine weiteren Erkenntnisse ergeben als die, die man schon besaß.
Zwanzig Minuten vor Dienstschluß hatte Carl sein zusammenfassendes Memorandum von sieben Seiten fertiggestellt. Er legte hundert Blatt Daten-Analysen dazu, die seinem Chef rein gar nichts sagten.
Kapitän zur See Johan F:son Lallerstedt hatte einen großen Teil seines Berufslebens der Zusammenarbeit mit Nachrichtenleuten gewidmet. Das war jedoch meist auf See gewesen, wo er Halbzivilisten der militärischen Funkanstalt kreuz und quer über die Ostsee geschippert hatte. Er hatte nie mehr als vage Erkenntnisse davon gewonnen, wonach diese Techniker im sowjetischen Funkverkehr schnüffelten, und hatte sich ernsthaft auch nie darum gekümmert. Er hatte diese Leute als etwas durchgedrehte Akademiker angesehen, und für ihn waren sie eher Passagiere als Kollegen gewesen. Einmal war es auf See zu einem Zwischenfall gekommen: Er war Kommandant eines Funkspionageschiffs gewesen, das mit einem sowjetischen Minenleger kollidiert war. Die Kollision hatte dazu geführt, daß man ihn zu einem nicht genau definierten Bürojob innerhalb des OP 5 abkommandiert hatte, was sowohl er selbst als auch seine Kollegen zur See als Rüge oder vielmehr Strafe verstanden hatte. Obwohl völlig unklar war, welcher der beiden Kapitäne, der schwedische oder der sowjetische, die Kollision verschuldet hatte. Der Chef der Marine hatte als Grund für die Versetzung angegeben, Lallerstedt sei im Zusammenhang mit dem Zwischenfall in der Presse zu stark in Erscheinung getreten.
Die Voraussetzungen für einen munteren und ungezwungenen Umgang des Seebären Johan F:son Lallerstedt mit den jungen Technikern der Analyse- und künftigen Operationsabteilung des Nachrichtendienstes waren zunächst also nicht die besten gewesen. Er mochte keine Schreibtischmilitärs.
Und dem etwas zu höflichen und etwas zu kenntnisreichen Carl Hamilton gegenüber war er ebenso mißtrauisch gewesen, bis er Carls Hintergrund kennengelernt hatte. Und der stand jetzt vor ihm, dieser Mann, der eine breitere und dramatischere Kampferfahrung besaß als irgendein anderer schwedischer Soldat seit dem letzten Krieg gegen die Russen zu Anfang des 19.Jahrhunderts, und legte ihm die Schlußfolgerungen eines EDV-Programms dar. Hamilton hatte sich nicht einmal gesetzt; es wurde zwar nicht darüber gesprochen, doch es hatte sich so ergeben, daß in den inneren Büroräumen militärische Umgangsformen herrschten. Und obwohl keiner von ihnen eine Uniform trug, blieb für beide entscheidend, daß ein Kapitän zur See am Jackenärmel einen breiteren Goldrand hat als ein Korvettenkapitän. Mag der Korvettenkapitän auch mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und der Tapferkeitsmedaille Gustavs III. ausgezeichnet sein, so hat er doch zu stehen, wenn der Kapitän zur See sitzt, sogar beim Nachrichtendienst.
»Setz dich, Carl, entschuldige, ich habe nicht daran gedacht, setz dich doch«, sagte Kapitän zur See Johan F:son Lallerstedt.
Es war Carls letzter Vortrag für einige Zeit, da ihm eine Dienstreise nach Kalifornien bevorstand. 001 sollte sich 002 und 003 ansehen, um sich ein Bild davon zu beschaffen, wie deren Ausbildung fortschritt. Diese Bezeichnungen waren ein höchst scherzhafter, höchst persönlicher und höchst inoffizieller Einfall Johan F:son Lallerstedts. In Schweden gibt es keine Doppel-Nullen.
Beim schwedischen Nachrichtendienst gibt es keinen Agenten, dem man das Recht einräumt, andere Menschen zu töten. Das darf auf keinen Fall geschehen.
Es sei denn, es geschieht in Notwehr oder es liegt im Interesse der Nation.
Erland Rickfors, Schwedens Botschafter in Kairo, spazierte am Nil entlang. Er hatte seine Wohnung vor etwa zwanzig Minuten verlassen und ging gerade unter der Brücke des 26.Juli hindurch. Es war ein angenehmer Nachmittag, warm wie ein normaler schwedischer Sommertag mit einem für Kairoer Verhältnisse ungewöhnlich klaren Himmel Er erreichte die Gezira-Straße, blieb eine Weile mit dem Mantel über dem Arm stehen und sah auf den Fluß. Auf dem anderen Ufer erhob sich das große Fernsehgebäude. Der Verkehr war schwach, und an diesem Nachmittag spazierten Hunderttausende von Menschen wie er um die Insel Gezira herum. Es war Freitag, in Schweden ein Arbeitstag, aber hier ein arabischer Feiertag.
Er war sich nicht sicher, richtig zu handeln. Doch einerseits hatte er schon A gesagt, indem er um ein möglichst kurzfristiges Zusammentreffen gebeten hatte, obwohl es Freitag war. Zum anderen war es aus Formgründen durchaus in Ordnung, der diplomatischen Routine zu folgen. Sein Auftrag als Sendbote Schwedens bestand darin, Schwedens gute Beziehungen zu Ägypten aufrechtzuerhalten und möglichst zu verbessern, nicht hinter dem Rücken ägyptischer Behörden zu operieren und gar diplomatische Verwicklungen auszulösen.
Die verabredete Zeit war schon um fünf Minuten überschritten. Araber sind jedoch nie pünktlich. Rickfors ging auf das Marriott-Hotel zu, das schönste Hotel Kairos und vielleicht des ganzen Nahen Ostens.
Vor nicht allzulanger Zeit war das Gebäude noch ein verfallener Palast aus dem 19.Jahrhundert gewesen, für den irgendein Pascha so große Geldmittel aufgewendet hatte, daß die Wirtschaft des Landes stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Man konnte sich das gut vorstellen, wenn man das Ergebnis der Restaurierungsarbeiten für fünfzig Millionen Dollar in Gold, Rot und Grün ansah. Im Park zwischen dem alten Palast und den neuen Hotelbauten und dem Swimmingpool liegen mehrere Gartenrestaurants, deren Tische zwischen Palmen, Hecken und riesigen Rhododendronbüschen eingebettet sind. Ein ausgezeichneter, diskreter Treffpunkt. Hier kann an einem Freitagnachmittag jeder sitzen, auch ein Botschafter, und wie zufällig jeden X-Beliebigen treffen, auch einen Obersten des ägyptischen Sicherheitsdienstes.
Zu seiner Verblüffung mußte Erland Rickfors sehen, daß Oberst Muhammed ibn Salaar schon an Ort und Stelle saß und sogar Zeit gefunden hatte, zwei Tassen Kaffee zu trinken. Erland Rickfors erschien zum erstenmal später als der Ägypter zu einem solchen Treffen. Aus reiner Verblüffung entschuldigte er sich für sein spätes Erscheinen, was jedoch ziemlich überflüssig war, da es sich nur um zehn Minuten handelte. In Kairo gilt jede Verspätung unter einer halben Stunde als pünktliches Erscheinen. Der Oberst streckte die Arme zu einer weit ausholenden Geste aus, die etwa bedeuten sollte, Allah werde schon alles richten.
»Ich hoffe, es kommt Ihnen nicht allzu ungelegen, daß ich an einem Freitag um diese Zusammenkunft gebeten habe«, sagte der Botschafter, als er sich setzte und einen Tee mit Zitrone bestellte. Er hielt es für unpassend, jetzt etwas anderes zu trinken.
»Durchaus nicht, lieber Freund, ich bin für Sie da, und das wissen Sie«, erwiderte der zivil gekleidete Oberst ohne jedes Anzeichen von Neugier oder Eile. »Ein herrlicher Winter, finden Sie nicht auch? Im letzten Jahr hat es ja fast die ganze Zeit geregnet«, fuhr der Oberst nach britischer Manier fort. Obwohl die ägyptischen Militärs seit ein paar Generationen von den Russen ausgebildet werden, steckt noch immer viel britisches Verhalten im Offizierskorps, zumindest im Umgang mit Leuten aus dem Westen.
»Ja, ein so schöner Tag wie dieser ist etwa so wie ein schwedischer Sommertag«, setzte der Botschafter das britische small talk fort, entschloß sich aber dennoch, gleich zur Sache zu kommen. »Sie müssen entschuldigen, Oberst. Ich habe um dieses Treffen ersucht, weil ich ein delikates Problem am Hals habe.«
»Dagegen werden wir gewiß etwas unternehmen können. Das hört sich übrigens angenehm an, ein delikates schwedisches Problem. Sonst sind es ja meist Ihre französischen Kollegen, die sich derlei zuziehen«, erwiderte der Oberst lächelnd. Er hatte das Wort »delikat« klingen lassen, als ginge es um ein amouröses Abenteuer und nicht um eine politisch kitzlige Situation.
»In unserer Botschaft, also auf unserem Territorium, befindet sich ein sowjetischer Staatsbürger. Er hat um politisches Asyl nachgesucht, kann allerdings nicht in der Botschaft wohnen bleiben, wie Sie verstehen werden, und …«
Der Botschafter verstummte mitten im Satz, als er den blitzschnell veränderten Gesichtsausdruck des ägyptischen Sicherheitsmannes sah. Beide starrten sich kurz verblüfft an. Der Oberst hatte sich als erster wieder in der Gewalt.
»Dieses Problem ist offenkundig mehr als delikat, Herr Botschafter. Es geht also um einen bestimmten Admiral?«
»Ja, Vizeadmiral, um genau zu sein.«
Der Oberst blickte demonstrativ lange in seine Kaffeetasse, bevor er antwortete.
»Und wir glaubten, er befände sich in der amerikanischen Botschaft. Das hätte uns die Angelegenheit auf gewisse Weise leichter gemacht. Nun, Herr Botschafter, was genau sollen wir bei diesem Problem unternehmen? Was meinen Sie? Hat Ihre Regierung schon Stellung genommen?«
»Nein, ich erwarte erst in drei oder vier Tagen Anweisungen. Ich könnte mir aber vorstellen, daß sie ihn nach Stockholm bringen wollen. Hier kann er ja nicht bleiben?«
»Und Sie werden ihm Asyl gewähren?«
»Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus.«
»Und wenn unsere Regierung die Auslieferung des Mannes verlangt?«
»Dazu kann ich im Moment nicht Stellung nehmen. Warum sollte Ihre Regierung das übrigens wollen?«
»Weil die Russen über das, was geschehen ist, gelinde gesagt empört sind. Ich kenne die näheren Details nicht, aber sie betrachten den Vorfall als äußerst ernste Angelegenheit. Wir sitzen also in der Tinte, um einen englischen Ausdruck zu gebrauchen. Ich glaube jedenfalls, daß er englisch ist. Also, was werden Sie vorschlagen?«
Der Botschafter dachte nach. Die Sache hatte eine unerwartete Wendung genommen. Natürlich war es zu spät, diese Initiative zu bedauern, und im übrigen wäre es wohl ohnehin früher oder später nötig gewesen, die Ägypter zu verständigen. Bis auf weiteres war es wohl am klügsten, mehrere Möglichkeiten offen zu lassen.
»Für den Moment kann ich nichts Genaues vorschlagen«, begann der Botschafter zögernd. »Ganz allgemein jedoch ist unsere Gesetzgebung so, daß wir niemanden ausliefern, der etwa mit der Todesstrafe rechnen muß. Und in dieser Hinsicht ist hier wohl unzweifelhaft eine gewisse Gefahr gegeben. Sind Sie nicht meiner Meinung, Oberst?«
Seitdem das Gespräch ernst geworden war, ließ der Oberst zum erstenmal ein feines Lächeln sehen.
»Unzweifelhaft. Und wie soll der nächste Schritt aussehen?«
»Vorausgesetzt, daß die Regierung meines Landes dem Mann politisches Asyl gewährt, was vorauszusetzen ich bis auf weiteres für am klügsten halte, haben wir also ein gemeinsames Problem.«
»Ohne jeden Zweifel. Und?«
»Dann sollte es wohl sowohl im ägyptischen wie im schwedischen Interesse liegen, den Burschen vom ägyptischen Territorium zu entfernen. Teilen Sie diese Meinung?«
»Ja, das ist eine denkbare Schlußfolgerung. Und wie sollte das geschehen, wenn ich fragen darf?«
»Dazu habe ich noch nicht Stellung nehmen können. Ich gehe davon aus, daß wir Sie um Hilfe bitten werden.«
»Die kann ich im Augenblick nicht garantieren. Wir stehen genau zwischen Ihnen und den Russen, und wie ich schon sagte, machen die den Eindruck, äh, als sei ihnen an einer Lösung dringend gelegen.«
»Wenn wir Ihnen den Mann ausliefern und Sie ihn an die Russen weitergeben, landen wir in einer ziemlich peinlichen Situation, wenn die Sache herauskommt. In diesem Fall müssen wir uns auf Ihre Diskretion verlassen können.«
»Das ist eins der wenigen Dinge, die ich Ihnen schon jetzt zusagen kann. Aber wenn nicht, was passiert dann?«