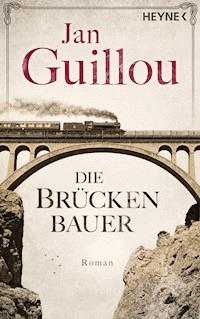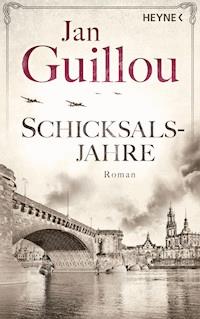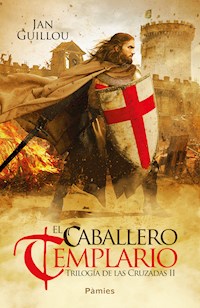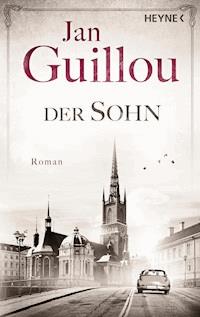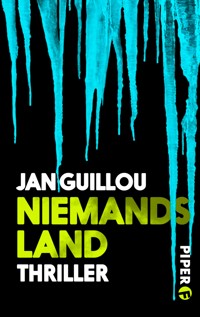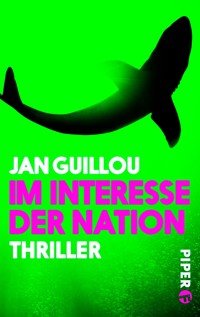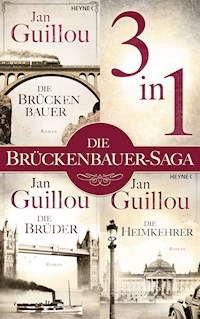4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die britische Polizei hat es mit einer bizarren Selbstmord-Serie zu tun: Die erste Tote ist eine junge Frau, deren Leiche in einem Teich gefunden wird. Aber wie soll sie es geschafft haben, sich erst zu erwürgen, dann zu knebeln und schließlich im flachen Wasser zu ertrinken? Dass sie und die folgenden Todesopfer in der Rüstungsindustrie gearbeitet haben, dürfte nicht ganz unerheblich sein. Der britische Geheimdienst bittet die Kollegen in Schweden um Mithilfe bei den Ermittlungen. Topagent Graf Hamilton alias »Coq Rouge« verfolgt die Spuren, die nach Moskau führen. Doch das Blatt wendet sich - und der aristokratische Superspion wird selbst zum Gejagten: Hamilton überlebt nur knapp eine Schießerei, doch dann werden seine Ex-Frau und seine kleine Tochter brutal ermordet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Übersetzung aus dem Schwedischen von Hans-Joachim Maass ISBN 978-3-492-98087-6 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 1994 Jan Guillou Titel der schwedischen Originalausgabe: »I hennes majestäts tjänst«, Norstedts Förlag, Stockholm 1994 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1998 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Burlingham / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 2. Auflage 2004
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
1
Samantha Arnold hatte sich erst selbst erdrosselt, sich anschließend die Hände auf dem Rücken gefesselt und in einem halben Meter Tiefe ertränkt. Die Polizei im Distrikt Thames Valley sah keinerlei Anlaß, ein Verbrechen zu vermuten.
Tatsächlich könnte man mit einem gewissen Maß an düsterer Ironie sechs Monate Polizeiarbeit so zusammenfassen. Mit dem Ergebnis, es liege ein Selbstmord vor, wenn auch ein Selbstmord, der einzigartige akrobatische Fähigkeiten voraussetzte, wurden die polizeilichen Ermittlungen im Fall Samantha Arnold beendet.
Dennoch würde in Anbetracht der konkreten Umstände des Todes von Samantha Arnold kein Polizeibeamter der Welt glauben, daß es sich um Selbstmord handelte.
Es war eine ältere Dame, Marjorie Warren, die bei ihrem Morgenspaziergang mit dem Hund die Leiche am Taplow Lake entdeckte. Die tote Frau lag etwa hundert Meter von der stark befahrenen Autobahn A 4 gut sichtbar da.
Marjorie Warren ging selbst ins Wasser und zog die Tote an Land. Es gab keinerlei Zweifel, daß es für Rettungsversuche zu spät war. Anschließend begab sich Mrs.Warren mit raschen Schritten zur Polizeistation an der A 4, meldete als gute britische Staatsbürgerin ihren Fund und hinterließ Namen und Adresse.
Die uniformierten Polizeibeamten, die als erste am Fundort erschienen, kamen sofort zu dem Schluß, daß es sich um Mord handelte. Sie sperrten die Umgebung ab und zogen die Kriminalpolizei hinzu.
Die Kriminalbeamten, die weniger als eine halbe Stunde später erschienen, zogen die gleichen Schlußfolgerungen. Die äußeren Umstände schienen eine sehr deutliche Sprache zu sprechen.
Die tote Samantha Arnold hatte einen Knebel im Mund. Um ihren Hals lag eine Schlinge. Ihre Beine waren mit einem Elektrokabel zusammengebunden, die Hände auf dem Rücken mit einem blauen Sprungseil gefesselt. Sie trug Blue Jeans, Hemd und Weste sowie hochhackige Schuhe.
Siebenunddreißig Meter vom Fundort entfernt stand ihr Wagen. Auch das Fahrzeug wies eine Reihe von Anzeichen auf, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Der Wagen war offensichtlich durchsucht worden. In einem Umkreis von fünf Metern lagen zahlreiche Papiere und Gegenstände verstreut. Einige Dinge fehlten jedoch, von denen die wichtigsten Samantha Arnolds Handtasche sowie die Autoschlüssel waren. Weder der erste noch der zweite Gang des Getriebes funktionierten, doch der Grund für diese Störung wurde nie ermittelt, oder, falls doch, wurden keine Ergebnisse dieser Ermittlung mitgeteilt.
Hingegen konnte mit großer Sicherheit rekonstruiert werden, was Samantha Arnold in den vorhergehenden Stunden getan hatte. Weniger als sechsunddreißig Stunden vor ihrem Tod hatte sie in einem Restaurant in Maidenhead mit ihrem Freund zu Abend gegessen. Dieser wurde natürlich umgehend sehr gründlich verhört – er hatte ein einwandfreies Alibi. Er hatte in London zu tun gehabt und gute Freunde besucht.
Bei dem Essen, bei dem sich die beiden jungen Leute zum letzten Mal trafen, sprachen sie von ihren Plänen für den bevorstehenden Urlaub, über Arbeit und Zukunft und anderes, was als vollkommen normal gelten muß. Anschließend hatten sie die Nacht bei ihm verbracht. Samantha war früh aufgestanden, was sie damit erklärte, daß sie versprochen habe, zu Hause den Rasen zu mähen.
Was sie auch tat. In dem Haus in Neville Close, das sie mit zwei Freundinnen teilte, galt ein rotierender Plan für bestimmte Gemeinschaftsarbeiten, und sie war an der Reihe gewesen, sich um den Rasen zu kümmern. Doch da das Kabel ihres elektrischen Rasenmähers schadhaft war, war sie zunächst zu dem drei Kilometer entfernten Haus ihrer Eltern gefahren und hatte sich dort von ihrem Vater ein neues Kabel geliehen.
Anschließend mähte sie den Rasen und verstaute einige schwarze Plastiksäcke mit Gras im Kofferraum ihres schwarzen Vauxhall Cavalier, warf das Rasenmäherkabel auf den Rücksitz und fuhr los. All dies wurde von ihrer Freundin Fiona Oyston beobachtet, die gerade im Obergeschoß saubermachte. Fiona Oyston sah den schwarzen Wagen starten und losfahren (ohne irgendeinen Fehler bei den ersten beiden Gängen zu bemerken), doch sie sah nicht, welche Richtung der Wagen einschlug. Sie ging davon aus, daß Samantha nach rechts fuhr, zum Haus ihrer Eltern.
Doch statt dessen mußte der Wagen nach links abgebogen und elf Kilometer bis zum Taplow Lake gefahren sein.
Ihr Vater sah Samantha nie mehr lebend wieder, nachdem er ihr das Rasenmäherkabel geliehen hatte. Samantha hätte nicht nur mit dem Kabel, sondern auch mit geschnittenem Gras, das sie immer auf den Komposthaufen der Eltern warf, zurückkommen sollen. Doch da keins dieser Vorhaben als besonders dringlich angesehen werden konnte, nahm der Vater an, daß irgend etwas dazwischengekommen war und Samantha offenbar die Unbequemlichkeit nicht auf sich nehmen wollte, die für den nächsten Tag geplante Reise nach Bournemouth damit zu beginnen, den Komposthaufen der Familie aufzusuchen.
Als Samanthas beschädigter Wagen an dem Ort aufgefunden wurde, den alle Polizisten der Welt als Tatort ansehen würden, fehlte das geschnittene Gras im Kofferraum. Die leeren Plastiksäcke lagen jedoch auf dem Beifahrersitz. Das Elektrokabel des Rasenmähers war um Samanthas Beine gewickelt. Unter dem Fahrersitz lag ein Geschenk, das eindeutig für ihren Freund gedacht gewesen war.
Insgesamt war es also selbstverständlich, daß die Thames Valley Police zunächst mit einer Mordtheorie arbeitete. Samanthas Angehörige und Freunde konnten sich ebenfalls nichts anderes vorstellen. Der Gedanke an Selbstmord kam erst nach einiger Zeit auf, und zwar bei der Polizei, nicht etwa bei Verwandten und Freunden der Toten.
Das erste Problem der Polizei war das Fehlen von Zeugen. Man machte einen LKW-Fahrer ausfindig, der ganz in der Nähe des schwarzen PKW über Nacht geparkt hatte. Der Mann erinnerte sich noch deutlich, daß eine Vordertür des Wagens offen gewesen war, doch, wie er erklärte, habe er sich nicht einmischen wollen, da der Ort, an dem der Wagen stand, offenbar so etwas wie eine romantische Anziehungskraft besaß. Es war üblich, daß junge Paare gerade hier hielten.
Als einige Zeit mit diffuser Polizeiarbeit ohne greifbaren Erfolg vergangen war, meldeten sich Samanthas Eltern bei der beliebten BBC-Sendung »Gesucht wird …« Dort reagierte man, wenn auch eher halbherzig, und brachte ein kurzes Feature, in dem die laufende Mordermittlung beschrieben wurde. Eventuelle Zeugen wurden gebeten, sich zu melden. Man zeigte auch ein Foto von Samantha Arnolds verschwundener Handtasche und dem Schlüsselbund mit dem Wagenschlüssel.
Der Fernsehsender erhielt kurz darauf einen interessanten Tip eines Mannes, der Samantha Arnold wiederzuerkennen behauptete. Er meinte, sich an Zeit und Ort zu erinnern sowie an einen elegant gekleideten Mann neben einem grünen BMW. Später stellte sich heraus, daß dieser Hinweis die Polizei entweder nicht erreicht hatte oder bei der Ermittlungsarbeit irgendwie verlorengegangen war.
Erst zwei Monate später konnte ein Kriminalreporter in einer lokalen Zeitung mitteilen, daß die Polizei jetzt dazu neige, von Selbstmord auszugehen. Der springende Punkt war dabei natürlich das Motiv, und der Reporter wußte »von einer hochgestellten Quelle bei der Polizei« zu berichten, daß Samantha an panischer Angst vor AIDS gelitten habe und daß diese Furcht offenbar zu schwermütigen Grübeleien geführt habe, die in Depressionen und Selbstmord geendet hätten.
Als ihre aufgebrachten Eltern und Freunde am folgenden Tag die örtliche Polizei belagerten, wurden die Spekulationen über Selbstmord mit allgemeinen Phrasen dementiert wie etwa »Sie wissen doch, wie Journalisten sind«.
Die Selbstmordtheorie gewann jedoch so sehr an Boden, daß sie am Ende zur Grundlage der Untersuchungen wurde.
Demzufolge war es Samantha Arnold also mit großem Erfolg gelungen, jede Neigung zu Grübeleien und Depressionen zu verbergen, selbst vor ihren Eltern, ihrem Freund und ihren Mitbewohnerinnen.
Ihren Selbstmord hatte sie schließlich so arrangiert, daß er sowohl für Polizisten wie für Laien wie ein Mord aussehen mußte. Sie muß diesem Vorhaben beträchtliche intellektuelle Mühen gewidmet haben – man beachte nur das verschwundene Gras sowie die leeren Plastiksäcke auf dem Vordersitz. Ganz zu schweigen von der nicht auffindbaren Handtasche, den verschwundenen Autoschlüsseln und dem schadhaften Getriebe. Ferner mußte sie dafür gesorgt haben, daß ihr Wagen so zugerichtet wurde, als wäre er in aller Hast durchsucht worden.
Die Wagenschlüssel mußte sie in nicht allzu großer Entfernung versteckt haben, denn der Wagen mußte schließlich dorthin gefahren worden sein, wo man ihn vorfand – das ganze Gelände wurde zu Beginn der Ermittlung durchsucht, als man noch von einem Mord ausging. Es wurden fünfzig Polizeibeamte mit Metalldetektoren eingesetzt – ohne Erfolg. Und dennoch waren dies noch die einfacheren Bestandteile von Samanthas Arrangements.
Möglicherweise kann man akzeptieren, daß sie sich einige blaue Flecken beibrachte, unter anderem an den Händen, blaue Flecken eines Typs, den man in der Sprache der Gerichtsmedizin Abwehrverletzungen nennt. Allerdings müßte man sich über die kriminologischen Kenntnisse der fünfundzwanzigjährigen Frau wundern: Woher sollte sie etwas von solchen Abwehrverletzungen gewußt haben?
Es ist auch kein Problem, sich selbst einen Knebel in den Mund zu stopfen. Man kann sich auch eine Schlinge um den Hals legen und sich damit Würgemale beibringen. Wenn man so weit gekommen ist, ist es auch keine Schwierigkeit, die eigenen Beine mit einem Stromkabel zu fesseln.
Dann wird es jedoch schwieriger. Erst danach sollte sie sich der Thames Valley Police zufolge mit einem Sprungseil die Hände auf dem Rücken gefesselt haben, um anschließend in dieser insgesamt äußerst seltsamen Ausstaffierung mit hohen Absätzen dreißig Meter zum Seeufer hinunterzuhüpfen und dann einen endgültigen, wenn auch sehr kurzen Sprung ins Wasser zu tun. Schließlich ertrank sie in fünfzig Zentimetern Tiefe.
Solche Schlußfolgerungen fordern natürlich jeden Kriminalreporter heraus. Und diese Reporter amüsierten sich königlich, unter anderem bei einer Pressekonferenz, bei der der Experte der örtlichen Polizei für Seemannsknoten et cetera behauptete, den Trick mit Selbstfesselung auf dem Rücken an sich ausprobiert zu haben; er verstummte jedoch, als ihm die höhnische Frage gestellt wurde, ob er das Experiment mit hochhackigen Schuhen durchgeführt habe, nachdem er sich erst die Beine mit einem Stromkabel zusammengebunden habe.
Der verantwortliche Gerichtsmediziner erregte mit seiner Erklärung, es sei durchaus üblich, daß Leute, die ins Wasser gehen wollten, sich einen Knebel in den Mund stopften, um nicht um Hilfe schreien zu können, eine gewisse Begeisterung; wieviel Hilfe braucht man in fünfzig Zentimeter Tiefe?
Was die Presse verstummen ließ, war entweder eine entsetzliche Wahrheit oder ein zynischer Trick.
Off the record ließ die Polizei durchsickern, welches Motiv dem Selbstmord angeblich wirklich zugrunde lag. Samantha Arnolds vermeintliche Phobie in Sachen AIDS sei in Wahrheit eine beschönigende Umschreibung. Tatsächlich aber sei sie tief verzweifelt gewesen, weil sie ihr Leben lang von ihrem Vater sexuell mißbraucht worden sei.
Es war nicht ratsam, diese Erklärung zu drucken. Erstens würde sie den Hinterbliebenen schaden. Zweitens würden solche Angaben bei Klagen gegen die englische Presse einen Schadensersatz von mindestens zweihunderttausend Pfund zum Ergebnis haben.
Die Presse verstummte, und der Fall Samantha Arnold geriet bis auf weiteres in Vergessenheit.
*
Carl war völlig verunsichert, als er sich dem achtjährigen Jungen auf der Anlegebrücke näherte. Er schlich weiter, als würde er sich einem Feind von hinten nähern. In ein paar Metern Entfernung blieb er unentschlossen stehen und betrachtete die Szene.
Eine schwedische Anlegebrücke bei schönem Mittsommerwetter, eine leichte Brise, von Zeit zu Zeit eine Kräuselung der Wasserfläche, das grüne Schilf, das sich weich im Wind neigte, um sich dann wieder raschelnd zu erheben.
Dort saß ein kleiner Junge und angelte. Der rotweiße Schwimmer hüpfte behäbig ein paar Meter draußen im Wasser, und auf der frisch geteerten Anlegebrücke lagen drei kleine Barsche mit Haut und Schuppen, die, nach Größe geordnet, schon in der Sonne trockneten.
Der Junge hatte dunkles, aber kein schwarzes Haar, etwa so, wie Carl es bei seinem eigenen neugeborenen Sohn in einigen Jahren erwartete.
Er mußte den Jungen auf seine Seite ziehen, das war ebenso zwingend wie der Befehl eines Oberbefehlshabers. Er mußte den Jungen dazu bringen, seine Einstellung zu ändern, denn bisher waren Mißtrauen, Furcht und entschiedene Abneigung das einzige, was er zeigte.
Stan war Tessies Sohn. Carl und Tessie verfolgten die Absicht, mit List, Güte sowie mit mehr oder weniger echter Liebe, je nachdem, von welcher Seite, den Jungen in einem Sorgerechtsstreit zurückzugewinnen. Bisher war alles nach Plan gelaufen. Das Gericht in Santa Barbara hatte ein weitgehend gemeinsames Sorgerecht verfügt, wie es hieß. Daraufhin war Stan per Gerichtsbeschluß dazu gezwungen worden, von Kalifornien nach Schweden zu fliegen, um in den Sommerferien seine Mutter zu treffen.
Zwei Tage lang war Carl jeder Versuch einer Annäherung mißlungen; der freundlichste Ausdruck, den der kleine Flegel für ihn fand, war »dieser Mann da«. Tessie hatte Carl beschuldigt, sich nicht genug Mühe zu geben, und er hatte erwidert, es sei erstens gar nicht so leicht, und zweitens wolle er nach dem Grundsatz »Eile mit Weile« verfahren. Das war ein Begriff, der Tessie unbekannt war.
Jetzt hatte er sich auch noch an den mißtrauischen Achtjährigen angeschlichen. Er stand wie festgefroren da; wenn er jetzt zurückschlich, um sich dem Jungen etwas lauter zu nähern, würde er sich lächerlich machen.
»Hast du nachgesehen, was der Wurm macht?« fragte er plötzlich.
»Himmel, verdammt, du kannst einem vielleicht Angst einjagen!« erwiderte der Junge, während er herumwirbelte. »Aber du bist wahrscheinlich so einer, der sich an Leute anschleicht«, fuhr er sauer fort und wandte sich erneut dem Schwimmer zu, den er jetzt mit einer alles verschlingenden Konzentration im Auge zu behalten schien. Carl stand eine Weile unentschlossen da.
»Gerade hier vor der Brücke ist es ziemlich tief. Wir haben den Grund nämlich ausgebaggert, damit ein Boot hier Platz hat. Wie wär’s, wenn du es ein wenig tiefer versuchst, näher am Seeboden?« fragte Carl mit angestrengter Freundlichkeit.
»Glaub ja nicht, daß du mir was über Fische beibringen kannst. Ich bin am Meer aufgewachsen«, erwiderte der Junge mürrisch.
»Das bin ich auch. Ich bin an schwedischen Gewässern aufgewachsen, genau dort, wo diese Fische wohnen. Glaub mir, die gehen ein bißchen tiefer, zumindest die großen«, sagte Carl lahm. Er fühlte sich völlig deplaziert.
Der Junge antwortete nicht, und Carl blieb schweigend hinter ihm stehen. Plötzlich schien der Junge sich anders zu besinnen und zog entschlossen den Köder aus dem Wasser. Er nahm die Schnur und schob den Schwimmer ein wenig höher, um Wurm und Haken tiefer sinken zu lassen.
»Warte!« sagte Carl, dem gerade eine Eingebung kam. »Dieser Wurm sieht nicht mehr sehr munter aus, und außerdem haben die Plötzen an beiden Enden schon was abgeknabbert.«
Er fing den Haken ein und streifte die Wurmreste ab. Dann kramte er aus der Kaffeedose, die er am Morgen selbst mit Erde und Regenwürmern gefüllt hatte, zwei Würmer hervor. Er riß einen Wurm in kleine Stücke, die er in einem kreisförmigen Muster von der Brücke ins Wasser warf, und befestigte schnell den zweiten Wurm am Haken.
»Jetzt wollen wir mal sehen«, sagte er mit übertrieben gespielter Erwartung und warf die Schnur aus.
»Warum hast du das gemacht?« fragte Stan neugierig.
»Ganz einfach, Kleiner«, erwiderte Carl, der mit Bedacht das englische Wort kid und nicht son gewählt hatte, »wir bringen den Barschen jetzt bei, daß Würmer etwas Leckeres sind. Überall da unten im Dunkeln sinken jetzt ungefährliche kleine Wurmstücke zu Boden. Stell es dir vor: Die Barsche naschen ein bißchen davon und entdecken, daß Würmer was Schönes sind, nicht wahr? Und dann beißen sie an und sitzen am Haken!«
Stan antwortete nicht, starrte aber mit sichtlich zunehmendem Interesse auf den Schwimmer.
So blieben sie eine Zeitlang sitzen und betrachteten den Schwimmer, der plötzlich mit einer schnellen Bewegung unterging. Der Junge schrie entzückt auf, riß intuitiv die alte Angelrute aus Bambus hoch und hatte den Fisch am Haken.
Einen Augenblick später lag ein Barsch zappelnd auf der Brücke. Er war dreimal so groß wie die anderen. Der Haken hatte sich tief ins Maul gebohrt.
Stan ergriff ihn mit beiden Händen, um ihn an der Brückenkante totzuschlagen, aber der glitschige Fisch rutschte ihm aus den Händen und verschwand wieder im Wasser, den Haken noch immer im Maul.
Als Stan die Rute erneut hochriß, ergriff Carl den an der etwas verhedderten Schur hängenden Barsch mit einer Hand. Dann stieß er dem Fisch den Daumen der anderen Hand schnell ins Maul und brach ihm mit einem Knacken das Genick. Vorsichtig zog er den Haken aus dem toten Fisch, legte die Wurmreste zur Seite und den Fisch neben die anderen Barsche. Dann griff er erneut nach der Dose mit den Regenwürmern.
»Himmel, den hast du aber schnell getötet«, keuchte Stan.
»Es ist wichtig, daß man sie schnell tötet«, erwiderte Carl ohne nachzudenken. Dann ging ihm auf, was er gerade gesagt hatte, und er beschloß, einige mildernde Worte hinterherzuschicken.
»Also, wenn wir uns schon das Recht nehmen, diesen Fisch zu töten, müssen wir zumindest dafür sorgen, daß er möglichst wenig leidet«, fuhr er verlegen fort, als er einen neuen Regenwurm auf den Haken streifte und die Reste des alten Wurms im selben Muster wie zuvor ins Wasser warf.
Fast augenblicklich biß wieder ein Fisch an, ein Barsch von der gleichen Größe wie der letzte. Diesmal wollte Stan ganz genau sehen, was Carl tat, um dem Fisch das Genick zu brechen. Dann saßen sie erneut gespannt und schweigend auf der Brücke und betrachteten den Schwimmer. Doch diesmal dauerte es.
»Glaubst du, sie sind inzwischen mißtrauisch geworden?« fragte Stan mit einem Anflug von Enttäuschung in der Stimme.
»Nix da, so schlau sind Fische nicht, aber sie kommen und gehen. Nur Geduld, dann kriegen wir wieder einen«, sagte Carl mit einem zufriedenen Zwinkern; er hatte das Gefühl, als würde jetzt auch bei ihm bald jemand anbeißen.
»Hast du das da, seitdem du unsere Hunde getötet hast?« fragte Stan nach einer Weile und zeigte mit einem Kopfnicken auf das Gewirr von weißen Narben auf Carls nacktem Unterarm.
»Mmh«, bestätigte Carl vorsichtig. »Tut mir leid, aber damals hatte ich kaum eine Wahl.«
»Ach was, scheiß auf die Hunde!« erwiderte Stan schnell. Carl mußte über den groben amerikanischen Ausdruck lächeln. »Ich hatte sowieso nicht viel für die Köter übrig. Aber hast du nicht Schiß gehabt? Diese verdammten Hunde jagen sonst allen Leuten eine Wahnsinnsangst ein.«
»Achte ein bißchen auf deine Sprache, junger Mann«, sagte Carl mit einem mühsam unterdrückten Lächeln. »Nein, man hat gar keine Zeit, vor solchen Hunden Angst zu haben. Wenn man Angst hat, erledigen sie einen. Hast du danach neue Hunde bekommen?«
Der Schwimmer tauchte erneut unter, und Carl hatte das Gefühl, als hätte ihn dieser neue Barsch gerettet wie der Gong einen angeschlagenen Boxer. Dies war mit Sicherheit eins der Themen, das er sich bei Gesprächen mit dem Jungen am wenigsten wünschte. Stan brach dem Barsch nach einigem Zögern selbst das Genick und streifte einen neuen Regenwurm auf den Haken.
»Papa sagt, du bist ein Mörder«, sagte Stan dann, als hätte er die ganze Zeit vorgehabt, auf diese Bemerkung hinzusteuern. Er sagte es mit abgewandtem Gesicht.
»Das ist eine ungerechte Beschreibung«, erwiderte Carl langsam und vorsichtig, während er verzweifelt überlegte, wie er fortfahren sollte: Sollte er alles als Bagatelle abtun und ein paar begütigende Worte sagen oder gestehen und alles romantisch verklären?
»Ich bin Marineoffizier. Ich habe in der schwedischen Marine einen Job gehabt, bei dem es dazugehört, daß man gegen die bösen Jungs kämpft. Man könnte sagen, daß ich etwas Glück gehabt habe, denn die bösen Jungs haben verloren, während ich gewonnen habe.«
»Und dann hast du ihnen den Hals durchgeschnitten!« erwiderte der Junge schnell mit fast eifrigem Tonfall und brachte Carl damit erneut aus dem Gleichgewicht.
»Nun ja …«, sagte er zögernd. »Gerade diese Methode ist wohl nicht so üblich, wie manche Leute glauben. Fußtritte und solche Dinge, die du in Filmen siehst, sind eher die Ausnahme. Wenn jemand ankommt und tritt und zappelt so wie diese Pyjamaringer, ist es doch praktischer, eine funktionierende Waffe in der Hand zu haben.«
»Das ist aber nicht fair!« wandte der Junge beinahe entrüstet ein.
»Wie wahr, wie wahr«, gab Carl zu. »Aber wir sprechen von Kriegshandlungen und nicht von Sport. Im Krieg gibt es nur die Regel, daß wir die Guten sind und gegen die anderen kämpfen, die Bösen. Es ist unser Job zu gewinnen, ihrer übrigens auch, und andere Regeln gibt es im Krieg nicht.«
Der Junge verstummte und wandte seine Konzentration wieder dem rotweißen Korkschwimmer zu. Carl grübelte darüber nach, was Stans Vater seinem Sohn wohl über die schlechten Eigenschaften des anderen Mannes eingetrichtert hatte. Meuchelmörder, Spion und weiß der Himmel was sonst noch.
Er beschloß, dem Thema nicht auszuweichen. Stan war immerhin ein achtjähriger Amerikaner, der im Kino und im Fernsehen inzwischen mehr als fünfundzwanzigtausend Morde gesehen haben mußte; natürlich wußte er nicht, ob der Junge in seiner Phantasie zwischen der Fernsehwelt und der Wirklichkeit unterscheiden konnte. Doch es war sicher ein Gesprächsthema, das ihn faszinierte. Inzwischen hatte wieder ein Fisch angebissen. Die anschließende Prozedur, den Barsch vom Haken zu nehmen, ihm das Genick zu brechen und einen neuen Wurm auf den Haken zu streifen, gab Carl Zeit, sich zu entschließen, wie er die Unterhaltung fortführen sollte.
Doch als der Schwimmer wieder auf dem Wasser hüpfte, schlug Stan unerwartet eine ganz andere Richtung ein.
»Papa sagt, daß du auch Kommunist bist«, sagte er mit einem Tonfall, der um ein Dementi zu bitten schien.
Carl reagierte mit einer Gegenfrage. »Weißt du, was die SEALS der Navy sind?«
»Aber klar! Special Warfare Center auf Coronado in San Diego, das weiß doch jeder Idiot«, erwiderte Stan entrüstet, als wäre es eine absurde Vorstellung, daß ein normaler achtjähriger Amerikaner die militärischen Eliteeinheiten der Nation nicht kannte.
»Na schön«, sagte Carl und lächelte über den Eifer des Jungen. »Ich bin ein SEAL. Åke, der große Blonde, der gerade zu Besuch ist, ist auch einer. Du glaubst doch wohl nicht, daß die amerikanische Marine irgendwelche verdammten Kommunisten bei den SEALS der Navy zulassen würde?«
Der Junge sah ihn zunächst fragend und forschend an, doch dann sprudelte er begeistert los.
»Wow!« rief er aus. »Stimmt es wirklich? Bist du ein echter SEAL?«
»Aber ja, so echt, wie man nur sein kann«, lächelte Carl zufrieden und richtete einen gespielten, weichen, freundschaftlichen Schlag gegen das Gesicht des Jungen.
»Jesses! Du kannst also sozusagen hier ins Wasser tauchen und richtig verschwinden?«
»Aber ja«, sagte Carl. »Ich verschwinde hier im Wasser, du siehst nicht, wo ich bleibe, und entdeckst mich erst, wenn ich dich fünf oder zehn Minuten später berühre. Kinderleicht. Wie ein Spaziergang im Park.«
»Wollen wir um einen Dollar wetten?« sagte der Junge verschmitzt.
»Okay, um einen Dollar, abgemacht«, erwiderte Carl und stand auf. Er zog die Brieftasche aus der Gesäßtasche, reichte sie dem Jungen und stürzte sich ins Wasser. An der Anlegebrücke war das Wasser drei Meter tief. Der Mälarsee war an dieser Stelle um diese Jahreszeit so voller Algen, daß Carl nicht zu sehen war. Der Lichteinfall von der Oberfläche machte es ihm trotzdem leicht, sich zu orientieren. Er schwamm zunächst so nahe am Grund wie möglich vom Ufer weg und verschwand zwischen den langen Fäden der Wasserpest. Carl spürte plötzlich ein Glücksgefühl, als er mit ruhigen Zügen durch das kühle Wasser schwamm. Die Kleidung und die Turnschuhe bremsten seine Bewegungen, doch wenn er ökonomisch schwamm, würde er sich mindestens fünfzig Meter entfernen können, bevor er den Schilfgürtel erreichte. Der letzte Teil war schwierig: Er mußte ins Schilf hineinkommen, ohne es in eine Bewegung zu versetzen, die man an der Wasseroberfläche sehen konnte. Er zog sich langsam voran; seine Lungen drohten zu zerplatzen, und der Körper meldete den Sauerstoffmangel. Er zwang sich trotzdem noch mehrere Meter weiter, bevor er vorsichtig zwischen den Schilfhalmen auftauchte. Dann bog er sie langsam zur Seite und spähte hindurch. Er sah, wie Stan aufstand und intensiv aufs Wasser spähte.
Carl kroch langsam an Land und zog im Schutz des Schilfs seine Kleider aus. Mit den Kleidern in der Hand schlich er in einem weiten Halbkreis, bis er nahe der Brücke hinter einem dicken Ulmenstamm gleich neben dem Pfad zum Haus stehenblieb. Jetzt blieb noch der schwierigste Teil. Sollte er die Wette gewinnen oder nicht? Was würde dem Jungen am besten gefallen: Wenn er einen Dollar damit gewann, daß Carl den Versuch machte, sich draußen auf der Anlegebrücke von hinten anzuschleichen, um dann in ein paar Meter Entfernung entdeckt zu werden? Oder wenn Carl wartete, bis der Junge es nicht mehr aushielt und am Baum vorbei zum Haus lief, um die anderen zu alarmieren?
Die Entscheidung fiel Carl nicht leicht. Es war verführerisch zu warten, bis der Junge in Panik geriet und die Wette verlor. Darin läge so etwas wie Wahrheit. Es wäre pädagogisch richtig. Carl würde erklären können, daß es in Wirklichkeit genau so funktionierte.
Doch was hatte die Wirklichkeit mit dieser Wette zu tun? Für ihn ging es darum, Stan für sich einzunehmen, und nicht darum, ihn mit maximalem Einsatz zu besiegen. Es war besser, die Wette knapp zu verlieren, als sie mit, dem Einsatz seiner überlegenen Kräfte zu gewinnen.
Als der Junge sich auf den Bauch legte, um ins Wasser zu spähen, nahm Carl die Chance wahr und ging schnell weiter, und zwar neben dem Kiesweg, auf dem seine Schritte zu hören gewesen wären. So konnte er den Fuß auf die von der Sonne erwärmte Holzbrücke setzen, bevor der Junge sich gerührt oder seine Stellung verändert hatte.
Jetzt durfte er nicht allzu schnell weitergehen, damit die Vibrationen seiner Schritte ihn nicht verrieten. Doch als er langsam weiterschlich, spielte er gegen die Zeit. Der Junge würde bald ungeduldig werden und die Körperhaltung ändern.
Carl hatte noch einen Meter vor sich, als Stan sich leicht drehte, aus dem Augenwinkel etwas entdeckte und zusammenzuckte, erst ängstlich, dann triumphierend.
»Ha! Ich hab dich erwischt! Du hast noch einen Meter übrig, ich hab gewonnen!« sagte Stan lachend.
»In Ordnung«, sagte Carl und ließ seine nassen Kleider mit einer übertrieben resignierten Geste auf die Brücke fallen. Er breitete die Arme aus. »Ich werde wohl allmählich alt. Die Kräfte lassen nach«, sagte er mit einem Lächeln und setzte sich auf die Brückenkante. Er bekam seine Brieftasche wieder und entnahm ihr einen Zwanzig-Kronen-Schein, den er dem Jungen reichte. Stan küßte ihn triumphierend und stopfte ihn in die Hosentasche.
»Obwohl wir natürlich am besten darauf trainiert sind, so was im Dunkeln zu machen«, sagte Carl nach einiger Zeit mit einem gespielt nachdenklichen Gesichtsausdruck.
»Wow! Im Dunkeln«, bemerkte Stan sichtlich beeindruckt. »Aber erzähl doch, wo bist du abgeblieben? Ich dachte fast schon, du wärst ertrunken, und eine Zeitlang glaubte ich … ach was, ich weiß nicht mehr, was ich glaubte. Aber wie hast du es gemacht?«
Carl berichtete pflichtschuldigst und exakt, was er getan hatte. Er zeigte die Richtung, in die er geschwommen war, und die weit entfernte Stelle, an der er das Schilf erreicht hatte, und erklärte dann, wie er an Land einen weiten Bogen geschlagen hatte, um nicht gesehen zu werden.
Stan wollte natürlich alles über die Einheiten für spezialisierte Kriegführung erfahren, wie die offizielle Bezeichnung für SEAL bei der amerikanischen Marine lautete. Und Carl war nicht gerade unwillig, es zu erzählen.
Sie zogen noch zwei weitere Barsche aus dem Wasser und beschlossen, daß sie für heute genug geangelt hätten. Carl würde die Fische putzen und versprach, zum Essen eine Vorspeise daraus zu machen.
Auf dem Weg zum Haus fragte Stan, ob Carl einen Film mit dem Titel Lethal Weapon gesehen habe. Dieser gab lachend und scheinbar beschämt zu, daß ihm dieser einzigartige Film leider entgangen sei. Stan zufolge war die Hauptperson in diesem Film ein Mann, der teuflisch gut mit einer Baretta-Pistole schießen könne – Carl korrigierte, es heiße Beretta, und erwähnte gleichsam nebenbei, daß dies eine seiner Dienstwaffen sei. Stans Frage, ob er genauso gut schieße wie Mel Gibson, mußte Carl unbeantwortet lassen.
Stan beschrieb eifrig, wie Mel Gibson, also der Polizist, den Mel Gibson darstelle, in eine Schießscheibe in schneller Folge die Form eines grinsenden Gesichts geschossen hatte. Carl brummte, in der ganzen Welt gebe es keinen Menschen, der das in Wirklichkeit könne. Die unvermeidliche Frage folgte natürlich, bevor sie das Haus erreicht hatten.
»Bitte, kannst du mir nicht zeigen, wie man mit einer richtigen Pistole schießt?«
Bei Carl meldeten sich verschiedene Alarmglocken gleichzeitig. Doch als er in die dunklen, bittenden Augen des Jungen blickte, wurde er weich. Außerdem würde es ihm dabei helfen, den Jungen auf seine Seite zu ziehen.
»Na schön, mein Junge, ich werd’s dir zeigen. Zumindest kann ich dir die Anfangskenntnisse vermitteln«, sagte Carl schließlich. Er schob den Jungen vor sich her zum Kellereingang auf der Rückseite des Hauses.
Sie stellten die Angelrute neben der Kellertür ab und legten die Fische auf den kühlen Steinfußboden. Dann führte Carl den Jungen durch die Dunkelheit zu der großen Stahltür mit dem Zahlen-schloß, gab die Kombination ein, schob den Jungen hinein, folgte ihm und zog die Tür hinter sich zu, ohne sie zu verschließen. Er wartete einige Sekunden in der totalen Dunkelheit und lauschte dem heftigen Atem des Jungen. Dann machte er das Licht an.
Die Neonleuchten flimmerten und knackten, als eine Reihe nach der anderen anging, bis der Schießstand von grellem Licht erhellt wurde. Am anderen Ende des Raums befanden sich vier gängige Militärziele, Viertelgestalten mit Kopf und Helm. Zwei große Waffenschränke standen an der Wand. Die dunklen Augen des Jungen waren fast so groß wie Untertassen.
Während Carl einen der Schränke öffnete, begann er mit seiner Instruktion. Am wichtigsten sei die Konzentration auf das, was man vorhabe. Bis auf das Zielen selbst müsse man alles ausschalten können. Außerdem komme es auf das weiche Abdrücken an. Die meisten Menschen brauchten viele Jahre, um das zu lernen, obwohl sich im Grunde jeder für das Schießen eigne. Wer am meisten trainiere, werde auch am besten.
Carl nahm zwei Pistolen aus dem Schrank, eine kleinkalibrige französische Wettkampfpistole, die er nur zu Übungszwecken brauchte, und seine großkalibrige Beretta. Er kontrollierte, daß die Waffen ungeladen waren. Er gab sie dem Jungen, der sie befühlte und einige Male blind abfeuerte. Dann lud Carl die kleinkalibrige Pistole und schoß eine langsame Serie auf das größte Ziel, wobei er beschrieb, was er tat.
Sie gingen hinunter und betrachteten das Ergebnis. »Du kannst dich begraben lassen, Mel Gibson!« sagte Stan beeindruckt. Dann klebten sie die Einschußlöcher an der Schießscheibe zu.
Carl lud die kleinkalibrige Pistole erneut mit fünf Schuß und ging mit dem Jungen den Gang entlang, bis sie sieben oder acht Meter von der Schießscheibe entfernt waren. Er stellte sich hinter seinen Schüler, drückte ihm die Waffe in die Hand, korrigierte die Schußposition und erteilte dann einen kurzen militärischen Befehl:
»Fünf Schuß auf das rechte Ziel. Feuer!«
Die Schüsse der Serie erfolgten zu schnell und waren weit gestreut. Carl ging mit dem Jungen zur Schießscheibe und wies auf die Treffer. Er erklärte, weshalb sie zu niedrig gelandet seien, weshalb beispielsweise tief links sieben Uhr ein schnelles und ruckhaftes Abdrücken bedeute.
Sie wiederholten den Versuch mit einem etwas besseren Ergebnis. Nach mehreren weiteren Versuchen einigten sie sich darauf, daß Stan mit der »richtigen« Pistole schießen dürfe, wenn es ihm gelinge, alle fünf Schuß ins Ziel zu bringen.
Carl hatte geglaubt, damit eine risikofreie Zusage zu geben. Doch der Junge gab sich ganz besondere Mühe. Beim zehnten Versuch brachte er alle fünf Schuß in dem Kreis unter, der zu treffen war.
Das Spiel hatte eine unangenehme Wendung genommen. Carl konnte sich nicht recht erklären, weshalb er es so empfand. Aber versprochen ist versprochen, und so lud er seine Beretta, beschrieb kurz ihren Rückstoß und schoß eine schnelle Serie, um zu zeigen, wie man es machte. Bei dieser kurzen Entfernung konnte er der Versuchung nicht widerstehen, ein grinsendes Gesicht zu schießen. Sie verklebten die Schießscheibe, und Carl lud erneut. Er stellte sich hinter den Jungen, bevor er ihm die Waffe reichte. Es folgten die letzten Ermahnungen, Stan solle langsam schießen und weich abdrücken. Wie erwartet machte der erste Rückstoß dem Jungen angst. Carl beruhigte ihn und zeigte, wie Stan die Waffe mit beiden Händen greifen könne, wie er sich etwas breitbeiniger hinstellen und den Lauf direkt aufs Ziel richten solle. Der Junge erklärte, in Kinofilmen schössen sie auch immer mit beiden Händen.
In dieser Stellung fand sie die Mutter des Jungen. Sie hatte gedämpfte Geräusche aus dem Keller gehört und Unheil gewittert. Und jetzt sah sie ihren Sohn mit einer der schauerlichen Mordwaffen Carls in den Händen. Sie schrie auf, doch die beiden hörten sie nicht. Dann dröhnte ein Schuß und noch einer. Carl gab dem Jungen freundliche Anweisungen und schien ihm noch einmal den richtigen Griff zu zeigen, bevor erneut geschossen wurde.
Als sie fertig waren und zu den Schießscheiben gingen, entdeckte Carl Tessie hinten an der Tür. Er erkannte an ihren Augen und ihrer Körperhaltung sofort, was sie dachte und empfand.
»Okay, mein Junge, ich glaube, für heute ist es genug«, seufzte er und nickte Tessie über die Schulter hinweg zu.
Stan lief ihr entgegen. Seine Wangen glühten vor Eifer.
»Mami, Mami, ich habe auch mit der richtigen Pistole getroffen. Außerdem haben wir fünf große Barsche geangelt, die wir nachher essen«, zwitscherte er.
Tessie umarmte ihn und blickte über die Schultern ihres Sohnes hinweg dunkel auf Carl.
»Mm, Liebling, wir sollten vielleicht anfangen, ans Essen zu denken«, sagte sie tonlos, nahm ihren Sohn bei der Hand und führte ihn hinaus, während er wieder lossprudelte und von seinem überwältigenden Erlebnis zu erzählen begann.
Carl blieb mit seiner Beretta in der Hand allein zurück. Er verstand sehr wohl, was Tessie fühlte, er verstand es nur zu gut. Vielleicht sollte er sich schämen, vielleicht sollte er sie um Entschuldigung bitten und versprechen, so etwas nie mehr zu tun, und so weiter. Doch andererseits hatte sie ihm einen klaren Auftrag gegeben: mit im großen und ganzen allen zu Gebote stehenden Mitteln Feindseligkeit und Mißtrauen ihres Sohnes zu brechen.
Auftrag befehlsgemäß ausgeführt, dachte er und ging zum Waffenschrank zurück Er schloß die beiden Pistolen und die Ohrenschützer ein, machte das Licht aus und holte die Barsche, bevor er auf der Innentreppe zur Küche hinaufging.
Auf dem Weg nach oben hängte er seine nassen Kleider auf und schlich fast beschämt ins Obergeschoß, um sich ein paar trockene Sachen anzuziehen, bevor er mit den Barschen in die Küche ging; aus reiner Zerstreutheit hatte er sie mit ins Schlafzimmer genommen.
Er mußte im Erdgeschoß eine Zeitlang suchen, bevor er Tessie und Stan in dem großen Wohnzimmer fand. Sie waren in eine leise, aber heftige Diskussion vertieft. Sie verstummten und blickten zu ihm hoch, als er eintrat.
»Okay, Mel Gibson, höchste Zeit, deine Barsche zu filieren«, sagte er so unbeschwert wie möglich und wedelte mit den Fischen.
Stan machte sich vorsichtig von seiner Mutter frei und ging ihm langsam und mit gesenktem Blick entgegen, ohne etwas zu sagen. Carl legte dem Jungen einen Arm um die Schultern und drehte ihn in Richtung Küche, während er zu Tessie gleichzeitig eine Grimasse schnitt, die bedeutete: Was zum Teufel hätte ich denn tun sollen. Sie quittierte das nur mit einer ruckhaften Kopfbewegung und blickte demonstrativ zur Seite.
»Mami fand es nicht gerade die allerbeste Idee, so mit einer echten Pistole zu schießen«, brummte Stan, als Carl die Barsche auf den Küchentresen knallte und ein geeignetes Messer aus einer Schublade zog.
»Na ja, du kennst doch Mütter«, erwiderte er neutral und unergründlich. Doch dann ging ihm auf, daß er ein paar Worte mehr dazu sagen mußte.
»Stan, deine Mutter liebt dich, nur darum geht es. Mütter mögen Schußwaffen nicht, weil die gefährlich sind, und damit haben Mütter auch verdammt recht.«
»Ja, aber das ist gerade der Spaß«, knurrte Stan übellaunig. »Und außerdem ist es doch nicht so gefährlich, wenn man einen Profi bei sich hat.«
»Jetzt wollen wir nicht logisch sein, Stan. Bei fast allen Menschen, die nicht beruflich mit Waffen umgehen müssen, geht es bei Waffen um Gefühle. So, jetzt laß mal sehen! Hier, so macht man das! Du legst den Fisch platt hin, dann mit dem Messer am Rücken entlang, so!«
Nachdem er Stan eine Zeitlang darin unterwiesen hatte, wie man einen Barsch putzt, kam ihm plötzlich der Gedanke, daß Tessie auf die Messerklinge vielleicht genauso reagieren würde wie auf die Pistole. Ein Messer läßt sich als Mordwerkzeug ebensogut einsetzen wie als Küchenwerkzeug, so wie eine Pistole ein kriminelles Werkzeug sein kann, ein militärisches Ausrüstungsstück oder ein Sportgerät. Außerdem stimmte es ja, daß er Menschen schon den Hals durchschnitten hatte, aber es stimmte auch, daß es nicht jeden Tag vorkam.
Sie aßen draußen auf der Terrasse mit Aussicht auf den See und das Hirschgehege. Åke Stålhandske und Anna waren mehr als zwei Stunden mit ihrem Kinderwagen im Gehege spazierengegangen. Anna erzählte, immer wieder durch Gelächter unterbrochen, von den Mühen ihres Mannes, den Kinderwagen über Stock und Stein zu ziehen. Einmal habe er es sich nicht verkneifen können, sich den Kinderwagen mit Tochter unter den Arm zu klemmen, als wäre er nichts weiter als eine Aktentasche.
Die Neugeborenen schliefen im Obergeschoß in ihren Kinderwagen-Einsätzen. Die Fenster waren geöffnet, damit unten zu hören war, wenn sie aufwachten. Die Gesellschaft verbrachte lange Zeit mit einem munteren ironischen Bericht darüber, wie man sich schließlich auf die Namen der Kinder geeinigt hatte.
Åkes und Annas Tochter hieß Lis Erika, obwohl Åke sich Liisa Erika gewünscht hatte, was trotz seiner sentimentalen Hinweise auf seine finnische Herkunft daran gescheitert war, daß der Name in Schweden immer falsch geschrieben werden würde.
Bei Tessies und Carls Sohn verhielt es sich ähnlich; sie hatten diskutiert, welche Namen in verschiedenen Ländern möglich waren und auf spanisch, englisch oder schwedisch ausgesprochen werden konnten, und waren am Ende zu dem Kompromiß Ian Carlos gelangt. Ian war in Schweden einer der Hamiltonschen Vornamen und würde auch gut nach Kalifornien passen, wenn sie erst mal dorthin gezogen waren. Der Name Carlos drückte Tessies mexikanische Herkunft aus.
Carl hatte die in Butter gebratenen Barschfilets als Zwischengang eingeschoben, um seine Essenskomposition nicht zu stören, die mit frischer Entenleber und einem unaufdringlichen Gewürztraminer, einer Spätlese, begonnen hatte. Anschließend wurden die Barschfilets unter lautem Lob, wie gut Stan sie geangelt habe, vertilgt. Sie wurden mit einem trockenen Muscadet heruntergespült, um nach dem leicht süßen Beginn eine Unterbrechung zu schaffen, bevor sie zu dem gedünsteten Lachs und dem weißen Burgunder übergingen.
Inmitten der vollkommenen schwedischen Sommerdämmerung und der guten Laune der Tischgesellschaft läutete das Telefon. Carl und Åke wechselten einen schnellen besorgten Blick, weil der Apparat ohne Anrufbeantworter, über den nur spezielle Gespräche einlaufen konnten, geläutet hatte.
Bei Tisch gab es so etwas wie einen schnellen Wetterumschwung, als Carl mit düsterem Blick aufstand, um ins Haus zu gehen und im großen Wohnzimmer abzunehmen. Während er eine kurze leise Unterhaltung führte, erstarb das Gespräch am Tisch. Als er wiederkam, blickten ihn vier fragende und unruhige Gesichter in Erwartung einer Nachricht an; auch Stan hatte an der Reaktion der anderen gemerkt, daß dieser Anruf den Rest des Abends ruinieren könnte.
Carl trat an den Tisch und umfaßte seine Stuhllehne, als wollte er sich sammeln, bevor er etwas sagte. Niemand am Tisch bewegte sich.
»Nun«, begann er sehr ernst. »Das war der Ministerpräsident. Er bittet übrigens um Entschuldigung für die Störung unseres netten kleinen Essens.«
Carl überlegte, wie er fortfahren sollte. Doch dann wandte er sich an Stan und zeigte ein schiefes kleines Lächeln.
»Der Ministerpräsident hat mir mitgeteilt, daß der Präsident der Vereinigten Staaten soeben angerufen hat, um zu sagen, daß man mir das Navy Cross zuerkannt hat. Einige der Anwesenden werden übermorgen in der Botschaft der USA erwartet, wo eine kleine Zeremonie stattfinden wird.«
Carl zuckte die Schultern und wollte sich gerade wieder setzen, als er zufällig den Gesichtsausdruck des Jungen bemerkte. Natürlich, es war undenkbar, daß ein achtjähriger Amerikaner nicht wußte, was das Navy Cross bedeutet.
Carl richtete sich auf und sah Stan in die Augen. »Well, junger Mann«, begann er mit gespielter Strenge. »Ich kann verstehen, daß du unter dem Coca-Cola-Verbot bei diesem Essen gelitten hast. Aber«, fuhr er in scherzhaftem Ton fort, »das hier muß natürlich gefeiert werden, und wenn du bisher noch keinen Champagner getrunken hast, ist jetzt eine gute Gelegenheit dazu!«
»Mit oder ohne Erlaubnis deiner Mutter«, fügte er hinzu und zwinkerte dem Jungen zu. Dann drehte er sich um und ging mit schnellen Schritten in Richtung Weinkeller.
*
SELBSTMORD MIT INDISCHEM SEILTRICK lautete die zynische Schlagzeile der größten Tageszeitung Bristols. Der Artikel war nicht allein aus journalistisch-ethischen Gründen mehr als fragwürdig.
Der siebenundzwanzigjährige Computerspezialist Ashraf Dajibhai war erstens kein Inder, sondern pakistanischer Herkunft. Zudem waren die Umstände seines Todes dermaßen kurios, daß es eigenartig erscheinen konnte, weshalb die Polizei von Bristol so schnell mit ihrer Schlußfolgerung an die Öffentlichkeit ging, es handle sich um Selbstmord.
Ashraf Dajibhai sollte sich auf folgende Weise selbst erdrosselt haben: Zunächst verband er vier Abschleppseile aus Kunststoff der Marke Cyclone miteinander, befestigte das eine Ende an einem großen Baum und legte sich das andere um den Hals. Danach sollte er sich ans Lenkrad seines grünen Audi 80 gesetzt haben und ziemlich langsam losgefahren sein, bis das Seil sich streckte und die Schlinge um seinen Hals ihn erdrosselte.
Auf dem Rücksitz des Wagens lagen zwei Weinflaschen, die er in einer nahe gelegenen Tankstelle gekauft haben sollte. Die eine Flasche war zu zwei Dritteln leergetrunken.
Schon dieser Umstand hätte genügen müssen, um das Vorliegen eines Verbrechens zu rechtfertigen, also eines arrangierten Selbstmords. Ashraf Dajibhai war gläubiger Moslem, was nicht nur Selbstmord zu einer Todsünde machte. Selbstmord in Verbindung mit Alkoholkonsum erschien zumindest seinen Verwandten als weit jenseits der Grenze zum Bizarren; Ashraf Dajibhai hatte in seinem ganzen Leben keinen Tropfen Alkohol getrunken.
Nachdem die Polizei von Bristol mit Hilfe ihrer Londoner Kollegen von New Scotland Yard rekonstruiert hatten, was Ashraf Dajibhai in seinen letzen Tagen und Stunden getan hatte, hätte noch weniger für einen Selbstmord sprechen müssen.
Dajibhai war eins dieser jungen Computergenies, denen es sehr schnell gelungen war, sich in gute finanzielle Verhältnisse emporzuarbeiten. Er war schuldenfrei und hatte ein Gehalt von rund vierzigtausend Pfund im Jahr. Seit zwei Jahren war er verheiratet. Er hatte einen einjährigen Sohn. Seine Frau Nita erwartete ihr zweites Kind. In seiner letzten Lebenswoche hatte er die Stromleitungen in dem neuerworbenen Haus in Kenton im Norden Londons restauriert. Zuvor hatte er das Haus frisch gestrichen und ein neues Rohrleitungssystem verlegt. Seine ehemaligen Kommilitonen an der Loughbourough University, an der er drei Jahre zuvor sein Examen als Bachelor of Science der EDV-Technik abgelegt hatte, waren ebenso verstört wie seine nahen Verwandten. Alle vertraten die Ansicht, daß Ashraf »der letzte wäre, dem man einen Selbstmord zutraut«. Soweit man wußte, hatte er keinerlei Sorgen, schien nie deprimiert zu sein, war immer fröhlich und hilfsbereit – was er häufig unter Beweis stellte. Unter anderem schrieb er für seinen Vater und Onkel, die je ein Feinkostgeschäft betrieben, die Buchführungsprogramme.
Keine vierundzwanzig Stunden vor seinem Tod hatte er für zweihundertachtzig Pfund einen neuen Anzug und für fünfundachtzig Pfund ein Paar Schuhe gekauft.
Am späten Nachmittag hatte er einen Anruf erhalten und seiner Frau gesagt, er müsse weg, um einem früheren Studienfreund bei einer kleinen Sache zu helfen. Dann hatte er den Wagen genommen, seiner Frau zugewinkt und war für immer aus ihrem Leben verschwunden.
Die Stelle, an der er am nächsten Tag außerhalb von Bristol gefunden wurde, war genau einhundertsechzig Kilometer von seinem Haus in Kenton entfernt.
Es gab noch drei weitere Umstände, welche die Schlußfolgerung, es liege ein Selbstmord vor, fast als einen bizarren Versuch der Behörden erscheinen ließen, etwas zu verbergen.
Erstens einige kriminaltechnische Details: Unter dem Fahrersitz, auf dem der Tote aufgefunden wurde, lag eine fünfzig Zentimeter lange Rohrzange, die niemand vorher im Wagen gesehen hatte. Die Länge der Rohrzange war absolut ausreichend, um es jemandem zu ermöglichen, neben dem Opfer zu sitzen, das Gaspedal von Hand zu betätigen und so das Seil zwischen Baum und Hals langsam zu strecken. Unter Ashraf Dajibhais hinterlassenen Papieren befand sich tatsächlich eine Quittung für ein einziges gekauftes Abschleppseil der Marke Cyclone; am Tatort wurden jedoch vier solcher Abschleppseile gefunden, die miteinander verknotet worden waren.
Zweitens: Ashraf Dajibhai arbeitete in der britischen Rüstungsindustrie. Er war darauf spezialisiert, Computersimulationsprogramme zu schreiben, mit denen sich sowohl Steuerungssysteme von Torpedos testen ließen als auch Störungsmöglichkeiten bei dem äußerst geheimen Feuerleitsystem Zeus.
Drittens: Der Vorfall erschien beinahe wie eine Kopie eines Falls, der sich vor zehn Jahren ereignet hatte, eigentümlicherweise gerade in Bristol. Es hatte den Anschein, als wiederholte sich die Geschichte, entweder infolge unerforschlicher göttlicher Ironie oder weil Menschen die Geschichte wiederholen wollten.
Zwischen 1983 und 1989 gab es eine Serie eigentümlicher Selbstmorde unter Personen, die bei der britischen Rüstungsindustrie angestellt waren, vor allem bei General Electrics. Von fünfundzwanzig Personen hieß es, sie hätten in diesen Jahren Selbstmord begangen. Die Umstände ihres Todes waren in mehreren Fällen so aufsehenerregend merkwürdig, daß die britische Presse schon bald eine große Sache daraus machte; eine Reportagereihe in der EDV-Zeitschrift Computer News wurde für die Darstellung der verschiedenen Fälle sogar mit einem Journalistenpreis belohnt. Da die Sache anschließend sogar im Parlament aufgegriffen wurde, wurde sie für das Innenministerium schon bald zu einer heißen Kartoffel. Das Ministerium setzte nämlich einige Untersuchungsausschüsse ein, die zu dem Ergebnis kamen, daß nichts Verdächtiges vorliege, daß Selbstmorde zwar eine düstere Angelegenheit, jedoch nicht sonderlich ungewöhnlich seien, und da General Electrics mehr als einhunderttausend Menschen beschäftige, müsse man rein statistisch davon ausgehen, daß ein paar Dutzend von ihnen sich in dem fraglichen Zeitraum das Leben nähmen.
Diese Statistik konnte durchaus logisch erscheinen. Bemerkenswert war allerdings, daß die Statistik sich dramatisch veränderte, nachdem die Frage in der britischen Presse groß behandelt worden war. Nach 1989 hörten die Angestellten von General Electrics damit auf, sich im Einklang mit der Statistik umzubringen.
Der neueste Fall erinnerte an diese Serie, überdies handelte es sich um eine Kopie eines früheren Selbstmords. Das öffentliche und politische Interesse war schnell geweckt, Untersuchungen wurden durchgeführt.
Dennoch verschlimmerte sich die Situation rasch.
Eine Woche nach Ashraf Dajibhais behauptetem da capo des indischen Seiltricks wiederholte ein Wissenschaftler indischer Herkunft, Vijai Samjani, einen weiteren Selbstmord aus dem Zeitraum 1983-1989.
Die Umstände waren verblüffend ähnlich.
Vijai Samjani hatte in einem Monat heiraten wollen. Was die Eheschließung hinauszögerte, waren die durchaus nicht ungewöhnlichen Schwierigkeiten, ein Einreisevisum für seine künftige Frau zu erhalten. Er hatte seinen lokalen Parlamentsabgeordneten einen Tag vor seinem Tod aufgesucht, um Druck in der Angelegenheit zu machen.
Auch Vijai Samjani fuhr plötzlich mit seinem Wagen los und verschwand nach Bristol. Er parkte in der Nähe der Clifton-Brücke über den Avon, ging auf die Brücke und sprang auf die Steinplatten am Widerlager der Brücke. Es war ein Sturz von mehr als siebzig Metern.
Auch in seinem Fall gab es kriminaltechnische Umstände, die sich schwerlich erklären ließen. Beispielsweise fand man im Aschenbecher des Wagens drei halbgerauchte Zigarillos, obwohl Samjani Nichtraucher war. Später stellte sich heraus, daß er in einem Bed & Breakfast übernachtet hatte, das weniger als einen Steinwurf von British Aerospace entfernt lag, wo er früher angestellt gewesen war und an Programmsystemen für die Luftabwehrrakete Rapier gearbeitet hatte. Zur Zeit seines Todes war Vijai Samjani bei Marconi Naval Systems angestellt und arbeitete an einer neuen Generation Torpedos des Typs Sting Ray.
In den meisten Ländern der Welt wäre es den zuständigen Polizeibeamten außerordentlich schwergefallen, die Ermittlungen einzustellen. Das britische Rechtssystem kennt jedoch eine Spezialität, die es in manchen Fällen ermöglicht, die gesamte Verantwortung für eine bestimmte Ermittlung in die Hände eines einzigen Menschen zu legen; dies völlig unabhängig von der allgemeinen Überzeugung der Briten, daß die Mächtigsten im Staate sich in alles einmischen und alles entscheiden könnten, indem sie einander in einem Herrenclub nur etwas zugrunzten.
In Großbritannien haben Gerichtsmediziner, die Coroner, eine sehr bedeutende juristische Prüfungsfunktion. Der Gerichtsmediziner sammelt sämtliches relevante Material und führt anschließend eine amtliche Leichenbeschau durch, eine Art Gerichtsverhandlung, die öffentlich ist. Dabei wird das Beweismaterial vorgelegt, das zumindest der Form nach von jedem Anwesenden diskutiert und in Frage gestellt werden kann. Bei einer solchen Prüfung kann der Gerichtsmediziner zwischen vier verschiedenen »gerichtlichen Entscheidungen« wählen: Tod durch Fremdeinwirkung, Tod infolge von Unglücksfall oder Selbstmord oder Tod durch ungeklärte Umstände (open verdict).
Die gerichtsmedizinische Prüfung der beiden Fälle von Vijai Samjani und Ashraf Dajibhai in Bristol führte zu dem Beschluß, daß Tod durch ungeklärte Umstände vorliege. Damit gab es für die Polizei von Bristol offiziell einen zwingenden Grund mehr, ihre Ermittlungen fortzusetzen. Es war nicht behauptet worden, es liege Mord vor.
Einige Zeit später ließ die die Polizei jedoch mehr oder weniger absonderliche Erklärungen für gedachte Selbstmordmotive durchsickern. Von Ashraf Dajibhai wurde behauptet, er sei mit der mystischen Sekte Anoopam Mission in Buckinghamshire in Berührung gekommen, einer Sekte, die in früheren bekanntgewordenen Fällen Menschen dazu gebracht hatte, in Grübeleien und Depressionen zu verfallen.
Es stellte sich jedoch bald heraus, daß hier bestenfalls eine Verwechslung vorliegen konnte. Die Sekte war hinduistisch, Ashraf hingegen ein gläubiger Moslem. Die Wahrscheinlichkeit, daß er, der überdies ein gelinde gesagt rationaler und moderner Mensch war, EDV-Experte mit der Spezialtät Militärtechnologie, ausgerechnet unter wirrköpfigen Hindus gelandet sein sollte, die in weißen Gewändern, mit Blumen, Weihrauch und aneinandergelegten Handflächen weißen Mittelstandsfrauen ins Ohr bliesen, es werde auf Erden Friede und Ruhe einkehren, wenn sie nur ein paar Dutzend Pfund für die weisen Worte des Abends beitrügen, nein, die Wahrscheinlichkeit war nicht groß.
Die inoffiziellen Sprecher der Polizei von Bristol wandten sich deshalb mit einer Berichtigung an die Presse. In Wahrheit sei Vijai Samjani in den Klauen der Sekte gelandet.
Wie einer seiner Freunde bestätigen konnte, hatte Vijai bei einer einzigen Gelegenheit die Sekte besucht. Allerdings sei er lauthals lachend wieder weggegangen. Offensichtlich also ohne Anzeichen einer beginnenden Depression.
Was nun Ashraf anging, den Moslem, der folglich keine hinduistische Sekte besucht haben konnte, so lautete nun die inoffizielle Erklärung, er habe eine außereheliche Beziehung unterhalten, über die man sich mit Rücksicht auf die Betroffenen nicht näher äußern könnte. Diese Tatsache habe es jedoch mit sich gebracht, besonders angesichts seiner streng moslemischen Religiosität, daß er seine Familie auf eine Weise entehrt habe, die nur eine drastische Art der Wiedergutmachung zulasse, eine, die mit moslemischen Traditionen vereinbar sei. Er habe die Wunden nur durch seinen Tod heilen können.
Sein Vater und sein Onkel schnaubten nur über diese Erklärung, als sie von eifrigen Reportern weitergegeben wurde. Entweder sei das, erklärten sie, ein zynischer Scherz, oder man habe sie mit irakischen Schiiten oder derlei verwechselt. Untreue sei ihrer Religion zufolge gewiß ein schweres Verbrechen, das die Familie entehre. Doch es hätte die Schande nur noch größer gemacht, wenn Ashraf dieses Verbrechen durch ein noch schändlicheres hätte sühnen wollen, nämlich durch einen Selbstmord in Verbindung mit Trunkenheit. Älteren Sitten in dem Teil Pakistans zufolge, aus dem die Familie ursprünglich stammte, hätte der junge Ashraf die Entehrung möglicherweise dadurch auslöschen können, daß er die Frau tötete, die der Anlaß zu seiner Untreue gewesen sei. Doch es erschien ihnen nicht wahrscheinlich, daß Ashraf, der Pakistan noch niemals besucht hatte, auf die Idee hätten kommen sollen, zu derart altertümlichen Sitten zurückzukehren.
Der britischen Presse kann mit Rücksicht auf die Sicherheit des Landes von der Regierung eine Schweigepflicht auferlegt werden. Dies ist für die Obrigkeit ein zweischneidiges Schwert, da das Risiko besteht, daß sich britische Journalisten dann ausländischer Kollegen bedienen und ihnen Hinweise geben, um anschließend »die ausländische Presse« zitieren zu können.
Es gibt jedoch eine Zwischenform in der englischen Obrigkeitsgesellschaft, die manchmal als »Gesellschaft für bescheuertes Händeschütteln« bezeichnet wird – damit ist die Art und Weise gemeint, wie Freimaurer einander die Hand geben. Die britischen Machthaber in Verwaltung, Industrie und Medien pflegen bei ungezwungenen Essen in ihren Herrenclubs täglichen Umgang miteinander. Irgendwo dort mußte jemand gegrunzt, die Augenbrauen gehoben oder auf andere Weise eine Andeutung gemacht haben. In kürzester Zeit war sich nämlich die gesamte Chefgarnitur der britischen Medien darin einig, daß es den Interessen der Nation nicht nützen würde, in dieser Bristol-Sache herumzurühren.
Bis auf weiteres kam damit die lästige Publizität zum Erliegen.
*
Carl lag in einer zwischen zwei spätblühenden Apfelbäumen gespannten Hängematte und versuchte sich einzureden, daß es bequem war. Diese Form der Ruhe hatte er sich schon immer als die höchste Form von Freizeit, ja, Pensionierung vorgestellt. Er übte sich nämlich nicht nur darin, bequem in einer Hängematte zu liegen, sondern auch in der Vorstellung, pensioniert zu sein. In einem Monat würde er seinen vierzigsten Geburtstag feiern. Vor sich hatte er ein schwindelerregendes Abenteuer in Form eines vollkommen zivilen Lebens; er hatte ein Gebot auf eine kleine EDV-Firma im Silicon Valley abgegeben, die sich darauf spezialisiert hatte, Software für militärische Systeme herzustellen. Das war ein Bereich, der ihm maßgeschneidert erschien. Er hatte in San Diego ein Bankkonto eröffnet und verhandelte mit einem deutschen Unternehmen über den Verkauf seiner schwedischen Immobiliengesellschaften. Der Fall der schwedischen Krone war ebenso groß wie unvermeidlich geworden, nachdem sich der Reichsbankchef des Landes als Vorstandsvertreter eines Großunternehmens an einer Spekulation gegen die eigene Währung beteiligt hatte. Carl fiel ein, daß der Reichsbankchef für zehn Jahre in den Kahn gegangen wäre, wenn er sich in den USA etwas Vergleichbares geleistet hätte. Wenn es in der alten Sowjetunion dazu gekommen wäre, wäre er von einem Erschießungspeloton hingerichtet worden; in Schweden blieb er in seinem Job sitzen und administrierte die Währungskatastrophe.
Eine für das Land weniger bedeutende, für Carl möglicherweise jedoch sehr bedeutende Konsequenz des dramatischen Währungsverfalls ergab sich daraus, daß die im Vergleich zur schwedischen Krone unnatürlich starke D-Mark zu Immobilienkäufen geradezu einlud. Mit etwas Glück würde er mit wenigen Schachzügen sein gesamtes Vermögen freimachen können, und dann brauchte er nur die nächste Maschine nach Kalifornien zu besteigen.
Tessies Vorgesetzte bei IBM waren einigermaßen entgegenkommend gewesen und hatten zugesagt, die Möglichkeiten zu prüfen, ihr innerhalb des Konzerns einen Juristenjob zu geben, entweder in Los Angeles oder San Diego; Carl stellte sich immer vor, daß sie wahrscheinlich nach Hause ziehen würden, also nach San Diego.
Die Geschichte mit dem Navy Cross hatte ihre Möglichkeiten wohl kaum verschlechtert. Carl war schamlos zufrieden, weil es ihm gelungen war, einen Vorgang, den er im Grunde als peinlich betrachtete, schon jenseits der Grenze zum Lächerlichen – nämlich die Verteilung von Medaillen –, in einen doppelten privaten Vorteil zu verwandeln.
Er hatte Tessie und Stan zur amerikanischen Botschaft mitgenommen. Beide waren amerikanische Staatsbürger. Der schwedische Ministerpräsident mußte sich damit abfinden, in dieser Gesellschaft nicht zur meistfotografierten Person zu werden.
Die eigentliche Veranstaltung war peinlich übertrieben, genau wie Carl es erwartet hatte, doch es war ihm gelungen, es so zu sehen, als wäre es ein Job, ein Falschspiel, mit dem er bestimmte Vorteile erlangen wollte.
Das war auch geschehen. Als der Junge ihn in Uniform gesehen und sofort die SEAL-Schwingen erkannt hatte, schwanden seine allerletzten Zweifel, was den neuen Mann seiner Mutter betraf. Immerhin hatte Stan mindestens zwei Abenteuerfilme mit SEAL-Einheiten in der Hauptrolle gesehen (wenn Carl den Zusammenhang richtig verstanden hatte, war es in beiden Fällen um den heldenmütigen Kampf von SEALS gegen Araber im Burnus mit Messern zwischen den Zähnen gegangen). Die Rhetorik des amerikanischen Botschafters hatte die übertriebenen Vorstellungen des Jungen von dem heldenmütigen Kampf für Demokratie und Frieden, den die USA und Schweden so tapfer gemeinsam führten, natürlich nicht im mindesten untergraben.
Die Rhetorik des schwedischen Ministerpräsidenten bei einer sogenannten »improvisierten Pressekonferenz« hatte der amerikanischen kaum nachgestanden.
Damit war der Junge gewonnen und das strategische Ziel erreicht, das Carl bei der lächerlichen Operation verfolgt hatte. Tessie hatte ihm einen Auftrag gegeben, und er hatte ihn ausgeführt. An etwas anderes wollte er nicht denken, geschweige denn deswegen erröten.
Obwohl er noch einen Schritt weitergegangen war. Immerhin gab es noch einen Rechtsstreit vor dem Bezirksgericht von Santa Barbara, den es endgültig zu gewinnen galt.
Nach den Zeremonien hatte er einer der anwesenden Zeitungen ein sogenanntes Exklusivinterview gewährt. Damit hatte er dem über diesen Bescheid fast schockierten Vertreter von CNN eine klare Absage erteilt. Dieser hatte stammelnd versichert, niemand erteile CNN eine Abfuhr.
Carl hatte den Reporter der Los Angeles Times für das Interview ausgewählt.
Sie hatten in der Botschaft um ein Zimmer gebeten, um ungestört reden zu können. Carl hatte zur kaum verhohlenen Irritation des Reporters Tessie und Stan mitgenommen und anschließend alle politischen Fragen oder Fragen, die seinen Job betrafen, mit vagen Floskeln oder mit einem »no comment« beantwortet, von Zeit zu Zeit aber mit einer Andeutung auf die wahrscheinliche Wiedervereinigung einer glücklichen Familie in Kalifornien hingewiesen.
Dem lag ein sehr einfacher Gedanke zugrunde. Nach Carls Erfahrung funktionierten Journalisten ebenso vorhersagbar wie KGB-Leute früherer Zeiten. Die Zeitung, die das Gefühl hat, etwas »exklusiv« bringen zu können, glaubt damit einen Knüller zu haben. Und ein Knüller muß möglichst groß aufgemacht werden. Für Carl war die Wahl der Zeitung wegen des Sorgerechtsstreits einfach gewesen. Es war wichtig, daß die Los Angeles Times die Sache groß herausbrachte, denn alle Angehörigen der Sozialbehörde und des Gerichts von Santa Barbara lasen dieses Blatt. Kleine Schnipsel in allen anderen Medien der Welt hätten ihn seinem Ziel nicht näher gebracht.
Damit hatte er seinen Beitrag geleistet. Er hatte Tessie erklärt, was er gedacht und wie er sich verhalten hatte. Schließlich hatte sie ihm sogar verziehen, daß er ihrem Sohn eine schwarze 9-mm-Pistole in die Hände gegeben hatte. Immerhin war sie sowohl Juristin als auch Amerikanerin, und es bereitete ihr keine Mühe, die Logik dieser Medien-Operation zu verstehen.
Und jetzt war all dies vorbei. Daher Hängematte, Urlaub, ziviles Leben, Zukunftspläne. Statt der ewigen russischen Sprachkassetten in seinem Walkman lauschte er jetzt der Pastorale von Beethoven. Er stellte sich vor, daß ein Sommertag in der Hängematte und Urlaub und Lebensplanung nach der Pensionierung recht gut zur Pastorale passen würden, ebenso wie die Aussicht auf das blaue Wasser des Mälarsees.
Im übrigen mochte er den kleinen Stan ganz freiwillig. Der Junge war neugierig, von großer Wißbegier, impulsiv und phantasiebegabt. Sie hatten zusammen viel Spaß gehabt, besonders als der riesige Åke, der heimlich Carls indiskretes Getratsche bestätigt hatte, daß auch er die SEAL-Schwingen trage, Stan mehrere Meter in die Luft geworfen hatte, um ihn dann weich aufzufangen und überraschend zu Carl hinüberzuwerfen, etwa so, wie die beiden es immer im Scherz mit Messern machten. Plötzlich warf der eine ein Messer auf das Gesicht des anderen, am liebsten bei Tisch mit anwesenden Ehefrauen.
Es erstaunte ihn, daß er es als so vollkommen normal empfand, wieder Vater geworden zu sein. Es war ein Wunder mit allem, was so dazugehört, aber nicht das gleiche Wunder wie beim ersten Mal. Es kam ihm vor, als hätte er schon eine gewisse Routine.
Carl hob die Hände und betrachtete sie. Sie waren inzwischen weicher geworden und paßten besser zu Kindern. Sie waren keine Waffen mehr, und so sollte es auch sein. Er drehte zwar immer noch jeden Tag seine Runden und schoß seine Serien, das eine auf Verlangen des Körpers und das andere auf Verlangen der Seele. Die Nahkampfübungen hatte er aber so gut wie eingestellt. Genau dieses Leben wollte er schließlich hinter sich lassen.
Ein kleiner dunkler Anflug von Unruhe machte sich in ihm bemerkbar, etwa wie ein vorübergleitende Wolke an einem sonst völlig klaren Sommerhimmel. Wenn er den Dienst quittierte, würde Åke, Vater von Lis, höchster operativer Chef der besonderen Abteilung des Nachrichtendienstes werden, wie ihre Abteilung offenbar seit kurzem hieß.
Dabei ging es natürlich um die baltischen Staaten und Rußland. Carl sah eine lange Reihe von Möglichkeiten für illegale schwedische Aktionen auf baltischem Territorium in den nächsten Jahren. Und wer sich auf so etwas einließ, ging immer eine Wette mit dem Tod ein. Sie selbst hatten meist Glück gehabt. Ihre Verluste waren klein gewesen, doch ein einziger Zufall genügte, und es konnte für eine ganze Gruppe auf dem Feld vorbei sein.
Das ist nicht gerecht, sagte er sich. Er selbst riß aus höchst privaten Gründen aus, und Åke blieb zurück. Und dieser würde früher oder später gezwungen sein, das Risiko auf sich zu nehmen, Anna zur Witwe zu machen. Und damit würde Lis Erika ohne Vater dastehen.
Seine Sentimentalität gefiel ihm nicht, und so schaltete er wieder die Kassette mit der Pastorale ein. Es ist aber trotzdem ungerecht, sagte er sich. Åke hat dieses russische Roulette schon so oft mitgemacht, daß er etwas anderes verdient, als einfach nur mit der Tätigkeit weiterzumachen, die logischerweise so enden muß, wie sie für Joar Lundwall, unseren ersten gemeinsamen Rottenkameraden, geendet hat.
Plötzlich überspülten Carl die Erinnerungen mit so brutaler Heftigkeit, daß er sich den Kopfhörer mit der Pastorale