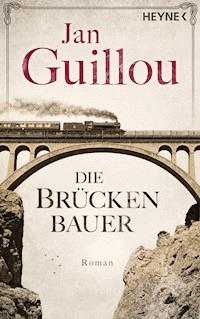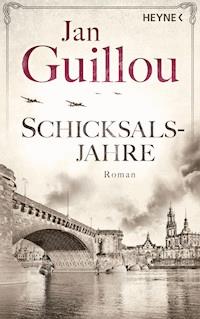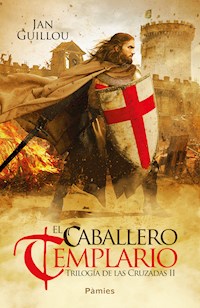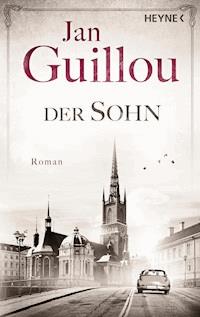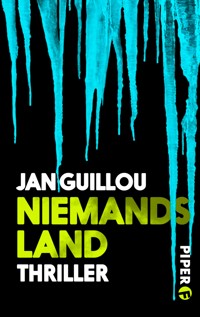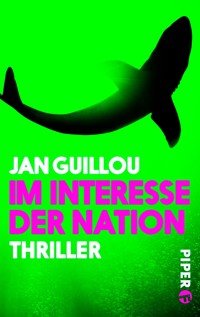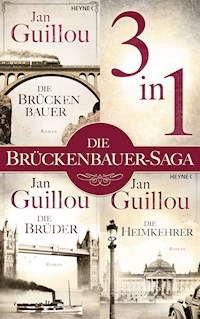4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Hamiltons richten auf ihrem Familiensitz ein prunkvolles Jagdfest aus. Doch die Feierlichkeiten werden jäh unterbrochen, als zwei Maskierte das Schloss stürmen und Gräfin Estelle, Agent Hamiltons Mutter, erschießen. War der Anschlag ein Gruß der sizilianischen Mafia an ihren Sohn? Hamilton alias »Coq Rouge« bleibt keine Zeit zu trauern, denn als neu ernannter Chef des schwedischen Geheimdiensts beschäftigt ihn eine spektakuläre Mordserie. Der Täter bringt scheinbar wahllos schwedische Bürger um und agiert dabei mit verblüffendem Geschick: ein tödlicher Messerstich, ein präziser Schuss aus großer Entfernung, ein Karategriff, der dem Opfer den Hals bricht. Hamilton weiß, dass es nur einen Mann in Schweden gibt, der solche Methoden beherrscht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Übersetzung aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt ISBN 978-3-492-98088-3 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 1995 Jan Guillou Titel der schwedischen Originalausgabe: »En medborgare höjd över varje misstanke«, Norstedts Förlag, Stockholm 1995 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1999 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © AYakovlev / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 2. Auflage 2002
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
1
Erst erschossen sie das falsche Weibsstück. Das wäre in der Formulierung des einzigen überlebenden Mörders die Erklärung für den einen Mord auf Vrångaholm. Reine Schlamperei also.
Sonst fand sich im Verhalten der Täter nicht viel, was auf Schlamperei hindeutete. Der Zeitpunkt für den Angriff war bemerkenswert gut gewählt. Das Ganze war überdies in weniger als fünfzehn Sekunden vorbei, und das einschließlich der Zeit, die es kostete, ein aus einer Wochenzeitschrift herausgerissenes Foto hochzuhalten, den Irrtum zu entdecken und ihn zu korrigieren.
Am Sonntag, dem 13. November 1994, begab sich eine gespaltene schwedische Nation an die Wahlurnen, um über die Frage abzustimmen, ob Schweden Mitglied der Europäischen Union werden sollte oder nicht. Während des gesamten Herbstes hatten die Beitrittsgegner in allen Meinungsumfragen klar geführt, und erst in der allerletzten Zeit hatten sich die Befürworter so weit angenähert, daß der Ausgang der Wahl nicht mehr als gewiß gelten konnte.
In jeder zufällig zusammengewürfelten Gruppe von Staatsbürgern hätte es an diesem Abend hitzige Diskussionen über das Für und Wider gegeben. Und wenn man auch noch die Menge guten Weins in Betracht zog, den gutes Essen und ein Fest erfordern, hätte die Diskussion empört, ja sogar gehässig werden können, nachdem die eine Seite behauptet hatte, Schweden sei jetzt dabei, ein Vasallenstaat Deutschlands zu werden. Die Deutschen würden bald auf schwedischem Boden einmarschieren, sofern dieser überhaupt noch schwedisch und noch nicht von Deutschen aufgekauft sei. Und die andere Seite hätte betont, das Land riskiere einen sofortigen Ruin und die Verlagerung aller schwedischen Industrieunternehmen in das Ausland, wonach nur noch die Eigentümer von Rentierherden eine anständige Möglichkeit hätten, ihr tägliches Brot zu verdienen, falls die Beitrittsgegner sich durchsetzten.
Die sechzehn Personen auf Vrångaholm hatten das Thema im Lauf des Tages überhaupt nicht diskutiert. Das lag jedoch keineswegs daran, daß sie in der Sache nicht engagiert waren. Im Gegenteil, sie hatten bei der Volksabstimmung alle mit Ja gestimmt. Allerdings schon früher in der Woche per Briefwahl, da sie ja wußten, daß sie den ganzen Sonntag auf Vrångaholm verbringen würden. Außerdem waren sie tief und ehrlich davon überzeugt, daß der Anschluß Schwedens an die EU notwendig sei, da sie in dieser oder jener Form alle ihr Einkommen aus der Landwirtschaft bezogen – was nicht unbedingt Landwirtschaft bedeutet, sondern ebensosehr, daß man gegen bestimmte staatliche Subventionen auf Landwirtschaft verzichtet, und diese Entschädigungszahlungen waren in der EU mit Sicherheit höher als in Schweden. Gerade in dieser Gesellschaft gab es für eine Diskussion also nicht sonderlich viel Anlaß.
Überdies hatte man den ganzen Tag der Jagd gewidmet, einer der besten Jagden des Jahres in Skåne, da Vrångaholm wegen seines Rothirschbestands einen guten Ruf genoß. Man würde also Rothirsch jagen, Damhirsch, Rehwild und gegebenenfalls auch Schwarzwild. Unter solchen Umständen ist es nicht nur unpassend, den Versuch zu machen, über Politik zu diskutieren, sondern es bleibt überdies kaum Zeit, über anderes zu sprechen als die eigentliche Jagd.
Der Tag hatte sehr gut angefangen. Nach den üblichen Zeremonien auf dem Rasen vor dem Schloß, wo der Gastgeber schnell die Beschränkungen herunterleierte, die bei der Jagd galten – keine Keiler über einer bestimmten Körpergröße, keine führenden Bachen, bei Damhirschen keine Halbschaufler, selbstverständlich keine Rothirsche zwischen acht und zwölf Enden, ebensowenig Rehböcke, die abgeworfen haben, und keine Ricken, wenn man nicht absolut sicher ist, daß kein Kitz in der Nähe ist, und so weiter –, hatten die Jäger einen sehr gelungenen Start gehabt.
Während des erstens Treibens waren zwölf Schuß abgefeuert worden, davon ein Doppelschuß (was darauf hindeuten könnte, daß einer der Jagdgenossen sich einen Fehlschuß erlaubt hatte, da er mit dem ersten Schuß nicht perfekt getroffen hatte), und aus diesem Grund hatte der Gastgeber der Jagdgesellschaft, Claes Peiper, mit einer gewissen Unruhe, von der er natürlich mit keiner Miene etwas verriet, alle Jäger zu sich gerufen, um zu besprechen, was geschehen war.
Es war lediglich folgendes geschehen: Zwölf Tiere waren mit zwölf Schuß erlegt worden. Der Doppelschuß wurde damit erklärt, daß einer der Vettern, Claude Hamilton, eine Doublette geschossen hatte: Das eine Tier war ein kapitaler Damhirsch mit einem Geweih an der Grenze zum Bronzemedaillen-Format, und das zweite Stück Damwild war ein Schmaltier. Sämtliche Tiere waren perfekt erlegt worden, und die Suchpatrouille, die sich mit vielsagendem Grinsen, das sich deren Mitglieder immer dann erlaubten, wenn sie der Ansicht waren, daß »die Grafen und Barone« gerade nicht hinsahen, bereitgemacht hatte, nach weidwund geschossenen Tieren zu suchen, mußte unverrichteter Dinge zu ihrem VW-Bus zurückkehren und ihre eifrigen und bellenden Hunde einsammeln.
Und danach war der Tag ebenso erfolgreich weitergegangen, wie er angefangen hatte. Einen ganzen Tag lang wurden ebenso viele Tiere erlegt, wie Schüsse abgefeuert worden waren, was sogar bei den Gelegenheiten ungewöhnlich ist, bei denen der Schloßadel sich zusammenfindet und ohne Außenstehende auf die Jagd geht.
Eine derart gelungene Jagd ist anschließend eine Garantie für ein gelungenes Festessen. Unter den Gästen ist niemand, der sich schämt und getröstet werden muß; alle haben einen erfolgreichen Tag hinter sich, und die Ehre dafür läßt sich in einer fast sozialistisch zu nennenden Ordnung freigebig verteilen, einer Ordnung, in der niemand vornehmer ist als der andere.
Das Essen begann also wie gewöhnlich um 19.00 Uhr, eine Stunde nach Schließung der Wahllokale, und damit war das Schicksal der Nation definitiv entschieden. Die Stimmung war natürlich ausgezeichnet, was nicht so sehr daran lag, daß die Jagd erfolgreich verlaufen war, sondern daran, daß niemand einen Mißerfolg hatte hinnehmen müssen. Es wurden die Reden gehalten, wie die Sitte sie verlangt. Feierliche Ansprachen der verschiedensten Art, angefangen bei der Rede Claude Hamiltons, des Jagdkönigs, die von seinem Vetter Raoul Hamilton mit gespieltem Neid kommentiert wurde, bis hin zur Ansprache Thottens, der sich im Namen aller für die Einladung bedankte, da die Gastgeberin seine Tischdame war.
Merkwürdig war nur eins: Alle saßen dort und waren jeder für sich davon überzeugt, daß in diesem Augenblick das Schicksal der Nation und vielleicht auch des eigenen Hofs – die Bezeichnung Schloß ist in Adelskreisen verpönt – entschieden wurde, ohne daß man erfuhr, wie die Abstimmung ausgegangen war. Es wäre unverschämt gewesen, die Tafel nur aus einem solchen Grund zu verlassen.
Die Problematik war der Gastgeberin durchaus bewußt. Natürlich fühlte sie sich erleichtert, weil die Jagd erfolgreich gewesen war, denn ein Mißerfolg hätte das Essen auf mehr als nur eine Weise zerstört. Erstens ist es überhaupt traurig, wenn eine große Jagd mit bestimmten Ansprüchen zum Teufel geht. Zweitens gibt es beim Essen ohnehin besondere Probleme.
Das eine Problem war die Doppelgräfin. Sie hieß jetzt Wachtmeister-Hamilton, war jedoch eine geborene Jönsson. Sie war nacheinander mit einem Wachtmeister und dann einem Hamilton verheiratet gewesen. Sie hatte beide überlebt, um danach mit einem pensionierten sozialdemokratischen Politiker zusammenzuziehen, der zwar mit einigem Anstand einen dunklen Anzug tragen konnte, in allem übrigen aber Sozi war, wie sehr er auch den Staatsmann und nach seiner Pensionierung als Botschafter auch den frischbekehrten Konservativen zu spielen versuchte. Die Doppelgräfin wurde hier nicht gern gesehen, und dieser Spitzname leitete sich natürlich von der Tatsache her, daß sie jetzt mit ihrem Emporkömmling nur »verlobt« war, da sie bei einer Heirat die beiden gräflichen Namen verlieren würde. Aus verschiedenen gesellschaftlichen Gründen wäre es jedoch schwierig gewesen, sie nicht einzuladen. Ihr »Verlobter« war zum Essen und zur Jagd offiziell eingeladen worden, hatte jedoch wie erwartet abgesagt.
Das zweite Problem war Estelle Hamilton. Dieses war aus der Sicht der Gastgeberin ein komplizierteres und schwerer zu meisterndes Problem; wenn die Gäste auf die Idee gekommen wären, der Doppelgräfin den Rücken zuzukehren, hätte man dies nicht der Gastgeberin anlasten können.
Doch bei Estelle Hamilton sah das auf mehr als eine Weise anders aus. Sie war wahrhaftig keine Jönsson, die eingeheiratet hatte. Das war es nicht.
In gesellschaftlicher Hinsicht war es eher umgekehrt. Sie war inzwischen so alt, daß sie von jedem der Anwesenden besondere Aufmerksamkeit und Höflichkeit verlangen konnte. Sie war auf diese oder jene Weise mit mehr als der Hälfte der Anwesenden verwandt. Gelegentlich setzte sie sich aber in den Kopf, steife altmodische Manieren an den Tag zu legen und von ihrer Umgebung zu verlangen, daß jeder so auftrat, wie es früher einmal üblich war. Das konnte zum Beispiel bedeuten, daß sie plötzlich verlangte, von allen mit »Tante« angeredet zu werden. Oder sie hielt demonstrativ auf Etikette oder andere Umgangsformen, womit sie bei allen Anwesenden Irritationen auslöste.
Und in ihrer derzeitigen Lage, hätte sie eine besonders gute Möglichkeit gehabt, das Essen zu dominieren und Feierlichkeit und Verstimmung zu verbreiten. Trauer läßt sich nicht einfach ignorieren. Ihr Sohn war vor kurzem Witwer geworden, und ihre beiden Enkelkinder waren ums Leben gekommen. Und um allem Elend noch die Krone aufzusetzen, fand sie sich mit einem Begleitwagen ein, in dem zwei Personen saßen, die sie die beiden »Wachtmeister« nannte, die sie neuerdings überall mit sich herumschleppen müsse. Sie hatte jedoch versichert, daß »die Wachtmeister« keine Umstände machen würden, da sie ihnen befohlen habe, in ihrem Wagen zu bleiben oder möglicherweise im Schloßpark spazierenzugehen, falls ihnen danach zumute sei, jedoch dürften sie nicht in Sichtweite des Hauses urinieren.
Die Gastgeberin war absolut davon überzeugt, daß Estelle Hamilton die Sicherheitspolizei des Landes so herumkommandieren konnte und daß man ihr sofort gehorchte. Estelle Hamilton hatte sich nämlich ihr ganzes Leben lang bei allen sofort Gehorsam verschafft, möglicherweise mit Ausnahme ihres Sohnes.
Auch das war eine quälende Komplikation. Alle Anwesenden an der Tafel wußten, daß sie in den letzten Jahren nur selten Kontakt mit ihm gehabt und daß er sie sogar in seiner Trauer auf Abstand gehalten hatte. Die Gastgeberin hatte die Angstvorstellung gehabt, daß irgendein Idiot vielleicht auf die Idee kam, die Stimmung aufzulockern, die vielleicht düstere Stimmung nach einer mißglückten Jagd, nach der die Angestellten immer noch nach irgendeinem weidwund geschossenen Tier suchten, obwohl man schon längst zu Tisch saß, und fröhlich nach ihrem Sohn fragte. Oder, noch schlimmer: daß jemand sein tiefes Mitgefühl in dieser schweren Stunde ausdrückte, und so weiter.
Die Gastgeberin hatte lange nachgedacht, bevor sie einen ihrer besten Freunde, Blixen, als Tischherrn Estelle Hamiltons unterbrachte. Es war unmöglich, daß jemand Blixen nicht mochte, nicht einmal normale Leute in der Stadt. Blixen konnte sogar von seinen Gästejagden erzählen und seiner Methode, die Schüsse auf Enten zu zählen, ohne daß es langweilig wirkte.
Insoweit war aus Sicht der Gastgeberin alles gut, sogar sehr gut, als sie wie ein Habicht am schmalen Ende des langen Tischs saß und darüber wachte, daß sich alle teuflisch gut amüsierten.
Ihr war aber auch klar, daß keiner ihrer Gäste auf die verdrehte Idee kommen würde, während des Essens eine Pause zu machen, vielleicht zwischen zwei Gerichten, um in Erfahrung zu bringen, wie die Volksabstimmung verlaufen war. Die Gäste hatten immerhin alle von Geburt und aus ungehemmter Gewohnheit, wie der Mittelstand aus irgendeinem Grund zu sagen pflegte, so viel Respekt vor dem Essensritual, daß sie weder Ungeduld zeigten oder gar – noch schlimmer – das Thema zur Sprache brachten. Dabei wollten alle wissen, wie es ausgegangen war. Sie waren alle davon überzeugt, daß soeben über ihr Leben und ihre Zukunft entschieden worden war; es ging um staatliche Subventionen Schwedens oder die bedeutend großzügigeren EU-Subventionen, wenn man auf dem fruchtbarsten Boden Schwedens keine Landwirtschaft betrieb.
Doch an diesem Tisch würde niemand auf die Idee kommen, darüber zu sprechen. Im Gegenteil, man widmete sich mit fast übertriebenem Enthusiasmus dem kollektiven Jagderfolg.
Der Habichtsblick der Gastgeberin suchte die Tafel ab. Die Sache mit der Doppelgräfin hatte sie geregelt. Es sah gut aus. Dabei hatte sie Johan Klingspor die Lage in vielleicht überdeutlichen Worten erklärt:
»Teufel auch, Johan, du bist doch immerhin Immobilienmakler. Da muß es dir gelingen, jeden Menschen zu charmieren. Du mußt mir in dieser Sache helfen. Halte sie bei Laune. Ich verspreche dir, daß du beim nächsten Mal eine der Freundinnen der Jungs als Tischdame bekommst, wenn du mir diesen Gefallen tust.«
Der Mann entledigte sich seiner Aufgabe, und es war gleichgültig, ob aus Loyalität und Freundschaft oder aufgrund der Zusage, beim nächsten Mal eine fünfundzwanzigjährige Blondine als Tischdame zu bekommen. Die Doppelgräfin war unter Kontrolle und schien sich sogar zu amüsieren.
Blixen hielt Estelle Hamilton mit seinem Charme in einem eisernen Griff. Alles unter Kontrolle – bis auf das, worüber niemand zu sprechen wagte.
Die Gastgeberin erkannte, daß sie die Entscheidung treffen mußte. Ihr Mann war gerade mit starkem und echtem Engagement in eine Diskussion über deutsche Wildschweine vertieft. Und die Entscheidung mußte vernünftigerweise jetzt fallen, bevor der Nachtisch aufgetragen wurde.
Sie stieß gegen ihr Glas und erreichte damit ein ebenso unmittelbares wie verblüfftes Schweigen, da von ihr im Moment ja kaum erwartet wurde, daß sie eine Rede hielt oder einen besonderen Toast ausbrachte, nicht jetzt vor dem Nachtisch.
»Genossen!« rief sie aus und reckte ironisch eine klassenkämpferische Faust in die Höhe. »Ich habe einen Vorschlag zu machen!«
Damit erreichte sie sofort eine amüsierte und verblüffte Aufmerksamkeit, und die Blicke aller richteten sich auf sie.
»In diesem Augenblick kann man erfahren, wie es für Schweden gegangen ist«, fuhr sie fort. »Wir sitzen zufällig bei Tisch, wollen aber alle wissen, wie es ausgegangen ist, nicht wahr? Wir machen folgendes!«
Ihr Blick fuhr suchend um den Tisch, bis sie ihren ältesten Sohn entdeckte, der ebenfalls Claes hieß.
»Claes! Geh bitte nach oben und erkundige dich, wie die Volksabstimmung ausgegangen ist!«
Dem jungen Claes fiel es keinesfalls schwer, der Aufforderung seiner Mutter nachzukommen. Teils war er selbst von brennender Neugier erfüllt, obwohl er das mit keiner Miene verraten hatte, teils hörte er ja die gegrunzte fröhliche Zustimmung der älteren Jäger am Tisch. Er eilte unter fröhlichen Anfeuerungsrufen los, während das für den Abend angemietete Personal ein stark kalorienhaltiges Dessert auftrug, dem selbst der stärkste Sauternes kaum beikommen würde.
Als er nach seiner kurzen Kontrolle im Fernsehzimmer im Obergeschoß zurückkam, war sein Gesicht vollkommen ausdruckslos. Möglicherweise hatte sich seine Miene ein wenig verfinstert, doch das war kaum auszumachen. Jedenfalls brachte er keine Siegesbotschaft mit.
»Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte. Welche wollt ihr zuerst hören?« begann er mit angestrengter Baßstimme.
Eine erschreckte Verwunderung breitete sich am Tisch aus.
»Erst die gute Nachricht«, schlug Blixen vor.
»Alles deutet darauf hin, daß die Ja-Seite gewinnen wird«, erwiderte Claes Junior mit dumpfer Stimme. Er machte jedoch kein glückliches Gesicht dabei. Seine Worte lösten eine verwunderte Verstimmung aus, denn in dieser Gesellschaft war alles andere als hundert Prozent für Ja eine undenkbare politische Einstellung.
»Nun, was ist denn die schlechte Nachricht?« fragte seine Mutter.
»Die schlechte Nachricht ist, daß die erste Prognose für das gesamte Land soeben gekommen ist«, fuhr der Sohn mit der gleichen unergründlich verschlossenen, düsteren Miene fort. »Und sie nennt folgende Zahlen. Also die erste Prognose für das Wahlresultat im ganzen Land. Ja: fünfunddreißig Prozent. Nein: fünfundsechzig Prozent.«
Es wurde vollkommen still am Tisch.
»Du hast dich doch nicht versprochen …«, tastete sich die Schwester des Gastgebers mit einer Miene vor, die zur Hälfte Schrecken und zur Hälfte mühsamen Humor ausdrückte.
»Nein, Tante, die erste Prognose für das ganze Land sieht genauso aus, wie ich es gesagt habe«, fuhr der junge Mann mit perfekt gewahrter Miene fort. »Fünfundsechzig Prozent für nein und fünfunddreißig Prozent für ja. Das ist die erste Prognose der Computer für das ganze Land, und Computer irren sich ja nie …«
Er wurde seines Knalleffekts beraubt, weil seine Tante in Ohnmacht zu fallen schien. Sie wäre nach hinten gefallen und vom Stuhl gerutscht, wenn ihr Tischherr sie nicht mit der Geistesgegenwart des Jägers aufgefangen hätte.
»Aber dann gibt es doch keine gute Nachricht«, keuchte sie.
»Aber ja doch, Tante, gibt es doch«, fuhr der jetzt sichtbar verlegene junge Mann fort. »Die Prognose für das gesamte Land soll nämlich nur auf der Grundlage der schon ausgezählten Wahlbezirke erstellt worden sein. Und jetzt sieht es so aus … Na ja, die haben die Stimmen bisher nur in solchen kleinen Gemeinden in Norrland mit zwanzig Personen oder so fertig ausgezählt … und … na ja, das weiß ja schließlich jeder, wie die Leute da oben sind … Aber sie rechnen damit, daß es ganz anders aussehen wird, wenn die großen Wahlbezirke ausgezählt sind, und dann …«
Er verlor den Faden, weil es am Tisch vollkommen still geworden war und alle ihn anstarrten. Er hatte bei der Jagd ein Damhirschkalb geschossen und war nahe daran gewesen, ein Schwein zu erlegen, was selbstverständlich verboten war. Dann hatte er doch darauf verzichtet und den gesamten Tag im großen und ganzen gut bewältigt. Jetzt hatte er eine schwere Sünde begangen und über etwas gescherzt, worüber man nicht scherzen darf. Doch er mußte sich jetzt aus dieser Situation herauswinden. Unbedingt. Er holte tief Luft und fuhr dann schnell fort:
»Eigentlich ist die Sache klar, Tante. Wir haben gewonnen. Die Frage ist nur, ob es am Ende zweiundfünfzig zu achtundvierzig zu unseren Gunsten stehen wird oder ob das Verhältnis noch besser wird, aber gewonnen haben wir.«
Was er sagte, überzeugte nicht. Alle am Tisch taten, als akzeptierten sie seine Erklärung, doch niemand machte ein richtig frohes Gesicht. Murmelnd kehrte man zu den Speiseritualen zurück.
Später, gegen halb elf, als die Zukunft der Nation definitiv entschieden sein mußte, begaben sich alle Anwesenden ohne jedes Anzeichen der Ungeduld ins Obergeschoß, in die Regionen der Kinder, in der Dinge wie Fernsehen und Computerspiele gehalten wurden. Man schaltete das erste Programm ein, um zu sehen, ob es eine Wahlprognose gab.
Zum Sitzen wurde es eng. Das Fernsehzimmer war schließlich nur für die Familie gedacht. So mußten einige Stühle hereingetragen werden, damit die ältesten weiblichen Verwandten gut sitzen und sehen konnten. Und als schließlich jeder einen Sitzplatz hatte und auch der Gastgeber saß, der sich bislang unten in der Küche aufgehalten hatte, um dort etwas zu erledigen, wurde das Fernsehgerät eingeschaltet.
Als erstes bekam man den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten zu sehen, der sichtlich erleichtert und glücklich aussah. Nach einigen Sekunden wurde klar, daß es sich um ein Sieges-Interview handelte. Der Regierungschef sagte, es sei für Schweden so etwas wie eine Schicksalsstunde gewesen, doch jetzt empfinde er tiefe Erleichterung. Gleichzeitig werde er jedoch unermüdlich daran weiterarbeiten, die Verliererseite davon zu überzeugen, daß der Wahlausgang für Schweden das Beste sei.
Darauf wurde der sozialdemokratische Ministerpräsident mit spontanem und fast südländisch begeistertem Beifall des Publikums im Raum bedacht, das ihm normalerweise oder vielmehr weder früher noch später je Beifall zollen würde.
Darauf folgte eine, wie es schien, routinemäßig präsentierte Prognose für das Land insgesamt. Wie es hieß, bestätige sie nur das, was man schon wisse. Der Sieg der Ja-Seite sei völlig sicher. Nichts könne das Endergebnis mehr beeinflussen. Die Frage sei nur, wie hoch der Sieg ausfallen werde. Die Tante, die bei dem kühnen Scherz ihres Neffen vorhin fast in Ohnmacht gefallen wäre, strahlte jetzt wie ein Kind am Heiligen Abend. Alle Anwesenden faßten sich bei den Händen, als wollten sie sich gegenseitig gratulieren. Der Gastgeber, der dies schon geahnt hatte, stahl sich schnell hinaus und kehrte mit einem Tablett zurück, auf dem vier Flaschen Champagner standen. Ihm folgten zwei der für den Abend angeheuerten Kellnerinnen und Abwäscherinnen mit Gläsern, die sie schnell verteilten, während der Gastgeber einschenkte. Er verschüttete den Champagner achtlos, so wie es bei besseren Herrschaften üblich ist, wenn etwas mit Champagner gefeiert werden soll.
Dann hoben alle ihre Gläser und prosteten, wenn auch nicht ganz klar war, worauf, ob nun auf das Vaterland, die selten gelungene Jagd, die jetzt zu erwartenden Subventionen für stillgelegte Flächen oder auf etwas ganz Allgemeines: Das Glück war jedoch vollkommen. Ein perfekter Abschluß eines höchst gelungenen Jagdtages auf Vrångaholm, eines Tages, der Thotten zufolge »in die Geschichte eingehen würde«.
Was er auch tat.
Im nächsten Augenblick traten zwei Männer in dunkler Kleidung und Wollkapuzen durch die Tür. In den Händen hielten sie Schrotgewehre des Typs Pump Action; sämtliche acht Männer im Zimmer bemerkten es sofort, da es ein Typ Schrotgewehr war, den kein Gentleman auch nur im Traum verwenden würde.
Einer der beiden Eindringlinge feuerte einen Schuß an die Decke ab, so daß dreihundert Jahre alter Stuck wie weißer und schwarzer Schnee auf die Anwesenden herabrieselte. Dann schrie er auf englisch, alle sollten vollkommen still sitzen bleiben.
Alle kamen seinem Befehl sofort nach. Es war vollkommen still im Zimmer. Falls jemand geglaubt hatte, dies sei ein eigenartiger Scherz, so war diese Vorstellung jetzt verflogen. Es war ein Alptraum, aber trotzdem Wirklichkeit, und das war im ganzen Raum zu spüren und auch dem Stuck anzusehen, der wie Schnee oder glitzernder Tand im Haar derer lag, die den Männern am nächsten saßen.
Die beiden Männer sahen sich sorgfältig um. Danach schoß der eine, der an der Tür stand, der Doppelgräfin direkt in die Brust, lud mit einer schnellen Bewegung der linken Hand nach und feuerte einen weiteren Schuß auf sie ab, als sie schon dabei war, vom Stuhl zu fallen. Sie zappelte noch einige Sekunden krampfhaft mit dem rechten Bein und blieb dann reglos liegen.
Jetzt richteten die beiden Männer ihre Waffen auf die zusammengedrängt sitzende Gesellschaft. Einer der beiden, der einige Schritte vorgetreten war, hob warnend die Hand zum Zeichen, daß alle sich still verhalten sollten. Er gab seinem Kollegen ein Zeichen. Dieser faßte seine Waffe mit beiden Händen und richtete sie auf die Mitte des Tischs mit den Champagnergläsern, während er selbst behutsam einen Zettel aus der Tasche zog, darauf starrte und unmittelbar danach Estelle Hamilton mit drei Schuß tötete; er repetierte so schnell, daß es den Anschein hatte, als hätte er nur einmal gefeuert. Dann hob er erneut warnend die Hand. Vermutlich sollte es bedeuten, daß alle die Ruhe bewahren sollten. Es folgte ein Kopfnicken zu seinem Kollegen, worauf dieser durch die Tür verschwand. Im nächsten Augenblick folgte der zweite Mann und schlug die Tür hinter sich so hart zu, daß einige Deckenleisten zu Boden fielen.
Nachdem die Tür zugeschlagen worden war, dauerte die Stille noch höchstens zwei Sekunden an. Dann stürzten die Männer zu den beiden erschossenen Frauen, brüllten einander Befehle zu und versuchten, mit der gleichen kalten Präzision zu handeln wie zuvor bei dieser selten gelungenen Schloßjagd in Schonen.
Auf der Polizeiwache in Ystad herrschte wie erwartet friedliche Ruhe. Es war eine allgemeine Erfahrung bei der Polizei, daß die Kriminalität an bestimmten Wochenenden und gerade an Wahltagen zu sinken pflegte. Kriminalkommissar Kurt Wallander hatte dieses Problem mit seinen beiden Kollegen, die an diesem Abend Dienst hatten, eher zerstreut diskutiert. Man war zu keiner spontanen Erklärung gekommen, hatte aber darüber gewitzelt, daß die Klientel der Polizei immerhin einen gewissen Respekt vor der demokratischen Grundordnung an den Tag lege. Obwohl die Ruhe eher darauf zurückzuführen sei, daß überall Menschen unterwegs waren und die Leute sich nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause hielten, um im Fernsehen den Wahlabend zu verfolgen. Und im Gegensatz zu Weihnachten erfordere ein Wahlabend nicht die gleich große Einnahme von Alkohol, was die naheliegendste Erklärung dafür sei, daß selbst Delikte wie das Verprügeln von Ehefrauen und häusliche Schlägereien im Verhältnis zu gewöhnlichen Wochenenden abnahmen.
Kurt Wallander blieb allein im Fernsehzimmer sitzen und versuchte Argumente gegen die Versicherung der Experten zu finden, daß das Ganze entschieden sei. Er hatte am Nachmittag seine Stimme abgegeben, und da er sich nach langem Zögern dazu entschlossen hatte, mit nein zu stimmen, fühlte er sich jetzt auf unklare Weise verletzt, weil eine Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht war, daß er unrecht hatte. Vielleicht war es so, na wenn schon. Aber wie konnte mehr als die Hälfte der Bevölkerung es wissen?
Die Bürokratisierung, dachte er müde. Die muß letztlich das stärkste Argument für nein sein. Man brauchte ja nur den Versuch zu machen, das Ganze in der eigenen Welt zu sehen, um zu begreifen, was passieren konnte; als ob er nicht selbst seinen Polizeidirektor Björk als höchste entscheidende Instanz hätte, wenn es eilig war, als wäre es wirklich notwendig, daß Björk sich zunächst an einen noch höheren Vorgesetzten in Malmö wenden mußte, der wiederum seine Vorgesetzten in Stockholm anrief, der allerdings nicht gestört werden durfte, weil er gerade an einem wichtigen Essen teilnahm. Ungefähr so würde es jetzt vielleicht werden, wenn auch für ein ganzes Land.
Er hätte seinen Bereitschaftsdienst ebensogut zu Hause in der Mariagatan ableisten können. Er brauchte ja nicht lange, um zur Wache zu kommen, wenn etwas passierte. Die Wochenenden neigten jedoch dazu, ihn melancholisch zu machen. Er versuchte, das Fernsehen zu vermeiden, da er so leicht dabei hängenblieb und den ganzen Abend vor dem Bildschirm auf dem Sofa hockte, wenn er erst einmal angefangen hatte. Aus ungefähr den gleichen Gründen versuchte er auch, hochprozentige Getränke zu meiden.
Als er sich nach dem letzen Kopenhagener auf dem Tisch vor sich streckte, spannte es ein wenig in der Taille. Er lächelte zufrieden, weil er es gut fand, allmählich sein normales Gewicht zurückzugewinnen, als normalisierte auch das seinen Gemütszustand. Er war jetzt dabei zu genesen, redete sich aber oft ein, daß es noch längst nicht vorbei war.
Als er den Kopenhagener gerade zögernd zum Mund führte, läutete das Telefon neben ihm. Mit einer dankbaren Grimasse warf er das süßliche Gebäck von sich, wischte sich die Finger und nahm den Hörer ab.
Die Mitteilung, die, man ihm jetzt machte, war knapp und klar. Doch der Inhalt war so geartet, daß kein normal gebauter Mensch so etwas mitteilen und dennoch so klar und beherrscht sprechen konnte, als ginge es nur darum, einen kleineren Verkehrsunfall zu melden. Wallander fühlte sich genötigt nachzufragen.
»Können Sie so nett sein, das zu wiederholen«, sagte er langsam.
»Wie ich gerade sagte«, teilte ihm die Stimme am anderen Ende mit einem kleinen Anflug von Irritation mit, »hier spricht Graf Claes Peiper auf Vrångaholm. Zwei meiner Essensgäste sind vor einer Minute erschossen worden. Die Schützen waren maskiert. Es waren zwei Täter, die englisch sprachen und mit Schrotgewehren des Typs Pump Action geschossen haben.«
»Haben die Täter den Tatort verlassen?« fragte Kurt Wallander.
»Natürlich«, entgegnete der andere gemessen. »Wir hörten einen Wagen, der in Richtung Snogeholm verschwand.«
»Sind alle anderen noch am Tatort?«
»Ja, natürlich.«
»Gut. Wir sind in zwanzig Minuten da. Ich schicke Krankenwagen. Bitte versuchen Sie, am Tatort nicht die Spuren zu verwischen«, erwiderte Kurt Wallander schneidiger, als er vorgehabt hatte. Da war etwas in der Stimme dieses Grafen, was ihm nicht gefiel. Er hätte einem normalen, anständigen, verzweifelten und verwirrten Staatsbürger den Vorzug gegeben.
Er legte auf, riß sofort den Hörer wieder hoch und alarmierte den Bereitschaftsdienst im Krankenhaus von Ystad. Danach ging er auf sein Zimmer und nahm die Liste der diensthabenden Beamten an sich, die er bei seinem Eintreffen nicht gelesen hatte. Er war davon ausgegangen, daß an einem solchen Abend nichts passieren würde, was die Kriminalpolizei betraf. Während er in der Liste blätterte, rief er die Einsatzzentrale der Malmö-Polizei an, da sie die einzigen im südwestlichen Schonen waren, die einen größeren Einsatz mit Straßensperren organisieren konnten.
Dann sah er zu seiner Zufriedenheit, daß Ann-Britt Höglund für dieses Wochenende als erste auf der Liste stand.
»Hej, Ann-Britt, hier Kurt. Bist du nüchtern?« sagte er in fast munterem Tonfall, nachdem sie abgenommen hatte. Sie erlaubte sich sofort zu bezweifeln, daß er es war, doch er tat diese Diskussion schnell ab und sagte, er werde sie in drei Minuten abholen, und dann würde sie erfahren, worum es gehe. Dann legte er auf, ohne eventuelle Proteste abzuwarten.
Als er vorfuhr, stand sie auf dem Kiesweg vor dem Haus. Sie trug Sportschuhe, dunkelblaue lange Hosen und eine dicke hellblaue wattierte Jacke und sah insoweit schon nach Polizistin aus. Und sie war ohne Zweifel nüchtern, vielleicht auch sauer, ob das nun an ihm lag oder dem Wahlergebnis. Sie setzte sich in den Wagen und grüßte nur mit einem kurzen Kopfnicken.
»Nun?« sagte sie auffordernd, als er ein paar Straßenblocks gefahren war. »Der Teufel soll dich holen, wenn es nichts Wichtiges ist.«
»Das ist es natürlich«, erwiderte er betont ruhig. »Auf Vrångaholm hat es einen Doppelmord gegeben. Zwei unbekannte maskierte Täter, die englisch sprachen, sind ins Schloß eingedrungen und haben zwei Essensgäste mit Schrotgewehren erschossen.«
»Essensgäste?« fragte sie und warf ihm einen forschenden Blick zu. »Wieso Essensgäste?«
»Na ja, der Mann, der mich anrief, der Gastgeber, hat sich so ausgedrückt«, knurrte Wallander mißbilligend. »Er hat also nicht gesagt, zwei Männer oder zwei Frauen seien erschossen worden, sondern nur zwei Essensgäste. Und jetzt sollen wir beiden Hübschen nämlich einen Besuch in der feinen Welt machen, in der man Essensgast ist, wenn man mit einer Schrotflinte erschossen wird.«
Er trat aufs Gaspedal und gab ihr mit einem Kopfnicken zu verstehen, sie solle das Blaulicht aufs Wagendach praktizieren. Er hatte während seines langen unbezahlten Urlaubs noch nicht gelernt, all die neuen Dinge zu beherrschen, die inzwischen entwickelt worden waren. Anschließend bat er sie, per Funk mit der Einsatzzentrale in Malmö und den Diensthabenden zu Hause in Ystad Kontakt aufzunehmen, um herauszufinden, was inzwischen angelaufen war.
Aus Malmö erfuhren sie, daß Einsatzwagen von Malmö und Lund unterwegs seien und daß in der angegebenen Fluchtrichtung bald einige Straßensperren fertig sein würden.
Von Fluchtrichtung konnte allerdings kaum die Rede sein, wie sich herausstellte, als Ann-Britt Höglund die Karte des Polizeibezirks von Ystad studierte, die nach neuester Dienstanweisung in jedem Einsatzwagen mitgeführt werden sollte. Der Maßstab war jedoch so groß, daß man nur ein flatterndes Blatt Papier in der Hand hatte, wenn man beim Fahren die Karte zu lesen versuchte. »In Richtung Snogeholm« konnte alles mögliche bedeuten und sagte im Grunde nur aus, daß der Wagen mit den beiden Tätern sich auf dem einzig möglichen Weg vom Tatort entfernt hatte, vermutlich auf dem gleichen Weg, auf dem die Männer auch gekommen waren.
Von der Wache in Ystad erfuhren sie nichts, was mit der angelaufenen Jagd zu tun hatte. Wahrscheinlich wollten die großen Jungs in Malmö alle wichtigen Dinge selbst in der Hand behalten. Seit sie Ystad verlassen hatten, hatte nur jemand per Handy angerufen und einen scheußlichen Autounfall kurz vor Snogeholm gemeldet; ein PKW sei bei hoher Geschwindigkeit mit einem Traktor zusammengestoßen, der offenbar von einer Stichstraße auf die Hauptstraße gefahren sei. Der Traktor sei umgekippt, und es sei unklar, wie es um die Beteiligten stehe, da der Anrufer nicht gewagt habe, sich an Ort und Stelle davon zu überzeugen. Die Wache in Ystad habe in Sjöbo zusätzliche Krankenwagen alarmiert, die jetzt unterwegs seien.
»Wie weit vom Tatort entfernt ist es zu diesem Autounfall gekommen?« fragte Wallander, als seine Kollegin die laute und durch Knacken gestörte Unterhaltung per Funk beendet hatte.
»Ein paar Kilometer oder so«, erwiderte sie nach einer langen raschelnden Konsultation der Karte.
Ann-Britt Höglund sah ihm an, was er dachte und welche Entscheidung er jetzt traf. Sie bewunderte Wallander, gerade weil er mit so etwas wie Instinkt gegen jede beliebige polizeiliche Dienstanweisung verstieß, nämlich in dem Moment, in dem er davon ausging, daß das die Sache wirklich voranbringen würde. Das war eine bemerkenswerte Eigenschaft, fast so etwas wie ein sechster Sinn und vermutlich etwas, was man nicht ohne weiteres lernen konnte, wie sehr man sich auch darum bemühte, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Obwohl es tatsächlich darauf ankam, recht zu haben, wenn man so handelte wie Wallander. Als sie zum letzten Mal gemeinsam an einer großen Sache gearbeitet hatten, hatte er bei kleinlicher Betrachtungsweise in der Schlußphase eines Fahndungsauftrags drei oder vier Verbrechen hintereinander begangen: Einbruch, Nötigung und noch ein paar Kleinigkeiten. Hätte er am Ende nicht recht gehabt, wäre er in den Knast gegangen und gefeuert worden, doch da er recht hatte und die Täter kurz nach der Wallanderschen Deliktserie hatten gefaßt werden können, hatte sich niemand beklagt.
Sie dachte, daß ein Mensch, der sich so verhielt, entweder ein unendliches Selbstvertrauen oder eine fast gleichgültige Einstellung zu sich selbst haben mußte. Und was Wallander anging, war unendliches Selbstvertrauen leicht auszuschließen.
Doch jetzt raste er also zu einem trivialen Autounfall statt zu einem Tatort, an dem sich zwei Mordopfer sowie eine unbekannte Zahl von Menschen befanden, die in sowohl praktischer als auch psychologischer Hinsicht der Polizei bedurften. Dennoch empfand sie eine schwer zu erklärende Zuversicht.
Als sie auf der kurvenreichen und schmalen Asphaltstraße ganz in der Nähe des Schlosses Snogeholm am Unglücksort anhielten, hatte sich dort schon eine kleine Gruppe ratloser Gaffer eingefunden. Ann-Britt Höglund hatte das Blinken der gelben Warnleuchten der Autos schon von weitem gesehen.
Als Wallander seinen Wagen so parkte, daß er den eigentlichen Unfallschauplatz von der Gruppe der Gaffer trennte, spürte er, daß er richtig gehandelt hatte. Er nickte seiner jungen Kollegin kurz zu, zog die Handschuhe an und nahm eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach. Dann stiegen beide aus. Sie ging auf die Gruppe der Neugierigen und er auf den umgekippten Traktor zu.
Der Motor des Traktors lief immer noch, doch die Scheinwerfer brannten nicht. Wallander leuchtete in die Fahrerkabine und entdeckte zu seinem Erstaunen, daß sie leer war. Er manövrierte den Oberkörper hinein, tastete nach dem Zündschlüssel und stellte den Motor ab.
Er holte tief Luft, bevor er sich der nächsten Aufgabe zuwandte. Er wußte, daß es schwierig werden würde. Der PKW war dem Traktor direkt in die Seite gefahren, und die ganze Vorderseite des Wagens war zerdrückt. Die Windschutzscheibe war von innen hinausgesprengt worden, da der Mann auf dem Beifahrersitz offenbar nicht angeschnallt gewesen war. Er war wie ein Geschoß durch die Scheibe geflogen und klebte jetzt in einer Körperhaltung in der Seite des Traktors, die keinen Zweifel daran ließ, daß er tot war. Wallander schluckte und schloß die Augen. Es fiel ihm schwer, menschliche Überreste zu betrachten.
Der Fahrer war ebenfalls nicht angeschnallt gewesen, war jedoch vom Lenkrad abgefangen worden, bevor sein Kopf die Windschutzscheibe erreichte. Möglicherweise war er noch am Leben, denn er blutete sichtlich aus einer Kopfwunde, blutete stark. Wallander sah auf die Armbanduhr. Es würde noch zehn Minuten und vielleicht länger dauern, bis ein Krankenwagen aus Sjöbo da sein konnte. Er wußte, daß er es versuchen mußte, und ging zu Ann-Britt Höglund, um sie um Hilfe zu bitten.
Inzwischen war es ihr gelungen, alle Gaffer zu verscheuchen, die sich nach und nach getrollt hatten. Der einzige Wagen, der noch da war, gehörte dem Mann, der Augenzeuge des Unfalls geworden war und die Polizei in Ystad angerufen hatte. Sie hatte die ersten notwendigen Angaben des Mannes aufgenommen, Namen und Telefonnummer und wollte ihn gerade freundlich bitten, den Schauplatz zu verlassen, als Wallander dazukam.
Als sie allein waren, wuchteten sie die Tür auf der Fahrerseite auf und zogen den verletzten Mann, der ein leises Stöhnen hören ließ, vorsichtig heraus. Bei seiner Lebensäußerung wechselten sie einen aufmunternden Blick. Offenbar gab es doch noch die Chance, dem Mann das Leben zu retten. Ann-Britt Höglund ging zum Streifenwagen zurück und holte ein paar Wolldecken, die sie auf dem Boden ausbreiteten, bevor sie ihn in Seitenlage darauflegten, was Ann-Britt auf der Polizeischule oft geübt haben mußte, da jede ihrer Bewegungen ohne Zögern erfolgte.
Anschließend durchsuchte sie die Taschen des bewußtlosen Mannes, um vielleicht etwas zu finden, was ihn identifizierte, während Wallander um den zertrümmerten Wagen herumging, um ein Kennzeichen zu finden. Als er es aufgeschrieben hatte und zum Streifenwagen zurückging, um sich nach dem Namen des Halters zu erkundigen, warf er zufällig einen Blick auf den Rücksitz. Er erstarrte, als müßte er noch einmal genau hinsehen, damit das Gehirn akzeptierte, was die Augen meldeten. Auf dem Rücksitz lagen zwei Waffen, zwei schwarze Gewehre eines Typs, den Wallander noch nie gesehen zu haben glaubte. Er machte mit einiger Mühe die hintere Tür des Wagens auf und entnahm ihm vorsichtig eine der beiden schwarzen Waffen. Als er sich zu seiner Kollegin umdrehte, richtete er unbeholfen die Mündung der Waffe auf sie, so daß sie erschrocken nach Luft schnappte. Sie hielt selbst eine große schwarze Pistole, die sie am Lauf festhielt, in der behandschuhten Hand. In der anderen hielt sie einen Paß und eine Brieftasche. Sie wedelte damit.
»Italiener«, sagte sie. »Die Pistole ist übrigens auch ein italienisches Fabrikat. Wir haben also die Täter?«
»Ja«, erwiderte Wallander tonlos. »Es sieht tatsächlich so aus.«
Im selben Moment entdeckten sie rotierendes Blaulicht, das schnell näher kam, und hörten die Krankenwagensirenen.
Auch im folgenden wich Wallander von den polizeilichen Vorschriften ab, die er nur dann befolgte, wenn es nicht ernst war. Die weitere Behandlung des nachweislich gestorbenen verdächtigen Täters konnte unter keinen Umständen ein besonderes Problem darstellen. Der Tote würde in aller Ruhe zur Gerichtsmedizin in Lund gefahren werden. Aber was jetzt den überlebenden und im technischen Sinn festgenommenen Täter anging, waren die Vorschriften schon komplizierter. Zunächst mußte man ihn in ein Krankenhaus bringen, das stand fest, wenn auch unter Polizeibewachung, da ein Laie seinen Gesundheitszustand nicht beurteilen konnte, der allem Anschein nach alles bedeuten konnte, angefangen bei einem unmittelbar bevorstehenden Tod bis zu einem schnellen und wütenden Aufwachen. Wallander sorgte dafür, daß der Überlebende in den ersten Krankenwagen gebracht wurde, zog Handschellen aus dem Handschuhfach des Streifenwagens und kettete den immer noch bewußtlosen Mann an dessen Trage fest. Dann wies er die Krankenwagenbesatzung an, zum Krankenhaus von Ystad zu fahren. Dort würden Kollegen Wallanders sie in Empfang nehmen, die er über Funk vorwarnen werde, damit sie nötigenfalls die Handschellen aufschließen könnten.
Als der erste Krankenwagen mit dem noch lebenden, aber festgeketteten Verdächtigen nach Ystad losfuhr, begannen die Männer des zweiten Krankenwagens gemächlich und scherzend damit, die Überreste des Mannes einzusammeln, der aufgrund seiner ablehnenden Einstellung gegenüber Sicherheitsgurten gestorben war. Wallander rief seinen Polizeidirektor an, schilderte kurz die Lage und beendete dann das Gespräch. Dann gab er Ann-Britt Höglund durch ein Kopfnicken zu verstehen, daß es Zeit sei aufzubrechen.
»Warum hast du das getan?« fragte sie vorsichtig, nachdem Wallander den Motor angelassen und mit kreischendem Getriebe den zweiten Gang eingelegt hatte.
»Was denn?« fragte er mit gespielter Unschuld.
»Na ja? Björk einfach so anzurufen und ihn dann aus der Leitung zu werfen?«
»Weil du und ich jetzt in Wahrheit in zwei Fällen zu ermitteln haben, und da fand ich schon, daß wir selbst entscheiden sollten, mit welchem Delikt wir anfangen.«
»Zwei Delikte?«
»Ja. Wir haben hier den Fall des unbemannten Traktors vorliegen, der ohne Licht auf eine größere Straße hinausfährt, auf der sich unsere nichts Böses ahnenden südländischen Täter auf der Flucht befinden, oder wie man das nennen soll. Zu ihrem Pech waren ihnen einige der besonderen Verkehrsgefahren des ländlichen Schonen unbekannt.«
»Wie etwa unbemannte Traktoren, die plötzlich ohne Licht auftauchen?«
»Genau. Der Fahrer dürfte jetzt wohl zu Hause sein, um seiner Frau als künftiger Zeugin einzuschärfen, daß er erst jetzt damit begonnen hat, Schnaps zu trinken – natürlich im Schockzustand. Doch als er fuhr, war er selbstverständlich nüchtern.«
»Das sind aber mehrere Delikte –Trunkenheit am Steuer, fahrlässige Tötung, grob verkehrswidriges Verhalten und Unfallflucht«, sagte sie in einem Tonfall, der Wallander eine Spur zu hochnäsig vorkam.
»Langsam, langsam«, sagte er, »wir sollten nicht so kleinlich sein. Unser zweites Verbrechen ist nämlich Mord, und da ist die Aufklärung vielleicht wichtiger als dieser Fall von Unfallflucht. Im Grunde genommen müßten wir dem Mann dankbar sein.«
Als sie auf dem knisternden Kies des Schloßhofs vorfuhren, war das ganze Haus erleuchtet, und die gesamte Hofbeleuchtung brannte. Vor dem Haupteingang stand ein Volvo, dessen Antennen darauf hindeuteten, daß es ein ziviler Polizeiwagen war. Von anderen Polizisten war nichts zu sehen.
Wallander empfand vages Unbehagen, als er vor der drei Meter hohen Tür stand und läutete. Es wurde nicht besser, als ein junger Mann im Smoking aufmachte und Wallander auf die Idee kam, daß es eine Art Bediensteter war. Er zeigte seinen Dienstausweis, murmelte etwas davon, daß er die Leute sprechen wolle, die hier wohnten, und machte Anstalten, ins Haus zu stiefeln.
Der junge Mann erstarrte, als hätte er eine Ohrfeige erhalten, fing sich jedoch schnell wieder und streckte Wallander eine Hand entgegen.
»Willkommen, Herr Kommissar, ich heiße Claes Peiper«, sagte er. Wallander fühlte sich wie ein Idiot.
»Aber du hast doch nicht angerufen?« fragte er mißtrauisch.
»Nein, Herr Kommissar, das war mein Vater. Er heißt auch Claes. Wenn Sie mir folgen wollen … ach nein, das ist nicht nötig, ziehen Sie sich nicht die Schuhe aus.«
Der junge Mann ging eine breite steinerne Hallentreppe hinauf. Wallander und Ann-Britt Höglund warfen einander einen fragenden Blick zu und folgten ihm; keiner von ihnen hatte Anstalten gemacht, die Schuhe auszuziehen.
Sie wurden durch ein paar große Räume in einen Salon geführt, in dem ein totales Chaos herrschte, weil annähernd zwanzig Personen durcheinanderredeten. Wallander und Ann-Britt Höglund blieben zögernd in der Türöffnung stehen. Die meisten Männer im Raum trugen einen Smoking, und sämtliche Frauen waren festlich gekleidet. Es hätte eine strahlende Gesellschaft sein sollen. Der junge Mann trat zu einem der Smoking tragenden Männer, flüsterte etwas und nickte mit dem Kopf zu Wallander und Ann-Britt Höglund hin, die immer noch in der Türöffnung standen und sich zutiefst unentschlossen fühlten. In diesem Moment wurden sie von zwei Männern entdeckt, die keinen Smoking trugen, sondern gewöhnliche dunkle Anzüge und zudem Hörgeräte, wie Wallander zunächst glaubte. Die beiden Männer unterhielten sich gerade aufgeregt mit zwei Frauen. Diese saßen, während sie selbst über sie gebeugt dastanden. Als sie jetzt die neuen Besucher entdeckten, unterbrachen sie ihre Unterhaltung und gingen selbstsicher auf Wallander und Ann-Britt Höglund zu, während sie mit einer komischen gleichzeitigen Bewegung in ihre Innentaschen griffen, um ihre Dienstausweise zu zücken.
»Högefjärd, Säk«, meldete er der erste kurz angebunden. »Und ihr seid Kollegen von hier, was?«
»Kommissar Wallander, Morddezernat Ystad. Dies ist meine Kollegin Ann-Britt Höglund«, erwiderte Wallander zögernd. »Was hat denn die Sicherheitspolizei hier zu suchen? Wie ist es möglich, daß ihr so schnell herkommen konntet …?«
»Oh, mach dir deswegen keine Sorgen, wir haben die Lage unter Kontrolle, erwiderte der eine Sicherheitsbeamte. »Wir haben die ganze Sache in der Hand. Verstärkung ist unterwegs«, erwiderte der zweite Säpo-Mann.
Wallander begriff zunächst nichts. Dann wurde er plötzlich wütend?«
»Was habt ihr in der Hand?« knurrte er. »Dies hier ist, wenn ihr erlaubt, der Polizeidistrikt Ystad, und hier hat die Polizei von Ystad alles in der Hand, und das sind wir! Laßt mich also für den Anfang fragen, was ihr hier zu suchen habt, und dann will ich eure Namen erfahren.«
»Personenschutz«, erwiderte der eine Sicherheitsbeamte, als verriete er damit etwas streng Geheimes.
»Personenschutz? Für wen denn?« fragte Wallander und hob die Stimme, so daß das Gemurmel im Raum plötzlich erstarb.
Er erhielt zunächst keine Antwort, was ihn noch wütender machte.
»Personenschutz für wen, habe ich gefragt?« brüllte er fast.
»Ja, also, das Objekt … eine der Ermordeten war unser Objekt. Da oben im Obergeschoß … aber wir haben den Tatort gesichert«, erwiderte der zweite mit demonstrativ gesenkter Stimme.
Wallander glaubte zunächst, sich verhört zu haben. Ein nervöses unterdrücktes Gekicher seiner jungen Kollegin überzeugte ihn jedoch davon, daß er sah, was er sah, und hörte, was er hörte.
»Mit euch müssen wir uns später beschäftigen«, seufzte er, schob die beiden beiseite und stiefelte mit mühsam erzwungener Selbstsicherheit mitten in den Raum und trat zu dem Mann hin, von dem er jetzt annahm, daß es Claes Peiper der Ältere sein mußte, folglich der Mann, der angerufen und den Mord gemeldet hatte. Der Mann erhob sich sofort und gab Wallander mit einer weichen Verbeugung die Hand.
»Sie müssen Claes Peiper sein«, sagte Wallander. »Ich bin Kommissar Wallander von der Polizei Ystad. Wir haben vorhin miteinander telefoniert.«
»Sie haben sich reichlich Zeit gelassen, um herzukommen. War das Haus schwer zu finden?« fragte der hochgewachsene schnauzbärtige Mann. Er trug ebenfalls einen Smoking. Sein Tonfall war entweder Ironie oder einfach nur freundliche Höflichkeit. Wallander konnte es nicht ausmachen.
»Wir wurden unterwegs aufgehalten«, brummte er. »Sagen Sie, können wir unter vier Augen sprechen und uns zunächst zum Tatort begeben, nur Sie und ich?«
»Natürlich … Aber die Wachtmeister hier sagen, der Tatort sei … gesichert, sagten sie, wenn ich mich recht erinnere.«
»Genau«, bestätigte Wallander und machte gleichzeitig eine Geste, die »Sofort mitkommen« bedeutete. »Und das bedeutet, daß nur Polizeibeamte den Tatort betreten dürfen. Wenn Sie so freundlich sein wollen?»
Als sie die breite Steintreppe zum Obergeschoß hinaufgingen, erst der Gastgeber, dicht gefolgt von Wallander und Ann-Britt Höglund einige Schritte dahinter, verfluchte sich Wallander wegen des albernen Ausdrucks »Wenn Sie so freundlich sein wollen«. Er wußte nicht, woher er plötzlich diesen Ausdruck hatte, hatte jedoch das Gefühl, daß es sich wie ein Zitat aus irgendeinem schwedischen Kitschfilm anhörte.
Die Tür zum Fernsehsalon im Obergeschoß war mit einem roten Seidenband versperrt, das jemand mit Heftzwecken am Türrahmen befestigt hatte. Wallander riß die provisorische Absperrung irritiert herunter und griff nach der Türklinke. Dann überlegte er es sich anders und wandte sich an den finster dreinblickenden, aber dennoch erstaunlich kühlen und gemessenen Gastgeber.
»Wenn es Ihnen unangenehm ist, möchte ich nicht darauf bestehen, aber ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie mit mir hineingingen und uns erklärten, was geschehen ist«, sagte er mit einer gezwungenen Höflichkeit, die ihn selbst erstaunte; es gab nicht den geringsten Anlaß, anders aufzutreten als so höflich und feinfühlig wie nur möglich.
»Natürlich ist es nicht angenehm, aber etwas muß schließlich geschehen, nicht wahr?« erwiderte der Gastgeber leichthin und zeigte mit einer Handbewegung auf die Tür. »Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und was nicht.«
Wallander öffnete die Tür und trat ein. Er ging mit ein paar langsamen Schritten ins Zimmer und überblickte die Szene. Man hatte die beiden Leichen mit weißen Laken bedeckt. Bei der Leiche, die der Tür am nächsten lag, war Blut durch das Laken gesickert. Die Einrichtung des Zimmers war moderner als die, die er im Erdgeschoß gesehen hatte. Es sah komisch überladen aus, da man eine große Zahl antiker Stühle hereingetragen hatte, wie sie in den übrigen Zimmern des Schlosses herumstanden. Es sah aus, als hätten sich alle hier zu einer Art Kinovorstellung vor dem Fernseher versammelt, den man in die Mitte des Raums gerollt hatte. Überall lagen Stuck und Putz herum, als hätte es geschneit. Wallander hob intuitiv den Blick und sah an der Decke ein großes Einschußloch mit schwarzen Pulverspuren. Auf einem Klavier standen vier Champagnerflaschen. Zwei waren leer, eine halb voll, und eine vierte war gerade erst aufgemacht worden.
Plötzlich ging Wallander auf, was die Leute hier getan hatten, und die Erkenntnis traf ihn mit einer ebenso unmotivierten wie heftigen Wut. Sie hatten also hier gesessen, um sich ihren Sieg in der Volksabstimmung anzusehen. Er schluckte und sah sich um. Eine Zeitlang bekämpfte er mit Mühe seinen aufflammenden Zorn, bevor er sich fähig glaubte, in einem normalen Tonfall Fragen zu stellen. Der Gastgeber stand ruhig und abwartend hinter ihm und hatte die Hände auf den Rücken gelegt.
»Wir wollen versuchen, das Geschehen zu rekonstruieren«, begann Wallander mit mühsamer Ruhe. »Sie haben heute abend hier offenbar ein Essen gegeben, wie ich der Kleidung der Anwesenden entnehme. Nach dem Essen sind Sie nach oben gegangen, um fernzusehen. Ich nehme an, daß es um das Ergebnis der Volksabstimmung ging?«
»Das stimmt … ja, viele von uns interessierten sich dafür. Wir wollten ja gern erfahren, wie die Sache ausgegangen war«, erwiderte der Gastgeber verbindlich, immer noch mit den Händen auf dem Rücken.
»Wie spät war es zu diesem Zeitpunkt?« unterbrach ihn Wallander.
»Zwischen zwanzig nach zehn und halb elf.«
»Aber die Wahl war zu diesem Zeitpunkt doch längst entschieden?«
»Das ist möglich, aber wir hatten ja ein Festessen.«
»Verzeihung?«
»Wir hatten ein Essen. Wir saßen bei Tisch, und das Essen war erst nach zehn zu Ende«, erwiderte der Gastgeber mit gerunzelter Stirn, da er offenbar nicht verstehen konnte, daß Wallander die Selbstverständlichkeit seiner Argumentation nicht aufging.
Wallander begriff immer noch nichts. Er sah jedoch die Falte auf der Stirn und beschloß, diese Art der Befragung bis auf weiteres aufzugeben und gleich zur Hauptsache zu kommen.
»Und was geschah, als die Täter das Zimmer betraten?« fragte er abrupt.
»Zwei maskierte Männer kamen dort herein … durch diese Tür. Einer blieb an der Tür stehen, der zweite ging bis etwa hierher … Der Mann, der hier auf dem Teppich stand, feuerte sofort einen Schrotschuß an die Decke. Das Ergebnis sehen Sie selbst.«
»Wo standen Sie in diesem Augenblick?« fragte Wallander.
»Ich stand dort drüben, bei den Champagnerflaschen«, entgegnete der Gastgeber ruhig und zeigte. »Ich war gerade dabei, weitere Gläser zu füllen.«
»Sie standen also fünf Meter von diesem Mann entfernt?«
»Es sind dreieinhalb Meter, aber dort habe ich gestanden.«
»Nun, und was geschah dann?«
»Der Mann, der hier stand, etwa hier, wo wir uns jetzt befinden, richtete seine Waffe auf uns und forderte uns in sehr entschlossenem Ton auf, uns ruhig zu verhalten. Angesichts der Situation vielleicht ein bißchen übertrieben …«
»Aha, und was passierte dann?« fragte Wallander, der mit einer unmotivierten Aggressivität zu kämpfen hatte.
»Der Mann, der an der Tür stand, eröffnete dann ohne jede Vorwarnung das Feuer. Er erschoß die Doppelgrä … ähm … er erschoß die Gräfin Wachtmeister-Hamilton mit zwei gutgezielten Schüssen …«
Er zeigte auf die hintere der beiden zugedeckten Leichen, und Wallander folgte mit dem Blick dem ausgestreckten Arm des Mannes.
»Mit zwei Schüssen, sagten Sie?«
»Ja. Er gab einen Schuß ab. Ein guter Treffer. Dann repetierte er und feuerte erneut, aber ohne zu repetieren.«
»Hatten Sie den Eindruck, daß die Schüsse tödlich waren?«
»Ohne Zweifel. Beides waren gute Treffer. Herz-Lunge, sicher grobe Schrotkugeln.«
»Was haben Sie und Ihre Gäste da getan?«
»Wir haben absolut nichts getan. Zwei Schrotgewehre des Typs Pump Action besitzen eine große Überzeugungskraft.«
»Schrotgewehre des Typs Pump Action? Sind Sie da absolut sicher?« fragte Wallander, der jetzt mit seinem Mißtrauen gegenüber der Exaktheit der ihm gemachten Angaben kämpfte.
»Ja, dessen bin ich sicher«, entgegnete der Gastgeber mit dem Anflug eines feinen Lächelns, das erneut Wallanders Wut aufflammen ließ. Da der Gastgeber ihm seine Reaktion offensichtlich anmerkte, folgte schnelle eine begütigende Erklärung.
»Herr Kommissar, Sie müssen schließlich bedenken, daß sämtliche Männer, die sich hier im Raum aufhielten, mit Waffen sehr vertraut sind«, fuhr er diplomatisch fort. »Ich meine, es war immerhin ein Jagdessen.«
»Was geschah dann?« unterbrach ihn Wallander abrupt.
»Der Mann, der hier mitten im Raum stand, hob die Hand, zog etwas aus der Tasche, das aussah wie … ja, es war sogar ein Zeitungsausschnitt. Er sah ihn an, zerknüllte ihn und eröffnete dann erneut das Feuer. Jetzt schoß er auf die Gräfin Estelle Hamilton die also dort liegt … Es ging sehr schnell. Er muß ein sehr guter Schütze sein.«
»Und sie starb auch auf der Stelle?«
»Soweit wir es beurteilen konnten, ja.«
Wallander ging zögernd ein paar Schritte ins Zimmer und trat dabei auf eine leere Schrotpatrone. Er bückte sich und hob sie erstaunt mit einem Kugelschreiber auf, den er in die verrußte Öffnung steckte, und hielt sie dann dem Gastgeber hin.
»Die Täter haben sich nicht die Mühe gemacht, ihre leeren Geschoßhülsen einzusammeln«, stellte er fest.
»Nein, es muß hier irgendwo im Zimmer vier leere Schrotpatronen geben. Das, was Sie da in der Hand halten, ist wahrscheinlich eine davon. Darf ich mal sehen?«
Wallander hielt ihm zögernd seinen Kugelschreiber mit der leeren Schrotpatrone hin. Es wurmte ihn, daß es Schrotpatronen hieß und nicht Geschoßhülse. Der Gastgeber zog langsam eine Lesebrille aus der Brusttasche und studierte den Text auf der Patrone, während er sie höflich drehte. Dann nickte er nachdenklich und bemerkte, es verhalte sich etwa so, wie er angenommen habe.
»Und was haben Sie angenommen?« fragte Wallander.
»Nun, es ist sogenannter Hirsch-Schrot, der für die Hirschjagd in Schweden nicht zugelassen ist. Neun große Bleikugeln in jeder Patrone, die auf kurze Entfernung sofort tödlich wirken. Sogar bei Wildschweinen, falls Sie verstehen …«
Wallander verstand nicht, hatte andererseits aber auch keinen Anlaß, die Expertise des Gastgebers anzuzweifeln. Er hielt Ann-Britt Höglund seinen Fund hin und gab ihr durch ein Kopfnicken zu verstehen, sie solle die restlichen Patronen aufsammeln. Sie streifte sich einen Plastikhandschuh über und zog dann noch eine Plastiktüte aus einer ihrer geräumigen Jackentaschen. Dann machte sie sich sofort ans Werk.
»Die Wachtmeister dort unten sagten, niemand dürfe hier im Raum etwas anrühren …« bemerkte der Gastgeber mit einer Höflichkeit, der ein vorsichtiger Protest die Waage hielt.
Das war endlich ein Tonfall, der Wallander zusagte.
»Warum sagen Sie Wachtmeister?« fragte er ebenso plötzlich wie scheinbar unbegründet amüsiert.
»Nun ja, hm … Estelle, ich meine die Gräfin Hamilton, die diese … Herren bei sich hatte, sie nannte sie Wachtmeister.«
»Ich verstehe«, sagte Wallander. »Wir werden später darauf zurückkommen, doch lassen Sie mich zunächst fragen, ob Sie glauben, die von den Tätern verwendeten Waffen beschreiben zu können. Überlegen Sie sorgfältig, denn das kann wichtig sein.«
»Natürlich«, entgegnete der Gastgeber gemessen und warf Wallander einen zweifelnden Blick zu, als wäre er nicht ganz sicher, ob dieser einen Scherz gemacht hatte. »Es war ein Schrotgewehr des Typs Pump Action, Kaliber zwölf, vermutlich ein amerikanisches Fabrikat. Schwarze Läufe, und die sogenannte Pumpe und der Kolben waren dunkelgrün, eventuell tarnfarben, das heißt schwarz und grün.«
»Und dessen sind Sie sicher?«
»Natürlich.«
»Und wenn wir uns dann den beiden Tätern zuwenden, was können Sie über die sagen?«
»Männer, vermutlich Ausländer, gut gekleidet. Sie trugen sogar Anzug und Krawatte. Handschuhe an den Händen. Maskiert, trugen solche Wollkapuzen mit Sehschlitzen. Gute Schützen … Vielleicht zwischen dreißig und vierzig Jahren, aber das läßt sich nur schwer sagen. Es ist schnell gegangen, sehr schnell.«
»Wie schnell?«
»Nun ja … es sind natürlich solche Augenblicke, die man als Ewigkeiten auffaßt. Aber so ist es ja selten … ich würde sagen, höchstens fünfzehn Sekunden seit dem Betreten des Raums, bis sie ihn verließen.«
Ann-Britt Höglund hatte inzwischen offenbar vier Schrotpatronen sowie einen Zeitungsausschnitt gefunden, die sie vor Wallander vielsagend hochhielt.
»Ja, so ist es …«, bestätigte Wallander. »Wie viele Schüsse sind hier drinnen abgefeuert worden?«
»Es waren sechs Schüsse. Einer an die Decke, zwei auf Gräfin Wachtmeister-Hamilton und dann drei auf Estelle Hamilton.«
»Müßten wir hier dann im Zimmer nicht sechs leere Hülsen … also sechs leere Schrotpatronen haben?«
»Nein. Das Interessante am Verhalten der Schützen war nämlich, daß sie nach ihrem letzten Schuß nicht repetierten.«
»Ich fürchte, ich kann nicht ganz folgen.«
»Ja aber … das ist doch selbstverständlich.«
Der Gastgeber machte ein resigniert fragendes Gesicht, doch Wallander schüttelte nur den Kopf über das vermeintlich Selbstverständliche, das sich zumindest ihm nicht erschloß. Da holte der Gastgeber ungeduldig Luft, spannte sich an und begann von vorn. Jetzt sprach er plötzlich wie zu einem Kind.
»Bei diesem Waffentyp funktioniert es also wie folgt: Man gibt einen Schuß ab, worauf man mit der linken Hand nachlädt. Dann wird die leere Patrone hinausgeschleudert, und eine neue rutscht in den Lauf. Der Mann, der als erster schoß, gab einen Schuß ab, lud nach und schoß erneut. Der zweite Schütze machte es genauso. Folglich müssen sich im Raum vier leere Schrotpatronen befinden.«
Wallander wurde in seinen Überlegungen unterbrochen, als sich an der zerschossenen Decke und den Wänden blaue Lichtreflexe zeigten. Dann waren die Fahrgeräusche weiterer Wagen zu hören, die auf dem Kiesweg auf das Schloß zufuhren.
»Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische«, sagte der Gastgeber, »aber müssen die … nicht hier liegen bleiben?«
»Nein«, erwiderte Wallander schnell. »Die Krankenwagenbesatzung erhält sofortigen Zutritt zum Zimmer, und danach halten wir die Absperrung nicht mehr aufrecht. Sie können mit dem Aufräumen beginnen, sobald Sie … na ja, sobald Sie es für richtig halten …«
»Unser Fernsehzimmer ist also sozusagen kein Tatort mehr?«
»Doch«, gab Wallander zögernd zurück, während ihn eine neue Attacke von Bosheit befiel. »Dieser Raum wird für immer ein Tatort bleiben. Ihre Urenkel können ihn Touristen zeigen, aber die Polizei braucht ihn nicht mehr.«
»Diese letzte Bemerkung finde ich unverschämt«, kommentierte der Gastgeber, ohne sich aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen oder die Stimme zu heben.
»Ja, das war sie«, bestätigte Wallander. »Ich bitte um Entschuldigung, aber jetzt gilt folgendes: Ich möchte Sie bitten, mit mir zu meinem Wagen hinunterzugehen, um sich zwei Waffen anzusehen. Dann wäre es mir lieb, wenn Ihre Gäste so schnell wie möglich nach Hause führen, jedoch mit einer Ausnahme.«
»Aber natürlich. Hier auf Vrångaholm haben wir der Polizei von Ystad immer zur Verfügung gestanden, zumindest in den letzten dreihundert Jahren«, entgegnete der Gastgeber mit einer ironischen Verbeugung.
Wallander erkannte, daß er die Ironie verdiente, und breitete die Arme in einer unbeholfen entschuldigenden Geste aus.
»Wir brauchen die Namen Ihrer sämtlichen Gäste und aller anderer Leute, die heute abend hier gewesen sein können oder denen bekannt war, daß Sie ein Fest gaben. Ich vermute, daß die sogenannten Wachtmeister da unten sich diese Informationen schon beschafft haben. Mir ist klar, daß es eine für Sie unangenehme Situation ist und daß … ja, wer es wünscht, kann nach Hause fahren.«
»Aber?« fragte der Gastgeber mit ruhig hochgezogenen Augenbrauen.
»Genau. Es gibt ein Aber. Ich würde mich gern mit zwei, mindestens zwei Ihrer Gäste von heute abend unterhalten, bevor sie wegfahren. Und dann möchte ich Sie wie schon gesagt bitten, mit mir zum Wagen hinauszugehen, um sich etwas anzusehen.«
Der Gastgeber antwortete nicht, sondern machte nur eine höfliche Handbewegung zur Tür. Wallander brauchte eine ärgerliche Sekunde, bis ihm aufging, was damit gemeint war: Er sollte Ann-Britt Höglund den Vortritt lassen, was er jedoch gerade nicht tat. So verfluchte er sich auf der Treppe zum Erdgeschoß.
Dort trafen sie auf die Krankenwagenbesatzung und einige Sicherheitsbeamte aus dem Polizeibezirk Malmö, die links und rechts Befehle brüllten. Wallander drängte sich durch das Gewimmel zur Krankenwagenbesatzung durch, wies sich aus und sagte den Männern, sie könnten die Leichen mitnehmen, die im Obergeschoß lägen. Sie sollten sie zum Gerichtsmedizinischen Institut in Lund fahren. Anschließend führte er Ann-Britt Höglund und Claes Peiper den Älteren durch das Gewimmel zu seinem geparkten Wagen. Er legte die Hand auf den Türgriff zum Rücksitz, überlegte es sich anders, ging zum Fahrersitz und zog ein paar Handschuhe aus der Seitentasche, die er dem Mann im Smoking überreichte.
»Ziehen Sie die Handschuhe an, und sehen Sie sich die Waffen auf dem Rücksitz an«, befahl er kurz.
Der Gastgeber zog sich die Handschuhe an, tat es jedoch mit einer erhobenen Augenbraue, was etwas betonen sollte – wahrscheinlich, daß es ihm nicht gefiel, von irgendwelchen Wachtmeistern so im Befehlston herumkommandiert zu werden. Dann nahm er eins der Schrotgewehre an sich, nickte kurz und legte es zurück.
»Ja«, sagte er. »Ich kann natürlich nicht sagen, ob gerade diese Waffen verwendet worden sind, doch es steht fest, daß es dieser Waffentyp war, dessen sich die Mörder bedienten.«
»Gut«, sagte Wallander. »Es ist also wie folgt: Wenn es stimmt, was Sie da oben gesagt haben, müßten sich in den Läufen dieser Waffen leere Schrotpatronen befinden?«
»Das läßt sich unmöglich sagen«, entgegnete der Gastgeber und hob erneut die Augenbraue. »In dem Augenblick, in dem sie das Zimmer dort oben verließen, befanden sich die leeren Patronen auf jeden Fall noch in den Läufen.«
»Nun ja«, sagte Wallander, den erneut etwas irritierte, was er nicht klar definieren konnte. »Versuchen wir es doch mal. Sie wissen ja, wie man sich anstellt, und außerdem haben Sie Handschuhe an. Können Sie einmal durchladen?«
Der Gastgeber sah ihn mit einer Miene an, die Wallander erkennen ließ, was der Mann dachte: Als würde seine Fähigkeit angezweifelt, eine Waffe durchzuladen. Vermutlich beherrschte er diese Kunst bei jeder der auf der Welt existierenden Waffen. Dann lud er durch und hielt die Waffe vorsichtig über den Rücksitz des Wagens, so daß die leere Schrotpatrone auf die Polsterung fiel und nicht zu Boden.
Wallander nickte und gab Ann-Britt Höglund ein Zeichen. Diese kramte ihre Plastiktüte hervor. Dann wiederholte der Gastgeber das Durchladen bei der zweiten Waffe – mit dem gleichen Ergebnis.
»Gut«, sagte Wallander. »Sie sind uns eine sehr große Hilfe gewesen, Herr Peiper.«
»Herr?« sagte der Gastgeber und hob zum drittenmal die Augenbraue.
Wallander kam plötzlich der Gedanke, daß der Graf auf Vrångaholm noch nie in seinem Leben mit Herr angeredet worden war, sofern es nicht beleidigend gemeint gewesen war. Wallander blickte zu Boden und versuchte seine Gedanken auf das Wesentliche zu konzentrieren, was ihm ungewöhnlich schwerfiel.
»Was wollen wir jetzt tun, Herr Kommissar?« frage der Gastgeber mit einer förmlichen Höflichkeit, die den ironischen Unterton bei der Aussprache von Herr nicht im mindesten verbarg.
»Also!« sagte Wallander ungerührt. »Wie ich schon sagte, würde ich mich gern mit einem Ihrer Jagdgefährten unterhalten, der sozusagen in guter Verfassung ist, und sobald wir wissen, daß wir die Namen aller haben, die hiergewesen sind … das haben wir doch? Nun ja, Sie können Ihre Gäste bitten, nach Hause zu fahren, wie immer es ihnen paßt.«