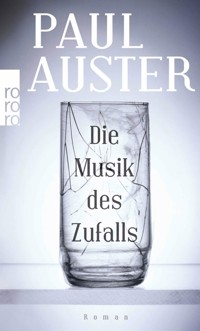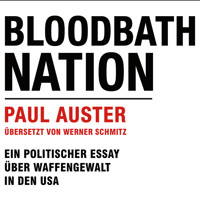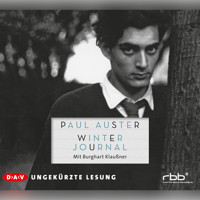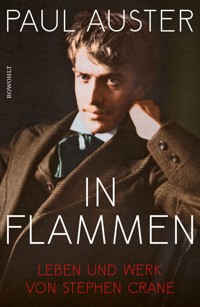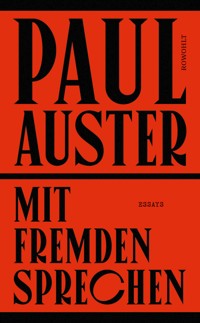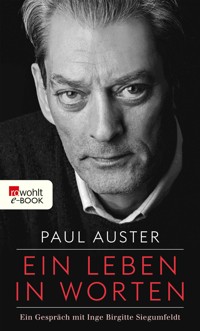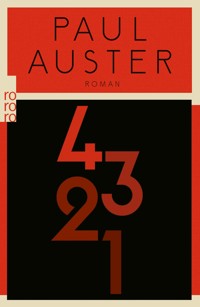9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
«Mit seinen beiden Büchern ‹New-York-Trilogie› und ‹Im Land der letzten Dinge› hat Paul Auster der gegenwärtigen amerikanischen Literatur eine andere Dimension eröffnet ... Austers Bücher wirken überraschend zeitgemäß, weil sie auf eine Erfahrung des Lebens – jetzt in diesem Augenblick – aus sind und mit einer monomanischen Lust vordringen in einen sonst sorgsam gehüteten Bereich: in unsere eigene Verwirrtheit angesichts der Welt. In dem Roman ‹Im Land der letzten Dinge› sind alle Spuren einer vertrauten Wirklichkeit scheinbar getilgt. Allerdings spielt Paul Auster hier nur mit Science-fiction-Versatzstücken, denn in seinen Augen bedarf es nur einer kleinen Drehung an der Schraube unserer Zivilisation, um sie in die Apokalypse, in ein neues (altes) Barbarentum umkippen zu lassen.» (Süddeutsche Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Ähnliche
Paul Auster
Im Land der letzten Dinge
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Siri Hustvedt
Vor nicht langer Zeit, da ich das Tor der Träume durchschritt, besuchte ich jene Erdenregion, in der die Stadt der Zerstörung liegt.
Nathaniel Hawthorne
Dies sind die letzten Dinge, schrieb sie. Eins nach dem andern verschwinden sie und kommen nie zurück. Ich kann dir erzählen von denen, die ich gesehen habe, von denen, die es nicht mehr gibt, doch wird kaum Zeit dafür sein. Es geschieht jetzt alles zu schnell, und ich kann nicht mithalten.
Ich erwarte nicht, dass du verstehst. Du hast nichts davon gesehen, und selbst der Versuch, es dir vorzustellen, wäre vergeblich. Dies sind die letzten Dinge. An einem Tag ist ein Haus noch da, am nächsten ist es weg. Gestern ging man über eine Straße, die heute nicht mehr existiert. Auch das Wetter wechselt in einem fort. Regentage folgen Sonnentagen, Nebeltage folgen Schneetagen, einmal kühl, einmal warm, erst Wind, dann Flaute, eine Zeit bitterer Kälte, und dann heute, mitten im Winter, ein lieblich heller Nachmittag, so warm, dass man keinen Mantel braucht. Wer in der Stadt lebt, lernt, nichts für selbstverständlich zu halten. Man schließt nur kurz die Augen, dreht sich um, um nach etwas anderem zu sehen, und was eben noch vor einem stand, ist plötzlich weg. Nichts bleibt, verstehst du, nicht einmal die eigenen Gedanken. Ihnen nachzuhängen wäre Zeitverschwendung. Ist etwas erst einmal weg, dann für immer.
So lebe ich, ging ihr Brief weiter. Ich esse nicht viel. Eben genug, dass ich weitergehen kann, mehr nicht. Zuweilen bin ich so schwach, dass ich glaube, keinen Schritt mehr voranzukommen. Aber es geht. So sehr ich auch strauchle, ich bewege mich fort. Du solltest einmal sehen, wie gut ich zurechtkomme.
Die Straßen der Stadt sind überall, und keine zwei Straßen gleichen sich. Ich setze einen Fuß vor den anderen, dann den anderen Fuß vor den ersten, und dann hoffe ich, das wiederholen zu können. Mehr nicht. Du musst begreifen, wie es jetzt um mich steht. Ich bewege mich. Ich atme, was mir an Luft gegeben ist. Ich esse so wenig wie möglich. Ganz gleich was die Leute sagen mögen, das Einzige, was zählt, ist auf den Beinen zu bleiben.
Du weißt noch, was du mir vor meiner Abreise gesagt hast. William ist verschwunden, sagtest du, und wenn ich noch so sehr suchte, nie würde ich ihn finden. Das waren deine Worte. Und dann sagte ich dir, ich gäbe nichts auf deine Worte, ich würde meinen Bruder schon finden. Und dann ging ich auf dieses schreckliche Schiff und ließ dich zurück. Wie lange ist das her? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Jahre, denke ich. Aber das ist nur eine Vermutung. Es kümmert mich nicht. Ich bin aus dem Gleis geraten, und nichts bringt mich wieder hinein.
So viel ist sicher. Ohne meinen Hunger wäre ich nicht in der Lage weiterzugehen. Man muss sich angewöhnen, mit so wenig wie möglich auszukommen. Braucht man weniger, so ist man mit weniger zufrieden, und je weniger man benötigt, desto besser ist man dran. So verändert einen die Stadt. Sie bringt einen völlig durcheinander. Sie macht einen lebenshungrig, und zugleich versucht sie einen umzubringen. Dem ist nicht zu entrinnen. Entweder man schafft es, oder man schafft es nicht. Wenn man es schafft, weiß man nicht, ob man es das nächste Mal auch noch schafft. Und wenn man es nicht schafft, schafft man es nie wieder.
Ich weiß nicht genau, warum ich dir jetzt schreibe. Ehrlich gesagt habe ich kaum an dich gedacht, seit ich hier bin. Aber auf einmal, nach all dieser Zeit, glaube ich etwas mitteilen zu müssen, und wenn ich es nicht ganz schnell hinschreibe, platzt mir der Kopf. Es ist gleichgültig, ob du es liest. Es ist sogar gleichgültig, ob ich es abschicke – vorausgesetzt, das ist überhaupt möglich. Vielleicht lässt es sich so erklären. Ich schreibe dir, weil du keine Ahnung hast. Weil du weit weg von mir bist und keine Ahnung hast.
Manche Menschen sind so dünn, schrieb sie, dass sie zuweilen fortgeweht werden. Die Stürme in der Stadt sind ungeheuer, sie fegen stets vom Fluss herauf und singen dir in den Ohren, stoßen dich hin und her, schleudern dir Zeitungen und Müll vor die Füße. Nicht selten sieht man die dünnsten Menschen zu zweit oder zu dritt umherziehen, manchmal auch ganze Familien, die mit Seilen und Ketten aneinandergebunden sind, um sich durch das gemeinsame Gewicht vor den Windstößen zu schützen. Andere verzichten ganz darauf, nach draußen zu gehen, drücken sich in Hauseingänge und Nischen, bis auch der heiterste Himmel ihnen bedrohlich vorkommt. Besser ruhig in ihrem Winkel ausharren, denken sie, als gegen die Steine geschmettert zu werden. Auch kann man es mit dem Hungern so weit treiben, dass man schließlich überhaupt nichts mehr hinunterbringt.
Noch schlimmer ist es für die, die ihren Hunger bekämpfen. Wer zu viel ans Essen denkt, bekommt nur Schwierigkeiten. Dies sind die Besessenen, die sich nicht mit den Tatsachen abfinden wollen. Sie durchstreifen die Straßen zu jeder Tageszeit auf der Suche nach Essbarem und gehen noch für den kleinsten Krümel enorme Wagnisse ein. So viel sie dabei auch finden mögen, es ist nie genug. Sie essen, ohne je satt zu werden, fallen mit tierischer Hast über ihr Essen her, stochern mit knochigen Fingern darin, und nie klappen ihre bebenden Kiefer zu. Das meiste trieft ihnen am Kinn entlang, und was sie verschlingen können, speien sie gewöhnlich nach wenigen Minuten wieder aus. Es ist ein langsamer Tod, als wenn das Essen Feuer wäre, ein Wahn, der sie von innen heraus verbrennt. Sie glauben, sie äßen, um zu überleben, doch am Ende sind sie es, die gegessen werden.
Tatsächlich ist das Essen eine diffizile Angelegenheit, und wer sich nicht mit dem zu bescheiden lernt, was ihm gegeben ist, wird nie mit sich in Frieden leben. Nahrung ist ständig knapp, und etwas, an dem man sich heute erfreut hat, wird ziemlich sicher morgen nicht vorhanden sein. Die städtischen Märkte sind wahrscheinlich die ungefährlichsten, zuverlässigsten Einkaufsstätten, aber die Preise sind hoch, und die Auswahl ist dürftig. Einmal gibt es nichts als Radieschen, ein andermal nichts als altbackenen Schokoladenkuchen. Diese häufige und drastische Umstellung des Speiseplans kann einem sehr auf den Magen schlagen. Doch bieten die städtischen Märkte den Vorteil, dass sie von der Polizei bewacht werden, da weiß man immerhin, dass das Erworbene im eigenen Magen und nicht in dem eines anderen landen wird. Nahrungsdiebstahl ist in den Straßen so verbreitet, dass er nicht einmal mehr als Verbrechen betrachtet wird. Darüber hinaus stellen die städtischen Märkte die einzige gesetzlich sanktionierte Form der Lebensmittelverteilung dar. Zwar gibt es viele private Lebensmittelverkäufer in der Stadt, doch können ihre Waren jederzeit beschlagnahmt werden. Und selbst wer es sich leisten kann, die zum Verbleib im Geschäft nötigen Bestechungsgelder an die Polizei zu bezahlen, muss stets mit Raubüberfällen rechnen. Diebe plagen auch die Kunden der privaten Märkte, und man hat statistisch nachgewiesen, dass jeder zweite Kauf einen Überfall nach sich zieht. Ich finde, bloß für den flüchtigen Genuss einer Orange oder den Geschmack von gekochtem Schinken so viel zu riskieren, lohnt sich kaum. Aber die Leute sind unersättlich: Der Hunger ist ein täglich wiederkehrender Fluch, und der Magen ist ein Fass ohne Boden, ein Loch, so groß wie die Welt. Die privaten Händler machen daher trotz aller Hindernisse gute Geschäfte, packen hier zusammen und ziehen dann dorthin; ständig auf dem Sprung, tauchen sie für ein oder zwei Stunden irgendwo auf und verschwinden ebenso plötzlich wieder. Doch ein Wort zur Warnung. Wenn du unbedingt Essen von den privaten Märkten haben willst, dann hüte dich vor den unorganisierten Händlern, denn betrogen wird überall, und es gibt viele Leute, die dir alles andrehen, bloß um einen Gewinn zu machen: mit Sägemehl gefüllte Eier und Orangen, Flaschen, die Pisse statt Bier enthalten. Nein, es gibt nichts, was die Leute nicht tun, und je früher du das begreifst, desto besser wird es dir gehen.
Wenn du durch die Straßen läufst, fuhr sie fort, musst du jeden einzelnen Schritt sorgfältig bedenken. Andernfalls ist ein Sturz unausbleiblich. Du musst ständig die Augen offenhalten, nach unten, nach vorne und nach hinten sehen, stets auf der Hut vor anderen Leuten und auf das Unvorhersehbare gefasst. Ein Zusammenstoß kann tödlich enden. Zwei prallen zusammen und schlagen gleich mit Fäusten aufeinander ein. Oder sie stürzen zu Boden und versuchen gar nicht mehr aufzustehen. Früher oder später kommt der Augenblick, da man nicht mehr aufzustehen versucht. Der Körper ist nun einmal schmerzempfindlich, dagegen hilft nichts. Und hier ist er es mehr als irgendwo sonst.
Die Trümmer sind besonders problematisch. Man hat sich auf die unsichtbaren Gräben, die jäh auftauchenden Steinhaufen, die flachen Furchen einzustellen, damit man nicht stolpert und sich verletzt. Und das Allerschlimmste sind die Wegzölle, die nur mit List zu umgehen sind. Wo immer Gebäude eingestürzt sind oder sich Müll angesammelt hat, stehen riesige Barrikaden mitten auf der Straße und versperren jeglichen Durchgang. Diese Sperren werden von Männern gebaut, wann immer Material dazu vorhanden ist, und dann stehen sie da oben, mit Keulen, Gewehren oder Steinen bewaffnet, und lauern Passanten auf. Sie haben die Straße in ihrer Gewalt. Wenn man vorbeiwill, muss man den Wächtern geben, was sie verlangen. Manchmal ist es Geld; manchmal ist es Essen; manchmal ist es Sex. Prügel sind an der Tagesordnung, und hin und wieder hört man von einem Mord.
Neue Zollstellen werden gebaut, alte verschwinden. Nie weißt du, welche Straßen du benutzen kannst und welche zu meiden sind. Nach und nach nimmt dir die Stadt jegliche Sicherheit. Du kannst dich nie auf einen Weg festlegen, und überleben kannst du nur, wenn du nichts nötig hast. Du musst auf der Stelle haltmachen, dein Vorhaben fallenlassen und umkehren können. Schließlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Und darum musst du lernen, die Zeichen zu deuten. Versagen die Augen, hilft manchmal die Nase weiter. Mein Geruchssinn ist unnatürlich scharf geworden. Trotz der Begleiterscheinungen – dem plötzlichen Ekel, der Benommenheit, der Angst, die mit dem Gestank in meinen Körper einzieht – schützt er mich in besonders gefährlichen Situationen, zum Beispiel wenn ich um eine Ecke biege. Denn die Zollstellen haben einen eigentümlichen Geruch, den man selbst aus großer Entfernung erkennen lernt. Aus Steinen, Zement und Holz zusammengesetzt, enthalten die Barrikaden auch Müll und Gipsabfälle, und durch die Einwirkung der Sonne auf diesen Müll entsteht ein Gestank, der intensiver ist als anderswo, und der Regen lässt den Gips quellen und zerfließen, so dass er seinen typischen Geruch verströmt, und beides zusammen, im Wechselspiel von Trockenheit und Nässe, bringt den Geruch der Zollstelle zur Entfaltung. Entscheidend dabei ist, dass man sich nicht daran gewöhnt. Denn Gewohnheiten sind tödlich. Selbst beim hundertsten Mal muss man allem und jedem entgegentreten, als ob man es nie zuvor gesehen hätte. Ganz gleich wie oft, es muss immer das erste Mal sein. Das ist so gut wie unmöglich, ich weiß, aber es ist eine unumstößliche Regel.
Man möchte meinen, das alles müsste früher oder später einmal enden. Die Dinge zerfallen und verschwinden, und Neues wird nicht hergestellt. Die Menschen sterben, und die Kinder weigern sich, auf die Welt zu kommen. Ich kann mich nicht erinnern, in all den Jahren, die ich hier bin, ein einziges Neugeborenes gesehen zu haben. Und doch treten immer wieder neue Menschen an die Stelle der verschwundenen. Karren ziehend, hochbeladen mit ihren Habseligkeiten, in stotternden, kaputten Wagen kommen sie, allesamt hungrig, allesamt heimatlos, vom Land und aus den umliegenden Ortschaften hereingeströmt. Bis sich diese Neuankömmlinge mit den Zuständen in der Stadt vertraut gemacht haben, sind sie leichte Beute. Viele von ihnen werden noch vor Ablauf des ersten Tages um ihr ganzes Geld betrogen. Manche bezahlen für Wohnungen, die es gar nicht gibt, andere lassen sich dazu verleiten, Aufträge für Arbeiten zu erteilen, die nie ausgeführt werden, wieder andere geben ihre Ersparnisse für Essen aus, das sich als bemalte Pappe entpuppt. Und dies sind nur die gewöhnlichsten Tricks. Ich kenne einen Mann, der davon lebt, dass er vor dem alten Rathaus steht und jedem Neuankömmling, der einen Blick auf die Turmuhr wirft, Geld abverlangt. Kommt es zum Streit, tritt sein Gehilfe als Ortsunkundiger auf, sieht nach der Uhr und bezahlt, damit der Fremde glaubt, dies sei hier so Brauch. Das Verblüffende daran ist nicht die Existenz solcher Schwindler, sondern wie mühelos sie die Leute dazu bringen, sich von ihrem Geld zu trennen.
Wer einen Platz zum Leben hat, läuft stets Gefahr, ihn zu verlieren. Die meisten Gebäude gehören niemandem, folglich hat man als Mieter keine Rechte: keinen Mietvertrag, keinen gesetzlichen Rückhalt, wenn jemand sich mit einem anlegt. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Leute mit Gewalt aus ihren Wohnungen vertrieben und auf die Straße gesetzt werden. Eine Rotte platzt mit Keulen und Gewehren bei dir herein und befiehlt dir zu verschwinden, und wenn du nicht glaubst, sie überwältigen zu können, was bleibt dir anderes übrig? Räumen heißt das, und es gibt wenige Leute in der Stadt, die ihre Wohnungen nicht zu irgendeiner Zeit einmal auf diese Weise verloren haben. Aber selbst wenn man das Glück hat, dieser speziellen Form der Vertreibung zu entgehen, kann man nie wissen, ob man nicht einmal einem der falschen Hausbesitzer auf den Leim geht. Das sind Wucherer, die nahezu alle Viertel der Stadt terrorisieren, indem sie Schutzgelder erpressen, bloß damit man in seiner Wohnung bleiben kann. Sie geben sich als Besitzer des betreffenden Hauses aus, prellen die Bewohner und stoßen nur selten auf Widerstand.
Wer jedoch keine Wohnung hat, befindet sich in einer ausweglosen Lage. So etwas wie leerstehende Wohnungen gibt es nicht. Und doch betreiben die Makler eine Art Geschäft. Täglich setzen sie Anzeigen in die Zeitung, in denen sie fingierte Wohnungsangebote machen, um Leute in ihre Büros zu locken und von ihnen Gebühren zu kassieren. Niemand lässt sich von dieser Praxis täuschen, doch viele Leute sind bereit, für diese leeren Versprechungen ihren letzten Pfennig zu opfern. Früh am Morgen scharen sie sich vor den Geschäftsstellen und stehen geduldig Schlange, manchmal stundenlang, bloß um zehn Minuten bei einem Makler zu sitzen und sich Fotografien von Häusern an baumgesäumten Straßen, von behaglichen Zimmern und mit Teppichen und weichen Ledersesseln ausgestatteten Wohnungen anzuschauen – friedliche Bilder, die an Kaffeeduft erinnern, der aus der Küche hereinzieht, an ein dampfendes heißes Bad, an die bunten Farben von schmucken Topfpflanzen auf dem Fensterbrett. Niemanden scheint es zu stören, dass diese Bilder vor mehr als zehn Jahren aufgenommen wurden.
So viele von uns sind wieder zu Kindern geworden. Nicht dass wir danach strebten, verstehst du, oder dass irgendjemand sich dessen wirklich bewusst wäre. Doch wenn die Hoffnung schwindet, wenn man erkennt, dass man sogar die Hoffnung auf die Hoffnung selbst aufgegeben hat, dann neigt man dazu, die Lücken mit Träumen aufzufüllen, mit kindlichen Gedanken und Geschichten, um nicht schlappzumachen. Auch die abgehärtetsten Menschen haben dann Mühe, sich zu bremsen. Mir nichts dir nichts unterbrechen sie, was sie gerade tun, setzen sich hin und reden von den Sehnsüchten, die in ihnen aufgestiegen sind. Essen ist natürlich eines der Lieblingsthemen. Oft genug kann man Leute minuziös die Gänge einer Mahlzeit beschreiben hören; angefangen bei den Suppen und Vorspeisen und so langsam weiter bis zum Dessert verweilen sie bei jedem Geschmack und jeder Würze, bei all den verschiedenen Aromen und Düften, konzentrieren sich einmal auf die Zubereitungsart, einmal auf die Wirkung des Essens selbst, vom ersten Kribbeln des Geschmacks auf der Zunge bis zu dem sich allmählich ausbreitenden Gefühl des Friedens, wenn der Bissen die Speiseröhre hinunter in den Magen wandert. Diese Gespräche, die sich manchmal stundenlang hinziehen, unterliegen einem sehr strengen Protokoll. Zum Beispiel darf man nicht lachen, und man darf sich auf keinen Fall von seinem Hunger überwältigen lassen. Keine Ausbrüche, keine unbedachten Seufzer. Dergleichen würde zu Tränen führen, und nichts verdirbt ein Gespräch übers Essen nachhaltiger als Tränen. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn man seinen Gedanken erlaubt, in die Worte zu schlüpfen, die aus dem Mund der anderen kommen. Lässt man sich von den Worten verzehren, kann man seinen gegenwärtigen Hunger vergessen und in das eintreten, was die Leute «die Stätte des nahrhaften Scheins» nennen. Manche behaupten sogar, diese Essensgespräche hätten einen Nährwert – die richtige Konzentration und ein entsprechendes Verlangen vorausgesetzt, den Worten der Teilnehmer Glauben zu schenken.
All das gehört zur Geistersprache. Es gibt alle möglichen Gesprächsvarianten in dieser Sprache. Die meisten beginnen, indem jemand zu einem anderen sagt: Ich wünschte. Was man sich wünscht, ist beliebig, Hauptsache, es kann nicht geschehen. Ich wünschte, die Sonne ginge niemals unter. Ich wünschte, mir wüchse Geld in den Taschen. Ich wünschte, in der Stadt ginge es zu wie in alten Zeiten. Du siehst, worauf es ankommt. Absurditäten und Kindereien, ohne Sinn und Bezug zur Wirklichkeit. Im allgemeinen halten die Leute sich an den Glauben, dass die Lage, so schlimm sie auch gestern war, gestern besser war als heute. Und die von vorgestern besser als die von gestern. Je weiter man zurückblickt, desto schöner und begehrenswerter erscheint einem die Welt. Jeden Morgen kämpft man sich aus dem Schlaf, um Verhältnissen ins Auge zu blicken, die schlimmer sind als die gestrigen, aber indem man von der Welt spricht, die vor dem Schlafengehen existierte, kann man sich vorgaukeln, der gegenwärtige Tag sei ein bloßes Trugbild, nicht wirklicher oder unwirklicher als die Erinnerungen an all die anderen Tage, die man in sich herumträgt.
Ich verstehe, warum die Leute dieses Spiel betreiben, doch ich selbst finde keinen Gefallen daran. Ich lehne es ab, die Geistersprache zu sprechen, und wann immer ich andere so reden höre, entferne ich mich oder halte mir die Ohren zu. Ja, ich habe mich verändert. Du weißt noch, was für ein verspieltes kleines Mädchen ich war. Du konntest nie genug von meinen Geschichten hören und von den Welten, die ich uns erfunden habe, damit wir darin spielen konnten. Das Schloss ohne Wiederkehr, das Traurige Land, der Wald der vergessenen Worte. Erinnerst du dich? Mit welchem Vergnügen ich dir Lügen auftischte, dich dazu verleitete, an meine Geschichten zu glauben, und dein Gesicht ganz ernst werden sah, wenn ich dich von einer fremdartigen Szene zur anderen führte. Und wenn ich dir dann sagte, das sei alles nur erfunden, fingst du an zu weinen. Ich glaube, ich mochte deine Tränen genauso sehr wie dein Lächeln. Ja, ich war wohl damals schon ein wenig frech, in den Kleidchen, die meine Mutter mir anzog, mit meinen zerschundenen und verschorften Knien und meiner kleinen unbehaarten Kindermöse. Aber du hast mich geliebt, oder? Du hast mich geliebt bis zum Wahnsinn.
Jetzt bestehe ich nur noch aus Wirklichkeitssinn und kalter Berechnung. Ich will nicht sein wie die anderen. Ich sehe, was ihre Phantastereien aus ihnen machen, und das soll mir nicht widerfahren. Die Geisterleute sterben allesamt im Schlaf. Ein oder zwei Monate lang laufen sie mit einem seltsamen Lächeln durch die Gegend, umgeben von einem unheimlichen jenseitigen Glühen, als hätten sie schon begonnen sich aufzulösen. Die Anzeichen, selbst die allerersten Vorboten, sind unverkennbar: die leichte Rötung der Wangen, die plötzlich etwas geweiteten Augen, der schleppende Gang, der üble Geruch des Unterleibs. Vermutlich ist es aber ein glücklicher Tod. Das will ich ihnen zugestehen. Manchmal habe ich sie fast darum beneidet. Aber ich kann doch nicht aus meiner Haut. Ich will das nicht zulassen. Ich werde so lange durchhalten, wie ich kann, und wenn es mich umbringen sollte.
Andere Todesarten sind dramatischer. Da gibt es zum Beispiel die Renner, eine Sekte, deren Mitglieder so schnell sie können durch die Straßen rasen und dabei wie wild um sich schlagen, in die Luft boxen und lauthals schreien. Meistens ziehen sie in Gruppen umher: Zu sechst, zu zehnt oder gar zu zwanzig kommen sie die Straße entlanggestürmt, ohne ihren Lauf je zu unterbrechen; sie rennen und rennen, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen. Es geht darum, so schnell wie möglich zu sterben, sich so abzuhetzen, dass das Herz nicht mehr mitmacht. Die Renner meinen, kein Mensch habe den Mut, dies allein zu tun. Beim gemeinsamen Laufen wird jedes Mitglied der Gruppe von den anderen mitgerissen, von den Schreien angespornt, von der selbstquälerischen Verbissenheit zur Raserei getrieben. Und darin liegt die Ironie. Um sich durch Laufen umzubringen, muss man sich erst einmal eine gute Kondition antrainieren. Denn sonst verfügte man nicht über die nötige Kraft, um über sich hinauszuwachsen. Die Renner unterziehen sich freilich mühseligen Vorbereitungen, um ihr Schicksal zu besiegeln, und sollten sie auf dem Weg dorthin zufällig einmal stolpern, wissen sie sich sofort aufzuraffen und weiterzumachen. Es handelt sich dabei wohl um eine Art Religion. Im ganzen Stadtbereich gibt es mehrere Büros – eines für jede der neun Zensuszonen –, und wer mitmachen will, hat eine Reihe komplizierter Aufnahmeprüfungen abzulegen: unter Wasser die Luft anhalten, Fasten, die Hand in eine Kerzenflamme halten, sieben Tage lang mit niemandem sprechen. Ist man dann aufgenommen, muss man sich dem Kodex der Gruppe unterwerfen. Dieser sieht unter anderem sechs bis zwölf Monate gemeinsamen Lebens vor, ferner ein streng reglementiertes Körpertraining und eine allmähliche Reduzierung der Nahrungsaufnahme. Ist ein Mitglied schließlich so weit, dass es seinen Todeslauf antreten kann, befindet es sich in einem simultanen Zustand äußerster Kraft und äußerster Schwäche. Theoretisch kann man unausgesetzt weiterlaufen, zugleich aber hat der Körper sämtliche Reserven aufgebraucht. Diese Kombination führt zu dem erwünschten Ergebnis. Am Morgen des festgelegten Tages bricht man mit seinen Begleitern auf und läuft, bis man seinem Körper entflohen ist, man rennt und schreit, bis man buchstäblich außer sich ist. Und irgendwann windet sich die Seele los, der Körper stürzt zu Boden, und man ist tot. Die Renner werben damit, dass ihre Methode zu über neunzig Prozent erfolgreich ist – das heißt also, dass fast niemand einen zweiten Todeslauf anzutreten hat.
Verbreiteter sind die einsamen Todesarten. Aber auch diese sind zu einer Art öffentlichem Ritual gemacht worden. Die Leute erklimmen die höchsten Stellen, bloß um herunterzuspringen. Den Letzten Sprung nennt man das, und ich muss zugeben, es hat etwas Bewegendes, jemandem dabei zuzusehen, als eröffne sich einem im Innern eine ganz neue Welt der Freiheit: den Körper am Rand des Daches stehen sehen, und dann jedes Mal der kurze Augenblick des Zögerns, der dem Wunsch zu entspringen scheint, diese letzten Sekunden zu genießen, und wie sich dein eigenes Leben in deiner Kehle zusammenschnürt, bis der Körper sich dann unerwartet (denn es ist nie abzusehen, wann es geschieht) in die Luft wirft und auf die Straße heruntergeflogen kommt. Die Begeisterung der Zuschauer würde dich verblüffen: ihr rasender Jubel, ihre Aufregung. Als hätten die Leidenschaftlichkeit und die Schönheit des Anblicks sie von sich befreit, sie der Armseligkeit ihres eigenen Lebens entrissen. Der Letzte Sprung ist etwas, das jeder begreifen kann, er entspricht jedermanns heimlicher Sehnsucht: blitzschnell zu sterben, sich in einem kurzen und erhabenen Augenblick auszulöschen. Manchmal glaube ich, der Tod ist das Einzige, für das wir überhaupt etwas empfinden. Er ist unsere Kunstform, die einzige Art und Weise, in der wir uns ausdrücken können.
Und doch gelingt es einigen zu überleben. Denn auch der Tod ist zu einer Quelle des Lebens geworden. Bei so vielen Leuten, die Schluss machen wollen, die über die verschiedenen Möglichkeiten nachdenken, diese Welt zu verlassen, kannst du dir vorstellen, was man damit für Geschäfte machen kann. Wer clever ist, kann recht gut vom Tod der anderen leben. Denn nicht alle sind so mutig wie die Renner und Springer, und vielen muss bei ihrem Entschluss geholfen werden. Dass man solche Hilfsdienste bezahlen kann, ist natürlich Vorbedingung; deshalb können praktisch nur die Reichen sie sich leisten. Gleichwohl floriert das Geschäft damit, besonders das der Euthanasiekliniken. Hiervon gibt es mehrere verschiedene Güteklassen, je nachdem, wie viel man dafür anlegen will. Die einfachste und billigste Todesart dauert höchstens ein bis zwei Stunden und wird unter der Bezeichnung Rückreise angeboten. Man meldet sich bei der Klinik an, zahlt an der Kasse sein Ticket und wird dann in ein kleines Privatzimmer mit frischgemachtem Bett geführt. Ein Pfleger deckt dich zu und gibt dir eine Spritze, dann schlummerst du ein und wachst nicht mehr auf. Die nächste Preisstufe ist die Reise der Wunder, die ein bis drei Tage dauern kann. Hierbei bekommt der Kunde, regelmäßig über einen gewissen Zeitraum verteilt, eine Reihe von Injektionen, die ihm ein euphorisches Gefühl von Losgelöstheit und Glück vermitteln, bis dann die letzte, tödliche Spritze verabreicht wird. Und schließlich gibt es die Vergnügungsfahrt, die sich bis über zwei Wochen erstrecken kann. Hier werden die Kunden üppig verwöhnt und auf eine Weise umsorgt, die sich durchaus mit dem Prunk der alten Luxushotels messen kann. Es gibt ausgeklügelte Menüs, Wein, Unterhaltung und sogar ein Bordell, das Männern und Frauen gleichermaßen offensteht. Die Kosten hierfür sind enorm, aber es gibt Leute, die der Versuchung, einmal, und wenn auch nur kurze Zeit, das süße Leben zu genießen, einfach nicht widerstehen können.
Man kann sich aber nicht nur bei den Euthanasiekliniken seinen Tod kaufen. Auch bei den Mordvereinen ist das möglich, und deren Beliebtheit wächst ständig. Wenn jemand sterben will, aber Angst hat, selbst Hand an sich zu legen, kann er gegen eine relativ bescheidene Gebühr dem Mordverein seiner Zensuszone beitreten. Daraufhin wird ihm ein Attentäter zugeteilt. Von den Vorkehrungen erfährt der Kunde nichts, und alles, was mit seinem Tod zu tun hat, bleibt ihm verborgen: der Zeitpunkt, der Ort, die Art der Ausführung, die Identität seines Mörders. In gewisser Hinsicht geht sein Leben weiter wie zuvor. Der Tod steht als absolute Gewissheit am Horizont, und nur die Todesart bleibt unergründlich. Anstatt auf Alter, Krankheit oder einen Unfall warten zu müssen, kann das Mitglied eines Mordvereins sich auf einen raschen, gewaltsamen Tod in nicht allzu ferner Zukunft freuen: eine Kugel in den Kopf, ein Messer in den Rücken, mitten in der Nacht ein Paar Hände um den Hals. Mir scheint, das Ganze macht einen am Ende nur wachsamer. Der Tod ist nichts Abstraktes mehr, sondern eine reale Bedrohung in jedem Augenblick des Lebens. Die zur Ermordung Bestimmten fügen sich gar nicht so sehr in das Unausweichliche, sondern werden im allgemeinen aufmerksamer, energischer in ihren Bewegungen, entwickeln ein stärkeres Lebensgefühl – als hätte eine neue Sicht der Dinge sie verwandelt. Viele von ihnen widerrufen schließlich auch und entscheiden sich wieder für das Leben. Aber das ist ziemlich schwierig. Denn ist man einmal einem Mordverein beigetreten, ist ein Austritt nicht mehr statthaft. Gelingt es einem aber, seinen Mörder zu töten, kann man von der Mitgliedschaft entbunden werden – und, wenn man will, sich selbst als Mörder einstellen lassen. Das ist das Gefährliche am Job des Mörders und der Grund dafür, warum er so gut bezahlt wird. Ein Mörder wird zwar nur selten getötet, da er natürlich erfahrener ist als sein zukünftiges Opfer, doch ab und zu geschieht es schon. Unter den Armen, besonders unter armen jungen Männern gibt es viele, die monate- und sogar jahrelang sparen, nur um einem Mordverein beitreten zu können. Wobei die Vorstellung lockt, als Mörder eingestellt zu werden – und damit den Lebensstandard zu erhöhen. Nur wenigen gelingt dies. Wenn ich dir von einigen dieser Jungen erzählte, könntest du eine Woche lang nicht mehr schlafen.
All das bringt eine ganze Menge praktischer Probleme mit sich. Wohin zum Beispiel mit den Leichen? Die Leute sterben hier nicht wie in den alten Zeiten, wo man im eigenen Bett oder im reinlichen Refugium eines Krankenhauses still verschied – sie sterben, wo sie sich zufällig gerade aufhalten, und in den meisten Fällen heißt das: auf der Straße. Ich meine jetzt nicht nur die Renner, die Springer und die Mitglieder der Mordvereine (denn die bilden ja bloß eine winzige Minderheit), sondern wirklich große Teile der Bevölkerung. Mindestens die Hälfte der Menschen haben kein Zuhause, sie sitzen buchstäblich auf der Straße. Leichen sieht man daher überall – auf dem Bürgersteig, in Hauseingängen, auf der Straße. Verlange keine Einzelheiten von mir. Genug, dass ich überhaupt davon spreche – mehr als genug. Was du auch denken magst, mangelndes Mitgefühl ist nicht das eigentliche Problem. Nichts bricht einem hier schneller als das Herz.
Die meisten Leichen sind nackt. Stets streifen Plünderer durch die Straßen, und es dauert nie sehr lange, bis ein Toter seiner Habseligkeiten beraubt ist. Als Erstes verschwinden die Schuhe, denn die sind sehr gefragt und kaum aufzutreiben. Als Nächstes werden die Taschen untersucht beziehungsweise alles andere gleich mit, die Kleider und was noch darin sein mag. Als Letzte kommen Männer mit Meißeln und Zangen, die etwaige Gold- und Silberzähne aus dem Mund reißen. Da ohnehin kein Weg daran vorbeiführt, übernehmen viele Familien, die das Ausplündern nicht Fremden überlassen wollen, es gleich selbst. In einigen Fällen entspringt dies dem Wunsch, die Würde des geliebten Toten zu bewahren; in anderen ist es schlicht ein Akt des Egoismus. Aber ich werde vielleicht zu spitzfindig. Wenn der Goldzahn deines Ehemanns dich einen Monat lang ernähren kann, wer dürfte dir einen Vorwurf machen, wenn du ihn ziehst? Ich weiß, ein solches Verhalten widerstrebt einem, aber wer hier überleben will, muss Prinzipien über Bord werfen können.
Jeden Morgen sammeln Lastwagen der Stadtverwaltung die Leichen ein. Dies ist die Hauptaufgabe der Regierung, und sie gibt dafür mehr Geld aus als für irgendetwas anderes. Den ganzen Stadtrand säumen Krematorien – sogenannte Transformationszentren –, und Tag und Nacht sieht man den Rauch in den Himmel steigen. Doch beim jetzigen schlechten Zustand der Straßen, die zum Großteil bloß noch Schutthalden sind, wird diese Arbeit zunehmend schwieriger. Den Männern bleibt nichts anderes übrig, als die Lastwagen zu parken und sich zu Fuß auf die Suche zu machen, was die Arbeit erheblich verlangsamt. Dazu kommen noch die häufigen Pannen der Lastwagen und gelegentliche Ausschreitungen von Zuschauern. Die Arbeiter der Todeswagen mit Steinen zu bewerfen ist ein beliebter Zeitvertreib der Obdachlosen. Obwohl die Arbeiter bewaffnet sind und ihre Maschinengewehre schon öfter gegen die Menge gerichtet haben, können ein paar Steinewerfer, die geschickt jede Deckung auszunutzen wissen, mit ihren blitzschnellen Vorstößen die Arbeit der Leichensammler vollständig zum Erliegen bringen. Ein schlüssiges Motiv liegt diesen Attacken nicht zugrunde. Zorn, Unmut und Langeweile sind die Ursachen, und da die Sammler die einzigen Vertreter der Stadtverwaltung sind, die überhaupt einmal in den Bezirken auftauchen, benutzt man eben sie als Zielscheibe. Man könnte sagen, die Steine repräsentieren den Abscheu der Leute vor einer Regierung, die erst dann etwas für sie tut, wenn sie tot sind. Aber damit ginge man zu weit. Die Steine sind ein Ausdruck des Elends, ganz einfach. Denn so etwas wie Politik wird in der Stadt nicht betrieben. Dazu sind die Leute viel zu hungrig, zu verzweifelt und zu zerstritten.
Die Überfahrt dauerte zehn Tage, und ich war der einzige Passagier. Aber das weißt du bereits. Du hast den Kapitän und die Besatzung kennengelernt, du hast meine Kabine gesehen, und ich brauche mich nicht noch einmal darüber auszulassen. Die Zeit verbrachte ich damit, das Wasser und den Himmel anzuschauen, und in den ganzen zehn Tagen habe ich kaum einmal ein Buch aufgeschlagen. Wir sind bei Nacht in die Stadt eingelaufen, und erst da begann ich ein wenig in Panik zu geraten. Die Küste war vollkommen schwarz, nirgendwo Lichter, und ich fühlte mich, als beträten wir eine unsichtbare Welt, einen Ort, in dem nur Blinde lebten. Aber ich hatte ja die Adresse von Williams Büro, und das beruhigte mich ein wenig. Ich brauchte bloß dorthin zu gehen, dachte ich, und alles andere würde sich von allein ergeben. Zum Allermindesten war ich zuversichtlich, dass ich Williams Spur würde aufnehmen können. Aber da war mir noch nicht klar, dass es die Straße gar nicht mehr gab. Nicht dass das Büro leer war oder das Gebäude verlassen. Es gab weder das Gebäude noch die Straße noch sonst irgendetwas: nichts als Schutt und Steine im weiten Umkreis.