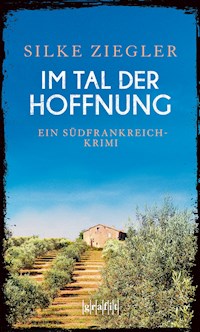9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Polizei von Montpellier steht vor einem Rätsel: Am Strand des nahe gelegenen kleinen Ortes Le Grau-du-Roi finden sich zwei angeschossene Jugendliche und eine bewusstlose Frau. Während die Jugendlichen um ihr Leben ringen, hat die Frau lediglich eine eher harmlose Kopfverletzung davongetragen – und sie ist im Besitz einer Pistole. Was ist hier passiert? Doch auch als die Unbekannte wieder zu sich kommt, kann sie nicht helfen, Licht in das Dunkel zu bringen: Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Dann verstirbt eines der Opfer, ausgerechnet der Sohn des Directeurs der Police Nationale. Polizeiärztin Collete de Chadier schlägt einen waghalsigen Plan vor, bei dem Cédric Douchet, der kürzlich vom Dienst suspendiert wurde, die Fremde einerseits im Auge behalten, ihr andererseits aber auch helfen soll, das Trauma zu überwinden. Widerwillig fügt sich der desillusionierte Ermittler. Schon bald muss er feststellen, dass ihn die schöne Unbekannte alles andere als kaltlässt – und ganz eigene Pläne verfolgt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Silke Ziegler
Im Licht der Erinnerung
Ein Südfrankreich-Krimi
© 2018 by GRAFIT Verlag GmbH
Chemnitzer Str.31, D-44139Dortmund
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pixelheld (Strand), Marc Lechanteur (Leuchtturm)
Über dieses Buch
In der Nähe von Montpellier werden zwei angeschossene Jugendliche und eine bewusstlose Frau gefunden. Während die Jugendlichen um ihr Leben ringen, hat die Frau lediglich eine harmlose Kopfverletzung davongetragen, kann sich allerdings nicht mal an ihren Namen erinnern.
Undercoverermittler Cédric Douchet gibt sich als ihr Ehemann aus, um ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Gemeinsam beziehen die beiden eine traumhaft schöne Ferienwohnung. Schon bald muss Cédric feststellen, dass ihn die geheimnisvolle Unbekannte alles andere als kaltlässt – und dass sie ganz eigene Pläne verfolgt …
Die Autorin
Silke Ziegler, Jahrgang 1975, lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Weinheim an der Bergstraße. Die gelernte Finanzassistentin arbeitet nach Anstellungen in diversen Kreditinstituten inzwischen an der Universität Heidelberg.
Die Reisen, die Silke Ziegler mit ihrer Familie unternimmt, inspirieren sie immer wieder zu neuen Geschichten.
Prolog
Mai 1992
Das Mädchen zog fröstelnd sein Nachthemd über die nackten Knie. Obwohl es bereits Mai war, sanken die Temperaturen nachts noch rapide ab. Vorsichtig legte es den Kopf zur Seite, um durch die Ritze der Schrankrückwand sehen zu können. Wenn es ganz still hielt, konnte es durch den schmalen Schlitz zwischen den beiden Holztüren schauen. Nein, das war kein böser Traum gewesen. Noch immer lag ihre Mutter seltsam verrenkt auf dem breiten Ehebett, dunkle Flüssigkeit breitete sich auf dem Laken aus. Auch der Kopf ihres Vaters schien merkwürdig verdreht zu liegen.
Das Mädchen zitterte. Obwohl es nicht verstand, was hier vor wenigen Sekunden geschehen war, sagte ihm sein Instinkt, dass es sich in großer Gefahr befand.
Warum nur hatte es seine Eltern nicht geweckt, als es das Geräusch unter seinem Zimmerfenster gehört hatte? Natürlich, Papa schimpfte immer, wenn es mitten in der Nacht im Schlafzimmer seiner Eltern auftauchte und unter Mamans Decke kriechen wollte. »Du bist doch schon ein großes Mädchen, kommst bald in die Schule.«
Na und? Das Mädchen liebte es, in die Arme genommen zu werden, denn der Körper seiner Mutter strahlte Wärme und Geborgenheit aus. Liebte es, seinen Rücken an Mamans Bauch zu schmiegen. Doch Papa hatte die letzten Male entschlossen darauf bestanden, dass es in das eigene Bett zurückging.
Nervös zupfte es am dünnen Stoff des Nachthemds. Der Mann war noch immer da draußen. Das Mädchen konnte ihn deutlich hören. Die leisen Schritte im Flur, seinen gleichmäßigen Atem. Nein, es verstand nicht, was hier geschah. Warum war er so böse?
Ängstlich hob es seine Hände und presste sie auf die Ohren. Noch immer hallten die Schüsse in seinem Kopf nach. Wieder spähte das Mädchen durch die Ritzen. Seine Eltern lagen unverändert auf dem Bett. Es wusste, dass etwas Furchtbares passiert war. Etwas Unwiderrufliches. Ein dicker Knoten bildete sich in seinem Magen.
Das Mädchen wischte sich eine Träne weg. Es war feige gewesen. Als es das Geräusch registriert hatte, war es leise aus dem Zimmer geschlüpft und hatte eine Zeit lang in die Stille der Nacht gelauscht. Aus Angst vor seinem Vater hatte es seine Eltern nicht geweckt, sondern war stattdessen in den ›Zauberschrank‹ geschlüpft.
Selbst Maman wusste nicht, dass das Möbelstück ein doppeltes Innenleben besaß. Außer dem Mädchen kannte nur Papa das Geheimnis. Ein ideales Versteck. Papa hatte dem Mädchen erzählt, der Schrank habe schon immer an dieser Stelle gestanden, selbst als noch seine Eltern in dem Haus gewohnt hatten. Das musste eine Ewigkeit her sein! Als Maman mit dem Baby im Krankenhaus gewesen war, hatte Papa dem Mädchen das Versteck gezeigt: eine kleine Nische hinter der Rückwand des Schrankes. Man musste die Holzplatte nur ganz leicht herausdrücken, um sich dahinter verstecken zu können. Das Mädchen hatte es in den letzten Wochen ein paarmal ausprobiert. Heimlich, wenn Maman mit dem Baby beschäftigt und Papa bei der Arbeit gewesen war. Auch heute Nacht waren sie nicht aufgewacht, als es sich leise in den Hohlraum gequetscht hatte.
Warum nur hatte das Mädchen seine Eltern nicht geweckt? Hatte es tatsächlich gedacht, es befände sich in einem seiner Abenteuer? War es wirklich der Ansicht gewesen, von seinem Geheimort aus habe es den besten Blick auf das Geschehen? Es schlug seine Hand vor den Mund, um ein Schluchzen zu unterdrücken. Warum half ihm bloß niemand? Was hatte der Mann mit ihm vor?
Dem Mädchen war klar, dass der Mann es nicht finden durfte. Hoffentlich wusste er nichts von dem Versteck. Nachdem er in das Kinderzimmer geschaut hatte, hatte das Mädchen gehört, wie er es mehrmals bei seinem Namen rief. Aus lauter Furcht, er könne es hören, hatte es die Luft angehalten. Bis es nicht mehr konnte. Es hatte mitbekommen, wie er im oberen Stockwerk herumlief und nach ihm suchte. Einmal hatte er kurz leise aufgelacht. Es hatte sich böse und unheimlich angehört. Dem Mädchen war klar, dass es nie wieder aus dem Schrank herauskommen durfte, andernfalls …
Als das Baby zwei Zimmer weiter plötzlich zu brüllen begann, zuckte das Mädchen vor Schreck zusammen. Nein, nicht das Baby! Der Mann durfte dem Säugling nichts tun. Das Geschrei schwoll immer weiter an. Das Mädchen zitterte am ganzen Körper. Tränen rannen ihm über die Wangen. Was sollte es bloß tun? Das Baby war noch so klein. Es konnte sich doch nicht wehren.
Die Verzweiflung raubte dem Mädchen fast den Atem. Die Härchen auf seinen Armen stellten sich auf. Seine Lippen bebten. Es wollte sich die Hände auf die Ohren drücken und nichts mehr hören. Es wollte die Augen schließen, obwohl es spürte, dass es den Anblick seiner Eltern nie vergessen würde. Dass es diese Angst, die kaum noch auszuhalten war, nie wieder loswürde. Nein, es gab kein Entkommen. Obwohl das Mädchen noch so klein war, wusste sein Verstand instinktiv, dass die Geschehnisse der letzten Minuten es sein gesamtes zukünftiges Leben verfolgen würden.
Ein weiterer Schuss hallte durch die Dunkelheit. Schlagartig verstummte das Gebrüll. Nein! Jetzt konnte das Mädchen sein Schluchzen nicht mehr unterdrücken. Der Mann hatte das Baby erschossen. Die Schmerzen in seiner Brust drohten das Mädchen zu erdrücken.
Als es erneut Schritte auf dem Flur hörte, presste es beide Hände so fest auf seinen Mund, dass der Kiefer schmerzte. Der Mann durfte das Versteck nicht finden. Die Beine des Kindes zuckten unkontrolliert auf der Holzplatte. Es hörte ihn seinen Namen flüstern. Leise und bedrohlich. Er suchte es und er wusste, dass das Mädchen hier irgendwo war. Würde er hinter den Schrank schauen? Hatte Papa ihm vielleicht sogar von der Nische erzählt?
Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich nicht findet.
Jetzt konnte das Mädchen ihn sehen, er stand zwischen dem Bett der Eltern und dem Wandschrank. Ein sehr böser Mann. Das Mädchen wagte nicht mehr zu atmen. Es schloss die Augen und betete erneut, er möge den Raum unverrichteter Dinge verlassen.
Als es Sekunden später die Augen öffnete, war der Mann nicht mehr zu sehen. Das Mädchen nahm die Hände vom Mund und stützte sich auf der Holzplatte ab. Erschrocken zuckte es zurück, als seine linke Hand auf einen kleinen Gegenstand stieß. Vorsichtig tastete es auf dem Boden herum, bis es fand, was in seine Haut eingeschnitten hatte.
Seit Monaten hatte Maman danach gesucht. Das Mädchen erinnerte sich an die Verzweiflung, die seine Mutter befallen hatte, als sie den Verlust bemerkte. Sein Vater dagegen hatte es mit Humor genommen. Doch darüber hatte sich Maman noch mehr aufgeregt. Zu dem Zeitpunkt war das Baby noch nicht auf der Welt gewesen. Papa hatte mit strenger Stimme darauf bestanden, dass Maman sich beruhigen solle. Wegen des Babys in ihrem Bauch. Das Mädchen hatte nicht verstanden, was die Aufregung der Mutter mit deren dickem Bauch zu tun haben könnte. Erwachsene waren manchmal seltsam!
Es umfasste den Gegenstand mit seinen Fingern und drückte fest zu. Maman würde sich darüber freuen. Als der Blick des Mädchens auf den verdrehten Körper seiner Mutter fiel, fingen seine Augen erneut an zu brennen.
Im nächsten Moment stieg ihm ein Geruch in die Nase, der dem Mädchen irgendwie bekannt vorkam. So roch es, wenn Papa im Garten grillte. Was machte der böse Mann? Das Mädchen konnte sich nicht erklären, was er vorhatte. Seine Beine schliefen langsam ein. Das Mädchen hatte keine Ahnung, wie lange es hier schon saß.
Als der Geruch so schlimm wurde, dass seine Augen zu tränen begannen, und es das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen, schob es angsterfüllt die Holzplatte zur Seite und krabbelte aus dem Schrank. Der Flur war rauchverhangen. Panisch sah es sich im Schlafzimmer um, vermied jedoch tunlichst, seine Eltern anzublicken. Mit letzter Kraft drückte es sich einen Zipfel seines Nachthemds vor das Gesicht und öffnete das Fenster. Bevor das Mädchen sprang, drehte es sich ein letztes Mal um und schwor sich, niemals über das gerade Erlebte zu sprechen. Über die Schuld, die es in dieser Nacht auf sich geladen hatte. Und über den bösen Mann, der die Familie des Mädchens so grausam ausgelöscht hatte.
1
Montag, 18.Juni 2018Am Strand Espiguette, in der Nähe von Le Grau-du-Roi
Der Schmerz hämmerte erbarmungslos gegen ihre Schädeldecke. Der Mann musste sie getroffen haben, denn sie konnte das Blut an ihrem Kopf spüren. Mit letzter Kraft versuchte sie, ihre Augen zu öffnen. Doch die Gesichtsmuskeln gehorchten ihr nicht mehr. Sie hörte das Meer, das in gleichmäßigen Wellen an den Strand rollte. Sie spürte den Sand unter ihren Fingern. Fieberhaft versuchte sie, die Gedankenfetzen, die ziellos durch ihre Gehirnwindungen rasten, zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Was war nur schiefgelaufen?
Die Schreie der Jugendlichen hallten in ihrem Kopf nach. Sie hätten nicht hier sein dürfen. Obwohl ihre Finger sich fester in den Sandboden krallten, konnte sie sie nicht kontrollieren. Ihre Hände gehorchten ihr nicht mehr, genau wie der Rest ihres Körpers. Es schien, als ob einzig ihr Geist noch ihr gehörte.
Als sie auf dem weichen Sandboden plötzlich kleine Erschütterungen wahrnahm, zuckte sie innerlich zusammen. Er kam näher. Jetzt würde er sie umbringen. Gleich, wenn er bemerkte, dass sie noch lebte. Sie fühlte sich wie ein Tier in der Falle. Gelähmt und unfähig wegzulaufen. Einem Menschen ausgeliefert, der keine Gnade kannte.
Am liebsten hätte sie laut losgeschluchzt. Aus Angst, aus Wut auf sich selbst und aus Zorn. Aus diesem unbändigen Hass heraus, der ihr ganzes Denken beherrschte. Doch sie konnte nicht. Sie war nicht in der Lage, auch nur die kleinste Gefühlsregung zu zeigen. Sie hörte sein Keuchen, seinen Atem. Er stand jetzt dicht neben ihr. Wenn ihre Augen nicht bereits geschlossen gewesen wären, hätte sie sie spätestens jetzt fest zusammengekniffen. Sie hatte keine Chance gegen ihn. Verletzt und unbewaffnet lag sie vor ihm und konnte nur auf ihren Tod warten.
Erneut lauschte sie den Geräuschen des Meeres, sog die salzige Luft in ihre Lungen. Spürte den warmen Wind, der ihre Haut sanft streichelte. Warum brachte er es nicht hinter sich? Sie wartete darauf, dass ihr Leben wie ein Film vor ihrem geistigen Auge abgespult wurde. Bestanden die letzten Sekunden nicht aus einer Zusammenfassung alles Erlebtem? Hatte sie das nicht schon öfter gelesen? Warum also kam bei ihr nichts? Hatte sie sich vielleicht getäuscht? War sie etwa schon tot? War das möglich? Tot zu sein, ohne es zu wissen? Nein, das konnte nicht sein. Tot war tot. Tot bedeutete: keine Gehirntätigkeit mehr. Davon konnte bei ihr keineswegs die Rede sein. Ihr Kopf war schließlich das Einzige, das überhaupt noch halbwegs funktionierte. Nein, für ihre Situation musste es eine andere Erklärung geben.
War er noch da? Sie meinte zu spüren, wie ihre Härchen sich aufstellten. Ihre Gedanken wurden schwammiger und nebulöser. Wo war bloß ihr messerscharfer Verstand geblieben?
Ihr wurde schwindlig. Sie fühlte sich wie auf einer viel zu schnellen Achterbahn. Ihre Überlegungen passten nicht mehr zusammen. Wo war sie? Und was war geschehen? Sie befand sich in einem Sog, der sie immer stärker mit sich riss. Sie musste hier raus.
Verzweifelt versuchte sie, den Nebel in ihrem Gehirn zu durchdringen. Ihre Gedanken wurden immer wirrer. Sie meinte zu fallen, obwohl irgendwo in ihrem Hinterkopf die Information verankert war, dass sie sich bereits auf dem Boden befand. Sie fiel und fiel, bis sie von undurchdringlicher Dunkelheit umgeben war. Wie hinter einem Schleier spürte sie etwas Hartes an ihrer Hand, bevor das laute Geräusch eines Schusses die Schwärze um sie herum durchschnitt. Sie war verloren. Endgültig verloren.
2
Dienstag, 19.Juni 2018Am Strand Espiguette
Officier Bernadette Lascallet stand auf dem höchsten Punkt der Düne und ließ ihren Blick langsam über die Szenerie wandern. Der kilometerweite Strand war von einer hohen Düne befriedet und wurde alle paar Hundert Meter von langen Felsformationen unterbrochen. Ihre Kollegen standen bei den Streifenbeamten, die als Erste den Tatort gesichert hatten. Mehrere Ärzte beugten sich über die drei Schwerverletzten: Die beiden angeschossenen Jugendlichen befanden sich hinter den ersten Felsen, die bis weit ins Meer hineinragten, während die verletzte Frau fast im Wasser lag. Ein Jogger hatte vor etwa einer Stunde einen Notruf abgesetzt und gemeldet, dass drei blutüberströmte Personen am Strand lägen. Was war hier nur passiert?
Nachdenklich beobachtete Bernadette die Beamten der Spurensicherung, die den Abschnitt großflächig absperrten. Die Polizistin blickte auf ihre Uhr. Es war kurz vor acht. Die ersten Sonnenanbeter würden frühestens in einer Stunde auftauchen, wobei sich der Ansturm an einem gewöhnlichen Arbeitstag in Grenzen halten dürfte. Erst heute Nachmittag würde es hier belebter werden.
Auf dem Parkplatz hinter ihr standen unzählige Dienstwagen der Police Nationale. Beamte schleppten geschäftig schweres Gerät über den feinsandigen Strandabschnitt. Einige Hundert Meter östlich von hier begann der FKK-Bereich. Wieder stellte Bernadette sich dieselbe Frage: Was war hier geschehen?
Als ein Wagen hinter ihr bremste, drehte sie sich um. Capitaine Émile Foncelle, ihr Vorgesetzter bei der Police Nationale in Montpellier, stieg auf der Fahrerseite aus und blickte sich suchend um. Als er sie entdeckte, hob er kurz seine Hand und steuerte direkt auf sie zu. Immer wieder sank er in dem sandigen Boden ein. Bernadette musste ein Schmunzeln unterdrücken. Foncelle war Ende fünfzig und wog über hundert Kilo. Sie konnte sein Schnaufen schon von Weitem hören.
»Bonjour, Officier Lascallet«, murrte er, schwer atmend, während er sich den Hügel hinaufquälte.
»Bonjour, Capitaine.«
Foncelle deutete mit dem Kinn auf den vor ihnen liegenden Strand. »Und, was haben wir?«
»Zwei schwer verletzte Jugendliche mit Schusswunden und eine junge Frau mit einer Kopfverletzung«, fasste Bernadette zusammen.
»Tatwaffe?«
Die Polizistin zuckte mit den Achseln. »Bis jetzt haben wir keine gefunden.«
»Weiß man schon etwas zum Tathergang?«
»Non.«
»Dann wollen wir mal«, stieß Foncelle gereizt hervor und bedeutete seiner Mitarbeiterin, ihn zu begleiten.
»Bernadette, Capitaine«, rief Officier Thibaut Daubry, der ihnen von der Stelle entgegenkam, wo die beiden Jugendlichen gerade medizinisch versorgt wurden.
Thibaut war Bernadettes Kollege, ein attraktiver Mittvierziger, der erst seit drei Jahren mit seiner Familie in Montpellier lebte.
Foncelle grüßte ihn.
»Die Ärzte sagen, es sieht nicht gut aus.« Bedauernd schüttelte Thibaut seinen Kopf.
Bernadette blickte ihn schweigend an. Auch Foncelle erwiderte nichts.
»Beide sind sehr schwer verletzt und haben viel Blut verloren.«
»Merde!«, entfuhr es dem Capitaine.
Bernadette sah betreten zu Boden.
»Wissen wir schon, wer sie sind?«, wollte Foncelle wissen.
Thibaut deutete mit dem Daumen hinter sich. »Officier Hullaut sucht mit der Spurensicherung gerade den Strand ab. Vielleicht finden sie etwas.«
»Wie sind die beiden hierhergekommen? Und wer ist die Frau?« Foncelle war anzusehen, dass ihm die Situation ganz und gar nicht behagte.
»Wir nehmen an, dass sie schon seit gestern Abend hier liegen.« Thibaut drehte sich um und blickte einen Moment lang schweigend auf die Wellen. »Die Ärzte vermuten aufgrund des Zustands der Verletzungen, dass der Schusswechsel am späten Montagabend stattgefunden hat.«
»Mon dieu!« Foncelle kratzte sich am Kinn.
»Zu der Identität der Frau können wir ebenfalls noch nichts sagen. Sie hat keinerlei Papiere bei sich.« Thibaut blickte kurz zu Bernadette. »Sie hat eine schwere Kopfverletzung. Möglicherweise ist sie gestolpert und auf die Felsen gefallen. Lebensgefahr besteht bei ihr jedoch keine.«
»Zwei junge Leute werden angeschossen und eine junge Frau zieht sich eine schwere Kopfverletzung zu? Und das gleichzeitig?« Foncelle zog ungläubig seine Augenbrauen hoch.
»Die Frau ist noch immer bewusstlos. Im Moment wird sie ebenfalls ärztlich versorgt.« Thibaut zeigte auf zwei Sanitäter, die neben einer am Boden liegenden Gestalt knieten.
»Was für ein Debakel.« Der Capitaine knetete seine Finger.
»Das hier haben wir bei der Verletzten gefunden.« Bernadettes Kollege hob eine transparente Tüte hoch, in der sich ein goldener Ring befand.
»Was ist das?«, wollte die Polizistin wissen.
»Vermutlich ein Ehering«, erwiderte Thibaut. »Jedoch nicht ihr eigener. Schauen Sie auf die Inschrift.«
Bernadette kniff die Augen zusammen, während sie und Foncelle versuchten, die Buchstaben und Ziffern im Inneren des Rings zu erkennen.
»8.Mai 1985«, las der Capitaine laut vor. »Für immer dein.« Er stockte. »Was soll das heißen?«
»Es könnte Deutsch sein«, entgegnete Thibaut und deutete auf dasÜ. »Dieses Zeichen gibt es nicht in allzu vielen Sprachen.«
»Eine Deutsche also?«
Thibaut zuckte mit den Achseln. »Vielleicht auch eine Österreicherin oder Schweizerin. Aber wie gesagt, es kann nicht ihr Ehering sein. 1985 ist diese Frau definitiv noch nicht im heiratsfähigen Alter gewesen, wenn sie überhaupt schon geboren war.«
»Der Ring der Eltern?«, mutmaßte Bernadette.
»Möglich«, erwiderte Thibaut vage.
»Wir haben etwas«, erschallte es plötzlich rechts von ihnen in aufgeregtem Tonfall.
Als Bernadette sich umdrehte, hob einer der Spurensicherungstechniker eine Pistole in die Höhe.
»Die Tatwaffe«, folgerte Thibaut hörbar erleichtert.
Foncelle starrte ins Leere. »Eine Ausländerin, die zwei Jugendliche am Strand niederschießt?«
Bernadette konnte sich denken, was im Kopf des Capitaines vor sich ging. Wenn Ausländer in Kapitalverbrechen verwickelt waren, zog dies immer diplomatische Verwicklungen der höchsten Kreise mit sich. Wenn, wie in diesem Fall, sogar der Täter selbst aus dem Ausland kam, würden sie keinen Schritt machen dürfen, ohne über jede ihrer Ermittlungsstrategien ausführlich Rede und Antwort zu stehen.
Officier David Hullaut kam auf sie zu. Er war ein paar Jahre jünger als Bernadette und hatte zur gleichen Zeit wie sie bei der Police Nationale angefangen. In den letzten Jahren hatten sie schon mehrfach gemeinsame Ermittlungen durchgeführt. Bernadette schätzte seine loyale und ehrliche Art.
David zeigte auf die Ärzte, während er sich zu ihnen gesellte. »Sie bringen die drei Verletzten ins Uniklinikum nach Montpellier.«
Foncelle nickte. »Wie lautet die Prognose?«
David zog eine Grimasse. »Sieht nicht gut aus. Die Jugendlichen sind sehr schwach aufgrund des hohen Blutverlusts.«
»Was ist mit der Frau?«
»Sie ist nicht bei Bewusstsein. Allerdings scheint die Kopfwunde schlimmer auszusehen, als sie ist.«
»Und niemand weiß, wer die drei sind.« Der Capitaine klang frustriert.
»Falsch«, widersprach David und blickte von Bernadette zu Thibaut. »Die Spurensicherung hat dahinten«, er deutete auf die Düne links von ihnen, »eine Handtasche gefunden.«
»Und?«
»Der Name der Jugendlichen lautet Sophie Dumonde, siebzehn Jahre alt, aus Le Grau-du-Roi.«
»Dumonde?« Foncelle schnappte nach Luft. »Raymond Dumondes Tochter?«
Bernadette horchte auf. Raymonde Dumonde war ein Großindustrieller, der in seiner Keksfabrik in Montpellier mehr als fünftausend Mitarbeiter beschäftigte. »Der Eigentümer von Dumonde-Kekse?«
Der Capitaine nickte. »Ich weiß, dass er eine halbwüchsige Tochter hat.«
»Die Adresse könnte hinkommen«, bestätigte David zögernd, bevor er ihnen eine Straße nannte, die im Villenviertel Le Grau-du-Rois lag.
»Mon Dieu!«, fluchte Foncelle. »Das bedeutet Ärger. Richtig großen Ärger.«
»Vielleicht schafft sie es ja«, versuchte Thibaut, ihn zu beschwichtigen. »Die Ärzte in der Uniklinik sind wirklich gut. Die besten, die die Region zu bieten hat.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr«, knurrte der Capitaine, bevor er sich wieder an David wandte. »Und wer ist der zweite Jugendliche?«
David schüttelte den Kopf. »Bedaure, aber das wissen wir noch nicht. In Dumondes Tasche befanden sich allerdings zwei Handys. Sobald diese untersucht sind, werden wir hoffentlich erfahren, um wen es sich bei dem jungen Mann handelt.«
Bernadette beobachtete, wie die Tragen mit den Verletzten langsam Richtung Parkplatz getragen wurden.
»D’accord«, erwiderte Foncelle. »Unterstützen Sie die Beamten der Spurensicherung soweit erforderlich. Wir treffen uns gegen zwölf im Büro und besprechen die weitere Vorgehensweise. In der Zwischenzeit werde ich mit Raymond Dumonde reden und den Directeur über dieses Debakel informieren. Hoffentlich kann Dumonde mir sagen, mit welchem Kerl sich seine Tochter abends am Strand verabredet.«
3
Vier Wochen zuvorMontpellier
»Papa.« Danielle wartete bereits seit einigen Minuten vor dem Eingang des imposanten Universitätsklinikums, als sie ihren Vater endlich auf sich zukommen sah.
Alexandre Sigrand umarmte seine Tochter und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Bonjour, chérie.«
»Was haben sie gesagt?« Besorgt sah Danielle ihren Vater an, der bekümmert den Kopf schüttelte.
»Nicht viel. Nur, dass die Untersuchungen beendet seien und sie mit uns sprechen wollten.«
»Ich verstehe nicht …« Danielle brach verwirrt ab.
Sie hatte gestern Dienst gehabt. Warum hatte keiner ihrer Kollegen mit ihr geredet? Als ihr Vater sie vor einer Stunde angerufen und gebeten hatte, ihn ins Krankenhaus zu begleiten, hatte sie keine Sekunde gezögert. Sie machte sich große Sorgen um ihre Mutter.
Bei Christelle Sigrand waren vor zehn Jahren die Anfänge einer Demenz festgestellt worden, nachdem sie immer öfter plötzlich nicht mehr gewusst hatte, wo sie war oder was sie gerade tun wollte. Zum damaligen Zeitpunkt war sie siebenundvierzig Jahre alt gewesen. Selbst Danielle als Ärztin fiel es schwer zu akzeptieren, dass ihre Mutter oder besser gesagt, das, was noch von ihrem Wesen existierte, Stück für Stück verschwand. In ihren schlechteren Phasen erkannte Christelle Sigrand weder ihren Mann noch Danielle.
»Sie scheinen erst heute früh weitere Ergebnisse bekommen zu haben«, unterbrach Danielles Vater ihre Grübelei.
»Dann lass uns reingehen.« Ungeduldig steuerte die Ärztin auf den Krankenhauseingang zu.
»Ich bin froh, dass du dabei bist, Danielle«, merkte ihr Vater leise an, während sie die Stufen hinaufstiegen.
Überrascht sah sie ihn von der Seite an. So gefühlsduselig war er sonst nicht. Auch er machte sich offenbar große Sorgen. Danielle kannte den Verlauf einer schweren Demenzerkrankung. Wenn jetzt noch weitere Hiobsbotschaften auf sie warteten … »Bei wem hast du den Termin?«
»Docteur Bannac.«
Danielle zuckte bei dem Namen innerlich zusammen. Während der Praktika ihres Medizinstudiums war sie mehrere Monate im Team von Docteur Louis Bannac tätig gewesen. Der gut aussehende Mittdreißiger hatte sie mit seinem umwerfenden Charme sofort in seinen Bann gezogen. Bis sie, drei Wochen nachdem sie eine leidenschaftliche Affäre mit dem aufstrebenden Mediziner begonnen hatte, erfahren musste, dass Louis verlobt und seine Zukünftige mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Nachdem sie das Techtelmechtel daraufhin beendet hatte, war sie ihm aus dem Weg gegangen. Und auch wenn sie mittlerweile dauerhaft im gleichen Klinikum arbeiteten, kreuzten sich ihre Wege kaum, da sie in unterschiedlichen Bereichen tätig waren. Louis war Onkologe, während Danielle sich auf Kinderheilkunde spezialisiert hatte.
Als sie bemerkte, dass ihr Vater sie abwartend anblickte, zog sie fragend die Augenbrauen hoch.
»Du kennst ihn also nicht?«
»Wen?« Danielle hatte nicht zugehört.
»Docteur Bannac«, erwiderte ihr Vater gereizt.
»Doch«, sie nickte, »doch, ich kenne ihn. Flüchtig. Aus meiner Studienzeit.« Sicher würde sie ihrem Vater nicht auf die Nase binden, dass sie mit Louis Bannac sogar schon gemeinsam geduscht hatte. Sie riss sich zusammen.
Alexandre Sigrand kramte einen kleinen Zettel aus der Hosentasche. »Zimmer 211, zweiter Stock«, las er ab.
»Bannac ist Krebsspezialist«, murmelte Danielle leise. Sicher gab es einen triftigen Grund dafür, dass ausgerechnet er mit ihnen sprechen wollte.
Christelle Sigrand lag seit drei Tagen auf der Inneren, da sie sich die letzten Tage immer wieder unwohl gefühlt hatte. Mit Sorge dachte Danielle an das erschöpfte Gesicht ihrer Mutter. Nachdem Christelle sich mehrmals vehement gegen eine Krankenhauseinlieferung gewehrt hatte, jedoch immer weniger trank und aß, war es letztendlich die Pflegerin ihrer Mutter gewesen, die den Notarzt gerufen hatte.
Alexandre Sigrand weigerte sich seit Jahren beharrlich, seine Frau in einem Pflegeheim unterzubringen. Und Danielle war überaus froh, dass er über die erforderlichen Mittel verfügte, um seiner Frau in der weitläufigen Villa, die sie gemeinsam bewohnten, die Betreuung zukommen zu lassen, die sie in ihrem Zustand benötigte.
Alexandre Sigrand hatte sich mit seiner Immobilienfirma in den letzten Jahrzehnten ein beachtliches Vermögen erarbeitet. Und doch nutzte das Geld im Fall ihrer Mutter nichts. Christelle Sigrand verabschiedete sich unweigerlich auf Raten aus dem Leben. Aus einem Leben, von dem andere nur träumen konnten. Mit einem treu sorgenden Ehemann, einer Tochter, die am Anfang einer vielversprechenden Medizinerkarriere stand, und Reichtum, der alle materiellen Ängste im Keim erstickte. Doch auch die beste Versorgung konnte Christelle Sigrands Zustand nicht nachhaltig verbessern.
»Hier ist es.« Danielle zeigte auf eine Tür links im Flur, während sie ihre bitteren Gedanken verdrängte.
»Ein Krebsspezialist?«, wiederholte ihr Vater mit entsetzter Stimme, als er zaghaft klopfte.
Bevor Danielle etwas erwidern konnte, ertönte eine männliche Stimme aus dem Raum.
»Oui?«
Danielles Puls beschleunigte sich, als sie die Tür öffnete. Während sie und ihr Vater eintraten, erhob sich Louis Bannac hinter seinem Schreibtisch.
»Bonjour, Monsieur Sigrand.« Er streckte ihrem Vater die Hand hin. »Ich bin Docteur Bannac.«
Alexandre Sigrand erwiderte die Begrüßung und stellte sich ebenfalls vor.
»Danielle.« Louis nickte ihr zu.
»Bonjour.« Zögernd ergriff sie seine Hand.
»Bitte«, der Arzt zeigte auf die Stühle vor dem Schreibtisch, »setzen Sie sich doch.« Louis nahm ebenfalls wieder Platz und zog eine Akte zu sich heran.
»Was ist mit Christelle?«
Danielle musterte das müde Gesicht des Mediziners. Sie hatte gehört, dass seine Frau vor Kurzem das dritte Kind bekommen hatte. Wenig Schlaf, viel Stress, dazu die langen Schichten und die psychische Belastung im Krankenhaus. Wahrlich kein Zuckerschlecken. Doch das Mitleid mit ihrem ehemaligen Geliebten hielt sich in Grenzen. »Louis, wir machen uns wirklich große Sorgen«, platzte es aus ihr heraus.
Er sah sie einen Augenblick mit überraschter Miene an, bevor er sich darauf zu besinnen schien, warum sie hier waren. »D’accord.« Er nickte langsam und sah zu Danielles Vater. »Ihrer Frau geht es in der Tat nicht besonders gut. Wir haben leider festgestellt, dass sie an Nierenkrebs leidet.«
Keine Vorwarnung, kein langsames Herantasten. Seine Worte hingen bleischwer in der Luft.
»Nierenkrebs?« Die Stimme von Danielles Vater zitterte. »Aber …?«
»Seid ihr euch sicher?« Danielle überkam das beklemmende Gefühl, der Boden unter ihr beginne zu wanken.
Louis nickte. »Leider ja.«
»Wie schlimm ist es?«, wollte ihr Vater wissen, während er seine Finger nervös ineinander verknotete und sich vorbeugte.
Der Arzt erklärte ihnen, welche Untersuchungen durchgeführt wurden und wie die Ergebnisse zu werten waren. »Nierenkrebs ist eine sehr seltene Krebsart«, erklärte er in sachlichem Tonfall. »Das Problem bei Ihrer Frau ist, dass beide Nieren befallen sind.«
»Beide?« Entsetzt schaute Danielle den Mediziner an.
Ihr war sofort klar, was diese Diagnose bedeutete. Wäre nur ein Organ befallen, hätte Christelle Sigrand ohne größere Einschränkungen mit der verbleibenden Niere weiterleben können. Waren aber beide befallen, sah die Situation schlagartig anders aus. Wesentlich schlimmer und viel lebensbedrohlicher. Dialyse konnte man bei Danielles Mutter ausschließen, da die Demenz so stark vorangeschritten war, dass Christelle Sigrand es mit Sicherheit nicht dulden würde, mehrmals pro Woche stundenlang an die entsprechenden Geräte angeschlossen zu werden. Und eine Erklärung würde sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht erreichen.
»Das heißt, sie braucht dringend ein Spenderorgan?« Danielle wollte nicht um den heißen Brei herumreden. Es ging um das Leben ihrer Mutter.
Louis atmete tief durch. »Theoretisch ja.«
»›Theoretisch‹?«, wiederholte Danielles Vater verwirrt. »Was soll das heißen, theoretisch? Und was ist praktisch?«
»Im Idealfall entfernen wir Ihrer Frau schnellstmöglich die beiden kranken Organe und sie bekommt eine passende Spenderniere transplantiert.« Der Onkologe machte eine Pause. »Aber …«
»Dann veranlassen Sie alles Nötige«, unterbrach Alexandre Sigrand ihn aufgebracht. »Die Kosten spielen keine Rolle, Docteur. Suchen Sie eine passende Niere für meine Frau und operieren Sie sie.«
Danielle blickte erschüttert auf die Schreibtischplatte. Wie durch einen dichten Schleier nahm sie Louis’ folgende Worte wahr.
»Wie gesagt, das wäre der Idealfall, Monsieur. Aber leider sieht die Praxis etwas anders aus.«
»Was soll das heißen? Ich sagte doch gerade …« Ihr Vater schnappte nach Luft.
»Ich habe gehört, was Sie sagten. Aber es gibt Listen für Spenderorgane. Und deren Reihenfolge hängt von verschiedenen Faktoren ab.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
Danielle sah Hilfe suchend zu Louis, der ihr wissend zunickte.
»Es wird eine Weile dauern, bis eine Niere für Ihre Frau zur Verfügung steht. Theoretisch.«
»Aber Sie haben doch eben gesagt …« Alexandre Sigrand fasste sich nervös an den Hals. »Was …? Ich verstehe nicht ganz …«
»Die Lage ist sehr ernst, Monsieur. Ich möchte Sie nicht belügen. Ihrer Frau bleibt leider nicht viel Zeit. Der Krebs befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Es tut mir wirklich sehr leid.«
Danielles Augen begannen zu brennen. Louis Bannac hatte ihnen gerade mitgeteilt, dass ihre Mutter ohne eine neue Niere sterben würde. Und da viel zu wenig Spenderorgane zur Verfügung standen, würde der Erhalt eines passenden Organs zu lange dauern, um Christelle Sigrand zu retten.
»Meine Frau ist dement«, stammelte Danielles Vater bestürzt.
»Das wissen wir, Monsieur. Und es macht die Behandlung leider nicht einfacher. Wir können Ihrer Frau nicht sagen, wie es um sie steht, denn sie würde es nicht verstehen.« Louis machte eine Pause. »Wer ist Madame Sigrands Betreuer?«
Danielles Vater schien den Mediziner nicht gehört zu haben.
»Ich bin für die Gesundheitssorge zuständig«, antwortete sie an seiner Stelle. »Mein Vater ist für die Vermögensangelegenheiten meiner Mutter verantwortlich. Seit ich mein Medizinstudium beendet habe, teilen wir uns die Betreuung.« Sie hatte das Gefühl, einen auswendig gelernten Text aufzusagen.
Louis Bannac erwiderte nichts.
»Wie lange?« Danielle erkannte ihre eigene Stimme nicht mehr.
»Wenn wir Glück haben und eine Niere bekommen …«, begann der Arzt zögernd.
»Wie lange, Louis? Und verkauf mich nicht für dumm! Du weißt genauso gut wie ich, dass meine Mutter nicht rechtzeitig eine Niere erhalten wird«, unterbrach sie ihn barsch.
»Ein paar Monate«, entgegnete er, während er von Danielle zu ihrem Vater sah. »Höchstens.«
Betretenes Schweigen machte sich breit. Danielle sah zu der Wanduhr hinter Louis, die die unheilvolle Stille mit ihrem stetigen Ticken betonte. Lebenssekunden, die verstrichen. Zeit, die verging. Unaufhaltsam, grausam und unerbittlich. Zeit, die sie nicht hatten. Zeit, die ihre Mutter nicht mehr besaß.
Danielle kam eine Idee. »Ich werde ihr eine Niere spenden.«
Warum hatte sie nicht gleich daran gedacht? Ihr reichte schließlich eine Niere. Und ihre Mutter müsste nicht auf ein Fremdorgan warten, sondern könnte schnell operiert werden.
Louis sah Danielle überrascht an, während ihr Vater neben ihr hastig aufsprang. »Nein!«
Irritiert blickte Danielle ihn an. »Nein?«
»Nein.« Er räusperte sich, bevor er sich wieder neben sie setzte.
»Warum nicht?« Sie runzelte die Stirn.
»Das wäre eine reelle Möglichkeit, Ihre Frau zu retten«, warf nun auch Louis ein. »Man kann mit einer Niere sehr gut leben, das ist durchaus möglich. Natürlich müssten wir erst testen, ob …«
»Nein«, unterbrach ihn Alexandre Sigrand erneut.
Danielle wurde wütend. »Das ist meine Entscheidung, Papa. Hast du nicht gehört, was Docteur Bannac gerade gesagt hat? Maman hat nicht mehr viel Zeit.«
Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Non, Danielle. Das werde ich nicht zulassen. Deine Mutter ist dement. An ihren schlechten Tagen weiß sie ihren eigenen Namen nicht mehr. So ein Leben hätte sie niemals gewollt. Und noch weniger wollte sie, dass du deine Gesundheit riskierst für ein Leben, das diese Bezeichnung schon lange nicht mehr verdient.«
»Bist du jetzt völlig verrückt geworden?« Danielle kniff ihre Augen zusammen, während sie Louis’ irritierten Blick auf sich spürte. »Willst du etwa sagen, Mamans Leben sei es nicht wert, gerettet zu werden?«
Fahrig fuhr sich Alexandre Sigrand über seinen Kopf. »Non!« Er presste die Lippen aufeinander. »Non, natürlich nicht. Aber sie würde nicht wollen, dass du so etwas für sie tust. Nicht in ihrer Situation!« Er sah zu Louis. »Bei so einer Organentnahme gibt es doch auch Risiken, Docteur, nicht wahr?«
Der Mediziner zögerte. »Alors … Natürlich handelt es sich um eine Operation und die ist nie komplett risikolos, aber …«
»Hörst du?« Triumphierend zeigte Danielles Vater in die Richtung des Arztes. »Ich werde das nicht zulassen, Danielle.«
Sie schüttelte ihren Kopf. »Ich verstehe dich nicht, Papa. Ich könnte Maman helfen. Sie wird sonst sterben.«
»Es wäre wirklich die bestmögliche Lösung, um Ihrer Frau rechtzeitig …«, unterstützte Louis sie.
»Non.« Ihr Vater hob abwehrend seine Hände. »Das ist keine Option.«
Bestürzt stellte Danielle fest, dass seine Augen feucht wurden.
»Ich habe meine Frau an diese furchtbare Krankheit verloren. Ich werde nie wieder auch nur einen unbeschwerten Tag mit ihr verbringen können.« Er sah zu Danielle. »Ich werde nicht zulassen, dass ich auch noch dich verliere.« Sein Blick wurde eindringlicher. »Niemals.« Betroffen blickte Danielle zu Louis, der hilflos seine Schultern hob. Ihnen war beiden klar, dass die Worte von Danielles Vater das Todesurteil für Christelle Sigrand bedeuteten.
4
Dienstag, 19.Juni 2018Montpellier
Irgendwo in den hinteren Windungen seines Hirns hörte Cédric undeutlich, wie ein Schlüssel im Haustürschloss gedreht wurde. Verschlafen blinzelte er, während er orientierungslos nach seinem Smartphone tastete.
»Mon dieu! Wie lange hast du denn hier nicht mehr gelüftet?«, ertönte die tadelnde Stimme seiner Ex-Frau aus dem Wohnungsflur, bevor eine nasse kalte Schnauze seine Hand anstupste.
»Coco«, brummte Cédric genervt und hob seinen Kopf. Die dunklen Augen der Dalmatinerhündin starrten ihn auffordernd an, während ihr ganzer Körper durch das aufgeregte Schwanzwedeln bebte. Obwohl sein Schädel dröhnte, als schlage jemand mit dem Hammer erbarmungslos auf ihn ein, musste er schmunzeln. »Coco«, wiederholte er grinsend, da er der Hündin einfach nicht böse sein konnte.
»Hast du etwa bis eben geschlafen?« Colette erschien im Türrahmen.
Cédric setzte sich auf, während seine Ex-Frau ihren Blick durch das unaufgeräumte Zimmer schweifen ließ. »Warum schläfst du auf der Couch?« Ihre Missbilligung war nicht zu überhören.
Müde fuhr er sich durchs Haar, während er die Decke zur Seite legte. »Dir auch einen guten Morgen«, knurrte er gereizt.
Colette schüttelte demonstrativ den Kopf, während sie das Wohnzimmer durchquerte, den Fensterladen aufriss und frische Luft hereinließ.
»Was machst du da?« Cédric stand auf und suchte nach seiner Jeans.
Gestern Abend war es ziemlich spät geworden. Er war noch in der Bar versackt, die sich im Erdgeschoss des Wohnhauses befand, in dem auch sein Appartement war. Irgendwie musste er mal wieder die Zeit vergessen haben. Zumindest konnte Cédric sich nicht erinnern, wann er nach Hause gekommen war.
»Was für ein Gestank.« Colette rümpfte ihre Nase.
Während er sich anzog, umrundete Coco ihn hektisch und ließ ihn keine Sekunde aus den Augen.
»Was machst du überhaupt hier?« Cédric kniff seine Augen zusammen. Es war zu hell und es war viel zu früh, um sich auf Diskussionen mit seiner stets perfekten Ex-Frau einzulassen. Auch heute früh sah Colette aus wie aus dem Ei gepellt: Ihr dunkelblaues Kostüm saß an ihrem Körper wie eine zweite Haut. Das Gesicht, das Cédric vor langer Zeit einmal als das schönste, das er je gesehen hatte, bezeichnete, war wie immer geschmackvoll geschminkt.
Die distanzierte und unnahbar wirkende Colette. Als sie sich zum ersten Mal begegnet waren, hatten ihre kühle Eleganz und leicht arrogant wirkende Art ihn angezogen wie das Licht die Motten. Cédric, der impulsive und chaotische Ermittler, und Colette, die bestens organisierte und durchstrukturierte Polizeiärztin. Diese Zeiten waren lange vorbei. Im Laufe ihrer Beziehung war ihm die Perfektion seiner damaligen Angetrauten immer stärker auf die Nerven gegangen. Irgendwann hatte er entschieden, dass er mit einer Frau, die niemals ungeschminkt an den Strand gehen würde und die beim Sex immer das volle Programm wie Kerzenschein, frische Bettwäsche und stimmungsvolle Musik benötigte, nicht glücklich werden konnte. Zu seinem Leidwesen hatte er einsehen müssen, dass Colette nur zufrieden war, wenn sie Barbie und Ken spielten. Das perfekte Paar mit der perfekten Wohnung und dem perfekten Leben. Aber Cédric war schon lange nicht mehr zufrieden gewesen. Ihm fehlte die Spontanität und das Abenteuer, Lebensfreude und Ausgelassenheit. Als er schließlich aus Trotz langsam zu seinem alten Lebensstil zurückgekehrt war, hatte es immer öfter Reibereien gegeben, bis sie schließlich gemeinsam entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen.
Seit zwei Jahren waren sie mittlerweile geschieden. Damals war Coco achtzehn Monate alt gewesen. Da sie beide an der Hündin hingen, hatten sie beschlossen, das Tier abwechselnd zu betreuen, auch wenn dieses Arrangement viel Organisationstalent benötigte. Colette konnte sich ihre Arbeitszeit frei einteilen. Sie arbeitete auf Honorarbasis für die Police Nationale in Montpellier, wenn diese bei ihren Ermittlungen ärztliche Unterstützung benötigte. Außerdem hatte sie einen Lehrauftrag an der juristischen Fakultät der städtischen Universität. Da Cédric als Undercoverermittler der Police Nationale stets mehrere Tage am Stück im Einsatz war, bevor er wieder für längere Zeit freihatte, ergänzten sich ihre Arbeitszeiten in der Regel nahtlos. Und wenn doch mal Not am Mann war, sprang Cédrics Bruder Léandre ein, der als selbstständiger Privatdetektiv Coco beaufsichtigen konnte, wenn er Büro- oder Recherchearbeiten zu erledigen hatte.
Cédric ging in die Küche und schaltete die Kaffeemaschine an. Die Dalmatinerhündin wich ihm nicht von der Seite.
»Was machst du den ganzen Tag?« Seine Ex-Frau trat zu ihm und musterte ihn unverhohlen.
»Hör zu, Colette. Ich bin seit fünf Minuten wach. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, du sollst den Schlüssel nur benutzen, wenn ich nicht da bin. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe?« Gereizt wandte Cédric sich ab.
»Was ist bloß aus dir geworden?«, stichelte sie weiter.
Ihr bevormundender Tonfall ließ ihn kochen.
»Du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Und dich rasieren. Mann, Cédric, lass dich doch nicht so gehen.«
Er drehte sich langsam zu ihr um und betrachtete stumm ihr perfektes Gesicht. Die Katzenaugen, die ihn vorwurfsvoll musterten. Die dünne Nase, die er mittlerweile einen Tick zu spitz fand. »Was willst du?« Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Du hast Verantwortung.«
Cédric lachte auf. »Für einen Hund, ja.« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube kaum, dass Coco sich für meine Haare oder meine Rasur interessiert.«
»So kann man doch nicht leben.« Colette fuchtelte mit ihren Händen herum, bevor sie sich erneut in dem Raum umblickte.
»Du kannst so nicht leben«, erklärte er süffisant. »Ich schon.« Er holte sich einen Becher aus dem Schrank, sah seine Ex-Frau kurz fragend an und schenkte sich ein, als sie mit ihrer manikürten Hand abwinkte.
»Du bist suspendiert. Das bedeutet nicht das Ende der Welt.«
Cédric atmete tief durch, bevor er seinen Kaffee zur Seite stellte. »Wir beide«, er zeigte erst auf sie, bevor er den Zeigefinger auf seine Brust richtete, »sind geschieden.« Er hob seine Augenbrauen. »Verstehst du das? Nicht mehr zusammen, getrennt.« Er deutete mit seinen Händen Distanz an. »Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Wie du richtig bemerkt hast, bin ich auf unbestimmte Zeit suspendiert. Das heißt, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Wenn du unbedingt jemanden bevormunden willst, dann wende dich an deinen Staatsanwalt. Sicher steht der auf frische Bettwäsche.«
Wütend blickte Colette ihn an. »Was willst du damit sagen?«
Cédric winkte ab. »Vergiss es.« Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee und legte den Kopf in den Nacken. Er wollte seine Ruhe haben.
»Hast du von der Schießerei am Espiguette gehört?«
Cédric sah seine Ex-Frau fragend an. »Knallen sich jetzt schon die Touristen gegenseitig ab?« Er verzog seine Lippen zu einem schwachen Grinsen. Von der Police Nationale wollte er gerade nichts hören, der ganze Laden ging ihm gehörig auf die Nerven. Gut, er hatte einen Fehler gemacht, aber die Suspendierung auf unbestimmte Zeit war eine seiner Meinung nach mehr als übertriebene Sanktion.
»Red keinen Unsinn«, entgegnete Colette scharf. »Dumondes Tochter scheint angeschossen worden zu sein.«
»Das Kind des Keksmoguls?«, hakte Cédric lustlos nach.
Colette nickte.
»Hast du einen Auftrag?«
»Non, noch nicht. Es scheint sich übrigens um eine Täterin zu handeln.«
»Mal was anderes.«
»Ist das alles, was du zu sagen hast?« Seine Ex-Frau verengte ihre Augen zu schmalen Schlitzen.
Er zuckte mit den Achseln. »Ich kenne Dumonde nicht. Und seine Tochter ebenso wenig.«
»Du bist so armselig«, fauchte Colette. »Badest in deinem Selbstmitleid und hast sämtliche Empathie verloren. Wo ist denn bloß der Kämpfer geblieben, der Weltverbesserer?«
»Als ob dich das noch interessieren würde«, gab er gelassen zurück. Sie konnte ihn mit ihren Worten nicht mehr treffen.
»Hör mal zu, mein Lieber«, Colette stemmte die Fäuste in die Taille. »Niemand hat dich gezwungen, die Kleine flachzulegen. Wenn du deinen …«, sie schluckte, »… wenn du dich nicht einmal so weit im Griff hast, dass du den Avancen dieser Drogenbraut widerstehen kannst, brauchst du dich im Nachhinein nicht über die angebliche Ungerechtigkeit der Welt aufregen. Dieser Fehler war allein deine Schuld.« Sie schob ihren Unterkiefer vor. »Ich habe immer gewusst, dass dir dein Rumgevögel irgendwann einmal zum Verhängnis werden würde.«
»Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst«, erwiderte Cédric. Er hatte keine Lust mehr auf die Besserwisserei seiner perfekten Ex-Frau mit ihrem perfekten neuen Partner und ihrem scheißperfekten Leben. Er wollte lieber weiter in seinem Selbstmitleid baden und seine Wunden lecken. Abwesend strich er der Hündin über den Kopf.
Colette nickte grimmig. »Kümmere dich ordentlich um Coco. Sie muss morgens um acht raus, nicht erst um elf.«
Mit diesen Worten drehte seine Ex-Frau sich um und stolzierte auf ihren High Heels in den Flur hinaus.
»Leck mich«, presste Cédric zwischen seinen Zähnen hervor und ging dann in die Hocke, um Coco ausführlich zu liebkosen. Die Hündin maßregelte ihn wenigstens nicht.
Zwei Sekunden später knallte die Wohnungstür zu.
»Jetzt machen wir es uns gemütlich«, erklärte er in feierlichem Tonfall und kehrte zur Couch zurück, um den Fernseher einzuschalten, während Coco sich seufzend neben ihn legte.
5
Le Grau-du-Roi
Nachdenklich blickte Bernadette der schwarzen Limousine hinterher, in der das Ehepaar Dumonde gerade zum Universitätsklinikum in Montpellier aufgebrochen war. Wieder hatte sie eine schlechte Nachricht überbringen müssen, die das Leben einer Familie von einer auf die andere Sekunde völlig aus den Fugen hob. Bernadette hoffte inständig, dass die beiden verletzten Jugendlichen überlebten.
Neben ihr schnaufte Foncelle tief durch. Ihm schienen ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen.
»Fahren wir zu Directeur Labachard?« Bernadette sah ihren Vorgesetzten abwartend an.
Foncelle zögerte. Nachdem die Dumondes die Hiobsbotschaft über die Ereignisse der letzten Nacht ansatzweise verdaut hatten, hatte Bernadette nach dem Freund der Tochter gefragt. Sophie schien offen mit ihren Bekanntschaften umgegangen zu sein. Zumindest wussten beide Eltern, dass sie gestern Abend mit Yann Labachard verabredet gewesen war.
Sowohl Foncelle als auch Bernadette mussten sich zusammenreißen, als sie den Namen hörten. Yann war das einzige Kind von Directeur Jacques Labachard, dem direkten Vorgesetzten Émile Foncelles.
»Merde!«, fluchte der Capitaine jetzt lautstark neben ihr und fasste sich an die Stirn. »Wer ist diese Ausländerin?«
»Vielleicht haben Thibaut und David mittlerweile neue Informationen«, merkte Bernadette halbherzig an. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten sich die beiden sicher schon gemeldet.
»Ja, vielleicht«, entgegnete Foncelle gedankenverloren.
Bernadette betrachtete das Panorama, das sich ihnen bot. Von der Villa der Dumondes hatte man einen freien Blick auf das Mittelmeer, das sich etwa fünfhundert Meter Luftlinie entfernt befand. Da es heute fast windstill war, lag es glatt und ruhig vor ihnen. Die Dumonde-Villa war ein Traum aus Glas und Beton mit einem parkähnlichen Garten, in dessen Mitte sich ein großer ovaler Swimmingpool befand. Die Oberschicht Le Grau-du-Rois, dachte Bernadette andächtig. Das Viertel war von einer hohen Steinmauer umgeben. Wenn man zu einem der Anwesen fahren wollte, musste man an einem Portier vorbei. Eine eigene kleine Welt, ein Mikrokosmos der Reichen und Schönen.
»Vielleicht war es eine missglückte Entführung«, überlegte Bernadette laut.
Foncelle sah sie überrascht an. »Wie kommen Sie darauf?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Sehen Sie sich hier doch mal um! Ich bin mir sicher, dass Dumonde, ohne zu zögern, bereit wäre, eine Menge Geld für seine Tochter zu zahlen.«
Ihr Vorgesetzter verzog sein Gesicht. »Sie könnten recht haben. Aber was ist mit Labachards Sohn? Sicher nagt der Directeur nicht am Hungertuch, aber reicht das, um Ziel einer Entführung zu sein?«
»Ein Versehen«, mutmaßte Bernadette vorsichtig. »Vielleicht dachte die Entführerin, Sophie Dumonde sei allein.«
Foncelle sah sie zweifelnd an. »Allein am Strand, am späten Abend?« Er schüttelte den Kopf. »Non, das passt irgendwie nicht.«
Bernadette überlegte. »Vielleicht hat diese Ausländerin auch die eigentlichen Entführer gestört? Möglicherweise ist irgendetwas schiefgelaufen?«
»Sie meinen, sie könnte nur eine unbeteiligte Zeugin sein?« Foncelle runzelte seine Stirn.
»Na ja, ganz unbeteiligt war sie wohl nicht«, widersprach Bernadette, während sie die Palmen hinter dem hohen Eisentor des Anwesens der Dumondes betrachtete. »Aber sie könnte unschuldig sein. Vielleicht waren weitere Personen beteiligt.«
»Die die beiden mutmaßlichen Entführungsopfer erst anschossen und sie dann samt einer Zeugin schwer verletzt am Strand zurückließen?« Wieder schüttelte Foncelle den Kopf. »Das klingt …«, er suchte nach Worten, »… sehr konstruiert.«
Bernadette verdrehte die Augen.
»Und denken Sie an die am Tatort gefundene Waffe«, fuhr Foncelle fort, der die Gereiztheit seiner Mitarbeiterin nicht zu bemerken schien. »Non.« Er spuckte auf den Boden. »Das sind alles Spekulationen, die uns nicht weiterbringen.«
Auch wenn sie es nicht zugeben wollte, musste Bernadette ihm zustimmen. Ihre Theorie hakte an mehreren Stellen. Niemand befand sich spätabends bewaffnet am Strand, wenn er nicht etwas Illegales vorhatte.
Das Klingeln von Foncelles Handy riss sie aus ihren Gedanken.
»Der Directeur«, stöhnte der Capitaine. »Merde!« Mit sichtbarem Widerwillen nahm er das Gespräch an, während er Bernadette eindringlich anblickte.
Nachdem sie eben erst von den Dumondes erfahren hatten, dass es sich bei dem zweiten Jugendlichen um Yann Labachard handelte, wäre der Directeur ihre nächste Anlaufstelle gewesen. Allerdings hatten sie nicht vorgehabt, ihn telefonisch über das Schicksal seines Sohnes zu unterrichten.
Bernadette wollte jetzt nicht in Foncelles Haut stecken. Eine schlechte Nachricht zu überbringen, war etwas, was keinen von ihnen kaltließ, aber eine schlechte Nachricht am Telefon mitzuteilen und den Angehörigen mit seinem Kummer erst einmal alleinlassen zu müssen, das war sehr starker Tobak.
»Bonjour, Monsieur le Directeur.« Foncelles Gesichtsausdruck war angespannt.
Bernadette beobachtete, wie er Labachards Worten lauschte.
»Monsieur … oui … oui … Hören Sie …«
Labachard schien ihn nicht zu Wort kommen zu lassen. Ein Knoten bildete sich in Bernadettes Magen. Wahrscheinlich erzählte der Directeur Foncelle gerade, dass er seinen Sohn vermisste.
Der Capitaine holte tief Luft. »Monsieur, bitte hören Sie mir kurz zu. Diese Schießerei gestern Nacht am Espiguette …« Er brach ab. »Wir haben leider ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass Ihr Sohn eines der Opfer sein könnte.«
Bernadette wandte sich ab. All das Leid, Tag für Tag. Manchmal fragte sie sich, wie lange ein Mensch es aushalten konnte, in die Abgründe des Lebens zu blicken. Bernadette war jung. Sie hatte den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn noch vor sich. Und zu dieser Konfrontation mit Leid, Gewalt und Tod würde es immer wieder kommen.
»Er liegt im Universitätsklinikum. Die Ärzte kümmern sich um ihn und Sophie. – Ja, das kann ich machen. – Sicher wird uns Docteur de Chadier helfen. – Ja, ich rufe sie gleich an.«
Das Bild der eleganten Polizeiärztin tauchte vor Bernadettes innerem Auge auf. Sie schätzte die kompetente Arbeit der Medizinerin sehr, auch wenn ihr Colette de Chadier manchmal einen Tick zu korrekt und kontrolliert wirkte.
»Ja, Officier Lascallet und ich machen uns gleich auf den Weg. – Wir stehen noch vor dem Haus der Dumondes. – Oui, Monsieur le Directeur. – D’accord.«
Nachdem Foncelle das Gespräch beendet hatte, drehte Bernadette sich wieder um.
Ihr Chef seufzte, während er sie wehmütig betrachtete. »Sie haben es ja mitbekommen.« Bekümmert zeigte er auf das Handy, während Bernadette nickte. »Er wollte mir eigentlich Bescheid geben, dass er später käme, weil sein Sohn unauffindbar sei.« Wieder atmete Foncelle tief aus. »Den Rest kennen Sie.«
»Sollen wir Docteur de Chadier einschalten?«
Er nickte. »Das hatte ich eh vor, aber jetzt, da …« Er stockte. »Gott bewahre, wenn eines der Opfer nicht überleben sollte …« Er presste seine Lippen aufeinander.
»Ich kann sie anrufen, während wir zur Klinik fahren«, bot Bernadette an.
Wieder nickte der Capitaine. »Ja, sie soll uns direkt im Krankenhaus treffen. Wenn wir Glück haben, ist die Ausländerin wach und kann uns einiges zu den Ereignissen am Strand erzählen.«
»Soll ich auch gleich einen Übersetzer informieren?«
Foncelle überlegte kurz. »Non«, erwiderte er dann. »Wir haben keine Ahnung, ob sie überhaupt schon wieder bei Bewusstsein ist. Außerdem kennen wir ihre Nationalität nicht. Ein Ring, in dem ein paar deutsche Worte eingraviert sind, beweist schließlich nichts.« Er warf einen letzten Blick die Straße hinunter und verzog sein Gesicht. »Kehren wir in unsere Welt zurück.«
6
Vier Wochen zuvorMontpellier
Nachdenklich blieb Danielle vor der Tür zum Krankenzimmer ihrer Mutter stehen. Ihr Vater hatte sich nach dem Gespräch mit Louis sofort verabschiedet, da er noch eine dringende Besprechung in der Stadt hatte. Er würde Christelle gegen Nachmittag besuchen. Seine Worte ließen Danielle noch immer erschaudern. Sie kannte ihren Vater lang genug, um zu wissen, dass er von seiner Meinung nicht abrücken würde.
»Bonjour, Docteur Sigrand.«
Danielle drehte sich zu der Schwester um, die bereits gestern ihre Mutter betreut hatte. »Bonjour. Wie geht es ihr?«
Die Schwester zuckte mit den Achseln. »Mittelprächtig, würde ich sagen. Kommen Sie.« Sie drückte die Tür auf und ging in das Krankenzimmer. »Madame Sigrand, schauen Sie mal, wen ich mitgebracht habe.«
Als Danielle den Raum betrat, erblickte sie ihre Mutter, die reglos vor sich hinstarrte. ›Mittelprächtig‹ war die Übertreibung des Tages, dachte Danielle niedergeschlagen. »Bonjour, Maman. Wie geht es dir?« Sie trat an das Krankenbett, während die Schwester im angrenzenden Bad verschwand.
Christelle bewegte ihren Kopf in Danielles Richtung, verzog jedoch keine Miene.
»Maman«, wiederholte Danielle eindringlich, um ihrer Mutter auf die Sprünge zu helfen. »Ich bin’s.« Sie bemühte sich um ein Lächeln.
»Danielle«, erwiderte die ältere Frau leise.
Danielle nickte und zog sich einen Stuhl heran. Während sie sich setzte, betrachtete sie besorgt das blasse Gesicht ihrer Mutter. Die Haut wirkte transparent. Dunkle Schatten lagen unter den Augen. Die Wangen waren eingefallen. Man sah ihrer Mutter die schwere Krankheit an, die den durch die Demenz bereits geschwächten Körper befallen hatte. Danielle nahm die Hand ihrer Mutter in ihre und drückte sie leicht. Die Finger fühlten sich kalt, fast leblos an. Bei dem Gedanken an das Gespräch mit Louis begannen ihre Augen zu brennen. Hastig wandte sie ihren Blick ab.
»Danielle«, flüsterte ihre Mutter.
Hinter Danielle betrat die Krankenschwester wieder das Zimmer, nahm eine leere Kanne vom Tisch und verließ leise den Raum.
»Wie geht es dir, Maman?«
Die Lider ihrer Mutter flatterten leicht, bevor sie die Augen schloss.
Vorsichtig gab Danielle die Hand wieder frei und legte sie auf den Bauch der Älteren. Erst dachte sie, ihre Mutter sei eingeschlafen, doch im nächsten Moment öffnete Christelle ihre Augen. »Müde«, stieß sie kraftlos hervor.
Danielle nickte. »Ja, ich weiß, dass du müde bist. Aber hier kannst du dich ausruhen.« Sie zögerte. »So lange du willst.«
»Tot«, zischte ihre Mutter plötzlich in aufgebrachtem Ton.
Danielle erschrak. »Was?« Sie rang um Fassung. »Was sagst du da?«
»Tot«, wiederholte ihre Mutter und nickte nachdrücklich.
»Was meinst du damit?« Danielle war geschockt, das Wort aus dem Mund ihrer Mutter zu hören. Sie war sich sicher, dass Louis noch nicht mit seiner Patientin über die Untersuchungsergebnisse gesprochen hatte. Schließlich hatte er vorhin angemerkt, dass es aufgrund der Demenz schwierig sei, ihrer Mutter überhaupt den Ernst der Lage begreiflich zu machen.
Ihre Mutter schüttelte den Kopf, während sie das Gesicht zu einer weinerlichen Grimasse verzog. »Tot, tot, tot …«
Christelles Worte klangen wie eine schauerliche Melodie. Danielle drehte sich um, in der Hoffnung, die Schwester möge wieder ins Zimmer kommen, um die Situation zu entschärfen. Doch sie war allein. Allein mit ihrer Mutter, die heute in noch wesentlich schlechterer Verfassung zu sein schien als in den letzten Tagen.
»Was meinst du, Maman?« Danielle fühlte sich unglaublich hilflos. »Warum sagst du dauernd dieses Wort?«
Ihre Mutter starrte sie einige Sekunden lang schweigend an, bevor sie jämmerlich aufstöhnte.
Verzweifelt sprang Danielle auf. »Maman, was hast du? Tut dir irgendwas weh?«
Hektisch warf ihre Mutter den Kopf von einer auf die andere Seite, bevor sie einen langen Seufzer ausstieß und Danielle erneut mit unbeteiligter Miene ansah.
Was war heute nur mit ihr los? Danielle wusste, dass ihre Mutter sie oft nicht erkannte. Bei ihrem Vater war es ähnlich. Oft kannte Christelle Sigrand ihr eigenes Leben nicht mehr. Sie wusste weder, dass sie eine Tochter hatte, noch einen Ehemann. Sie hatte ihren Namen, ihr Zuhause und alles, was sie ausmachte, vergessen. Ab und zu schafften es vereinzelte Bruchstücke ihrer Erinnerung, sich wieder an die Oberfläche ihres Denkens zu kämpfen. Das waren jedoch kostbare und immer seltener werdende Momente. Die meiste Zeit ihrer Besuche verbrachte Danielle damit, an der Seite ihrer Mutter zu sitzen und beruhigend auf sie einzureden. Manchmal erzählte sie von Ereignissen aus ihrer Kindheit. Oft saß sie auch einfach schweigend neben der älteren Frau und betrachtete sie. Ihre Mutter verschwand. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und heute schien sie schlimme innere Kämpfe auszufechten, die vielleicht ihren Ursprung tief in Christelles Vergangenheit hatten. Möglicherweise handelte es sich jedoch auch um bedrohliche Ängste, die mit dem stetigen Verlust des Gedächtnisses einhergingen.
»Tot«, flüsterte Danielles Mutter erneut. Ihre Augen waren weit aufgerissen, ihre Lippen zitterten.
Danielle hatte keine Ahnung, wie sie den Zustand ihrer Mutter deuten sollte. Noch nie hatte sie sie dermaßen aufgewühlt und verängstigt gesehen. Sie bemühte sich um einen beruhigenden Ton. »Maman, niemand ist tot. Papa kommt später auch noch vorbei, weil er dich sehen möchte. Es geht ihm gut.« Sie schluckte. »Und mir geht es auch gut. Ich habe heute frei.« Besorgt registrierte sie, wie ihre Mutter erneut begann, den Kopf hin und her zu werfen.
»Und, ist alles in Ordnung?«
Erleichtert drehte sich Danielle zu der Schwester um. »Sie ist heute ganz … merkwürdig.«
»Merkwürdig?« Die Schwester trat näher.
»Sie sagt die ganze Zeit das Wort ›tot‹«, entgegnete Danielle voller Sorge und kam sich im nächsten Moment lächerlich vor. Wer war denn die Ärztin? Aber ihre Mutter war nicht ihre Patientin. Das hier war etwas anderes. Außerdem hatte Danielle in ihrem beruflichen Alltag keinerlei Berührungspunkte mit Demenzpatienten. Sie erhob sich.
»Sie dürfen das nicht so ernst nehmen«, beschwichtigte die Krankenschwester. »Ich weiß, es ist schwer mitanzusehen, wie ein geliebter Mensch sich immer weiter von einem entfernt, obwohl er körperlich noch anwesend ist.«
Danielle nickte. »Ja, ich weiß einfach nicht …« Traurig schüttelte sie den Kopf.
»Sie hatten doch heute die Besprechung mit Docteur Bannac?«
Danielle spürte den fragenden Blick der Schwester auf sich. »Ja.« Sie blickte kurz zu ihrer Mutter, die jetzt mit geschlossenen Augen leise schnarchte. »Ja, er hat uns gesagt, wie … was mit ihr ist.«
Die Schwester musterte sie mitfühlend. »Sie sind Ärztin. Was soll ich sagen? Es tut mir sehr leid.«
»Danke«, entgegnete Danielle. »Kann ich … Ist es möglich, dass ich noch ein wenig bei ihr bleibe?«
Die Angestellte hob ihre Hand. »Natürlich. Setzen Sie sich zu ihr. Auch wenn sie schläft, spürt sie Ihre Anwesenheit.« Sie räumte den Nachttisch ab. »Nutzen Sie die Zeit.«
Danielle nickte. Ja, die Zeit lief. Jede Minute, die verging, war unwiderruflich verloren. Ihre Mutter würde sterben, wenn sie ihr nicht half. Danielles Gedanken kreisten immer wieder um dieselbe Frage. Sie musste dringend mit Maxime sprechen. Sicher wüsste er Rat.
Leise setzte sie sich wieder auf den Stuhl und betrachtete ihre schlafende Mutter, deren Gesicht nun friedlich und entspannt wirkte. Als Danielle an die bedrohlichen Worte von eben denken musste, lief ihr erneut ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Ahnte Christelle vielleicht, wie es um sie stand?
7
Dienstag, 19.Juni 2018Montpellier
Als Bernadette und Foncelle in der Klinik ankamen, sprach der behandelnde Arzt gerade mit den Eltern der verletzten Jugendlichen.
»Der Sohn des Directeurs wird noch operiert«, erklärte David ihnen, als die Polizeiärztin eintraf.
Colette de Chadier wirkte genauso korrekt und unnahbar wie immer. »Bonjour«, grüßte sie die Polizeibeamten.
»Docteur«, der Capitaine streckte ihr seine Hand hin, »schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten.«
»Ich wurde schon heute früh über den Vorfall informiert.« Sie verzog keine Miene. »Ich dachte mir, dass Sie sich melden würden.«
»Sind wir so durchschaubar?« Foncelle grinste wie ein kleiner Junge.
Bernadette blickte zu David und Thibaut, die das Gleiche zu denken schienen wie sie. Es war unübersehbar, dass ihr Vorgesetzter eine Schwäche für die Ärztin hatte, auch wenn er weder ihrer Altersklasse noch ihrem Intellekt entsprach. Genervt verdrehte Bernadette ihre Augen.
»Was haben wir?« Wenn de Chadier Foncelles Gebalze bemerkte, ging sie zumindest nicht auf seinen Tonfall ein.
»Sophie Dumonde, eines der Schussopfer, ist über den Berg. Die Verletzung war glücklicherweise nicht lebensgefährlich«, erwiderte Thibaut. Als er Bernadettes fragenden Blick bemerkte, fuhr er fort: »Das hat mir eine der Schwestern gesagt.«
»Sie erwähnten gerade, dass Labachards Sohn noch operiert würde«, erwiderte der Capitaine und blickte Officier David Hullaut an.
Der nickte. »Oui. Yann Labachard scheint es schwerer erwischt zu haben. Mehr wissen wir aber nicht.«
Colette de Chadier machte sich einige Notizen. »Was ist mit der dritten Verletzten?«
»Darüber hat uns noch niemand informiert«, entgegnete David, während er zu Thibaut blickte.
»Bon«, fasste de Chadier zusammen. »Dann sollten wir schnellstmöglich mit dem zuständigen Arzt sprechen.«
»Er redet noch mit den Eltern.« Bernadette zeigte den Flur hinunter, wo die beiden Ehepaare an den Lippen des Mediziners hingen. Die zwei Mütter hatten verweinte Augen, während der Directeur und der Großindustrielle sichtlich um Fassung rangen. Im nächsten Moment trat eine Krankenschwester zu der Gruppe und bedeutete Sophies Eltern, ihr zu folgen. Der Directeur legte schützend einen Arm um die Schulter seiner Frau, gab dem Arzt die Hand und wandte sich zum Wartebereich um.
Nachdem er kurz mit seiner Gattin gesprochen hatte, erhob er sich wieder und steuerte auf die Polizeibeamten zu.
»Bonjour.«
Bernadette musterte das erschöpfte Gesicht des Directeurs. Wie musste es sich anfühlen, um das eigene Kind zu bangen? Zu fürchten und zu hoffen? Eilig verdrängte sie den Gedanken.
»Docteur Merveilles kommt gleich und wird mit uns sprechen«, erklärte Jacques Labachard.
»Ich nehme an, Sie möchten über jedes Detail der Ermittlungen informiert werden?«, fragte Foncelle vorsichtig nach.
Labachard verengte seine Augen. »Allerdings.«
»Ist das Innenministerium bereits eingeschaltet?«
Bernadette hielt den Atem an. Waren Polizeibeamte persönlich in Ermittlungsfälle involviert, herrschte das ungeschriebene Gesetz, sie von dem Fall abzuziehen. Wegen Befangenheit, aber auch wegen eventuell fehlender Distanz und Neutralität. Da Labachards Sohn schwer verletzt war, konnte sich Bernadette kaum vorstellen, dass sein Vater unvoreingenommen die Ermittlungsarbeit begleiten konnte. Andererseits war ihr kein einziger Fall bekannt, in dem ein Beamter der höheren Führungsebene ähnlich in laufende Ermittlungen verwickelt gewesen war.
»Was wollen Sie andeuten, Foncelle?« Labachards Stimme klang gefährlich ruhig.
»Sie wissen doch, wie das läuft, wenn Familienangehörige von Polizeibeamten Opfer von Straftaten werden«, erwiderte der Capitaine mit fester Stimme.
»Ich bin Ihr Vorgesetzter. Mein Sohn liegt dadrinnen«, Labachard deutete mit dem Zeigefinger hinter sich, »und kämpft um sein Leben. Wollen Sie mir etwa verbieten, die Ermittlungen zu verfolgen?«
»Non, Monsieur.« Foncelle schüttelte seinen Kopf. »Das möchte ich nicht. Aber meines Erachtens muss das Innenministerium darüber Bescheid wissen. Oder wollen Sie, dass es später vor Gericht heißt, wir seien befangen an die Ermittlungen herangegangen, weil eines der Opfer der Sohn des Directeurs ist? Sicher haben doch gerade Sie höchstes Interesse daran, die mutmaßliche Täterin mit wasserdichten Beweisen zu überführen.«
Thibaut und David schauten betreten zu Boden, während die Ärztin an ihrem Stift herumnestelte und weiter keine Miene verzog.
»Machen Sie Ihre Arbeit, Foncelle, und klären Sie diesen verfluchten Fall auf. Den Rest lassen Sie mal getrost meine Sorge sein.« Labachard kochte vor Wut und schien sich nur mit Mühe zusammenzureißen.
»Wer von Ihnen ist Capitaine Foncelle?«
Niemand hatte bemerkt, wie der Arzt, der sich als Docteur Yves Merveilles vorstellte und eben noch mit den beiden Elternpaaren geredet hatte, zu ihnen getreten war.
Nachdem Foncelle sich und seine Mitarbeiter ebenfalls vorgestellt hatte, lotste der Mediziner sie in eine ruhigere Ecke am Ende des Ganges und bedeutete ihnen, sich zu setzen.
Der Capitaine beugte sich vor. »Können Sie uns schon etwas zu den drei Verletzten mitteilen?«
Merveilles nickte. »Die Eltern habe ich ja gerade informiert. Sophie Dumonde ist über den Berg. Die junge Frau ist in einer erstaunlich guten Verfassung. Die Schusswunde war glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Die Operation ist gut verlaufen und wir gehen davon aus, dass wir sie nur ein paar Tage im künstlichen Koma halten müssen.«
Der Capitaine schnaufte. Wahrscheinlich hatte er bei den ersten Worten des Arztes gehofft, die Jugendliche spätestens morgen befragen zu können.
»Yann Labachard wird zurzeit noch operiert. Die Kugel hat leider mehrere lebenswichtige Organe beschädigt. Der junge Mann hat sehr viel Blut verloren.«
»Ihre Prognose?« Foncelle blickte kurz zum Directeur.
»Wenn er die Operation übersteht, wäre das ein echter Hoffnungsschimmer.« Merveilles verzog bedauernd den Mund.
Bernadette musterte verstohlen Labachard, dessen Augen verdächtig glänzten.
»Und die verletzte Frau?«
Der Arzt wiegte seinen Kopf von rechts nach links. »Die Unbekannte ist momentan noch ohne Bewusstsein. Wir rechnen aber damit, dass sie spätestens morgen ansprechbar sein wird. Sie hat eine offene Wunde links am Hinterkopf, höchstwahrscheinlich ist sie auf den Felsen aufgeschlagen.«
»Keine Fremdeinwirkung?«, hakte Colette de Chadier nach.