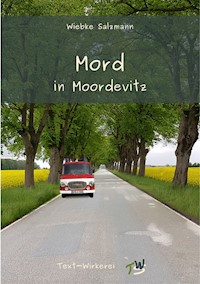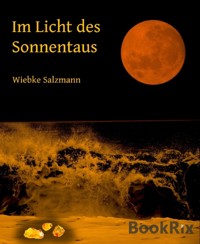
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit Jahren liegt Havnstadir unter einer grauen Wolkendecke, die Stadt verarmt zusehends. Kergja schlägt sich gerade so durch, sie verdient ihr Bisschen Geld mit dem Sonnentau, den sie am Strand sammelt. Was ihr Auftraggeber damit anstellt, interessiert sie nicht weiter. Doch dann wächst aus einem Stück Sonnentau ein Baum. Ein Baum, der sprechen und gehen kann. Geheimnisvolle leuchtende Kugeln schenken den Bewohnern Havnstadirs endlich das langvermisste Licht und es geht aufwärts. Doch dann rollen Wellen ohne Wind an Land, das Meer steigt und die ersten Stadtteile versinken im Wasser.
Sind die Kugeln schuld? Und was hat der merkwürdige Priester tatsächlich vor?
Können Kergja und Svalur die Stadt retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Licht des Sonnentaus
Wiebke Salzmann
„Im Licht des Sonnentaus“ ist ein (abgeschlossener) Teil einer Reihe; mehr Informationen zu den anderen Romanen des Zyklus finden Sie unter www.wetterdrachen.net.
Über das Buch
Seit Jahren liegt Havnstadir unter einer grauen Wolkendecke, die Stadt verarmt zusehends. Kergja schlägt sich gerade so durch, sie verdient ihr Bisschen Geld mit dem Sonnentau, den sie am Strand sammelt. Was ihr Auftraggeber damit anstellt, interessiert sie nicht weiter. Doch dann wächst aus einem Stück Sonnentau ein Baum. Ein Baum, der sprechen und gehen kann. Geheimnisvolle leuchtende Kugeln schenken den Bewohnern Havnstadirs endlich das langvermisste Licht und es geht aufwärts. Doch dann rollen Wellen ohne Wind an Land, das Meer steigt und die ersten Stadtteile versinken im Wasser. Sind die Kugeln schuld? Und was hat der merkwürdige Priester tatsächlich vor? Können Kergja und Svalur die Stadt retten?
Prolog
Eine silbrig-weiße Eule flog über die Wiesenhügel von Soley und musterte das fruchtbare Land, das still, zu still unter dem grauen Himmel lag. Das Gras stand hoch und hätte längst gemäht werden müssen, auch um die Last der Kirschbäume kümmerte sich niemand, und die Rosen in den Vorgärten verwilderten. Beim Anblick des unzeitigen Schnees im nördlichen Teil des Landes stellte die Eule unwillkürlich die Federn auf. Dann glättete sie ihr Gefieder wieder; hier, wo sie flog, herrschte das warme Wetter, das für Juli zu erwarten war. Sie segelte über die verlassenen Höfe hinweg, bis sie ein Haus erreichte, aus dessen Schornstein Rauch aufstieg. Die Eule ließ sich auf dem von Winden umrankten Zaun nieder. Nebel schien aus ihrem Gefieder aufzusteigen. Wenig später betrat eine Frau die Küche des Bauernhauses. Ihr Haar floss silberweiß über einen Mantel von derselben Farbe. Er schimmerte, wie aus Federn gewebt, soweit das zu erkennen war. Denn er wich dem Blick aus, verschwamm an den Rändern wie eine Nebelschwade. Das Alter der Frau war nicht zu bestimmen. Ihr herzförmiges Gesicht war faltenlos, aber ihre meergrauen Augen unter den hohen runden Brauen schienen ein Wissen zu bergen, das nicht in einem einzigen Menschenleben anzuhäufen war. Drinnen wurde sie bereits erwartet. Eine kleine, alte Frau, deren weißes Haar im Sonnenlicht rot schimmerte, schenkte dampfenden Tee in irdene Tassen und stellte Brot und Butter auf den rissigen, aber blank gescheuerten Tisch. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab, nahm ein Tuch und rieb Äpfel ab. Die Gestalt am Fenster drehte sich um. Der kohlschwarze Mantel schimmerte, er schwang um seine Trägerin, kurzzeitig wirkte es, als breitete ein Rabe seine Flügel aus. Schwarze Augen, umrahmt von ebenso schwarzen Wimpern, lagen tief in den Höhlen, umgeben von Schatten wie nach langer Krankheit oder tiefer Trauer. Glatt umspannte die Haut den Schädel, keine Falte störte das bleiche Antlitz, aus dem dunkle Lippen unnatürlich hervorstachen. Über der hohen Stirn war das Haar gescheitelt, fiel von dort wie ein schwarzglänzender Wasserfall bis fast auf den Boden. Die Silberweiße neigte leicht den Kopf zur Begrüßung, und ein Lächeln der dunklen Lippen in dem wachsweißen Gesicht vertrieb einige der Schatten. Die kleine Alte reichte jeder einen Apfel. „Esst. Der größte Teil der Ernte in Soley wird verkommen. Es ist niemand mehr da, der ernten könnte.“ Sie biss selbst in einen Apfel und betrachtete ihre Besucherinnen nachdenklich. Die Silberweiße winkte ab und antwortete mit einer Stimme, die dunkel hallte: „Keine Angst, Mysla. Das Wetter wird sich wieder beruhigen. Noch zwei, drei Jahre, dann wird sich die Kälte aus dem Norden zurückziehen. Diese Aufgabe haben wir bewältigt. Allerdings wird Hamarborg sich noch lange nicht vom Krieg erholen, und so lange wird auch Soley nicht wieder besiedelt werden wie früher. Die Gärten werden verwildern, und du wirst hier in den nächsten Jahren sehr einsam leben, wenn du hierbleiben willst. Aber das ist es nicht, was mir Sorgen macht. Die Hafenstadt, Havnstadir, ist es. Wir haben wenig auf sie geachtet. Zu wenig vielleicht. Seltsame Dinge geschehen dort. Beunruhigende Dinge, wenn man die alten Geschichten kennt.“ „Havnstadir?“ Mysla runzelte nachdenklich die Brauen. „In den Bergen im Westen? Haben sie dort auch unter dem Eis zu leiden?“ „Nein. Dämmerlicht. Die Stadt liegt unter einer andauernden Wolkendecke. Aber das ist es nicht. Auch die Wolken werden verschwinden. Es ist etwas anderes. Nichts, was mit den unzeitigen Wintern zu tun hätte. Sondern mit anderen Dingen – älteren Dingen ...“ „Die See – das Einhorn des Wassers.“ Die Stimme der Schwarzhaarigen war heiser und tief wie die See, von der sie sprach. „Ich spüre es. Auch wenn noch nichts zu sehen ist. Saefaxi, der Hüter des Wassers, wird unruhig.“ „Das Einhorn des ... “ Fassungslos sah Mysla von einer zur anderen. „Aber – die Einhörner mischen sich nicht in unser Treiben hier ein!“ „Sie haben es getan. Dann und wann. Wenn es nötig war.“ Die meergrauen Augen sahen in die Ferne, vielleicht auch in eine ferne, vergangene Zeit, während die Silberweiße an ihrem Tee nippte. Die Hände der Schwarzen krallten sich um die Fensterbank. Das Lächeln in ihren Augen sank zurück in die Schatten, und Schatten schienen ihrem Mantel den Glanz zu nehmen, als sie sich wieder zum Fenster drehte. „Ja, aber ...“ Mysla fasste sich an die Stirn, hob abwehrend die andere Hand. „Das letzte Mal ist Jahrhunderte her ...“ „Jahrtausende.“ Die Worte der Schwarzen schienen sich mühsam über raue Stimmbänder zu quälen, sie klangen wie zerkratzt. „Es ist Jahrtausende her, dass die alten Bäume untergingen.“ Die Schwarze schwieg, sie stand gebeugt, als wühlte ein Schmerz in ihrem Leib. Dann richtete sie sich auf und wandte sich entschlossen um. „Und nun hat einer der Bewohner Havnstadirs angefangen, Sonnentau zu sammeln. Nicht hier und da ein Stück oder auch einen Beutel voll, um Schmuck herzustellen. Nein, er hortet riesige Mengen davon. Und ich weiß nicht, warum.“ Die Silberweiße nickte langsam. „Aber wir müssen wissen, warum. Doch wir müssen vorsichtig sein. Unser Eingreifen darf nicht ... zu falschen Schlüssen führen.“ Ein Lächeln legte sich auf das Gesicht der Schwarzen, ein Lächeln voller Trauer. „Nicht wir, Hrimugla. Ich. Ich habe es miterlebt. Ich habe ... es wieder gutzumachen. Ich muss verhindern, dass es noch einmal geschieht. Um jeden Preis. Und sei es der Untergang Havnstadirs oder seiner Bewohner.“
Das Fest des Blutmonds
Ein Sonnenstrahl durchbrach die Wolkendecke und durchschnitt die Dunkelheit. Das Licht traf den Strand, spielte mit dem angeschwemmten Tang und erfüllte die Luft mit seinem salzigen Modergeruch. Der Strahl wanderte über den Sand, als die Wolken sich träge bewegten. Zu Kergjas Füßen leuchtete etwas auf. Sie bückte sich rasch und hob das Stück Sonnentau auf. Es war ein außergewöhnlich großer Stein, etwa wie ein Taubenei, und er war goldgelb und durchsichtig. Schon wollte sie ihn zu den anderen in ihren ledernen Beutel stecken, da hielt sie überrascht inne. Tief im Inneren des Steins steckte etwas, etwas, das wie ein Samenkorn aussah. Wenn auch nicht wie eines, das Kergja jemals gesehen hatte. Sie strich die weizenblonden Strähnen, die sich aus dem Zopf gelöst hatten, aus den Augen und drehte den Sonnentau fasziniert im Sonnenlicht hin und her. Wie konnte ein Samenkorn dort hineingelangen? Oder war es doch keines, sah irgendeine Struktur im Inneren des Steins nur so aus? Was war Sonnentau eigentlich, und wo kam er her? Seit fast zwei Jahren sammelte Kergja ihn nun schon für Brennir, hatte aber nie mehr als einen flüchtigen Gedanken daran verschwendet. Er war schön, wurde in der Stadt schon immer gesammelt, und früher war der Schmuck aus Sonnentau berühmt gewesen. Halb erinnerte Fetzen alter Geschichten drängten aus Kergjas Gedächtnis nach oben, Märchen, die ihre Mutter ihr vor vielen Jahren erzählt hatte und die schon diese nur noch bruchstückhaft gekannt hatte. Aber was war Sonnentau wirklich? Der goldgelbe Schimmer erlosch. Unwillkürlich sah Kergja zum Himmel hinauf. Die Wolkendecke hatte sich wieder geschlossen, die Farben versanken im Grau. Ihr Blick schweifte flüchtig zum Wasser. Glanzlos wie angelaufenes Metall und genauso reglos lag das Meer da, brachte kaum die Kraft für ein leises Kräuseln seiner Oberfläche auf. Keine Welle war zu sehen, die am Ufer brechen und die Grabesstille hätte brechen können. Weiter im Süden lagen reglos die Schiffe im Hafen. Einzig die Bootsbauer hatten in den letzten zwei Jahren ein regelmäßiges Einkommen gehabt, da die Segelschiffe alle mit Rudern ausgestattet worden waren. Unschlüssig wog Kergja ihren Beutel in der Hand. Konnte sie es sich leisten, dieses schöne Stück Sonnentau zu behalten? Sie hatte einmal ein ganzes Armband aus Sonnentau besessen, ein Geschenk ihrer Tante zu ihrem 15. Geburtstag. Aber schon ein Jahr später, kurz nach dem Brand, hatte sie es an Brennir verkaufen müssen, weil sie das Geld gebraucht hatte. An diesem Vormittag hatte sie dank einiger Wolkenlücken bereits einige Stücke Sonnentau gefunden, der Lohn dafür müsste eigentlich für heute reichen. Andererseits war ihre Ausbeute nicht immer so groß, die Sonnenstrahlen schafften es nicht jeden Tag, die Wolken zu durchdringen. Und ohne Sonnenlicht, im Dämmer unter den Wolken, war es fast unmöglich, den Sonnentau im Tang am Strand zu finden. Unschlüssig betrachtete sie den Stein. Ein tiefes Krächzen riss sie aus ihren Gedanken. Vor ihr saß eine Krähe – nein, ein ausgewachsener Kolkrabe, groß und so gänzlich schwarz, dass Kergja beiläufig begriff, wieso Schwarzes so oft als „rabenschwarz“ bezeichnet wurde. Es war, als hätte der Rabe das Schwarz erfunden. Der Vogel legte den Kopf schief und krächzte wieder. „Redest du mit mir?“, fragte sie ihn. Ein raues „Kr-Ja“ kam zur Antwort. Kergjas graue Augen weiteten sich, dann schüttelte sie den Kopf und lachte über sich selbst. Raben konnten sprechen lernen, wenn sie von Menschen aufgezogen wurden. Natürlich ohne zu verstehen, was sie das redeten. So zutraulich, wie der Vogel war, war er wohl an Menschen gewöhnt. Sie hockte sich hin und streckte vorsichtig die Hand aus. Auch wenn er zahm war, hatte er doch einen beeindruckenden Schnabel. „Bist du deinem Herrchen davon geflogen? Hm?“ Die schwarzen Augen des Raben sahen sie an, ihre glänzende Schwärze zog Kergjas Blick an, hielt ihn fest wie mit einem unsichtbaren Faden. Kergjas linke Hand spielte mit dem Sonnentau, ohne dass es ihr bewusst war, die rechte streckte sie weiterhin dem Raben hin, der reglos verharrte. „Ich denke, ich behalte euch beide“, erklärte sie dann träumerisch. „Dich und den Sonnentau.“ Der Faden riss, als der Rabe den Kopf abwandte. Der Sonnentau mit dem Samenkorn war so schön, sie würde ihn erst einmal behalten. Wenn das Geld später knapp werden würde, konnte sie ihn immer noch an Brennir verkaufen. Sie steckte ihn in die Tasche ihres blauen Rockes. Kergja erfühlte ein Loch im Stoff der Tasche und wechselte den Stein in die andere Tasche. Sie sah an sich herunter. Das Blau war inzwischen so ausgewaschen, dass es fast grau war. Blau war die Farbe der Weber, aber was sagte das schon. Sie würde nie als Weberin arbeiten. Sie konnte von Glück sagen, wenn sie die Arbeit als Sonnentausucherin behalten konnte. Der Rabe flatterte auf ihre Schulter. Kergja verzog kurz das Gesicht, als sich die Krallen in die Narbe bohrten. Auch nach zwei Jahren war sie immer noch empfindlich. Als hätte der Rabe es gespürt, rückte er ein Stück weiter und machte es sich bequem. Kergja hörte Stimmen und wandte sich um. Zwei der anderen Sammler, ein älterer Mann und seine Frau, winkten und kamen auf sie zu. „Machst du noch weiter? Wir hören auf für heute, das war bestimmt das letzte Licht. Die Sonne geht ohnehin bald unter.“ Kergja nickte. Der Mann hatte recht, heute hatte es nicht mehr viel Sinn. „Wo hast du denn den aufgegabelt?“, fragte die Frau mit Blick auf den Raben. „Eben gerade, hier am Strand. Scheint ein zahmer zu sein“, erwiderte Kergja und schloss sich den beiden Sammlern an. Als sie dem Meer den Rücken zuwandte und die Berge sich vor ihr erhoben, spürte sie wieder ihre Schultern zusammensacken. Die Gipfel des Grafjalla schienen ihr seit der Dunkelheit gewachsen zu sein, als machten sie mit den Wolken gemeinsame Sache, um Havnstadir zu erdrücken. Kergjas Blick suchte die Stadt, die sich in ein enges Tal zwischen zwei Gipfel kauerte, und holte tief Luft. Schon jetzt, obwohl sie noch unten auf dem Strand gingen, spürte sie die Enge der Mauern. Schweigend wanderten sie durch den Sand, wandten sich dann nach links und gingen einen Pfad entlang, der sie aufwärts führte. Bald erreichten sie die ersten Hütten der Vorstadt. Als sie zwischen die Wände der Hütten traten, wurde die Dämmerung tiefer, obwohl die Sonne hinter den Wolken noch nicht untergegangen sein konnte. Kergja achtete nicht auf die grauen Holzwände zu beiden Seiten der Gasse, vielleicht waren sie sogar farbig gestrichen, was spielte das in der ewigen Dämmerung für eine Rolle? Ein überraschendes, seltenes Geräusch riss sie aus ihrer Versunkenheit – quietschendes Lachen. Zwei Kinder jagten sich durch einen Garten, versteckten sich voreinander hinter dem dürren, bleichen Laub einiger Büsche. Kreischend und kichernd verschwanden sie in einem der Häuser, die Stille fiel wieder in die Gasse. Müde wandten sich die Gesichter der Erwachsenen, die vor den Hütten saßen und nähten, flickten oder schnitzten, wieder ihren jeweiligen Arbeiten zu. In geschlossenen Räumen war es zu dunkel für jede Art von Tätigkeit. „Dass die immer noch hier unten wohnen“, unterbrach die Frau neben Kergja schließlich das Schweigen. „Die halbe Stadt steht inzwischen leer, die könnten sich doch innerhalb der Stadtmauern Häuser suchen.“ Kergja sah nach oben, auf die schwarze Öffnung des westlichen Stadttores, die düsteren Mauern rechts und links davon. „Besonders einladend sieht Havnstadir im Moment nicht aus, oder?“, bemerkte der Mann. „Seit einer Woche haben sie selbst am Tor die Fackeln eingespart.“ Die Frau lachte kurz. „Oh ja – und dann diese neue Verordnung für den Herbst. Jeder darf nur eine Stunde am Tag Kerzen anzünden. Im Ernst – habt ihr genug Geld für Kerzen? Wenn erst der Winter kommt ...“ „Die Winterstürme werfen aber immer viel Sonnentau auf den Strand.“ Die Munterkeit in der Stimme des Mannes klang gezwungen. Kergja warf ihm einen kurzen Blick zu. Es stimmte. Ohne Sturm würden sie bald keinen Sonnentau mehr finden. Der Vorrat am Strand aus den letzten Stürmen musste bald zu Ende gehen. „Winterstürme!“ Die Frau schnaubte verächtlich. „Wo sollen die denn bitte herkommen? Es hat seit zwei Jahren keinen Sturm oder wenigstens Wind gegeben!“ Hinter dem Stadttor verabschiedete Kergja sich unter einem Vorwand von ihren Begleitern, froh, allein weitergehen zu können. Es war erst Juli, und sie wollte nicht über den Winter nachdenken und schon gar nicht über Stürme. Mit einem Gewittersturm hatte alles angefangen, vor zwei Jahren. Sie folgte einer schmalen Gasse in den nördlichen Teil der Stadt, bog, als sie die vom Blitz zerborstene Krone der Kastanie auf dem alten Marktplatz erkennen konnte, in die Schmiedegasse ein, obwohl dies ein Umweg war. Aber auch in der Schmiedegasse meinte sie noch, den Geruch zu spüren. Bitter, wie von kaltem Rauch. Innerlich fröstelnd zog sie die Schultern zusammen. Der Brand war zwei Jahre her, sie bildete sich den Geruch nur ein. Sie musste aufpassen, wohin sie trat. Auf der Straße lag Staub, auch Abfall. Die Reinigung der Straßen, an denen mehr als die Hälfte der Häuser leerstand, hatte der Stadtrat eingestellt. Die Schmiedegasse war eine der breiteren in Havnstadir, eingegrenzt von zweistöckigen Häusern, in deren Erdgeschossen die Werkstätten und Ladengeschäfte der Schmiede lagen. Gelegen hatten. Die meisten Schmieden, an denen Kergja vorüberging, waren geschlossen, die Fenster mit Brettern vernagelt, die Türen verrammelt. Rohe Bretter, gehalten von groben Nägeln, die achtlos in das geschnitzte und verzierte Fachwerk getrieben worden waren. Kergja versetzte einem Stück herabgefallenen Putzes einen Tritt. Staubend zerfiel es. Sie schoss ein zweites hinterher, kollernd rollte es über das Pflaster, ein aufdringlich lautes Geräusch in der Stille. Es blieb in einem Loch im Pflaster hängen. Als sie die letzte Schmiede erreichte, hielt sie inne. Säcke und Kisten stapelten sich auf der Straße. Der Schmied und seine Söhne luden alles auf einen Ochsenkarren, Frau und Töchter hörte sie im Haus rumoren. Der jüngste der Söhne nahm das Ladenschild herunter, wickelte das Feurige Einhorn, das Wahrzeichen der Gilde der Schmiede, sorgfältig in ein Leintuch. Kergja schlang die Arme um sich. „Du gibst also auch auf? Wo gehst du hin?“ Der Schmied fuhr herum und schien erleichtert, Kergja zu erkennen. „Du bist es. Ja, wir ziehen nach Hamarborg. Schmiede können sie dort gebrauchen. Heißt es.“ „Heißt es. Waffen brauchen sie. Heißt es. Meine Mutter hat deine Leuchter immer bewundert.“ Der Schmied betrachtete sein Haus, die vernagelte Ladenöffnung. Seine Augen lagen dunkel in den Höhlen, seine Stimme war die eines Mannes, der erkannt hat, dass er aus einer Falle nicht mehr herauskommt, und aufgibt. „Ich habe auch gelernt, Schwerter und Pfeilspitzen zu schmieden. Und wovon soll ich hier leben? Wer braucht hier noch Geschirr? In den letzten zwei Jahren habe ich nicht ein Drittel von dem verkauft, was ich früher auf einem einzigen Markt losgeworden bin. – Und in Hamarborg scheint die Sonne.“ „Und wenn der Krieg längst verloren ist? Was nützt euch dann die Sonne? Seit Wochen sind keine Nachrichten aus Hamarborg gekommen.“ „Vater hat recht“, mischte sich der zweite Sohn ein. „Wir müssen ja nicht ausschließlich Waffen schmieden. Mit mehr Licht – mit überhaupt Licht können wir auch wieder Leuchter und Schalen herstellen. Schon mal versucht, bei Kerzenlicht feine Verzierungen zu schmieden? Nicht jeder hat so eine gute Arbeit wie du und kann sich auch noch Haustiere leisten!“ Kergjas Augen zogen sich zusammen, ihre Hand fuhr wie schützend zu dem Vogel auf ihrer Schulter, aber bevor sie eine passende Antwort gefunden hatte, streckte der Schmied ihr die Hand hin. „Wir müssen jetzt los. Ich will mit den Sachen noch aus der Stadt raus, bevor es ganz dunkel wird. Wir sind schon zu spät dran.“ Kergja ergriff die Hand, nickte den Söhnen zu und ging wortlos an dem Karren vorbei. Was hätte sie auch sagen sollen? Glück wünschen? Bedauern bekunden? Bedauern darüber, dass wieder einer ihrer Bekannten die Stadt verließ? Sie würde allein zurechtkommen, das tat sie seit zwei Jahren. Also was sollte sie bedauern? Sie straffte die Schultern und marschierte weiter. Hinter sich hörte sie die Stimmen der Familie, dann setzte sich der Karren in Bewegung und entfernte sich rumpelnd. Kergja schlang erneut die Arme um sich, sie spürte die Krallen des Raben bei der Bewegung und sein tröstliches, lebendiges Gewicht auf ihrer Schulter.
Hinter dem neuen Marktplatz bog Kergja ab und folgte der schmalen Straße, bis sie ins Viertel der Silberschmiede an der nordwestlichen Stadtmauer gelangte. Es wurde jetzt dunkler, hinter den Wolken sank die Sonne auf den Horizont. Früher hatten hier wohlhabende Leute gewohnt, aber inzwischen waren viele Häuser verlassen. Der Putz bröckelte, hie und da hing ein halb abgerissener Fensterladen, klafften Löcher in den Scheiben, drang muffiger, staubiger Geruch aus den leeren Zimmern. Die Malereien auf den Fachwerkbalken waren verblasst, halb verdorrte Rosenbüsche fristeten ein zähes Dasein vor den Häusern, in denen niemand mehr wohnte, der sie hätte gießen können. Den schwachen Duft konnte Kergja nur wahrnehmen, wenn sie sich über die Blüten beugte. Brennirs Haus war das einzige noch bewohnte in der Silbergasse. Kergja hatte gehört, dass Brennir erst hierher gezogen war, nachdem die anderen Bewohner bereits gezwungen gewesen waren, ihre teuren Häuser aufzugeben. Sie hatte keine Ahnung, ob er Silberschmied war, seine Gewänder waren jedenfalls nicht silbergrau, sondern schwarz. Die Fachwerkhäuser standen Wand an Wand und bildeten so eine Barriere zwischen der Straße und den Gärten, die sich hinter den Häusern bis an die westliche Stadtmauer erstreckten. Kergja hatte noch nie einen der Gärten zu Gesicht bekommen. Sie oder ihre Familie hatten nie einen besessen, aber wenn sie sich einmal einen Traum erlaubte, dann den, einen dieser verlassenen Gärten in Besitz zu nehmen, am liebsten einen Rosengarten. Brennir oder sein Sohn Svalur baten sie allerdings immer nur in die große Eingangshalle, ließen sich den Sonnentau aushändigen und zählten ihr das Geld in den Beutel. Kergja blieb vor der schweren Tür stehen, von der die grüne Farbe abblätterte. Rechts und links kämpften zwei Rosenbüsche mit der Dunkelheit. Ihre Blüten waren dunkelrot wie Granate und ihr Duft berührte Kergjas Nase wie Schmetterlingsflügel. Kergja hob die Hand, um zu klopfen, da bemerkte sie, wie der Rabe sich aufrichtete. Er hielt den Kopf gedreht, als musterte er das Fachwerkhaus sorgfältig. „Was ist? Müsste auch mal wieder gestrichen werden, wie? Aber das dürfte dich wohl kaum stören! Heh, wo willst du hin?“ Der schwarze Vogel breitete die Flügel aus und flatterte zu einem Birnbaum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er hockte sich in eine Astgabel, als versuchte er, sich im spärlichen Blattwerk zu verstecken. Kergjas Hand sank nach unten. „Wartest du auf mich?“, fragte sie, ohne dass ihre Stimme viel Hoffnung verraten hätte. Selbst wenn der Vogel einmal zahm gewesen war, er war dem letzten Besitzer ja wohl auch weggeflogen. Kergja wandte sich ab, betrat das Haus und zog die Tür hinter sich zu. Der Flur lag im düsteren Licht zweier Kerzen. Unter ihren nackten Füßen spürte sie den kalten Steinfußboden. Obwohl es draußen warm war und sie Schuhe sparen konnte, überlief sie hier drinnen ein Frösteln. Sie zog die Schultern zusammen. Auf halbem Weg zwischen der schweren Eingangstür und der Tür, hinter deren in Blei gefassten Glasscheiben Kergja das grau-grüne Gras des Gartens sehen konnte, empfing Brennir sie, eine hohe, breite Gestalt im üblichen bodenlangen, schwarzen Gewand, gegürtet mit einem roten Strick. Trotz der weiß gestrichenen Wände war es so dunkel, dass sie kaum sein Gesicht erkennen konnte. Dunkle Rechtecke rechts und links zeigten Türen in andere Zimmer an, linkerhand führte eine Treppe ins Obergeschoss. Rings um die Decke lief eine verblasste Bordüre, niemand hatte sich die Mühe gemacht, das Muster zu erneuern. „Mehr nicht?“ Ärgerlich runzelte Brennir die Stirn. Seine rote Haarmähne schien sich zornig aufzustellen. Ein Windhauch von oben blähte sein Gewand. Kergja zwang sich, gleichgültig die Schultern zu zucken. „Zu dunkel“, murmelte sie, wich aber unwillkürlich einen halben Schritt zurück. Dann biss sie die Zähne zusammen und hob den Kopf. Brennir war zwei Kopf größer als sie und fast dreimal so breit, und seine Augen glühten auf sie herab, zwei Funken unter den Flammen der buschigen, roten Augenbrauen. „Und du bist sicher, dass du nicht noch irgendwo welchen versteckt hast?“ Die tiefe Stimme zitterte leicht – vor Ärger oder wie im Fieber. Kergja schluckte. Sie dachte an das Stück in ihrer Rocktasche. Es war groß, würde ihr eine Menge Geld bringen. Und wenn es ihm so wichtig war ... Aber sie hatte es gefunden, sie war den ganzen Tag in feuchtem Sand und Tang gewatet. Und sie würde nicht klein beigeben. Vor niemandem und auch nicht vor Brennir! „Nein“, zischte sie, ignorierte den trockenen Mund und das flaue Gefühl, das sich unter Brennirs brennenden Augen, in ihr ausbreitete. „Und selbst wenn es so wäre – was geht es dich an! Der Sonnentau gehört dir nicht!“ Brennirs Kiefer mahlten, sein Blick wurde sengend. „Ich brauche jedes einzelne! Heute Nacht ist Blutmond, die Priester haben das Fest ausgerufen“, grollte er. „Heute Nacht wird er wieder verbrannt werden. Werden tausende Stücke verbrannt werden!“, dröhnte seine Stimme durch die Halle. Kergjas Faust schloss sich in der Tasche um ihren Sonnentau. Dann sackte Brennir unvermittelt zusammen. „Und sie sind verloren. Alle verloren.“ Noch während er leise vor sich hin murmelte, warf er ihr achtlos das Geld hin, wandte sich um und eilte hinüber zu der Tür auf der rechten Seite. Kergja holte Luft, um ihre zitternden Knie zu beruhigen. Dann bückte sie sich nach den Münzen und klaubte sie zusammen. Heute schien Brennir ja mal wieder eine seiner ganz seltsamen Launen zu haben. Er war besessen, geradezu verrückt nach dem Sonnentau, da waren sich alle Sammler einig. Aber er zahlte gut, und gewalttätig war er noch nie geworden. Brennir hatte die Tür zum Labor offen gelassen, Kergja konnte ihn sehen, hockend an einem gewaltigen Tisch, der über und über von Körben, Krügen und Säcken bedeckt war. Soweit sie das erkennen konnte, waren sie alle bis oben angefüllt mit Sonnentau. Brennir nahm Stück für Stück heraus, hielt jedes einzelne vor sein Auge, starrte im Licht einer Kerze hinein, als könnte er den Schlüssel zu den tiefsten Geheimnissen der Welt entdecken. Und warf jedes einzelne anschließend achtlos in eine Kiste. Sie hatte keine Ahnung, was er mit dem Sonnentau anstellte. Am Anfang hatte sie gedacht, Brennir wolle Schmuck herstellen und irgendeine neue Technik entwickeln, und sich kopfschüttelnd gefragt, an wen er in diesen Zeiten Schmuck verkaufen wolle. Aber es war nie ein Schmuckstück aus seiner Werkstatt aufgetaucht, kein Schmuckstück und auch sonst nichts.