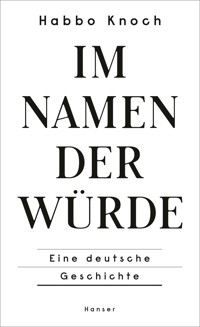
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Würde des Menschen ist unantastbar: nur ein Versprechen oder politische Maxime?
Das Grundgesetz garantiert die Würde des Menschen – ein abstraktes Versprechen, aus dem im Laufe der Jahre sehr konkrete Forderungen abgeleitet wurden. Ging es der frühen Bundesrepublik um die Distanzierung von der nationalsozialistischen Diktatur, berief man sich später immer stärker auf die Menschenwürde, um gegen globale Ungerechtigkeit oder für die Rechte der Frauen zu kämpfen, sich für sexuelle Gleichberechtigung genauso einzusetzen wie gegen die Straffreiheit von Abtreibungen. Habbo Knoch erzählt, wie sich die Idee der unantastbaren Würde des Menschen schon vor 1945 entwickelte und wie sie, trotz aller unterschiedlichen Interpretationen, zur wichtigsten Übereinkunft der Deutschen wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die Würde des Menschen ist unantastbar: nur ein Versprechen oder politische Maxime?Das Grundgesetz garantiert die Würde des Menschen — ein abstraktes Versprechen, aus dem im Laufe der Jahre sehr konkrete Forderungen abgeleitet wurden. Ging es der frühen Bundesrepublik um die Distanzierung von der nationalsozialistischen Diktatur, berief man sich später immer stärker auf die Menschenwürde, um gegen globale Ungerechtigkeit oder für die Rechte der Frauen zu kämpfen, sich für sexuelle Gleichberechtigung genauso einzusetzen wie gegen die Straffreiheit von Abtreibungen. Habbo Knoch erzählt, wie sich die Idee der unantastbaren Würde des Menschen schon vor 1945 entwickelte und wie sie, trotz aller unterschiedlichen Interpretationen, zur wichtigsten Übereinkunft der Deutschen wurde.
Habbo Knoch
Im Namen der Würde
Eine deutsche Geschichte
Hanser
»Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.«
https://united4rescue.org
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Habbo Knoch
Impressum
Inhalt
Einleitung
Was ist Würde?
Die Geschichtlichkeit der Menschenwürde
Eine deutsche, eine politische Geschichte
Drei Säulen der Würde
I
Der Auftakt im 19. Jahrhundert
1
Drei Arten der Würde: Eine historische Hinführung
2
Freiheit durch Würde: Der bürgerliche Entwurf
3
Für ein würdiges Leben: Die sozialistische Alternative
4
Würde in Gemeinschaft: Das personalistische Modell
II
Vom Zivilisationsbruch zum Gründungsbekenntnis
5
Grenzen der Demokratie: Aufstieg und Fall der Würde nach 1918
6
Verfolgung und Widerstand: Die Menschenwürde als Vision
7
Nach dem Krieg: Die Suche nach einer neuen Ordnung
8
Konsens ohne Einigung: Der Weg ins Grundgesetz
III
Die Sakralisierung der Würde
9
Mehr Ehre als Würde: Rehabilitierungskämpfe in der jungen Republik
10
»Freiheit und Menschenwürde«: Die antikommunistische Pathosformel
11
Eine juristische Leitplanke: Die »Objektformel« als Meilenstein
12
Im Zweifel für die Würde? Die Verfassungshüter in Karlsruhe
IV
Die Vergesellschaftung der Würde
13
Aufbrüche zur Empathie: Die Würde als gesellschaftspolitischer Wert
14
Gegengewalt — gegen Gewalt: Die Würde im globalen Freiheitskampf
15
Würde anders gedacht: Die Ankunft der liberalen Demokratie
16
Die »bleierne Zeit« beenden: Eine Republik zwischen Reform und Revolution
V
Die Würde in der pluralistischen Gesellschaft
17
Im Kampf um Rechte: Die Globalisierung der Menschenwürde
18
Anfechtungen der Würde: Der Staat und die Marginalisierten der Gesellschaft
19
Anerkennungskämpfe: Selbstmobilisierung und Lebensschutz
20
Überlebensfragen: Die Würde im Krisenmodus
Schluss
Nachwort
Anmerkungen
Einleitung
I Der Auftakt im 19. Jahrhundert
II Vom Zivilisationsbruch zum Gründungsbekenntnis
III Die Sakralisierung der Würde
IV Die Vergesellschaftung der Würde
V Die Würde in der pluralistischen Gesellschaft
Schluss
Register
Einleitung
»Dignity? We are in great need of it!« Smalltalk mit einem Mitarbeiter der US-Botschaft im Januar 2020. Alle Unterlagen für mein Visum liegen vor, sind geprüft und für gut befunden. Ein paar Stempel noch, einige freundliche Hinweise, ein Informationsblatt: Läuft wie hier alles nach Plan, stellt sich trotz der Autorität des Amtes ein Gefühl von Respekt, Anerkennung und Sicherheit ein. Was damit als Achtung vor der Würde des Menschen zum Ausdruck kommt, hat sich wie ein Wollmantel um unser Leben gelegt. Er bettet unsere Rechte ein, bietet Schutz vor staatlicher Willkür und erleichtert unsere Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. Für die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik ist das seit dem 23. Mai 1949 durch den ersten Artikel des Grundgesetzes verbrieft: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Seither sind eine Fülle von Lebensbereichen unter den Schutz der Menschenwürde gestellt worden. 2021 auch Visumsangelegenheiten innerhalb der Europäischen Union.
Doch das Bild des Wollmantels trügt. Bilder von Flüchtlingen, Schiffbrüchigen und Ertrunkenen im Mittelmeer oder von Push-Backs an den Grenzübergängen nach Europa stehen für das Gegenteil von geordneten, menschenwürdigen Verfahren. Migration, Illegalität oder Staatenlosigkeit sind nur zu oft mit Erfahrungen von Willkür, Respektlosigkeit und Gewalt verbunden. Empörung regt sich. Aber ändert das etwas? Anscheinend nicht: Tagtäglich werden überall auf der Welt Menschen mit Gewalt erniedrigt, sie leiden an Hunger und Armut, arbeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen oder werden gefoltert. Menschen werden zu wehrlosen Objekten staatlicher Maßnahmen, wenn über sie zum Beispiel durch polizeiliche Gewaltakte oder Eingriffe in die Privatsphäre im Namen von Sicherheit und Ordnung verfügt wird. Vielen Menschen mangelt es an essentiellen materiellen Voraussetzungen, um ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu führen — ganz abgesehen von denjenigen, die hungern müssen. Wohlfahrt und Fürsorge schlagen in Herabsetzungen und die Missachtung persönlicher Bedürfnisse um.
Es liegt auf der Hand, dem Staat in solchen Fällen vorzuwerfen, die Menschenwürde zu verletzen. Aber worauf gründet unser oftmals intuitives und emotionales Alltagsverständnis der »Würde des Menschen«? Wie sind die moralischen, rechtlichen und politischen Maßstäbe entstanden, nach denen wir heute etwas als »entwürdigend« oder »unwürdig« bewerten? Wie verhalten sich das »unwürdige Verhalten« und die »Verletzung der Menschenwürde« zueinander? Als der Parlamentarische Rat das Grundgesetz entwarf, wählte er auf Geheiß des späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss bewusst eine offene Formulierung, um ihr möglichst viel Zustimmung zu sichern. Das sollte sich als große Chance wie als erhebliche Belastung erweisen. Für die Auslegung der Würdenorm existierten keine Vorbilder, nicht im Staatsrecht und auch nicht in der Philosophie. Denn die Würde des Menschen war bis dahin weder legislativ noch in der politischen Moral verankert. Die heutige Bedeutung der Menschenwürde kann deshalb nur aus einer historischen Perspektive verstanden werden. Erst infolge der Verwerfungen des 20. Jahrhunderts mit den Diktaturen, Kriegen und Verbrechen zunächst vor allem auf europäischem Boden, dann aber auch mit Blick auf die globale Dimension der kolonialen Herrschaft des Westens hat sich die Menschenwürde von einer moralischen Idee und politischen Kampfformel zum Bestandteil des Rechts, zu einer prominenten Bezugsgröße öffentlicher Debatten und zu einem prekären Anker des politischen Handelns entwickelt.
Nach dem Ende des Nationalsozialismus mussten sich insbesondere die Deutschen fragen, wie sie ihre Gesellschaft normativ begründen wollten. Auf diese Herausforderung sollte Artikel 1 des Grundgesetzes eine Antwort geben, wie in den Teilen II und III dieses Buches nachzulesen ist. »Die Würde des Menschen ist unantastbar«: Dieses Axiom, es besser machen zu wollen als nach 1918 und 1933, stellte ein Novum dar, denn einen derart prominenten Rang hatte die Menschenwürde bis dahin in keiner anderen Verfassung eingenommen. Lange sollte dies so bleiben. Vergleichbar ist nur ihre Stellung in der Charta der Vereinten Nationen von 1945 und in der drei Jahre später verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Während die Menschenwürde international jedoch nicht bindend war, diente sie im Grundgesetz mehr als nur einem rhetorischen Zweck. Weil sie von Beginn an nicht nur eine Pathosformel sein sollte, konnte sie sich zum Fundamentalprinzip der verfassungsrechtlichen Ordnung und der politischen Moral der Bundesrepublik entwickeln. Aber wie und unter welchen Voraussetzungen fand die Würde des Menschen ihren Weg in das Grundgesetz der Bundesrepublik, und wie gelangte sie von dort aus in deren moralische Kultur?
Was ist Würde?
Wer in die umfangreiche philosophische, juristische und theologische Literatur schaut, die gerade in den beiden letzten Jahrzehnten zur Menschenwürde erschienen ist, findet zu dieser Frage relativ wenig, stellt aber zumindest eines fest: Es besteht kein Konsens darüber, was die Menschenwürde ausmacht und umfasst, wie und ob sie sich verbindlich begründen lässt oder ob sich aus ihr Schutzansprüche und allgemeine oder spezifische Rechte ableiten lassen. Sie wird variantenreich als Konzept und Idee, Wert und Empfindung, Norm und Haltung beschrieben. Man findet sie als von Gott zugesprochene oder als anthropologische Eigenschaft des Menschen, als geschichtlich gewachsenes und sozial verabredetes Regulativ, als Zwilling von Vernunft und Freiheit, als Lebensform oder als Gefühl. Sie ist partikular oder universal, reversibel oder unantastbar, sie wird abstrakt begründet oder konkret erfahren, sie kann als absolut gültig proklamiert oder als kontingente Norm begriffen werden. Als wenig ergiebig erweist es sich, nach einem vermeintlichen ideengeschichtlichen Ursprung der heutigen Würdenorm in der Antike, im spätmittelalterlichen Christentum oder im Humanismus zu suchen.
Aus historischer Sicht ist die Frage, was Würde ist, ohnehin falsch gestellt. Denn es lässt sich, und das soll dieses Buch zeigen, eigentlich nur sagen, was unter der Würde des Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und Bedingungen verstanden wurde, und damit auch, ob und wie dies mit Kontinuitäten und Diskontinuitäten in Politik, Recht und Gesellschaft einherging. Mehr nicht. In genau diesen historischen Kämpfen, Skandalisierungen, Aushandlungen, Verrechtlichungen und Habitualisierungen der Menschenwürde liegt ihre Geltung begründet, ebenso ihre Gefährdung. Denn nicht messerscharfe Definitionen retten die Menschenwürde, sondern eine gelebte, aus der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gewachsene politische Kultur, die es sich zum höchsten Wert gemacht hat, für die Würde der Menschen einzutreten und sie zu schützen.
Aber für eine erste Orientierung lässt sich mit dem Philosophen Peter Schaber zwischen einer »kontingenten« und einer »inhärenten« Würde unterscheiden, die sich bei genauerem Hinsehen in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts allerdings so eindeutig selten findet.1Kontingent ist Würde dann, wenn sie als moralische oder soziale Auszeichnung und Bewertung zugeschrieben, erworben und verloren werden kann. Diese Form der Würde lässt sich anhand äußerer Merkmale nach kollektiv verbindlichen oder hinlänglich vertrauten Kriterien erkennen. Es handelt sich mit dem Rechtsphilosophen Dietmar von der Pfordten um eine »nichtkörperliche, äußere, veränderliche Eigenschaft der wesentlichen sozialen Stellung und Leistung eines Menschen«.2 Sie ist partikular und verlierbar. Als »kleine« Würde ist sie eng mit Begriffen wie Ehre, Privileg oder Status verbunden. Es geht bei ihr um Einfluss und Macht, Normen und Verhalten, Auftreten und Erscheinung. Kontingente Würde ist mithin ein soziales Phänomen, das für denjenigen sichtbar ist, der die zugrunde liegenden Codes kennt.
Anders die inhärente Würde: Sie ist eine unsichtbare Idee, ein Konzept oder eine Eigenschaft. Als ein dem Menschen aufgrund seines Menschseins zukommendes Wesensmerkmal muss und kann sie nicht erst durch seine Herkunft, seine Leistungen oder ihm verliehene Auszeichnungen entstehen. Von der Pfordten hat diese »große Würde« als eine »nichtkörperliche, innere, im Kern unveräußerliche, notwendige und allgemeine Eigenschaft des Menschen« definiert.3 Sie ist absolut, universal und essentiell. Gleichsam zwischen der »großen« und der »kleinen« Würde changiert das Prinzip eines »menschenwürdigen Daseins«, das allerdings in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, weil darunter nicht mehr nur ökonomische Lebensbedingungen verstanden werden, sondern auch Ansprüche auf einen menschenwürdigen Umgang im Bereich der allgemeinen Lebensqualität.
Allerdings wird besonders in der Philosophie, aber auch in den Neurowissenschaften seit einigen Jahren kontrovers diskutiert, ob die Würde des Menschen überhaupt eine »Eigenschaft« sein kann. Fraglos ging der Parlamentarische Rat noch von dieser Vorstellung aus, als er die Würde des Menschen an den Anfang des Grundgesetzes stellte. »Würde«, »Mensch« »unantastbar«: Das war bewusst pathetisch formuliert, um ein Gefühl der vorherigen Erschütterung aller bestehenden Werte zu überwinden und der zukünftigen Politik angesichts der Gegenwart der sozialistischen Herrschaft eine möglichst starke Orientierung zu bieten. Die Geschichte der Würde in der Bundesrepublik ist jedoch immer wieder mit Verunsicherungen verbunden, was die Bedeutung, Geltung und Reichweite von Artikel 1 angeht. Einige dieser historisch wiederkehrenden Krisen der Würdenorm in Theorie und Praxis lassen sich in drei systematische Fragen übersetzen.
Kommt, erstens, die Würde allen Menschen in gleicher Weise zu? Wenn die inhärente Würde im Sinne einer Mitgift verstanden wird, ist dies ohne Abstufung und Bedingung der Fall. Sie kann weder vermehrt noch vermindert werden. Je nach Definition besteht sie seit der Zeugung, einer bestimmten embryonalen Phase oder der Geburt. Zwei andere Modelle verknüpfen die inhärente Würde mit bestimmten Bedingungen: Als Potenzial ist die Würde zwar grundsätzlich bei allen Menschen aufgrund ihres Menschseins angelegt, muss aber erst verwirklicht werden und kann dadurch unterschiedliche Grade erreichen. Schließlich kann die inhärente Würde als Fähigkeit aufgefasst werden, die an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist — zum Beispiel, nach Maßstäben der Vernunft zu handeln. Damit kommt Würde jenen Menschen nicht zu, die über diese Fähigkeit nicht verfügen oder sie nicht nutzen können.
Ist die Würde, zweitens, mit Rechten verbunden? Hier wird zwischen der Gattungswürde und der Anspruchswürde unterschieden. Als Gattungswürde wird die inhärente Würde zwar als allen Menschen gegeben betrachtet, aber aus ihr werden keine Rechte abgeleitet. Manche argumentieren, dies sei auch gar nicht möglich, da es sich um ein normatives Prinzip handele. Eine Verknüpfung von Würde und Rechtsansprüchen wird aber auch abgelehnt, weil sich aus dem diffusen Würdepostulat nicht genau bestimmen ließe, um welche Rechte es sich handeln könnte. Dagegen leiten andere aus dem Konzept der universalen Menschenwürde die Geltung bestimmter Rechte als zwingend ab: den Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit, die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit oder das Verbot von Diskriminierungen. Deshalb sei sie im Sinne einer Anspruchswürde selbst als ein Grundrecht zu verstehen. Dem wird entgegengehalten, dass dieses Modell nicht ohne äußerst starke und keineswegs von allen geteilte Vorannahmen darüber auskommt, was den Menschen ausmacht.
Was ist, drittens, schließlich das Schützenswerte an der Würde des Menschen? Dietmar von der Pfordten begreift die Menschenwürde als Möglichkeit einer »Selbstbestimmung über die eigenen Belange«, die unbedingt zu schützen sei.4 Für Peter Schaber geht es um den Anspruch, nicht erniedrigt zu werden, der auf einem absoluten Recht auf Selbstachtung gründet.5 Selbstbestimmung und Selbstachtung sind demnach unabdingbar, um eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln und leben zu dürfen. Gerade in jüngerer Zeit ist die Ausrichtung an der Selbstbestimmung zum Gegenstand einer lebhaften Debatte darüber geworden, was die Würde des Menschen ist, wozu auch eine verbreitete Skepsis gehört, ob es sie gibt oder man ein solches Konzept braucht. Aber um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen, hat die Geschichte der Menschenwürde einen langen Weg zurücklegen müssen.
Die Geschichtlichkeit der Menschenwürde
Den Weg der Würde als »Geschichte der Säkularisierung christlicher Prinzipien« zu begreifen, wie es der Historiker Heinrich August Winkler tut, greift zu kurz.6 Vielmehr erklärt sich die Genese der Würdekonzepte daraus, gegen die Geltung von partikularen Weltanschauungen mit universalem Anspruch eine moralische Leitidee für eine immer unübersichtlichere Gesellschaft zu begründen. Dieser Weg ist bei weitem noch nicht zu Ende. Aber er speist sich aus verschiedenen Wurzeln und ist zugleich zum einen selbst diskontinuierlich, widersprüchlich und vielfältig, zum anderen aus dezidierten Brüchen mit der Vergangenheit hervorgegangen. Ohne christlich geprägten Personalismus, liberales Freiheitsdenken und sozialistische Gleichheitsvorstellungen ist die Menschenwürde — auch in der Vielfalt ihrer Bedeutungen — nicht vorstellbar, aber auch nicht ohne deren Scheitern in den mittleren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Eines wird im Licht des Nationalsozialismus mehr als deutlich: Die Würde des Menschen ist im Grunde ihrer allgemeinen, nur sozial zu verankernden Geltung keinesfalls unantastbar, da sie zumindest mit absoluter Macht und totaler Gewalt außer Kraft gesetzt werden kann. Kein Dogma, keine Idee der Würde kann den Menschen davor schützen, sondern nur ihre rechtliche, politische und moralische Verankerung.
Da kontingente und inhärente Merkmale der Würde oft miteinander verknüpft wurden und werden, lohnt zunächst mit Teil I dieses Buches ein Blick auf die Genese der Menschenwürde als politische Kampfformel vom 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Denn in dieser Zeit wurde begonnen, von der Menschenwürde zu sprechen, um Einschränkungen der menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten und Beschädigungen von Körper und Seele durch den Staat zu benennen. Gerade diese Phase hat der Sozialphilosoph Hans Joas für seine Genealogie der Menschenrechte in den Blick genommen. Im 19. Jahrhundert habe sich, so Joas, ein »Glaube an die Menschenrechte und die universale Menschenwürde als das Ergebnis eines spezifischen Sakralisierungsprozesses« herausgebildet. Jedes »einzelne menschliche Wesen« sei »mehr und mehr (…) als heilig angesehen und dieses Verständnis im Recht institutionalisiert« worden.7
Hans Joas nennt diesen Prozess die »Sakralisierung der Person«. Sie gründe zwar auf christlichen Wurzeln, säkularisiere diese jedoch, ohne das Moment des Heiligen ganz aufzugeben. Andere sprechen bezogen auf Werte wie die Menschenwürde von einem Baustein der »Zivilreligion«, der eine ansonsten bestehende Leerstelle gefüllt habe. Mit Joas verdankt sich der globale Aufstieg der Menschenwürde zu einem moralischen Leitkonzept nicht dem Vernunftgedanken der Aufklärung oder einer Säkularisierung der Welt, sondern der ins Profane übertragenen Idee einer Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die vom christlichen Glauben abgelöst worden sei. Die Geschichte der Menschenwürde — und mit ihr der Menschenrechte — in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist nach Joas ohne dieses Fundament der sakralen Person nicht zu denken.
Von der Idee der sakralen Person zur Etablierung der Menschenwürde als normativem Leitprinzip der liberalen Demokratie der Gegenwart verlief die historische Entwicklung keineswegs konsequent, sondern in hohem Maße kontingent. Sie war von Momenten der Empörung, Akten der Skandalisierung und Prozessen der Sensibilisierung abhängig. Eine Geschichte der Würde muss deshalb im Zusammenhang mit dem konkreten Ringen um mehr politische und gesellschaftliche Freiheiten aufgesucht werden — den vielen Auseinandersetzungen im Namen der Würde gegen ihre Missachtung, Verletzung und Umdeutung. In dieser Form wurde die Menschenwürde erstmals im Kontext von Demokratisierung und Verrechtlichung, gesellschaftlicher Emanzipation und humanitärer Sensibilität seit der Mitte des 19. Jahrhundert politisch sichtbar, war jedoch massiver Gegenwehr, scharfen Restriktionen und gegenläufigen Deutungen ausgesetzt. Die Menschenwürde konnte sich nur als Kampfformel etablieren, und sie ist dies letztlich bis heute geblieben.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war die Menschenwürde nur ein prekäres, oft solitäres und schillerndes Ideal, das aufflammte, um Unmenschlichkeiten sichtbar zu machen. Die langsame Wende in der Geschichte der Würde in Deutschland kann deshalb nur als eine politische Geschichte miteinander zusammenhängender Ideen und Diskurse, Gefühle und Praktiken geschrieben werden. Sie verlief dabei keineswegs geradlinig. Dem stand nicht zuletzt die Kumulation von deutschem Autoritarismus, Imperialismus und Rassismus in den Verbrechen des Nationalsozialismus diametral entgegen. Auch deshalb lässt sich die deutsche Geschichte nicht im Namen der Würde emanzipatorisch umdeuten. Aber vom Ringen um bürgerliche Freiheiten gegen die Macht der monarchischen Herrschaft über den Widerstand im Nationalsozialismus bis zu den Auseinandersetzungen um die Staatsbürgerrechte in der Bundesrepublik erweist sich das Verhältnis von Staat und Individuum gerade im deutschen Fall als ein besonderes Konfliktfeld, in dem die Menschenwürde als antihegemoniale und emanzipatorische Kampfformel durch die politische Opposition und die Zivilgesellschaft profiliert worden ist. Für sie haben sich nicht selten gerade jene Menschen eingesetzt, die selbst von ihrer Verletzung betroffen waren.
Eine deutsche, eine politische Geschichte
Auch wenn die Menschenwürde keine deutsche Erfindung ist: In keinem anderen Land ist seit der Wende zum 19. Jahrhundert derart im Namen der Würde die immer lauter werdende Forderung verhandelt worden, den Einzelnen vor illegitimen Zugriffen des Staates und zunehmend auch von Dritten auf sein Leben, seinen Körper und seine Seele zu schützen. Mit der Gründung der Bundesrepublik hat sich die Menschenwürde zu einem staatlich abgesicherten Abwehrrecht, zu einem Axiom für die Bewertung rechtlicher Fragen von Bedeutung und darüber hinaus zu einem fundamentalen Scharnier für die Aushandlung drängender gesellschaftspolitischer Fragen entwickelt. Dieses Buch will vor allem in den Teilen III, IV und V die dafür maßgeblichen Weichenstellungen, Verankerungen und Positionen aufzeigen und einordnen. Vor allem solche Ereignisse, Themen und Akteure werden genauer betrachtet, die ausdrücklich im Namen der Würde ihren Weg in das Grundgesetz und aus ihm heraus mitgestaltet haben. Das Reden und Handeln im Namen der Würde des Menschen erweist sich dabei als eminent wandelbar, kontrovers und vieldeutig. Und es zeigt sich, dass gerade der Verzicht auf die Semantik der Würde ebenso wie ihre Diffamierung als politischer Akt von eminenter Aussagekraft ist.
Fraglos haben dabei der Zweite Weltkrieg und die Herrschaft des Nationalsozialismus maßgeblich zur Verrechtlichung, Politisierung und Moralisierung der Menschenwürde beigetragen. Doch den Weg der Würdenorm in das Grundgesetz und erst recht von dort aus in die politische Kultur der Bundesrepublik allein aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus oder gar der nationalsozialistischen Verbrechen im engeren Sinne abzuleiten, greift zu kurz. Artikel 1 lässt sich nicht ohne die vorherige Präsenz der Menschenwürde in gesellschaftlichen Debatten, der intellektuellen Kultur und politischen Aushandlungsprozessen erklären. Zudem haben immer besondere zeitgenössische Bedingungen dazu geführt, die Menschenwürde argumentativ, appellativ oder rechtlich zu mobilisieren — vom Antikommunismus der Nachkriegszeit über die Demokratisierung und Liberalisierung der 1960er und 1970er Jahre bis hin zum transnationalen Humanitarismus und den Herausforderungen moderner Technologien für die Frage nach dem Wesen des Menschen.
Vor allem aber entwickelte sich der Bezug auf den Nationalsozialismus im Zusammenhang mit der Würdenorm erst in mehreren Schüben: Nachdem zunächst die Unterdrückung des deutschen Volkes durch die »Hitler-Diktatur« im Vordergrund stand, gewann ein universales, absolutes und essentielles Verständnis der Menschenwürde erst seit den 1960er Jahren an Bedeutung, als sich mit einer neuen gesellschaftlichen Sensibilität für das Leiden anderer Menschen auch eine empathische Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus herauszubilden begann. Ihre Entfaltung hin zur Staatsräson erlebte sie erst seit den 1990er Jahren. Diese Empathie bildete bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates und in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik bestenfalls eine Hintergrundströmung: Die Würde des Menschen an den Anfang des Grundgesetzes zu stellen war keine Konsequenz aus den nationalsozialistischen Verbrechen, sondern gründete in der Haltung, die Deutschen seien insgesamt durch die nationalsozialistische Diktatur ihrer Würde beraubt worden.
Drei Säulen der Würde
Erst mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Gründung der Bundesrepublik fanden die Stimmen der Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen langsam Gehör. Besonders eindrücklich hat die jüdische Widerstandskämpferin Hanna Lévy-Hass in ihrem erstmals 1979 auf Deutsch erschienenen Tagebuch aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen geschildert, was es bedeutet, wenn Mindeststandards der Selbstachtung und das Recht auf Selbstbestimmung verwehrt werden. Am 8. November 1944 schrieb sie: »Unsere Existenz hat etwas Tierisches, Grausames an sich. Alles Menschliche ist auf null reduziert. (…) Wir sind nicht tot, aber wir sind Tote. Man hat es fertigbekommen, in uns nicht nur das Recht auf das gegenwärtige Leben abzutöten«, sondern auch »das Bewusstsein, einmal als Menschen, die dieses Namens würdig waren, existiert zu haben.«8 Ihren Zustand im Lager stellte die aus Jugoslawien stammende Lévy-Hass dem gegenüber, was den Menschen für sie eigentlich ausmachte: Freundschaft erfahren zu können, über Geist und Gefühle zu verfügen, sich an Kunst und Schönheit zu erfreuen, eine eigene Vergangenheit zu haben.
Lévy-Hass sehnte sich danach zurück, ihr Leben eigenständig gestalten und leben zu können. Diesen Wunsch verknüpfte sie mit einem »Recht auf das gegenwärtige Leben«. Das Lager aber nahm den Häftlingen dieses Recht ohne Ansehen der Person und ihrer Geschichte. Sie beschrieb sich als an Körper, Geist und Seele zutiefst gedemütigt, entehrt und beschädigt. Was sie unter ihrer Würde verstand, ruhte auf drei Säulen, die ihr alle genommen worden waren: dem Recht zu leben, dem Recht auf eine humanistische Entfaltung ihrer Persönlichkeit und dem Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Doch sprach Lévy-Hass an keiner Stelle von der »Würde des Menschen« oder der »Menschenwürde«. Im Zustand ihrer tiefsten Erniedrigung standen ihr diese Ausdrücke nicht zur Verfügung, weil die Menschenwürde weder im Recht noch in der Sprache verankert war, um dem Staat Grenzen zu setzen und die durch ihn erfahrene Verletzung auszudrücken.
Hanna Lévy-Hass befand sich nicht nur physisch und seelisch in einer scheinbar ausweglosen Situation: Der Zivilisationsbruch des Holocaust und der nationalsozialistischen Verbrechen bedeutete zugleich ein »nicht mehr« und ein »noch nicht wieder« der Fundamente alles Sozialen. Genau diese historische Ausgangssituation bildet den inneren Kern des vorliegenden Buches und der Motivation, es zu schreiben. Für den Weg der Menschenwürde zu einer Abwehrnorm, um das Individuum vor dem Zugriff des Staates und von Dritten zu schützen, war nicht entscheidend, sie als eine dem Menschen innewohnende Eigenschaft zu betrachten. Um der Menschenwürde eine fundamentale politische und gesellschaftliche Bedeutung einzuräumen, musste sie sich die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft erst als etwas bewusst machen, das dem Menschen durch systematische Massenverbrechen an Körper und Geist genommen werden kann.
Sich die Antastbarkeit, die Verletzbarkeit der menschlichen Würde in all ihren Dimensionen, Graden und Nuancen zu vergegenwärtigen: Auf dieser nach 1945 nur prozessual zu gewinnenden Einsicht gründen Stärke und Schwäche der Menschenwürde zugleich. Denn ihre Geltung beruht auf einem historisch gewachsenen Rahmen der politischen Moral, der in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen hergestellt worden ist, genau dort aber auch wieder verlorengehen kann. »Im Namen der Würde« möchte nachzeichnen, wie dieser Rahmen entstanden ist, um sich seiner Grundlagen in einer Zeit zu vergewissern, in der die Menschenwürde schwer im Gegenwind vieler Kritiker, Gegner und Herausforderungen steht.
I
Der Auftakt im 19. Jahrhundert
1
Drei Arten der Würde: Eine historische Hinführung
»Du bist Nummer Hundertneunzig?«, fragt der Direktor einer Strafanstalt einen seiner jugendlichen Delinquenten. Dessen Antwort wird zur Klage darüber, »nur noch eine Ziffer« zu sein. Der Direktor sieht seine Autoritätswürde angegriffen und reagiert empört: »Daran ist Niemand schuld, als Du allein! Wer seine Freiheit mißbraucht und seine Menschenwürde mit Füßen tritt, der wird eingesperrt und gilt als Strafvollzugsobject, das man zur besseren Uebersicht mit einer Zahl bezeichne. Hast Du das verstanden?« Der Sträfling reklamiert seine Unschuld und fällt in ein »dumpfes Brüten«. Denn ihm wird vorenthalten, was er als zu seiner Würde gehörig versteht: »Wer hat das Recht, dem Menschen ihren Strahl, ohne den er nicht leben kann, zu entziehen? Wer hat die fürchterliche Strafe erfunden, die ihn den Seinen entreißt einer That wegen, an der sie keinen Antheil haben? Wer wagt es, zu behaupten, daß der richterliche Schiedsspruch, welcher in die tiefsten Tiefen eines menschlichen Seins hinunterlangt, untrüglich sei?«1
Der Direktor sieht seine Würde in Gefahr, dem Delinquenten wird seine genommen: Wie in Karl Mays Erzählung »Des Kindes Ruf« von 1879 erweist sich das 19. Jahrhundert in der Geschichte der Würde als zähes Ringen zwischen der kontingenten, hier an ein Amt gebundenen Würde und der inhärenten Würde des Menschen: Auf der einen Seite geriet die Autoritätswürde gerade mit Blick auf ständische Vorrechte wiederholt unter Druck, konnte sich aber mit jeder antirevolutionären Restauration des monarchischen Prinzips wiederbeleben. Auf der anderen Seite findet sich die inhärente Würde in der zitierten Szene gleich zweifach: einmal als konditionale Würde, indem der Direktor dem Sträfling vorhält, seine Menschenwürde »mit Füßen getreten« zu haben. Dann aber wird sie auch als universale Würde sichtbar, da der Delinquent Rechte für sich beansprucht, die dem Menschen allgemein zukämen. Zudem findet das Gespräch in einem Rahmen statt, der als Entpersönlichung zur »Nummer« und als »Object« qualifiziert ist. Aber wann entstanden diese Modelle der kontingenten, konditionalen und universalen Würde, worauf gingen sie zurück, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
Kontingente Würde
Historisch betrachtet war die Würde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vor allem kontingent. Als Autoritätswürde — auch von Amtswürde oder Standeswürde ließe sich hier sprechen — stellte sie eine Kombination aus Rang, Status und Leistung oder, allgemeiner, eine an herkunfts- oder berufsständische Merkmale geknüpfte, herausgehobene soziale Position dar, die mit bestimmten Erwartungen an Verhalten, Auftreten und Kleidung verbunden war. Sie manifestierte sich äußerlich und entstand durch Zuschreibungen und Auszeichnungen. Diese Form der Würde wurde in der Antike als »dignitas« der römischen Führungsschichten begründet und stand seither in einem engen Zusammenhang mit Monarchen, Adeligen oder kirchlichen und weltlichen Amtsträgern, also Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. In diesem Sinne definierte Johann Christoph Adelung die Würde 1811 in seinem »Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart« zum einen als »jeden Vorzug eines Dinges oder einer Person«, zum anderen als den »äußeren Vorzug« eines Menschen, vornehmlich durch ein damit »verbundenes Amt«.2
Die Autoritätswürde war weder egalitär noch universal, denn neben der Herkunft hing sie von historischen Bedingungen wie Traditionen und Konventionen ab. Mit ihr war ein bestimmter Habitus assoziiert: ein maßvolles Verhalten, angemessene Kleidung oder bedächtiges Schreiten. Zudem konnte die Autoritätswürde durch Fehlverhalten, die Änderung sozialer und politischer Umstände oder durch Abwahl und Rücktritt abhandenkommen. Das mit der Autoritätswürde verbundene Verhalten galt als etwas Erlerntes, nicht als menschliche Eigenschaft. Gerade »Standes-Personen«, also Adelige, verfehlten häufig den an sie gestellten Anspruch, sich würdig zu verhalten. Viele sprächen, so Johann Christoph Gottsched 1730, zwar »ihrer Würde gemäß (…), solange sie ruhigen Gemüthes« seien, aber wenn sie der »Affekt übermeistert, vergessen sie ihres hohen Standes fast, und werden wie andere Menschen«.3
Es handelte sich aber nicht nur um einen moralischen Begriff, sondern auch um eine Herrschaftskategorie. In der Antike legitimierte die Autoritätswürde ihre Träger dazu, über Bedienstete und Sklaven zu verfügen, oder sie ermöglichte den Zugang zu bestimmten öffentlichen Ämtern. »Die Zeremonien, die Amts- und Standestrachten, die ernsten Mienen, das feierliche Dreinschauen, die langsame Gangart, die gewundene Rede und alles überhaupt, was Würde heißt«, so der bissige Kommentar von Friedrich Nietzsche 1881, »das ist die Verstellungsform derer, welche im Grunde furchtsam sind, — sie wollen damit fürchten machen (sich oder das, was sie repräsentieren).«4 Auch als Machtinstrument blieb die Autoritätswürde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die vorherrschende Form der Würde, zumal sie auf moderne Institutionen wie Staatsorgane, Parlamente oder Gerichte und deren Repräsentanten übertragen wurde. Nicht zuletzt in der Diplomatie spielt die Würde dieser Art bis heute eine zentrale Rolle als Machtinstrument, wie vor allem Verletzungen zeremonieller Ordnungen oder Kränkungen des nationalen Selbstbewusstseins demonstrieren, die als »Schande« oder »Schmach« bezeichnet wurden.
Mit der Zeit wurde die Autoritätswürde als Charakterwürde verinnerlicht. Bestimmte Handlungen, Äußerungen oder Formen des Auftretens galten als würdig oder unwürdig, auch wenn es nicht um Träger der Autoritätswürde ging. Jemand trägt oder erleidet etwas mit Würde, handelt würdig oder spricht in würdevollem Ton. Die Charakterwürde wird daran bemessen, ob jemand bestimmte soziale Normen und damit verbundene Erwartungen erfüllt. Sie können, müssen aber keineswegs mit der Autoritätswürde korrelieren, weil Normen eines als würdig erachteten Verhaltens für jegliche Art von Gruppen und Kollektiven — etwa für politische Zusammenschlüsse oder Nationen — aufgestellt werden können. Auch die Charakterwürde ist kontingent, weil sie Ausdruck eines historisch bedingten Urteilens darüber ist, ob jemand einem bestimmten Maßstab entspricht, auf den sich eine Gemeinschaft verständigt hat.
Wie die Autoritätswürde weist auch die Charakterwürde eine große Nähe zur Ehre auf, was an ihre vormodernen Wurzeln erinnert. Beide Begriffe bilden zwei Seiten desselben Phänomens: der Kategorisierung von Gesellschaften nach Herkunft, Charakter und Verhalten gemäß einer bestimmten sozialen Rangordnung. Stellte die Würde hierbei eher die äußere, sichtbare Form dar, wurde lange Zeit die Ehre als eigentlicher Kern einer inneren Wertigkeit begriffen, deren Maß und Geltung sich aus dem jeweiligen sozialen Ort ableitete. Je nach Status konnte sie in unterschiedlichem Ausmaß verletzt werden. Das Recht, ihre Wiederherstellung einzufordern, war klar hierarchisiert. So war das bis weit ins 19. Jahrhundert intensiv praktizierte Duell als spektakulärste Form, auf Ehrverletzungen zu reagieren, nominell Adeligen vorbehalten.
Im bürgerlichen Zeitalter waren Würde und Ehre begrifflich weitgehend austauschbar. Philosophen und Literaten appellierten daran, die persönliche Ehre durch individuelle Selbstachtung zu gewinnen. Gegen die verbreitete Kritik am Ehrbegriff wertete Georg Friedrich Wilhelm Hegel sie zur von Gott gegebenen inneren Ehre auf. Er kam dabei einem Teilaspekt des heutigen Würdebegriffs sehr nahe: Indem die Ehre über die eigene Persönlichkeit nach außen getragen und anderen sichtbar gemacht werde, sei sie das »schlechthin Verletzliche«.5 Auf die vom Einzelnen ausgehende zwischenmenschliche Dimension hob 1862 auch die »Rechtskunde für Jedermann« ab: »Die Ehre ist das Band alles menschlichen Verkehrs und daher das höchste Gut des Menschen, vermöge dessen er allen Anderen gleich steht und einen Werth erhält, der von Jedem anerkannt werden muß, so lange er sich nicht selbst entwürdigt, also der Achtung verlustig und der Verachtung werth gemacht hat.«6
Im Lauf des 19. Jahrhunderts trat neben die Ehre im engeren Sinne als Standesprivileg auch die Ehre als Erziehungsziel, das aber ebenfalls in zweifacher Hinsicht kontingent war: Nicht allen — zum Beispiel Menschen aus kolonialen Herrschaftsräumen — wurde überhaupt zugesprochen, eine solche Ehre ausbilden zu können, bei anderen verfing die Erziehung nicht. Das war fatal in einer Gesellschaft, in der Ehre ein entscheidendes soziales Kapital darstellte, das einerseits eng mit Männlichkeit und Nation, andererseits mit weiblicher Schamhaftigkeit und Zurückhaltung verknüpft war. Wie bedeutsam die Ehre nicht nur für die soziale Ordnung noch im Übergang zum 20. Jahrhundert war, zeigt sich im Bereich des Rechts: Obwohl der »bürgerliche Tod« — der vollständige Verlust aller Rechte — im Lauf des 19. Jahrhunderts verschwand, blieben die »Ehrenrechte« oder die »bürgerliche Ehre« als Bezeichnung für die Grundbefugnisse des Staatsbürgers erhalten. Sie konnten — faktisch bis zur Strafrechtsform von 1969 — bei bestimmten Delikten oder abhängig vom Strafmaß aberkannt werden.
Eine dritte Form der kontingenten Würde ist noch zu ergänzen: Von ihr wurde vor allem seit dem 18. Jahrhundert mit Bezug auf künstlerische Objekte, Gebäude oder Denkmäler gesprochen, wenn sie bestimmte ästhetische Ideale erfüllten. Diese Ausdruckswürde ist eine Frage der kollektiven Geschmacksbildung, historisch wandelbar und ein Qualitätskriterium, das kulturelle Objekte hierarchisiert. Auch sie ist das Ergebnis einer wertenden, historisch gewachsenen und partikularen Zuschreibung. Die drei Arten der kontingenten Würde — Autorität, Charakter und Ausdruck — konvergieren in der Vorstellung, eine gesellschaftliche Ordnung, ihr soziales Miteinander und ihre Kultur entlang der Würde zu ordnen, zu hierarchisieren und zu differenzieren.
Die kontingente Würde diente historisch dazu, Ungleichheiten zwischen Menschen zu erklären und zu rechtfertigen. Sie kam nicht allen zu und hing von Stand, Glauben, Tugend oder Bildung ab, im Christentum vom gottgefälligen Leben, später von der bürgerlichen oder humanistischen Moralität. Frauen und Kinder waren von diesem Würdeverständnis ausgenommen, ebenso Menschen, denen Stand und Ehre abgesprochen oder die nicht zu den »Zivilisierten« gerechnet wurden. Die kontingente Würde hat ein mögliches Verfallsdatum: Sie kann aufgegeben, verloren oder abgesprochen werden. Zudem ist sie nicht mit Rechten verbunden, um die Freiheit des Einzelnen zu schützen, sondern begründet vielmehr das Recht zur Herrschaft über die Freiheit anderer, zum Beispiel von Sklaven. Indem diese Form der Würde bestehende soziale Hierarchien und Exklusionen widerspiegelte und bekräftigte, war sie eine relative Eigenschaft ausgewählter Menschen, die immer von etwas anderem abhing, etwa von Gott, der die Würde dem rechtmäßig gläubigen Menschen im Unterschied zu anderen zukommen ließ, von einem Amt, das man bekleidete, oder von einem Stand, in den man hineingeboren wurde.
Konditionale Würde
Um 1800 verstanden die meisten Philosophen, Theologen und Literaten unter Würde eine innere Anlage, die jeden dazu befähigte, sich im Sinne der Charakterwürde zu einem guten Menschen zu entwickeln. Sie wurde der rein äußerlichen Würde oder Ehre entgegengesetzt, die sich im Streben nach Rang, Prunk und Ansehen äußerte. Die inhärente Würde des Menschen weist dabei zwei Formen auf: eine konditionale und eine universale. Gilt Letztere immer, wird die konditionale, von der kontingenten nicht immer klar zu unterscheidende Würde an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Christentum und Humanismus haben zwar das Postulat einer Alleinstellung des Menschen gegenüber allen anderen Lebewesen mit Hilfe der Würde in sein Inneres verlegt und in diesem Sinne als Mitgift entworfen. Aber sie wurde zugleich an das Ziel eines tugendhaften Lebens geknüpft, um als Mensch zur moralischen Vollkommenheit zu gelangen. Diese konditionale Vorstellung der inneren Würde gelangte in Deutschland — weitaus mehr als in Großbritannien oder Frankreich — über die schöne Literatur und das moralische Schrifttum des 18. Jahrhunderts in den bildungsbürgerlichen Diskurs.
Bereits in der Antike finden sich aber vereinzelt Ansätze, die Würde als innere, wenn auch noch nicht als universale Eigenschaft des Menschen oder als fundamentales Prinzip der Moral zu verstehen. So sprach Cicero gelegentlich von der »dignitas« des Menschen an sich, weil ihn die Vernunft (»ratio«) auszeichne. Aber im Vordergrund stand bei ihm — neben der Autoritätswürde — die Charakterwürde. Letztere band er an Grundtugenden wie Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit und Mäßigkeit. Wie vielen seiner Zeitgenossen ging es Cicero eher um die »humanitas« im Sinne einer auf moralische Vollkommenheit zielenden Persönlichkeitsbildung. Die Fähigkeit zur Menschlichkeit wurde zum Wesensmerkmal des Menschseins erklärt, das den Menschen von den Tieren unterschied, aber durch »inhumanitas«, also unmenschliches Verhalten, eingebüßt werden konnte.
Die Vorstellung von der inneren Würde als einer Wesenseigenschaft allein des Menschen, die ihn von allen anderen Kreaturen grundsätzlich unterscheidet, breitete sich seit dem Mittelalter mit dem Ansatz der Gottesebenbildlichkeit (»imago dei«) aus. Nach den Lehren von Augustinus oder Thomas von Aquin bedeutete Würde, sie zwar von Gott übertragen zu bekommen, aber durch ein tugendhaftes Handeln ausfüllen zu müssen. Nach Aquin verfügt der Mensch über Würde als die Fähigkeit, sich zwischen richtigen und falschen Handlungen entscheiden zu können. Wer aber sündige, verlasse die »Ordnung der Vernunft« und falle »ab von der menschlichen Würde, welcher gemäß er von Natur frei und selber Zweck seiner Handlungen ist«.7 Wer jemand anderen unschuldig der Beschämung preisgibt, so ein wichtiges Element dieses Ansatzes, entwürdigt sich selbst. Die christliche Würde war somit zwar eine innere, an sich unveränderliche Eigenschaft, aber zum einen kam sie allein dem gläubigen Menschen innerhalb der christlichen Ordnung zu, zum anderen verlor sie, wer sich nicht angemessen verhielt.
In der christlichen Welt war die Würde weder eine fundamentale Rechtsnorm, noch hatte der Mensch darauf einen absoluten Anspruch als Individuum. Wie die ihr verwandte Seele war die Würde des Menschen ein Teil seines Inneren, für das jeder Mensch selbst verantwortlich zeichnete. Hinsichtlich ihrer sozialen Stellung blieben die Menschen kategorisch voneinander nach Ständen unterschieden. An diesem religiösen Würdekonzept haben die Kirchen bis weit ins 20. Jahrhundert festgehalten: Die Würde des Menschen und die Frage seiner Bürgerrechte wurden strikt voneinander getrennt. Für das Erste sahen sich die Kirchen als zuständig an, für das Zweite nicht. Man war weit davon entfernt, Vernunft, Gleichheit und Würde als absolut anzuerkennen und zum Fundament eines grundsätzlich egalitären Menschenbildes zu erklären oder sie gar mit der Anerkennung von Menschenrechten zu verknüpfen.
Der Würdebegriff war so sehr durch dieses christliche Verständnis besetzt, dass er in den Schriften des Humanismus während der Renaissance und in der frühen Aufklärung nur eine untergeordnete Rolle spielte. Allerdings wäre das heutige Verständnis von Menschenwürde nicht ohne jenen fundamentalen Wandel des Menschenbildes vorstellbar, der sich seit dem 15. Jahrhundert ereignete. Die meisten Denker des frühen Humanismus teilten die christliche Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Grund seiner Ausnahmestellung in der Welt, einige von ihnen säkularisierten sie sogar. Gemeinsam war den Humanisten, sich von dem jahrhundertelang von der christlichen Lehre vertretenen Bild eines weltlichen »Elends des Menschen« abzuwenden. Dem Menschen wurde nun die Fähigkeit zugeschrieben, seine weltliche Existenz im Sinne eines guten und angenehmen Lebens zu gestalten. In diesem Sinne leitete der weithin vergessene Florentiner Philosoph Giannozzo Manetti 1452 in seiner Schrift »De dignitate et excellentia hominis« die Würde des Menschen zwar auch aus einer von Gott verliehenen Vollkommenheit ab, schrieb seiner Seele aber »Intelligenz, Gedächtnis und freien Willen« zu, die ihn zu einem nahezu vollkommenen, schöpferischen Wesen machten.
Dieses idealisierte Bild der entwicklungsfähigen Menschennatur im Rückgriff auf Vorstellungen der Antike prägte den Humanismus der Renaissance. Als früher Wegbereiter des modernen Würdekonzepts wird dabei oft Manettis Zeitgenosse Pico della Mirandola angeführt, ein humanistischer Gelehrter, der die päpstliche Kirche von innen verändern wollte. Sein 1486 entstandenes Hauptwerk »Die Würde des Menschen« erschien erst posthum 1557, nachdem er bereits im Alter von 31 Jahren von seinem Sekretär ermordet worden war. Der Kirche war er zu kritisch. Doch weder hatte Pico den Titel seines Werks zu verantworten, noch hat er darin von »dignitas« im Sinne der Menschenwürde gesprochen. Gleichwohl erkannte er im Einklang mit den Humanisten dieser Zeit auf der Erde »nichts Wunderbareres als den Menschen«. Ihn unterschied nach Pico von allen anderen Geschöpfen, eigenverantwortlich seine Natur bestimmen und zwischen Vervollkommnung und Selbstzerstörung wählen zu können. Damit nahm er Aspekte der individuellen, vernunftbegründeten Autonomie vorweg, blieb aber der Erwartung eines gottgefälligen Lebens verhaftet.
In der frühmodernen politischen Philosophie ging es dann vor allem um das Verhältnis von Staat, Recht und Freiheit. Die Würde spielte keine tragende Rolle. Wo etwa der Naturrechtler Samuel von Pufendorf im 17. Jahrhundert von der christlichen Verknüpfung von Seele, Würde und Vernunft im Sinne der Gottesebenbildlichkeit abwich, nutzte er einen neuen Begriff: »dignatio«, also Würdigkeit. Dem Menschen sei »ein feines Gefühl der Selbstachtung eingegeben, dessen Verletzung ihn nicht weniger tief trifft als ein Schaden an Körper und Vermögen«.8 Pufendorf lenkte den Blick damit auf die anthropologische, wenn auch in Gottes Schöpfung fundierte Eigenschaft des Menschen als soziales Wesen, das auf die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft angewiesen ist. Die Würde des Menschen ergab sich für ihn komplementär aus dieser Sozialität. Angewiesen auf ein Leben in Gemeinschaft, könne und müsse der Mensch sich zu einem sittlich vollkommenen Wesen entwickeln. Würde war in diesem Sinne für Pufendorf eine moralische, aber keine rechtliche oder politische Kategorie. Der Mitbegründer des Vernunftrechts eignet sich auch aus einem anderen Grund kaum als Ahnherr für den politischen Würdebegriff des 20. Jahrhunderts: Pufendorf gestattete den Menschen kein Widerstandsrecht gegen den Staat.
Im Übergang zum 18. Jahrhundert erlebte dann die Idee der inneren Würde eine bemerkenswerte Blüte. So nahm der reformierte Theologe Johann Caspar Lavater den Ansatz der Gottesebenbildlichkeit des Menschen in seiner zwischen 1775 und 1778 erschienenen »Physiognomik« wörtlich: Das menschliche Gesicht war für ihn ein idealer Ausdruck der Würde, die er als ein nur dem Menschen zukommendes »Sensorium« für die unsichtbare göttliche Welt betrachtete. Würde war nach Lavater die individuelle Fähigkeit, Gott zu schauen. Ihren jeweiligen Entwicklungsstand vermeinte er der Physiognomie des Menschen ablesen zu können. Umgekehrt sollte die Kunst, diese Art der Würde im Antlitz des anderen erkennen zu können, zugleich auch den eigenen Weg zur Erkenntnis Gottes öffnen.
Auch in einer bürgerlichen Ordnung, die sich zunehmend von Gott emanzipierte und von den Dogmen der Kirche distanzierte, wollten viele Denker dieser Zeit den Menschen aus sich selbst heraus als für andere Wesen unerreichbar stilisieren. Seine Würde als innere, anthropologische Befähigung musste im Streben nach einem Verhaltensideal sichtbar werden, das jeder Mensch zu erreichen trachten, aber auch verfehlen konnte. In moralphilosophischen Werken, Handbüchern der Sittlichkeit und Erziehungsratgebern war nun vielfach von »Menschenwürde« die Rede. Gottfried Immanuel Wenzel forderte 1804 in seiner »angewandten Moral«, die Menschenwürde zu erhalten und zu erhöhen. Das ging mit zahlreichen Geboten einher: Man solle weder »Verachtung« noch »Haß« in absoluter Weise gegen einzelne Menschen hegen oder diese durch Fakten, Ausdrücke und Kritik in ihrer Würde missachten. Im Zentrum stand bei Wenzel eine Selbstverpflichtung zum moralischen Handeln: »Erniedrige die Menschheit nicht, durch Verleugnung deiner eigenen Würde, durch Unsittlichkeit.«9 Die Menschenwürde war aber lediglich eine Kategorie der Moral. Als Charakterwürde sollte sie das zwischenmenschliche Verhalten regulieren.
Was aber den Zustand dieser inneren, konditional gedachten Würde anging, kam Johann Gottfried Herder in seinen »Briefen zur Beförderung der Humanität« zu einem vernichtenden Urteil: »Das Menschengeschlecht (…) hat seinem größten Teil nach keine Würde; man darf es eher bemitleiden als verehren.« Aufgrund ihres zweitausendjährigen Verfalls seit der griechischen Antike ersetzte Herder »Menschenwürde« durch »Humanität«. Den Menschen zeichne seine Anlage zur Humanität als das »Göttliche in unserem Geschlecht« aus. »Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden muß, oder wir sinken, höhere und niedere Stände, zur rohen Tierheit, zur Brutalität zurück.«10 Mit dem Bild der »Tierheit« waren natürlich nicht nur tierische Kreaturen im biologischen Sinne gemeint, sondern all jene menschlichen Lebewesen, denen ein höheres Maß des Menschseins oder die Möglichkeit dazu abgesprochen wurde wie den Sklaven oder den Unterschichten. An diese und viele andere Voraussetzungen geknüpft, prägte die innere Würde in ihrer konditionalen, partikularen Form das Moralverständnis des Bürgertums bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
Universale Würde
Eine besondere Form der inhärenten Würde ist die universale Würde. Über sie verfügen alle Menschen ganz unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Fähigkeiten oder ihrem Verhalten. Erstmals hat dieses Würdeverständnis 1945 mit der Charta der Vereinten Nationen einen rechtlich und politisch relevanten Ausdruck gefunden. Sie stellte sich unter den »Glauben an (…) Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit« und verpflichtete ihre Mitglieder, die »Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen«.11 Das Konzept einer universalen und absoluten Würde als unverlierbare Eigenschaft aller Menschen lässt sich aber bis in die Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Die meisten der heutigen Definitionen beziehen sich auf Immanuel Kant, ohne dass dieser sich selbst als Protagonist des Würdebegriffs verstand. Ideengeschichtliche Genealogien, die Kant als Bindeglied zwischen Humanismus, Aufklärung und dem 20. Jahrhundert sehen, konstruieren eine kaum belastbare Kontinuität zwischen an sich ganz heterogenen Würdekonzepten. Zudem ist der Begriff weder von tragender Bedeutung für Kants Moralphilosophie noch sonst in seinen anderen Werken besonders präsent. Aber er war eng mit seinen Leitkonzepten Vernunft, Sittlichkeit und Autonomie verknüpft.
Wegweisend für Kants Beitrag zur Idee der Menschenwürde als einer universalen, absoluten und essentiellen Eigenschaft des Menschen war, dass er jegliche metaphysische Grundlage bestritt. Statt von Gott leitete er sie anthropologisch aus der natürlichen Vernunftbegabung des Menschen ab, die ihn zu Autonomie und Sittlichkeit befähigte. Der Mensch müsse sich für sein Handeln nicht mehr vor Gott, sondern lediglich vor seinem Gewissen und dem inneren Sittengesetz verantworten. Die Würde des Menschen verstand Kant als etwas Abstraktes, das sich aber in einem Gefühl bestätige. 1798 leitete er im »Streit der Fakultäten« die Würde aus »etwas in uns« ab, »das zu bewundern wir nie aufhören können, wenn wir es einmal ins Auge gefaßt haben«.12 Begründet lag die Würde aber in seiner Fähigkeit zur »inneren Gesetzgebung«. Dem Menschen komme deshalb eine »unverlierbare Würde (dignitas interna)« zu, so Kant in seiner »Tugendlehre« von 1797, die ihm »Achtung (reverentia) gegen sich selbst einflößt«. Ausgedrückt sei dies im »Gefühl seines inneren Werths (valor), nach welchem er für keinen Preis (pretium) feil ist«.13
Kant lieferte eine Reihe von Beispielen, wann er die Würde als verletzt ansah. Einige betreffen in auffälliger Weise die ökonomische und damit sittliche Lebensführung: Der Mensch solle keine Schulden ohne ausreichende Sicherheiten machen, keine verzichtbaren Wohltaten annehmen und Armut vermeiden. Die Verantwortung für ihre Würde liegt hier bei den Betroffenen. Andere Fälle kommen dem heutigen Würdeverständnis näher: »Werdet nicht der Menschen Knechte; laßt euer Recht nicht ungeahndet von Anderen mit Füßen treten. (…) Das Hinknien oder Hinwerfen zur Erde (…) ist der Menschenwürde zuwider.« Eine Kategorie macht aber besonders deutlich, wie Kant die »unverlierbare Würde« mit einer Verhaltensnorm verknüpft hat: »Das Klagen und Winseln, selbst das bloße Schreien bei einem körperlichen Schmerz ist euer schon unwerth.«14 Dieses Würdeverständnis war weit gespannt, mit materiellen Maßgaben für die richtige Lebensführung verbunden bis hin zur heroischen Verhaltenswürde — es war aber kein Abwehrrecht.
Kant verfolgte keine Ambitionen, aus der Würde des Menschen selbst ein emanzipatorisches Konzept zu entwickeln. Aber er lieferte mit der Selbstzweckformel den grundlegenden Gedanken säkularer Würdekonzepte des 20. Jahrhunderts: »Die Menschheit selbst ist eine Würde; denn der Mensch kann von keinem anderen Menschen (…) bloß als Mittel, sondern muss jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden, und darin besteht eben seine Würde (…), dadurch er sich über alle anderen Weltwesen (…) erhebt.«15 Weil aber allein seine Würde es dem Menschen ermögliche, seine Autonomie zu verwirklichen, müsse sie unbedingt geschützt werden. Niemand dürfe einen anderen Menschen ausschließlich zum Mittel für eine andere Sache machen. Damit erklärte Kant die Würde zu etwas Absolutem, das einer Realisierung der Selbstbestimmung vorgelagert, aber durch die grundsätzliche Vernunftfähigkeit des Menschen begründet war.
Kant war seiner Zeit voraus. Denn wurde in diesen Jahren die Universalität des Menschen betont und zudem mit unveräußerlichen Rechten verknüpft, geschah dies meist ohne den Umweg über den Würdebegriff. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der »Virginia Bill of Rights«, vom 12. Juni 1776 hieß es: »That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity (…).« Die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 sprach von den »natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechten der Menschen«. Davon waren jedoch viele Menschen ausgenommen — insbesondere Unfreie, Frauen oder Straffällige. Die Menschenrechtserklärungen wie auch die fortschrittlicheren Verfassungen dieser Jahre basierten auf naturrechtlichen Ordnungskonzepten, denen die christliche Lehre und Vorstellungen einer göttlichen Schöpfungsordnung zugrunde lagen.
Ohne vorrechtliche Anschauungen war die Legitimation einer postfeudalen Ordnung im 19. Jahrhundert nicht denkbar. Sie wirkten lange als gefühlte Grundlage liberaler Verfassungen — nicht zuletzt bis in den Artikel 1 des Grundgesetzes hinein als Bedürfnis, es auch jenseits des positiven Rechts zu fundieren. Die beiden grundlegenden Dokumente der Menschenrechtsgeschichte benötigten einen expliziten Bezug auf die Menschenwürde nicht, um die absolute Gültigkeit der Menschenrechte zu begründen. Der Würdebegriff war noch zu sehr mit dem feudalen Ständestaat im Sinne der Autoritätswürde und mit den moralischen Dogmen der christlichen Welt als Charakterwürde verbunden. Er bot sich nicht an, um emanzipatorische Ziele zu begründen. Dies hatte eine weitreichende Konsequenz: Bis 1945 handelte es sich bei der Menschenwürde und den Menschenrechten um Ideen, die meist unabhängig voneinander verwendet wurden.
2
Freiheit durch Würde: Der bürgerliche Entwurf
1865 unterschied »Pierer’s Universal-Lexikon« drei Auffassungen der Würde: die Würde als einen »aus sittlicher Größe hervorgehenden inneren Wert«, der mit »moralischen Eigenschaften«, der »Achtung Anderer als Recht« und einem »edlen, Achtung gebietenden Benehmen« durch Körperhaltung, Rede und Erscheinung einherging, die »Würde des Menschen« als »innere persönliche Würde, welche dem Menschen nach seiner sittlichen Haltung zukommt«, und die Würde als einer »äußerlichen Höherstellung in der Gesellschaft«.16 1909 erläuterte »Meyers Großes Konversations-Lexikon« Würde als eine »ästhetisch anziehende, in Haltung, Benehmen und Sprache sich kundgebende äußere Erscheinung gefestigter Willensgefühle« und als einen »ästhetischen Ausdruck des geschlossenen, ruhigen, seiner selbst bewußten und oft dem Erhabenen sich annähernden Charakters«.17
Die beiden Einträge zeigen, wie eng die innere und äußere Würde, in ihren kontingenten, konditionalen und — in Ansätzen — universalen Ausprägungen im bürgerlichen Deutschland nach 1800 zusammengedacht wurden. Würdig im Sinne der Charakterwürde zu leben hatte sich als ein universal formuliertes, wenn auch nur partikular realisierbares Bildungsideal durchgesetzt. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb die Würde mit dem Potenzial und der Fähigkeit verknüpft, sie zu realisieren, aber auch mit der Gefahr, sie zu verlieren. Allerdings sah das bürgerliche Zeitalter auch den Aufstieg der Menschenwürde zu einer emanzipatorischen Kampfformel.
Politische Würde und bürgerliche Freiheit
Mit der universalen Erhöhung des Menschen als einem zur inneren Würde befähigten Wesen ging ein bestimmtes Interesse des aufstrebenden Bürgertums einher: Die Festung der aristokratischen Standeswürde sollte geschleift werden. Sich auf die Würde zu berufen war nicht vom bürgerlichen Freiheitsanspruch zu trennen, der sich gegen die Vorherrschaft des Adels richtete. So rückte Adolph Freiherr von Knigge in seinen 1788 veröffentlichten Regeln für den »Umgang mit Menschen« die Würde ins Zentrum der von ihm aufgestellten Verhaltensregeln. Er riet seinen vornehmlichen Adressaten, bereits ökonomisch erfolgreichen Bürgern, auch eine »innere Würde« aus dem Bewusstsein ihrer grundsätzlichen »Menschenwürde« heraus zu entwickeln und diese nach außen bescheiden, aber selbstbewusst zu zeigen. Die Regeln des adeligen Umgangs müsse man zwar kennen, aber nur wenn die »Obern« durch das eigene Auftreten im Zeichen der Würde den »Werth als Mensch« fühlten, begegneten sie ihm nicht mehr mit »Verachtung«.18
Unter den Bedingungen der absolutistischen Herrschaft eröffnete der vielstimmige Appell, die »innere Würde« als persönliche »Erhabenheit« auszubilden, einen vorkonstitutionellen Weg, um sich Freiheitsräume zu verschaffen. Wenn Friedrich von Schiller in der Würde als Herrschaft über die eigenen Affekte den »Ausdruck einer erhabenen Gesinnung« sah, hing ihre Verwirklichung nicht nur von einem Mindestmaß an Freiheit ab, sondern war zugleich eine ihrer Bedingungen.19 Indem die an sich unsichtbare innere Würde als »Kraft, die von den Leiden unabhängig ist«, dazu beitrug, Gefühle, Leidenschaften und andere Formen des sinnlichen Empfindens zu kontrollieren, wurde sie als wirksame Selbstbeherrschung äußerlich sichtbar.20
Wirkliche Freiheit erlangte demnach nur, wer sein Verhalten gegenüber anderen Menschen zu kultivieren vermochte und dadurch die innere mit der äußeren Würde in Einklang brachte. Dennoch war die romantische Menschenwürde um 1800 kein genuin politischer Begriff. Der bürgerliche Humanismus des frühen 19. Jahrhunderts verstand sie nicht als Fundament der liberalen Bürgerrechte. Sie war konditional und partikular: Um sie zu realisieren, bedurfte es persönlicher Bildung, eines bestimmten gesellschaftlichen Verhaltens und letztlich auch eines hinreichenden sozialen Status. Nur gelegentlich blitzte ein weitergehendes emanzipatorisches Potenzial des Würdebegriffs auf. »Wir glauben«, zitierte die »Neue Rheinische Zeitung« am 3. Mai 1849 aus der ersten Ausgabe des »Thüringer Volkstribuns«, »daß die reine Demokratie nur in einer solchen Staatsform sich verwirklichen lasse, in der die Würde des Menschen in Allem auf’s Höchste geachtet wird, in der demokratischen Republik.«21 Erst wenige Wochen vor dem Zeitungsartikel war in Frankfurt die liberal geprägte Paulskirchenverfassung verabschiedet worden. Ihr Makel: Die wichtigsten deutschen Staaten boykottierten sie. Ihr spätes Erbe trat schließlich das Grundgesetz an, auch wenn 1849 von Würde vor allem im Sinne der Autoritätswürde die Rede war — als der »im Mannesstamme« erblichen »Würde des Reichsoberhauptes«, also des Kaisers.22
Dennoch war die Verfassung wegweisend für die spätere Verrechtlichung der Würde. Nicht ohne Grund ähnelt § 138 des Entwurfs dem ersten Artikel des Grundgesetzes, da sich der Parlamentarische Rat an ihm orientierte: »Die Freiheit der Person ist unverletzlich.« Die Wendung illustriert aber, wie sich von Kant bis zur Weimarer Verfassung von 1919 nicht Würde, sondern Freiheit als roter Faden durch die bürgerliche Epoche zog. Oft übersehen, aber nicht minder wichtig war § 139, mit dem die Abschaffung der Todesstrafe begründet wurde: »Ein freies Volk hat selbst bei einem Verbrecher die Menschenwürde zu achten.« In beiden Paragraphen kam jedenfalls eine liberale Vision von Freiheit und Menschenwürde erstmals dezidiert zu sich selbst.
Die konstitutionellen Monarchien, die in Reaktion auf die Französische Revolution und die ihr nachfolgenden liberalen Emanzipationsforderungen entstanden, vermieden es, von Grundrechten zu sprechen oder sie substantiell zuzugestehen. Sie verzichteten für die wenigen Rechte, die den Bürgern gewährt wurden, auf Begründungen, die als universal verstanden werden konnten — wie auf die Idee der inhärenten Würde des Menschen. Die Herrschaftsträger wollten ihr Vorrecht nicht aufgeben, Freiheiten jederzeit wieder einschränken zu können: Standesrecht sticht Menschenrecht — das war die machtvolle Antwort der konservativen Autorität des Adels auf das bürgerliche Würdepathos des frühen 19. Jahrhunderts. Deshalb sucht man in den Verfassungen des Norddeutschen Bundes von 1867 und des Deutschen Reiches von 1871 vergebens nach Grundrechten oder nach der Würde des Menschen.
Aber selbst im Zusammenhang mit den liberalen Verfassungen des Vormärz galt Würde eher als Synonym für Ehre. Freiheit kam das größere politische Gewicht zu: Sie könne, so der Literaturwissenschaftler Friedrich Theodor Vischer, nur »Freiheit im Volke« bedeuten, nicht lediglich eine »philanthropische Anerkennung der allgemeinen Menschenwürde«.23 Hier das harte Recht, dort das softe Gefühl: Das sollte sich im Würdediskurs immer wieder finden. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich dann beobachten, wie der Begriff in der Öffentlichkeit weiter entpolitisiert und auf die Autoritätswürde begrenzt wurde.
Gleichwohl hatten Begriff und Idee der Würde des Menschen — bis hin zur weitläufigen Redeweise von der »Menschenwürde« — seit dem frühen 19. Jahrhundert auch neben den liberalen Forderungen nach Bürgerrechten an Kontur gewonnen. Die Menschenwürde entwickelte sich immer mehr zu einem Signum politischer Protestbewegungen und zum oppositionellen Kampfbegriff: Ging es um das Ende der Sklaverei, die rechtliche Gleichstellung von Juden, die Emanzipation der Frau oder den Schutz vor staatlicher Gewalt, war der Appell an die Menschenwürde nicht mehr weit.
Menschenwürde und Emanzipation
Plädoyers für eine rechtliche Gleichstellung der Juden stützten sich häufig auf die Würde, meist als innerer Wert und als Verhaltensideal, seltener als universales Prinzip. Vor allem wurde der liberale Freiheitskampf zum Vorbild und das neu gewonnene bürgerliche Bewusstsein für die Menschenwürde zum Maßstab erklärt. Der evangelische Pfarrer Georg Friedrich Schlatter, ein renommiertes Mitglied des badischen Revolutionsparlaments von 1848, wollte den Juden das Staatsbürgerrecht nicht länger verwehren, weil der zum »Bewußtsein seiner Menschenwürde erwachte Bürger« doch gelernt habe, es als das »wertvollste unter allen Gütern des Staates« zu würdigen.24 Sein katholischer Amtskollege Max Stephan Stigelmayr befand 1847, die »Menschenfreundlichkeit« fordere für alle Menschen ungeachtet ihrer Religion die »Rechte der Menschenwürde«. Er begründete dies mit der eigenen Selbstachtung, »denn jeder Mensch, der seine Würde fühlt, empfindet die Verletzung dieser Würde an anderen gerade so, als wäre die seinige verletzt worden«.25 In ähnlicher Weise sprach der Hamburger Gabriel Riesser als jüdischer Aktivist zugunsten der Emanzipation vom »Pulsschlag (…) für Freiheit und Menschenwürde«. Die nichtjüdischen Bürger könnten es nicht zulassen, wenn Juden ihre Rechte verwehrt würden, obwohl man sie inzwischen als »gleich erkennt in allen menschlichen freien Verhältnissen«.26 Aber eine solch weitgehende Begründung teilten selbst nichtjüdische Befürworter einer Gleichstellung der Juden oftmals nicht.
Appelle an die Menschenwürde gingen Mitte des 19. Jahrhunderts häufig mit dem Hinweis einher, sie fühlen zu müssen, wolle man sich als sittlicher Mensch verstehen. Darin spiegelte sich neben eigenen Verfolgungserfahrungen eine wachsende Sensibilität für die Folgen von Unterdrückung und Freiheitsentzug wider. Auch in der frühen Frauenbewegung richtete sich die Forderung nach Menschenwürde gegen staatliche Repression und bürgerliche Fremdbestimmung. Kraftvoll trat in den 1840er Jahren mit Louise Aston eine Vorkämpferin für Frauenrechte und Demokratie in diesen Diskurs ein. Sie formte einen neuen Begriff: die »Frauenwürde«. Vom Staat wegen ihres Beziehungslebens und Auftretens verfolgt, verfasste sie 1846 ihre politische Autobiographie »Meine Emancipation, Verweisung und Rechtfertigung«. Sie könne, so Aston, ein »Institut« wie die Ehe »nicht billigen, das mit der Anmaßung auftritt, das freie Recht der Persönlichkeit zu heiligen (…), während nirgends grade das Recht mehr mit Füßen getreten und im Innersten verletzt wird«. In ihrer Kritik an den Machthierarchien der bürgerlichen Ehe bezog sie sich auf Kants Norm, dass der Mensch nicht nur als Zweck behandelt werden dürfe. Die Ehe mache »zum Eigenthume (…), was nimmer Eigenthum sein kann: die freie Persönlichkeit«.27
Aston orientierte sich an George Sand, die zur selben Zeit als gesellschaftskritische Schriftstellerin in Paris für Furore sorgte. Wie Sand »der heiligen, oft entweihten Liebe einen Tempel zu bauen«, sei »die einzige Frauen-Emancipation, an der auch meine Sehnsucht hängt, das Recht und die Würde der Frauen in freieren Verhältnissen, in einem edleren Cultus der Liebe wieder herzustellen«. Auch Fanny Lewald wandte sich gegen die Zwänge der bürgerlichen Ehe und andere Zumutungen eines fremdbestimmten Lebens als Frau, die »aus tausend Frauenherzen den Aufschrei nach Emancipation hervorgebracht« hätten. Es lebte, wie sie für die »Leidensjahre« ihrer »Lebensgeschichte« festhielt, in ihr als Widerstandsmoment das »Gefühl von der wahren Menschenwürde, die man erniedrigt, wenn man den Menschen zwingen will, gegen sein eigenstes Wesen zu handeln«.28 Nur wenige Jahre nach Aston konnten bürgerliche Frauen dann bei Julie Pfannenschmidt pointiert lesen: »Frauenwürde ist Menschenwürde in ihrer reinsten Bedeutung.«29
Louise Otto, Mitgründerin und jahrzehntelang Vorsitzende des bürgerlichen Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, leitete aus dem Verhaltensideal der inneren Würde den Anspruch sittlicher Selbsterziehung ab. Diesem Ideal verlieh sie eine politische Bedeutung, indem sie die Menschenwürde gegen die herrschende Geschlechterordnung als »Recht der freien Selbstbestimmung« definierte, das auch Frauen zuzugestehen sei. Wer in diesem Sinne »selbständig handelnd im Leben« stehe, werde durch ihre Männer und Väter vom politischen Leben ferngehalten.30 Dem müssten sich die Frauen jedoch »mit dem ganzen Bewußtsein ihrer sittlichen Würde (…) so lange widersetzen, bis denn endlich doch der Sieg der Humanität zu einem allgemeinen wird«.31
Früher Humanitarismus
Das neue Interesse an der Würde des Menschen um 1800 stand im Zusammenhang mit dem Aufkommen des frühen Humanitarismus, dem Einsatz für hilfsbedürftige Menschen. Zum ersten Mal wurden in dieser Phase vielfältige Widerstände transnational und wirkmächtig gegen Gewaltverhältnisse mobilisiert, die aus heutiger Sicht als entwürdigend betrachtet werden: Folter und Sklaverei, Gefängniswesen und Armenfürsorge, Züchtigung und Unterdrückung, Demütigung und Ungleichheit — Forderungen, die schließlich in die großen Bewegungen des späten 19. Jahrhunderts für Wahlrecht, Gleichstellung und Frauenrechte hineinreichten. Vielfach aus christlichen Motiven gespeist, breitete sich eine neue »humanitäre Sensibilität« (John Haskell) heraus, die das Leiden anderer empathisch wahrnahm und es gemildert oder verhindert wissen wollte. Philosophen wie David Hume oder Adam Smith, aber auch Gotthold Ephraim Lessing erklärten die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, zu einer wesentlichen emotionalen Qualität des Menschseins. Zugleich eröffnete die Literatur der Zeit ihren Lesern neue Gefühlswelten und eine Kultur der Empfindsamkeit, die zur großen Resonanz der Menschenrechte um 1800 beigetragen hat.
Überschätzen sollte man die neue humanitäre Sensibilität des 19. Jahrhunderts aber nicht. Zeitlich ging sie mit dem Aufstieg von Anthropologie und Rassismus einher. Insbesondere Sklaven und Einwohner kolonisierter Gebiete waren nicht nur rechtlos, sondern wurden auf der untersten Stufe des Menschseins eingeordnet, deren höchste Form die europäischen »Weißen« für sich reklamierten. Die meisten Denker der Aufklärung forderten zwar Freiheit und Gleichheit, aber eben nicht für alle. Sie gehörten zu den Ersten, die zwischen verschiedenen »Rassen« unterschieden, indem sie Menschen nach äußeren Merkmalen bewerteten, ihnen bestimmte Charaktereigenschaften zuschrieben und in einer Rangordnung klassifizierten. Auch ein moralischer Universalist wie Kant war wie die meisten seiner Zeitgenossen anthropologisch zutiefst von einer konstitutiven Ungleichheit menschlicher »Rassen« überzeugt.
Gleichzeitig spielte der Rekurs auf Würde im Kontext von Humanität und Menschlichkeit eine gewisse, wenn auch semantisch nicht hervorstechende Rolle bei der Abschaffung der Sklaverei. Im Mai 1787 hatten zwölf religiöse Aktivisten in London die »Gesellschaft zur Abschaffung der Sklaverei« gegründet, vorbereitet durch verschiedene Pamphlete und Petitionen, die eine moralische Öffentlichkeit schufen. Vor allem die beteiligten Quäker argumentierten mit der christlichen Nächstenliebe und einer grundsätzlichen, von Gott verliehenen Gleichheit der Menschen, die für alle zu gelten habe. Statt durch das Konzept der universalen Würde waren die meisten Abolitionisten durch »feelings of humanity« sowie den Widerspruch zwischen der Sklaverei und einem »common sense of mankind« motiviert.32 Die Bewegung durchzog aus heutiger Sicht ein Widerspruch: Griffen Abolitionisten überhaupt auf die religiös begründete Idee einer inneren, universalen Würde zurück, wurde den Sklaven abgesprochen, dieses Potenzial verwirklicht zu haben. Daraus leitete 1791 einer ihrer prominentesten Vertreter, der britische Parlamentarier William Wilberforce, einen Erziehungsauftrag ab: »To give them power of appealing to the laws, would be to awaken in them a sense of the dignity of their nature.«33




























