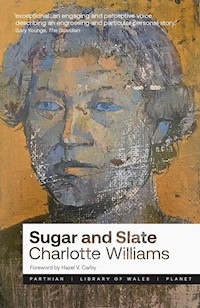9,99 €
9,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jessica Mayhew
- Sprache: Deutsch
Jessica Mayhew ist glücklich verheiratet und eine erfolgreiche Psychotherapeutin. Als jedoch der attraktive Schauspieler Gwydion Morgan ihre Praxis betritt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Jessica fühlt sich zu Gwydion hingezogen, aber dieser leidet unter einer seltsamen Phobie, und Jessica befürchtet, er könnte Selbstmord begehen. Um die Ursachen seiner Erkrankung zu ergründen, besucht sie das Haus seiner Familie an der walisischen Küste und stößt dort auf ein düsteres Geheimnis, das sie schon bald selbst in große Gefahr bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2015
3,8 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.