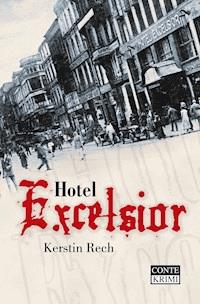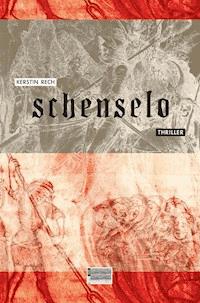Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Schatten des Permes heißt die überarbeitete Neuauflage des Kult-Krimis Der Permes und seines Nachfolgers Der Werwolf vom Webenheimer Bösch. Die Geschichten spielen in einem Dorf im Saarland, umgeben von dichten Wäldern. Über Jahrzehnte hinweg verschwinden immer wieder Menschen auf rätselhafte Weise. Hat sie der Permes, der Herrscher des Waldes geholt? Als die erfolgreiche Architektin Jessica Lück nach Jahren in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehrt, muss sie sich, zusammen mit ihrem Jugendfreund und Pfarrer Alfred, Erinnerungen stellen, die geradewegs zu einem wahnsinnigen Mörder führen. Hat er im Auftrag des Permes getötet? Bei all dem Grauen, welches zutage tritt, bleibt Jessica noch Zeit für privates Glück, das sie in ihrer Jugendliebe Margot wiederfindet. Ein Jahr später wird das Dorf erneut vom Bösen heimgesucht. Ein Werwolf hätte Margot beinahe getötet. Und wieder raunt man im Dorf, dass auch hier der Permes seine Hand im Spiel hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
…noch viel höher scheinen dann die Berge, enger und düsterer die Täler, gigantisch die Felsen. Und stolpert man über einen herab gefallenen Zweig, über einen Stein, oder hört man die Quellen und die vielen Wässerlein murmeln, klingt einem der ungewohnte Schrei eines Waldvogels in die Ohren, so haben unheimliche Wesen ihre Hand im Spiel….Und in unserem Walde sind es der „Permes“ und der „Butterhut“, auch die „Goldgluten“ sind gefürchtet und wenn es ganz schlimm im Walde zugeht, dann ist eben „Proforschtjagd“. Ihr Jungen wollt es nicht glauben, doch fragt die Alten, denen ist der „Permes“ sicher schon begegnet.
Wilhelm Schetting (1908-1945) (aus 750 Jahre Bierbach, Hrsg. Heinrich Ehrmantraut)
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Kapitel I
Bierbach, 03.August 2003
Kapitel II
Bierbach, Grohbachtal, 18. Juli 1903.
Kapitel III
Bierbach, 05. August 2003
Kapitel IV
Bierbach, 15. Mai 1972
Kapitel V
Bierbach, 05. August 2003
Kapitel VI
Bierbach, 06.August 2003
Kapitel VII
Karlsruhe, 6.August 2003
Kapitel VIII
Auf der A6, 12. August 2003
Kapitel IX
Bierbach, 13. August 2003
Kapitel X
Bierbach, 13. August 2003
Kapitel XI
Bierbach, 13./14. August 2003
Kapitel XII
Bierbach, 14. August 2003
Kapitel XIII
Bamberg, 30. April 1909
Kapitel XIV
Bierbach, 14. August 2003
Kapitel XV
Saarbrücken, 14. August 2003
Kapitel XVI
Bierbach, 14. August 2003
Kapitel XVII
Bierbach, 14./15. August 2003
Kapitel XVIII
Bierbach, 15. August 2003
Kapitel XIX
Pforzheim, 15. August 2003
Kapitel XX
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXI
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXII
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXIII
Saarbrücken, 16. August 2003
Kapitel XXIV
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXV
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXVI
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXVII
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXVIII
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXIX
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXX
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXXI
Bierbach, 16. August 2003
Kapitel XXXII
Bierbach, 17. August 2003
Kapitel XXXIII
Bierbach, 17. August 2003
Kapitel XXXIV
Bierbach, 17. August 2003
Teil 2
Kapitel I
Bierbach, 15. Juli 2004
Kapitel II
Bierbach, 22. Juli 2004
Kapitel III
Bierbach, 30. Juli 2004
Kapitel IV
Bierbach, 30.07.2004
Kapitel V
Bierbach, 31. Juli 2004
Kapitel VI
Bierbach, 31. Juli 2004
Kapitel VII
Abtei Mariawald, 31. Juli 2004
Kapitel VIII
Breslau, 31. Juli 2004
Kapitel IX
Saarbrücken, 01. August 2004
Kapitel X
Pirmannswald, 12. Oktober 1953
Kapitel XI
Am Webenheimer Bösch, 22. Juli 1954
Kapitel XII
Am Webenheimer Bösch, 05. Februar 1970
Kapitel XIII
Bierbach, 01. August 2004
Kapitel XIV
Homburg, 01. August 2004
Kapitel XV
Bierbach, 01. August 2004
Kapitel XVI
Bierbach, 17. August 2003
Kapitel XVII
Am Webenheimer Bösch, 11. Juli 2004
Kapitel XVIII
Bierbach, 01. August 2004
Kapitel XIX
Bierbach, 02. August 2004
Kapitel XX
Bierbach, 02. August 2004
Kapitel XXI
Bierbach, 02. August 2004
Kapitel XXII
Saarbrücken, 02. August 2004
Kapitel XXIII
Bierbach, 02. August 2004
Kapitel XXIV
Bierbach, 02. August 2004
Kapitel XXV
Homburg, 02. August 2004
Kapitel XXVI
Bierbach, 02.August 2004
Kapitel XXVII
Bierbach, 02.August 2004
Kapitel XXVIII
Bierbach, 03. August 2004
Kapitel XXIX
Bierbach, 03. August 2004
Kapitel XXX
Bierbach, 03. August 2004
Kapitel XXXI
Bierbach, 03. August 2004
Kapitel XXXII
Saarbrücken, 03. August 2004
Kapitel XXXIII
Saarbrücken, 03. August 2004
Kapitel XXXIV
Wörschweiler, 04. August 2004
Kapitel XXXV
Bierbach, 04. August 2004
Kapitel XXXVI
Bierbach, 04. August 2004
Kapitel XXXVII
Bierbach, 05. August 2004
Kapitel XXXVIII
Bierbach, 06. August 2004
Glossar
Teil 1
-I-
Bierbach, 03.August 2003
Bald würde die Sonne untergehen. Im Osten hatte der Himmel schon die Farbe von reifen Orangen angenommen. Wenn sie nicht im Dunkeln durch den Wald nach Hause gehen wollte, dann musste sie jetzt langsam aufbrechen.
Margot Klaus legte die Heckenschere ins Gras und begutachtete ihr Werk.
Sie hatte vor ein paar Tagen die roten Johannesbeeren gepflückt und heute die Sträucher geschnitten, die ihr Grundstück zum Primannswald hin begrenzten.
Sie beschnitt die Beerensträucher immer gleich nach der Ernte, damit das Sonnenlicht den ganzen Strauch erreichen konnte. Und sie hatte die alten Triebe abgeschnitten, denn bald würden sie durch neue ersetzt werden.
Sie sammelte das Schnittholz der Beerensträucher ein und legte es auf den Haufen mit den fleckigen Blättern der Tomaten und Kartoffeln sowie den Stützstangen der Bohnen und das von Milben befallene gelbe Bohnenlaub, um es tags darauf zu verbrennen.
Margot ging ein paar Schritte auf ihren Lieblingsbaum zu. Er war ein alter Apfelbaum, der nur noch kinderfaustgroße Äpfel tragen konnte, aber sie liebte ihn. Als sie bei ihm war, schloss sie die Augen und strich sanft über seine Rinde, bis sie die Einkerbungen unter ihren Fingerspitzen fühlte. J und M. Sie lächelte.
Dann riss sie plötzlich die Augen auf. Wie so oft, wenn sie sich alleine in der Nähe des Waldes aufhielt, hatte sie das Gefühl, jemand stünde ganz nahe bei ihr. Manchmal konnte sie fast seinen Atem spüren, den Atem des Permes. Aus dem Wald hörte sie ein Knacken, als sei jemand auf einen dürren Ast getreten.
Sie bückte sich schnell und nahm die Heckenschere wieder in die Hand. Dann drehte sie sich um spähte mit zusammengekniffenen Augen in die Dunkelheit des Pirmannswaldes.
Nichts war zu sehen. Sie legte die Heckenschere wieder ins Gras und schob mit dem Fuß das letzte Laub auf den präparierten Haufen.
Sie schwor sich, beim nächsten Mal, ihr Handy mitzunehmen, wenn sie wieder allein hier draußen sein würde
„Wird das ein Scheiterhaufen für die Bas Stollebett?“, fragte Wolfgang Lenhard, ihr Nachbar und Freund, und lachte.
Woher war er so schnell aufgetaucht?
„Na klar, Wolfgang, für wen sonst?“ Sie stimmte in sein Lachen ein. „Und damit der Permes mich nicht holt, bin ich froh, mit dir durch den Wald nach Hause gehen zu können. Hast du einen Spaziergang gemacht?“
„Ja. Im Sommer ist es am angenehmsten im Wald.“
„Ach, dann warst du das vorhin. Ich habe etwas rascheln gehört.“ Sie deutete zu dem grünen Dickicht, das für Blicke undurchdringlich schien.
Wolfgang runzelte die Stirn. „Nein, Margot. Ich bin gerade erst gekommen.“ Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Ich musste in Ruhe über einiges nachdenken.“
„Darf man erfahren, worüber?“
Er antwortete nicht gleich, sondern betrachtete nachdenklich den Scheiterhaufen, der zwischen ihnen stand. Dann sah er auf und antwortete mit gequältem Lächeln: „Über die Vergangenheit, Margot. Über das was geschehen ist.“
-II-
Bierbach, Grohbachtal, 18. Juli 1903.
„Tot! Tot! Sie schlagen mich tot!“, kreischte die Bas Stollebett.
Die Gänsehirtin von Bierbach war sie, die Bas Stollebett. Und ein armes Weib war sie obendrein, das von dem geringen Lohn ihres Gewerbes kaum leben konnte. So kam es, dass sie ihren kargen Lebensunterhalt mit dem Erbetteln von Speck und Brot und Kartoffeln aufbesserte.
Und mit noch etwas anderem kam sie den Bierbachern an. Einer Gabe nämlich, die einmalig war und um die sie dennoch niemand im Dorf zu beneiden wagte. Und eben diese Gabe stand wohl im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sie jetzt auf der Flucht war. Auf der Flucht vor drei mit Äxten bewaffneten Bierbacher Burschen.
Wenn die Bas immer sonntags, nachdem die Leute aus dem Dorf aus der Kirche kamen, ihre paar Pfennige fürs Gänsehüten abholte und noch ein bisschen etwas dazu erbettelte, gaben ihr die Bierbacher gerne etwas ab. Aus Mitleid zum einen und zum anderen, weil sie die Gänse des Dorfes so gut hütete.
Und einen dritten Grund gab es.
Wenn man es genau betrachtete, gaben sie hauptsächlich und ohne sich dessen bewusst zu sein, aus Furcht. Furcht nicht allein vor der Bas, der alten, Tabak schnupfenden Gänsehirtin, sondern vor der geheimnisvollen Macht, mit der sie im Bunde zu stehen schien. Denn die Bas konnte Brauchen, und von irgendwoher musste sie die Kraft für diese Gabe bekommen haben.
Dass der allmächtige Herrgott die alte Bas so außergewöhnlich ausgestattet hatte, hielten die Dorfbewohner für unwahrscheinlich. Was sollte der Herrgott schon mit einer verlumpten Gänsehirtin im Sinn haben, wenn es in Bierbach so viele rechtschaffene Leute gab? Aber wenn nicht Gott, wer blieb dann noch übrig?
Wer da draußen, so fragten sich die Bierbacher, vor allem in der dunklen Jahreszeit, wenn die Nacht länger währte als der Tag und der kalte Mond durch die Fenster in die kleinen, niedrigen Kammern schaute.
Wer beobachtete sie, versteckt im Dunkeln der Nacht? Wer jagte und schnappte zu wie ein Wolf, wenn ein unbedarfter Mensch alle Vorsicht außer Acht ließ und des Nachts alleine in den Wald ging?
Wer war es, der das beschauliche Dorf zwischen Schucht, Steinberg, dem Bliesgau und dem Hechlertal ebenfalls seine Heimat nannte und der im Wald nahe dem Grohbach seinen Unterschlupf hatte?
Genau dort, vermutete man nicht zu Unrecht, war das Unheimliche zu Hause, in der Nähe jener Stelle, wo die Bas Stollebett ihre Hütte hatte.
Doch war jemand krank im Dorf, dann wurde die Bas Stollebett ans Krankenlager gerufen. Es gab kein Haus in Bierbach, in das man sie nicht schon bestellt hatte. Im Linnebrunne, auf dem Hüwelche, im Käsehof oder im Eck bis hinauf in die Muhl. In den Häusern der Tagelöhner, der Kleinbauern, der Korbmacher, der Maurer, Schuster und Pflasterer hatte sie so oft gestanden und die Wärme gespürt, die von den unter den Stuben liegen Ställen hochstieg. Dann verabreichte sie ein nach eigener Rezeptur aus Kräutern
und Pilzen hergestelltes Gebräu und murmelte für die Umstehenden unverständliche Beschwörungsformeln.
Wenn man wollte, konnte man ab und zu beschwichtigende Worte wie Jesus Christus oder unser Herrgott im Himmel heraushören. Und es schien beruhigend, dass die Bas Stollebett den Namen des Herren aussprechen konnte, ohne dass der Zorn des Himmels sie traf.
Man sprach nicht gerne darüber, dass man ihre Dienste in Anspruch nahm und war froh, wenn sie nach dem Brauchen wieder das Haus verlies. Man schämte sich auch gebührlich, so wie man sich schämt, wenn man einem verbotenen Laster frönt. Doch der Aberglaube im Dorf war eben doch stark, zu manchen Zeiten fast so stark wie der Glaube. Doch eben nur fast. Und das bewahrte Bierbach vor dem Schicksal, das der Permes sich für das Dorf ausgedacht hatte, wenn sie, die Bierbacher, ihn in ihre Häuser, in ihre Herzen, einlassen würden.
Die Bas Stollebett hauste die meiste Zeit im Grohbachtal, mitten im Pirmannswald in einer schiefen, modrigen Holzhütte, die mit verbeulten Blechen notdürftig abgedeckt war. Dort saß sie die meiste Zeit auf einem Bündel Binsen, starrte auf die offene, aus drei Steinen und einem viereckigen Blech bestehende Feuerstelle und stopfte ausgefallene Gänsefedern in ein Säckchen. Da ihre Hütte nur eine kleine Öffnung hatte, durch die man hinein und hinaus kriechen konnte, war das Innere ständig voller Rauch. Vermischt mit der Feuchtigkeit, die an vielen Tagen im Grohbachtal hing, machte er das Atmen schwer, benebelte den Geist und berauschte die Sinne.
„Tot! Tot! Sie schlagen mich tot!“ Die Bas Stollebett kreischte weiter, während sie den Waldweg entlang rannte. Ihre Stimme, die vor Angst in eine schrille, unnatürliche Höhe zog, verfing sich in den Spitzen der Tannen und Fichten, schwebte wie ein fadenscheiniges aber festes Spinnennetz in die Kronen der Eichen und Buchen und hatte schon nichts Menschliches mehr.
Ein Eichelhäher, der vom Webenheimer Bösch herübergeflogen kam, stieß einen warnenden Ruf aus, der von den Baumkronen widerhallte.
Die Bas Stollebett hatte ihre Röcke gehoben und rannte mit nackten Füßen von ihrer Hütte zur Kanzel.
Zu ihrer Rechten floss der Grohbach als dünnes Rinnsal dahin. So brav und leise, als wolle er den Lauf der Welt nicht stören. In seinem seichten Wasser konnte man gerade die Füße benetzen.
Unklar schien es, wie es dieser Bach ohne Hilfe geschafft haben soll, vor vielen Tausenden von Jahren den Schucht vom Steinberg zu trennen, und das bewaldete Tal, das seinen Namen trug, zu formen.
Die Bas Stollebett rannte. Angst und Verzweiflung trieben sie vorwärts über den breiten Waldweg. Wie hatte es geschehen können, dass diese drei Bierbacher Burschen in ihre Hütte hatten kommen können, ohne von ihr bemerkt zu werden? Warum hatte sie nicht ihr Lachen und Rufen gehört, als die drei, durch das Grohbachtal marschierend, beständig näherkamen?
Warum hatten die Gänse in ihrem Pferch nicht Alarm geschlagen? Gänse sind die besten Wachhunde. Und die Bas konnte bislang auf sie vertrauen.
Sonst hatte die Bas immer „komme erinn, ihr Buwe!“ gerufen, wenn sie die Ankömmlinge hörte, die in den Wald kamen, um Holz zu schlagen. „Komme erinn, ihr Buwe“ und die Buben waren der Aufforderung gefolgt. Alle. Jedes Mal.
Sie kamen sogleich durch die kleine Öffnung hereingekrochen. Auf allen vieren. Saßen dann da auf ihren Fersen. Ängstlich und doch neugierig beäugten sie die Bas Stollebett durch den dichten Rauch ihres süßlich riechenden Feuers.
Und dann erzählte sie die Geschichten, die ihr so am Herzen lagen. Von den Goldgluten, von der Proforschtjagd, vom Butterhut und vom Permes. Immer wieder vom Permes. Wie er dem alten Vetter Dorkel des Nachts erschienen war, als dieser bei seinen Schafen schlief. Den alten Hanjakob fast zu Tode erschreckt hatte, als dieser im Schweitzertal seinen Gaul hütete. Und immer kam er in anderer Gestalt. Als Jäger im grünen Wams, als Ketten rasselndes Ungeheuer, das sich aus seinem Kerker befreit hatte, als Harlekin, der seine Späße trieb. Doch immer war es der Permes.
Aber dieses Mal hatte sie sie nicht kommen hören, die Burschen, die zum Holzschlagen in den Wald gekommen waren. Plötzlich waren sie da gewesen, hatten am Eingang gehockt und mit großen Augen und voller Abscheu dem Treiben in der Gänsehütte zugesehen.
Das hätte nie, nie geschehen dürfen.
Als hätte der Permes plötzlich Wasser ins Feuer gegossen, war der Rauch undurchdringlicher und fester geworden, und als er wieder seine natürliche Dichte annahm, war der ganze Spuk vorüber.
Regungslos und stumm hatte die Bas Stollebett zuerst dagesessen und zurückgestarrt. Hatte gehofft, dass ihre im Geiste gestammelten Beschwörungen die rechte Wirkung auf die drei jungen Männer hätten, und sich der Mantel des Vergessens über sie legen würde. Sie hoffte auf die Kraft des Permes.
Ihre Hoffnung erstarb jäh, als der Sohn des Korbmachers nach draußen gekrochen war, um seine Axt zu holen, die er, wie seine Kameraden, neben der Hütte abgelegt hatte. Er schien entschlossen, die Ordnung im Universum wieder herzustellen, damit der Himmel oben und die Erde unten bliebe. Und was immer in der Hölle verborgen war, sollte dort und nur dort weiterfristen.
Als die Bas Stollebett die Entschlossenheit des Korbmachersohnes erkannt hatte, bekam sie es mit der Angst zu tun. War aufgesprungen, an den verdutzten Gesichtern der beiden anderen, die nur noch aus Augen zu bestehen schienen, vorbeigestolpert und auf allen vieren davon gekrabbelt. Schreiend davon gekrabbelt. Draußen gab sie dem dritten, der unschlüssig seine Axt in der Hand wog, einen kräftigen Stoß vor die Brust und raffte ihre Röcke.
Wie Bluthunde mussten ihr nun die drei Bierbacher Burschen folgen. Sie hatten Angst. Gerade so wie die Bas Stollebett. Doch ihre Angst war grauenvoller anzusehen, denn ihre Angst galt dem Unfassbaren. Dem nicht zu Begreifenden. Instinktiv erfassten sie, dass es mit einem Axthieb nicht getan wäre. Das Böse konnte man nicht einfach töten.
Was wussten sie über den Permes? Was hatten ihre Altvorderen immer erzählt? Wie konnte man ihm beikommen? Sicher nicht, indem man sein williges Werkzeug, die alte Gänsehirtin, tötete.
Sie rannten und rannten. Rannten der Bas Stollebett hinterher und hofften doch gleichzeitig mit jedem Schritt, mit jedem Schlag ihrer Herzen, sie nie einzuholen. Sie rannten hinterher, weil keiner von ihnen vor seinen Kameraden als feiger Hund dastehen wollte.
Rannten in ihren klobigen Schuhen, von der Gänsehütte den Waldweg Richtung Dorf auf den Felsvorsprung, genannt Kanzel, zu. Doch ahnten sie, dass sie sich mit jedem Schritt, den sie Bierbach näherkamen, weiter von der Wahrhaftigkeit, der Sicherheit und der Realität entfernten.
Der Lück Johann, der Sohn des reichsten Bauern aus Bierbach, der Bubel Julius, Musiker wie sein Vater und der Lenhard Max, dessen Familie dem Gewerbe der Korbmacherei nachging und dessen ältester Bruder nach Amerika, nach Rochester, ausgewandert war.
„Tot! Tot! Mach se tot! Permes! Mach se tot!“, kreischte die Bas. Ihre Stimme wurde immer wilder. Beschwörender.
Von der Hütte her hörte man die Gänse laut schnattern.
Der Bubel Julius bekam eine Gänsehaut am ganzen Körper, obwohl es ein schwül-heißer Tag war. Der Schweiß, der seinen Körper bedeckt hatte, stockte. Wurde schmierig und kalt wie bei einem frischen Leichnam. Sein Mund war ausgetrocknet, als hätte er ihn mit Sand ausgerieben.
Plötzlich musste er an die Kerb im letzten September denken. An den Kerbemontag, als er, der beste Trompeter im ganzen Westrich, mit den anderen Musikanten zum Tanz aufgespielt hatte.
Julius Schritte verlangsamten sich. Schon hing er hinter seinen Kameraden zurück, die stur die Bas Stollebett im Blick hatten. Zu gerne hätte er, der Musikant, seinen Tagträumen nachgehangen und von den jungen Bierbacher Mäde geträumt, statt einer alten Hexe nachzurennen und vielleicht Schlimmes, unvorstellbar Schlimmes heraufzubeschwören.
Vielleicht, so befiel ihn unvermittelt eine Ahnung, sollte die schöne, fröhliche Kerb im vergangenen Jahr seine letzte gewesen sein. Vielleicht würde er nie mehr den bunten Kerbestrauß sehen. Würde nie mehr aufspielen können, wenn der Hammel ausgetanzt werden würde.
Es war ihm nicht wohl. Er hatte Angst vor der Rache des Permes, sollte der Bas Stollebett etwas zustoßen. Und was wollten sie überhaupt mit der Alten anfangen, wenn sie sie eingeholt hatten? Weder er noch seine beiden Kameraden würden in der Lage sein, der Alten mit der Axt das Hirn zu spalten. Hatte sie nicht auch den Permes angerufen und seinen und den Tod seiner Freunde gefordert?
Aber auf der anderen Seite konnte er den Lück Johann und den Lenhard Max nicht einfach aufhalten. Konnte nicht seine Hände auf ihre Schultern legen und sagen: „Losse ma se lawe, die alt Stollebett.“
Hätte er gewagt, sie aufzuhalten, hätten sie zu dritt über das alte, kreischende Weib lachen können, wie es seine Röcke bis zu den knotigen Knien gerafft hatte und auf seinen schwieligen, verhornten Füßen den Waldweg entlang rannte.
Er konnte ja nicht ahnen, der brave Bubel Julius, dass seine Kameraden dasselbe empfanden, wie er. Dass sie, auch wenn sie es niemals zugegeben hätten, dankbar gewesen wären, wenn er sie aufgehalten hätte. Sie hätten ihn noch oft damit aufgezogen: „De Julius hat Mores vor de alt Bas Stollebett gehatt. Bestimmt hatter gemennt, dass se ne verhext.“ Und er, der Julius, hätte ihnen in Memmersch Wirtschaft ein Bier spendiert, damit sie endlich die Klappe halten würden.
Nein, sie konnten nicht mehr Halt machen. Denn nie hätten sie vergessen können, was sie in der verrauchten Hütte hatten mit ansehen müssen.
Julius holte seine beiden Freunde ein und schaute zum Himmel.
Zu dem warnenden Eichelhäher hatten sich Schwärme anderer Waldvögel gesellt. In noch nie da gewesener Harmonie hatten sich die vielen verschiedenen Arten zusammengetan und hingen wie eine dunkle Wolke über der unheimlichen Gruppe, angeführt von der kreischenden, alten Bas Stollebett, dicht gefolgt von den Äxten schwingenden Burschen.
Die Bas Stollebett erreichte die Kanzel und kletterte so schnell sie konnte hinauf.
Am Fuße der Kanzel blieben die drei Burschen einen Moment stehen, als erhofften sie sich göttlichen Beistand. Denn so oder so empfanden sie es als frevelhaft, dass die Gänsehirtin ausgerechnet auf der Kanzel Zuflucht suchte. Die Kanzel, so wurde jener aus Buntsandstein bestehende Felsvorsprung im Grohbachtal genannt, von dem aus der heilige Pirminius im achten Jahrhundert gepredigt hatte, um der Gegend das Christentum zu bringen.
Der Gründer der Klöster auf der Insel Reichenau, im Elsass und der Pfalz hatten nicht ahnen können, dass dieses Gebiet zwischen Schucht und Steinberg, wo fünfhundert Jahre später ein Ort namens Bierbach entstehen würde, keinem anderen je gehören würde als dem Permes.
So sah es zumindest die Bas Stollebett.
Der Permes war ihr Geliebter und ihr Herr. Er kam so oft zu ihr in die Hütte, wie sie ihn rief. Und anders als die Burschen, die an den Holztagen im Wald bei ihr eine Rast einlegten und zu ihr in die Hütte gekrochen kamen, um sich die wunderlichen Erzählungen der Bas anzuhören, kam der Permes immer aufrecht herein. Wie ein Herr.
Sie hatte nie gesehen, wie er das machte, da er nur kam, wenn die Hütte voller Rauch war und ihre Augen tränten. Er stand dann da, aufrecht, groß und schön und sah auf sie herunter, auf die alte Bas Stollebett, wie sie auf den Binsen lag und die Beine spreizte und sich ihm darbot.
Aus seinen Erzählungen wusste sie, dass er schon auf diesem Flecken Erde zu Hause gewesen war, als Schucht und Steinberg noch eine einzige Sandsteintafel waren, als es noch kein Grohbachtal gab. Die Zeit kannte der Permes noch. Er kannte noch diese Zeit und die Zeit davor und alle Zeiten der Welt. Und sie allein hatte Anteil an seinem Wissen und seiner Macht. Sie und nicht einer von den anderen Bierbachern, die sie mit ein paar Almosen abspeisten, und von denen jetzt drei hinter ihr her waren.
Als sie in fliegender Hast den Felsen hinaufgeklettert war und oben auf der Kanzel stand, waren ihre Fingernägel abgebrochen und ihre Beine blutig geschürft. Sie glaubte sich in Sicherheit, als die drei Burschen laut keuchend am Fuße des Felsvorsprungs ankamen.
Johann und Julius lehnten die schwer gewordenen Äxte an die Beine, pressten ihre Hände an die linke Bauchseite und schnauften schwer. Max fuhr sich mit dem Ärmel über das schweißnasse Gesicht.
Die Gänsehirtin stand auf der Kanzel und lachte keuchend. Hinter sich die Felswand, um sie herum Büsche und Bäume, vor sich den Abgrund.
Sie lachte mit einem Gesellen, den nur sie alleine sah, der einmal hinter den drei Burschen stand und grotesk auf einem Bein tanzte und sich vor ihr verbeugte, dann auf dem bewaldeten Hügel direkt über ihr herumspukte.
Vom Dorf her riefen die Kirchenglocken, doch Johann, Julius und Max hörten sie nicht.
Die Bas Stollebett breitete die Arme aus, denn jetzt stand der Permes ganz nah neben ihr.
„Permes!“
Sie drehte sich ihm zu, fuhr mit der Hand ordnend über ihr mausgraues Kopftuch und wiegte sich derb in den Hüften.
Der Permes legte den Kopf schief.
Unten standen die drei Burschen und schauten hinauf zur Kanzel, merkwürdig berührt von dem absonderlichen Verhalten der Alten.
„Bas Stollebett! Komm runner!“, rief Johann.
„Odder mir hole dich!“, rief Max.
„Un dann kannsche awwer was erläwe!“, schloss Julius.
Die Bas Stollebett riss ihren Blick vom Permes los, der in ihren Augen schöner war denn je, und drehte den Kopf ruckartig den dreien am Fuße der Kanzel zu.
„Mach se tot! Permes! Mach se tot!“
Ihr linker Arm fuhr auf Johann, Julius und Max zu, als wolle sie Blitze schleudern.
Wie unter einem schmerzhaften Hieb zuckten die drei zusammen.
Ein kalter Wind kam auf, der so gar nicht zu dem schwülheißen Julitag passen wollte. Die drei Burschen drehten ihre Köpfe von der Kanzel weg und sahen in die entgegengesetzte Richtung, hinüber zum Webenheimer Bösch. Sie suchten mit fiebrigen Augen die bewaldete Höhe nach der Quelle dieser plötzlichen Kälte ab, konnten aber nichts entdecken. Kam sie vom Hexentanzplatz oder aus dem Tunnel, der durch den dichten Fichtenwald führte?
Sie wandten sich wieder der Kanzel zu und griffen nach ihren Äxten, als sie mitten in der Bewegung innehielten. Sie konnten nicht glauben, was sie da sahen.
Der Lück Johann, der Bubel Julius und der Lenhard Max verstanden von der Sekunde an, was es bedeutet, wenn einem das Blut in den Adern gefriert und einem die Haare zu Berge stehen.
Sie sahen sich an und schworen sich, das unheimliche Geheimnis dieses Sommertages ein Leben lang zu hüten. Kein Wort darüber. Nicht zu ihren Eltern, nicht zu ihren Geschwistern. Und auch später nicht zu ihren Ehefrauen, nicht zu ihren Kindern.
Und sie wussten, dass der Holztag, an dem sie ohne Feuerholz aus dem Wald zurück ins Dorf kämen, ihr ganzes Leben verändern würde.
Drunten im Dorf blieben die Bierbacher auf der Straße stehen und schauten hinauf ins Grohbachtal.
Verwundert sahen sie die Vögel über der Kanzel kreisen. Hörten das Geschrei aus unzähligen Vogelkehlen.
Und dann begannen auch noch die Kirchenglocken zu läuten.
Ein schlimmes Unheil ahnend, taten die Bierbacher das einzig ihnen richtig Erscheinende, sie bekreuzigten sich und machten sich wieder daran, ihrem Tagwerk nachzugehen.
Nur die Familien von Johann, Julius und Max machten sich noch Sorgen. Sie sorgten sich so lange, bis die drei wohlbehalten ins Dorf zurückkamen.
Dass sie nicht, wie ihnen von ihren Vätern aufgetragen, mit dem geschlagenen Holz zurückgekommen waren, trug ihnen zwar Schelte ein. Doch war das nicht bös gemeint. Falls ihre Leute das Entsetzen in den Gesichtern der drei bemerkt haben sollten, so haben sie es nicht erwähnt.
„Es gebt Sache, iwwer die schwätzt ma besser net, bevor ma demet es Unglick ahnzieht“, dachten sie.
Die Bas Stollebett war tot.
Der Wannemacher, der am Abend nachsehen wollte, wo die Gänse blieben, fand ihre Leiche am Fuße der Kanzel. Er ging ins Dorf zurück, um Hilfe zu holen.
Etwas merkwürdig fanden die Bierbacher, die kurze Zeit später um die Tote herumstanden, dass ihr Körper so zerschmettert da lag, wo doch die Kanzel höchstens drei Meter hoch war und man sich von ihr kaum zu Tode stürzen konnte. Auch von der bewaldeten Höhe über der Kanzel nicht.
Am Schlimmsten hatte es den Kopf von der Bas Stollebett erwischt. Ihre Oberlippe war hochgezogen, als wäre sie weggeschrumpft. Das Zahnfleisch, in dem bis vor kurzem noch ein paar braune Zahnstümpfe gestanden hatten, war zu einer breiigen Masse zerschlagen worden. Ihr Schädel war furchtbar zugerichtet. Unter den grauen Haarsträhnen gähnten tiefe Spalten. Blut und ausgelaufene Hirnmasse waren auf den festgetretenen Waldboden gequollen. Über den zähen Brei hatten sich bereits die Schmeißfliegen hergemacht, und unzählige Waldameisen trugen fleißig Klümpchen für Klümpchen davon.
Der alte Lück schob nachdenklich seine Mütze in den Nacken und hob die Axt auf, die neben der Toten im Gras lag, und die er als seine erkannte. Keil und Stiel waren blutverschmiert. Haare und Erde klebten daran. Kopfschüttelnd versuchte Lück die Axt im Gras zu säubern.
„Geh doch do an die Grohbach. Do werds doch sauwerer.“
„Do hasche recht. Losst der die gut Axt do im Wald leie. Der kann was erläwe!“
„Wer hätten awwer a gedenkt, dass es Stollebett èmol vun der Kanzel fallt un sich dotsterzt.“
Nachdem alle einmal hingekuckt hatten, deckten die Frauen die Leiche mit einer mitgebrachten Pferdedecke zu. Die Männer steckten sich je ein Stück abgebrochenen Kautabak in die Wangen. Kauten und spieen abwechselnd. Alle zusammen warteten sie, erleichtert über den Tod der Bas Stollebett, auf den Pfarrer. Sie vertrauten darauf, dass der alte Herr mit einem gesprochenen Segen und geweihtem Wasser alles, was hier auch geschehen sein mochte, von Gottes Erdboden verbannen konnte.
„Was machten dann dei Kuh? Gebt se jetzt besser Milch?“, fragte Klause Hans.
„Seit vorgeschter schunn“, antwortete der Bubel und kramte in den ausgebeulten Taschen seiner Joppe. „Jetzt han ich mei Peif dehemm leie gelosst.“ Er schüttelte verärgert den Kopf.
„Es gebt heit noch è Gewitter.“ Der Sornberger Jakob kniff die Augen zusammen und blinzelte in die untergehende Sonne.
Die andern taten es ihm nach. Damit trat ein unausgesprochenes Gesetz in Kraft, die Bas Stollebett und ihr sonderbares Ende zu vergessen.
Die Gänse wurden schon am nächsten Tag von einer anderen Gänsehirtin gehütet, die sich weigerte, die Hütte ihrer Vorgängerin zu benutzen, und sei es nur, um sich vor plötzlichen Regenschauern zu schützen. Auch die Gänse trieb Ferrangs Veronika ins Hechlertal statt ins Grohbachtal.
Veronika war bis dato die Magd vom Bauer Lück gewesen, der froh war, das eigenwillige Geschöpf von seinem Hof zu bekommen. Vor allem, da sie anfing, seinem Sohn Johann den Kopf zu verdrehen. Und an einer gewöhnlichen Magd als künftige Bäuerin und Mutter seiner Enkel war ihm nicht gelegen. Zumal er nicht garantieren konnte, selbst von der Magd die Finger zu lassen - wie sich vor zwei Wochen in der Kammer ihres Stallhäuschens in der Hirtengasse erwiesen hatte.
Die Hütte der Bas Stollebett verfiel mit den Jahren. Bald schon überwucherten sie Flechten und Moos.
Doch das Gebiet, wo die Gänsehütte gestanden hatte, gehörte fortan auf eine unheimliche Weise zum Dorfleben dazu.
1906 ließ der damalige Jagdpächter, Christian Fleisch aus Saarbrücken, auf derselben Stelle, wo einst die Hütte der Bas Stolleberg gestanden hatte, eine Jagdhütte bauen und nannte sie „Jägerheim Christians Ruhe im Grohbachtal“. Der aus Vorarlberg stammende Unternehmer ließ auch noch einen Weiher anlegen. Wasser gab es ja genug im Grohbachtal. Ein Tagelöhner aus dem Lothringischen, Jean-Pierre Grosser, der bei dem Bau der Hütte geholfen und im Dorf keine Übernachtungsmöglichkeit gefunden hatte, blieb allein bei dem Rohbau, um dort zu schlafen. Er wurde am nächsten Tag von seinen Kameraden vermisst. Man nahm an, dass der als arbeitsscheu geltende Mann das Weite gesucht hatte.
1955 kaufte die Gemeinde Bierbach das Grundstück, errichtete einen Kinderspielplatz, und aus der Jagdhütte des Christian Fleisch wurde die Waldschenke. Der sieben Jahre alte Hans-Peter Orloff, der mit seinen Eltern und seiner Schwester am Hechlerberg wohnte, wollte unbedingt wissen, ob der Spielplatz schon fertig war. Also machte er sich eines Tages nach dem Abendessen heimlich auf den Weg ins Grohbachtal. Mosersch Lydia sah ihn noch mit seinem Roller die Eckstraße hochfahren. Den Roller fand man in der Nacht am Ufer des Fischweihers. Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus dem Weiher. Nichts. Auch eine groß angelegte Suchaktion in der Umgebung brachte keinen Erfolg. Der Junge wurde nie gefunden.
1960 wurde der Weg von der Eckstraße ins Grohbachtal, vorbei an der Kanzel bis hin zum Spielplatz, asphaltiert. Auf halben Weg, zwischen Kanzel und Dorf, wurde ein Parkplatz angelegt.
Michael Hanauer, der erste in Bierbach, der eine Vespa sein Eigen nannte, wollte den neu asphaltierten Weg als Rennstrecke benutzen. Brigitte und Ludwig Meier kamen gerade von ihrem Grundstück am Fuße des Schuchts und bogen zur selben Zeit, als Michael am Parkplatz vorbeifuhr, mit ihrem Leiterwagen in den Weg zum Dorf ein. Sie hörten ein Motorgeräusch, dem sie keine weitere Beachtung schenkten. Hinter der ersten Kurve nach der Kanzel entdeckten sie Michaels Vespa auf dem neu asphaltierten Weg liegend. Die kleinen Räder der Maschine drehten sich noch, vom Hanauer Michael fehlte jede Spur.
1970 wurde ein zweiter Fischweiher angelegt. Herbert Weber, der mit ein paar Freunden in der Waldschenke gesessen und zu viel getrunken hatte, kam auf die Idee, den neuen Weiher pinkelnd einzuweihen. Also torkelte er nach draußen. Seine Freunde ließen ihn alleine ziehen und haben ihn von der Stunde an nicht mehr gesehen.
1972 wurde direkt neben der Kanzel von der Freiwilligen Feuerwehr Bierbach eine Kneippanlage gebaut. In über 4000 Arbeitsstunden wurden von den Männern ehrenamtlich ein Wassertretbecken und ein Armbecken errichtet. Christa Bender wollte ihren Mann Otto von der Baustelle abholen, da sie beide an diesem Freitagabend noch zu einem Geburtstag eingeladen waren. Es war ein langer heißer Tag. Als Christa den Wald betrat, dämmerte es. Sie konnte nicht wissen, dass die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr wegen der Hitze schon längst Feierabend gemacht hatten und im Dorf in der Eckwirtschaft saßen. Niemand hat Christa Bender je wieder gesehen.
Verirrten sich zu Lebzeiten der Bas Stollebett nur Holz schlagende Burschen und Liebespaare ins Grohbachtal im Pirmannswald, so entwickelte sich diese Region später zu einem Naherholungsgebiet für Einheimische und Besucher aus der Umgebung.
„Gehn net alleen in de Wald“, warnte der Lenhard Max, der Lück Johann und der Bubel Julius alle, ob sie es hören wollten oder nicht, „gehn nie alleen in de Wald.“ Doch wer nahm schon drei alte Männer ernst?
-III-
Bierbach, 05. August 2003
Draußen kochte der Asphalt und die Luft flimmerte und flirrte, als würde sie jeden Moment ihre physische Konsistenz verändern wollen. Ganz Europa stöhnte in diesem Sommer unter den Temperaturen, die seit Ende Mai fast jeden Tag weit über 30 Grad Celsius lagen.
In der Wirtschaft Bei Theo in der Pfalzstraße in Bierbach war es angenehmer als draußen, will heißen, knapp unter zweiunddreißig Grad.
Eine zivile Temperatur bei durchschnittlich 40 Grad in diesem Sommer. Dazu trug ein Tischventilator auf höchster Stufe bei, der im hinteren Teil der Kneipe auf einem Regal stand, zwischen einem schmiedeeisernen Topf mit drei rosafarbenen Plastikrosen und einem grauen Tonkrug mit der verschnörkelten Aufschrift Gruß aus Bamberg. Wie ein tanzender Derwisch wirbelte er die abgestandene Luft im Raum herum.
Über dem Ventilator, fast unter der Decke, hing ein Schwarzweißfoto von der Damenmannschaft des FC Bierbach von 1976, in der Theos Frau Ruth das Tor gehütet hatte.
Daneben hing eine Bleistiftzeichnung unter Glas. Das Papier war schon vergilbt. Es stellte ein kleines Kunstwerk dar, signiert von Johann Lück, datiert im Jahre 1911, und es zeigte die Kanzel. Über der Kanzel stand eine schwarz gekleidete Gestalt, die aussah wie Murnaus Nosferatu mit großen, zu Klauen gekrümmten Händen: der Permes. Und er starrte mit stechenden Kohleaugen hinüber zur Damenmannschaft des FC Bierbach.
Pfarrer Alfred Bubel lächelte.
Was ein Psychologe wohl daraus schließen würde, dachte Alfred, dass Theo die beiden Bilder gerade so zueinander platziert hatte?
Er saß, oder besser klebte, auf einem der mit Kunstleder bezogenen Barhocker. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, lösten sich und rannen kitzelnd über sein Gesicht. Immer wieder wischte er sie mit einem weißen Stofftaschentuch weg, doch mit jedem Schluck Bier wurden es mehr.
Außer ihm waren nur noch drei andere Gäste in der Wirtschaft, die ausgemergelten Brüder Karl, Gerd und Franz Weber. Die ganze Familie Weber sah aus, als würde sie seit Generationen an Unterernährung und Mangelkrankheiten leiden.
Karl, Gerd und Franz standen neben der geöffneten Tür und steckten den Rest ihrer Stütze in den Spielautomaten. Nebenbei diskutierten sie darüber, ob Lance Armstrong oder Jan Ullrich die Tour de France im nächsten Jahr gewinnen würde.
Für Unkundige hörte es sich an, als hätten die drei Brüder den dicksten Krach. Ihre Fäuste waren geballt und ihre Gesichter krebsrot. Mit einer Vehemenz, die in keinem Verhältnis zu ihrer Körpergröße oder ihrem Gewicht stand, warfen sie Geldstück um Geldstück in den Schlitz des Spielautomaten und schlugen jedes Mal dagegen, als müssten sie befürchten, dass der Apparat die Kohle sonst wieder ausspuckte.
„Da! Friss!“, drohten sie dem Automaten, und der gehorchte.
Immer wieder warfen sie Hochwürden in seiner schwarzen Hose und seinem schwarzen Kollarhemd lauernde Blicke zu. Glückspiel war Sünde. Daran konnten sie sich noch dunkel aus der Zeit des Religionsunterrichts erinnern. Was war das für ein Pfarrer, der sich einen Dreck um seine Schäfchen kümmerte und lieber vor sich hinstarrte. In der Wirtschaft. Mit einem Glas Bier. Wenn sie heute Abend ohne Geld dastünden, wäre eindeutig der Pfaffe schuld.
Karl hätte dem Pfaffen gerne die Meinung gesagt, aber bei denen zog man immer den Kürzeren und außerdem stotterte Karl, wenn er seinen Alkoholpegel noch nicht erreicht hatte. Aber wenn der erst einmal erreicht war! Karl spürte eine unbändige Lust auf eine richtig schöne Schlägerei in sich hoch kochen. Er schlug sich mit der Faust in die hohle Hand. „Kkkomm mmir einer ddumm!“
Und wenn er sich heute nicht den Pfaffen vorknöpfen würde, dann bei nächster Gelegenheit den Wolfgang, der im Kirchenchor sang und auch immer ein so frommes Gesicht machte und der mit dem Pfaffen befreundet war. Der Karls Mutter immer so scheinheilig grüßte und die alte Frau früher die Unterkirche hatte putzen lassen. Für die Weber-Brüder, besonders für Karl, war das ganze Dorf verdorben, scheinheilig und gemein.
„Aalles dddreckige Bbastarde“, knurrte er.
„Wen meinst du?“, fragte sein Bruder Gerd, warf noch einen Euro in den Schlitz und knallte mit der Faust auf den Spielautomaten. „Die Pfaffen?“
„Ddas gganze Ddorf. Nnur dddreckige Bbastarde!“
„Mit der Nas immer ganz oben!“, sagte Franz.
Alfred saß allein an der Theke und ahnte nichts von dem Kampf, der in Karl und dessen Brüdern tobte. Er betrachtete stattdessen sein Porträt in einem versilberten Pokal, den Theo, im letzten Jahr bei einem Bierzapfwettbewerb auf dem Webenheimer Bauernfest gewonnen hatte.
Was er sah, war ein rundes Gesicht mit ein paar Haaren obendrauf, das durch die bauchige Form des Pokals noch mehr in die Breite gezogen wurde.
Du siehst aus wie die Witzfigur eines wohlgenährten, mittelalterlichen Mönchs. Du hättest in Der Name der Rose mitwirken könne, dachte er bei sich.
Er nahm sein Taschentuch wieder aus der Hosentasche und wischte sich über das Gesicht. Nicht nur die Hitze, die sich in seiner schwarzen Kleidung hielt wie in einem Nachtspeicherofen, machte ihm zu schaffen. Er haderte heute so mit Gott und der Welt, wie er es seit seiner Zeit als Welt verbessernder, der lateinamerikanischen Befreiungstheologie zugeneigter Theologiestudent nicht mehr getan hatte. Als er für sein Leben gern an der Seite von Bischof Romero Lateinamerika aus den Klauen einer habgierigen Oligarchie befreit hätte. Das harte Studium an der Priesterakademie in Speyer hatte ihm nur in seinen Träumen Gelegenheit geboten, heroische Taten zu vollbringen. Und im Nachhinein betrachtet, schien dies auch nicht Gottes Wille gewesen zu sein. Er hatte etwas anderes mit ihm vor. Aus dem kämpferischen Theologiestudenten Alfred war ein Dorfpfarrer geworden.
Seine Gemeinde Bierbach gehörte zur Stadt Blieskastel und war mit fast zweitausend Einwohnern der drittgrößte Stadtteil.
Bierbach lag am Fuße zweier Bergrücken, dem 334 Meter hohen Schucht und dem Steinberg, der noch 15 Meter näher an alpine Größe heranreichte. Bierbach lag vor allem zwischen den über die Grenzen des Landes bekannten Naherholungsgebieten Pirmannswald und dem Bliesgau. Und die Bierbacher Aue, durch die sich die Blies schlängelte, war eine der schönsten Flussauen in ganz Deutschland. Es gab einen Radweg, der neben der Blies entlangführte und der an Wochenenden überfüllt war von Radfahrern, Fußgängern, Inline-Skatern.
Es herrschte ein Betrieb wie auf den Wanderwegen zu den Schlössern vom Bayernkönig Ludwig. Na ja, nicht ganz, aber fast.
In Bierbach war er geboren und aufgewachsen, und im acht Kilometer entfernten Homburg hatte er das Johanneum besucht, ein von den Herz-Jesu-Missionaren gegründetes Internat, in dem auch Externe wie er unterrichtet wurden. Nach dem siebenjährigen Studium und der Weihe zum Priester war es dem Bierbacher Bub gelungen, sich schnell wieder in das Dorfleben einzufügen.
Normalerweise sollte ein Priester nie Pfarrer in seiner Heimatgemeinde werden, wo man ihn bereits als Kind gekannt hatte. Aufgrund des großen Priestermangels in der Diözese Speyer hatte man bei ihm eine Ausnahme gemacht. Und es war keine Fehlentscheidung des Bischofs gewesen. Alfreds anfängliche Sorge, von den Älteren, die hauptsächlich in seine Kirche kamen, nicht respektiert zu werden, hatte sich als grundlos erwiesen.
Er nahm einen großen Schluck Bier, leckte sich den Schaum von den Lippen und wischte sich wieder mit seinem Taschentuch über die Stirn und den Hals. Matthäus kam ihm in den Sinn und Alfred deklamierte: „Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“
„Selig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer“, deklamierte Karl ebenso flüssig. Er hatte seinen Pegel erreicht. Seine Brüder und der Wirt lachten kehlig.
Alfred hörte gar nicht hin.
Er hatte die letzten Wochen mit seinem Gemeindereferenten Jens Lüders, einem dürren, überlangen, asketisch aussehenden Mann aus dem protestantischen Nordfriesland, ein Programm entwickelt. Lüders nannte es despektierlich ein Unterhaltungsprogramm. Es war Alfred daran gelegen, die Bierbacher Jugend wieder zum Gottesdienst und zur aktiven Teilnahme am Kirchenleben zu bewegen. Ermutigt hatte ihn das seit ein paar Jahren aufflammende Interesse vieler Teenager an der Bibel, vor allem an der Offenbarung des Johannes. Alfred wurde häufig darauf angesprochen und um eine Erklärung gebeten, was es mit den sieben Posaunen auf sich hatte oder mit der Schale des Zorns oder auch mit dem Reiter auf dem weißen Pferd.
Die hochgezogenen Augenbrauen und das spöttische Lächeln seines gestrengen Gemeindereferenten ignorierend, hatte er dieses Interesse zum Anlass genommen, Jugendmessen und extra Bibellesungen für junge Leute zu organisieren.
Es hatte nicht lange gedauert, bis seine Hoffnungen zerstört wurden, genau gesagt bis heute Nachmittag und der ersten Bibellesung. Ihr Thema waren Die Briefe des Paulus an die Korinther, und es war kein einziger Jugendlicher gekommen.
Alfred, der mit Lüders wartend in der Unterkirche gesessen hatte, gab der Hitze die Schuld, die die Jugendlichen wohl eher ins Schwimmbad als in die Kirche getrieben hatte.
Lüders hatte dazu nur die Nase gerümpft und das kleine Kreuz über der Sitzgruppe fixiert. Es war ihm vom Gesicht abzulesen, welcher Art das Zwiegespräch zwischen ihm und Jesus Christus war. Lüders grundsätzliche Frage dabei lautete, so vermutete er: Warum, oh Herr, ist dieser fette Trottel Pfarrer und nicht ich?
Nach einer dreiviertel Stunde hatte er den Gemeindereferenten nach Hause geschickt und zwanzig Minuten gewartet, bis er sicher sein konnte, ihm vor der Kirche nicht mehr zu begegnen. Dann war er unglücklich die Treppe hoch gestapft, am begrünten Innenhof kurz stehen geblieben und hatte einem Schmetterlingspaar zugeschaut, das sich sacht auf einer Rosenblüte niedergelassen hatte.
Dann war er durch den Haupteingang, unter dem Kirchturm hindurch, auf den Vorplatz gegangen. Aber statt ins Pfarrhaus zu gehen, entschloss er sich, seinen Eltern, Lisbeth und Pirmin Bubel, in der Korngartenstraße einen Besuch abzustatten.
Vielleicht hatte seine Mutter einen Kuchen gebacken, zumindest hatte sie einen in der Tiefkühltruhe, den sie für ihn auftauen würde. Der Gedanke hatte ihn wieder froh gestimmt und er war die Treppe hinuntergeeilt, die vom oberen Teil des Dorfes direkt in die Korngartenstraße führte.
Auf halber Höhe der Treppe war ihm Falk Strobel, der neunzehnjährige Sohn seines Freundes Günter, begegnet. Von ihm hatte Alfred erfahren, dass die jüngeren Mitglieder seiner Gemeinde die Religion mit einer Folge aus Akte X, einer Krimiserie mit Fantasy- Science-Fiction und Horrorelementen, verwechselten und die Offenbarung des Johannes einfach nur cool fanden. Sie hatten keinerlei Interesse, die Messe zu besuchen und sich ernsthaft mit der Bibel auseinander zu setzen. Angesagt war lediglich, das letzte Kapitel des Neuen Testaments nach drehbuchreifen Gruselszenen zu durchforsten.
„So ist es halt, Herr Pfarrer. Da kann man nichts machen. Tschüß“, hatte Falk abschließend gesagt, grüßend die Hand gehoben und seinen Weg fortgesetzt. Und damit war Alfreds letzte Hoffnung auf ein reges, die ganze Kirchengemeinde umfassendes Miteinander, dahin.
Vielleicht aber, so dachte er sich jetzt, habe ich nur einen Grund gebraucht, wieder mal ein Bier zu trinken.
Die Stunde, die er bei seinen Eltern verbracht hatte, war nicht sehr amüsant gewesen, auch wenn er seinen Kuchen bekommen hatte. Seine Mutter werkelte die ganze Zeit in der Küche herum und murmelte leise vor sich hin, wahrscheinlich ein Gebet. Sie lebte getreu nach dem Motto: Müßiggang ist aller Laster Anfang.
Je größer und stattlicher Alfred wurde, desto schmächtiger erschien ihm sein Vater. Ihn verfolgte die Vorstellung, ein Bandwurm würde in dem alten Mann hausen und ihn von innen langsam auffressen.
Der alte Pirmin Bubel hatte auf dem Küchenstuhl gesessen und abwechselnd seinen Sohn und das Kreuz über dem Tisch angestarrt und dabei die Faust seiner rechten Hand geballt, als hätte er einen inneren Kampf durchzustehen.
Bei Bubels hing in jedem Zimmer ein Kreuz an der Wand. Darüber, dass seine Eltern Gott so offensichtlich zugetan waren, hätte er eigentlich glücklich sein müssen. Aber wenn er ehrlich war, schämte er sich ihrer.
Er trank einen Schluck Bier. Es bedrückte ihn, dass er sich seiner lieben Eltern schämte und dass er seinen Vater nicht gefragt hatte, was ihn quälte.
„Noch drei! Oder sollen wir verdursten, Theo!“, schrie Franz, und Alfred zuckte zusammen.
„Kommt gleich“, beruhigte ihn Theo.
Inzwischen war es Abend geworden, das Pfarrbüro geschlossen und Daniela Westphal, seine tüchtige Pfarrsekretärin, längst zu Hause bei Mann und Kindern. Die Kranken und Bedürftigen hatte er am etwas kühleren Vormittag schon besucht und eine Abendmesse hatte er heute auch nicht mehr zu halten. Gott sei Dank, dachte er und nahm noch einen Schluck.
Zu viel Bier durfte er natürlich auch nicht trinken, denn immerhin war er der katholische Pfarrer von Bierbach. Und in Bierbach, so klein es auch war oder gerade deswegen, hatten die Wände Augen und Ohren. Aber gegen ein zweites Glas war nichts einzuwenden.
„Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß hieß: Treu und Wahrhaftigkeit“, zitierte Alfred den Johannes und winkte Theo, den Wirt herbei.
„Noch eins, Herr Pfarrer?“
„Ja, bitte.“
„Und wie geht’s? Sonst alles in…..?“
Alfred nickte, obwohl der Rest des Satzes im infernalischen Geschepper fallender Münzen und dem Gewinner-Jingle des Spielautomaten unterging. Einer der Weber-Brüder schien eine Glückssträhne zu haben.
„Früher hätte es das nicht gegeben, dass der Pfarrer in die Wirtschaft kommt. Jedenfalls nicht in dem Dorf, in dem er Pfarrer war. Da sind sie zum Saufen und zum… nach Saarbrücken gefahren.“ Theo lachte dröhnend, während er ein neues Karlsberg zapfte.
Alfred runzelte leicht verärgert die Stirn, was der Wirt im Halbdunkel der düsteren Kneipe nicht sehen konnte, aber irgendwie ahnte. Sein Lachen wurde immer verhaltener und endete in einem verlegenen Räuspern.
Hinter Alfreds Rücken machte Franz eine eindeutig obszöne Geste. Bevor Theo etwas zu ihm sagen konnte, drehte er sich wieder dem Spielautomaten zu.
„Die Zeiten haben sich geändert. Nichts für ungut, Herr Pfarrer“, entschuldigte sich der Wirt.
„Ich mische mich überall gerne unter die Gemeinde, damit ich den Kontakt nicht verliere.“
„Ist schon recht, Herr Pfarrer, Sie dürfen ja auch mal ein Bier trinken. Ich habe da nichts dagegen.“
„Das ist nett von dir, Theo.“ Alfred lachte.
„Außerdem bin sowieso evangelisch.“
„Da habe ich nichts dagegen.“
„Das ist großzügig von Ihnen, Herr Pfarrer.“
Theo stellte das gezapfte Bier vor Alfred auf die Theke.
„Würden Sie bei der Ökumene mit den Evangelischen das Abendmahl feiern?“
Alfred holte tief Luft und stöhnte innerlich. Hatte man als Pfarrer denn nie Feierabend? „Die katholische und die evangelische Kirche feiern so manches Fest zusammen. Wir leben die Ökumene, gerade hier in Bierbach“, wich er der Frage aus.
Er hasste diese Fragen, von denen er glaubte, dass kein ehrliches Interesse dahintersteckte, sondern der Wunsch, die katholische Kirche als nicht mehr zeitgemäß darzustellen. Denn wie sollte er Fragen wie diese oder die noch beliebtere nach dem Zölibat in ein, zwei griffigen Sätzen beantworten?
Wie viele Christen, so überlegte er und nahm einen großen Schluck, kannten denn noch den Sinn und Ursprung der Eucharistie oder des Abendmahls? Wer wusste noch, dass sich in der katholischen Kirche während der Eucharistiefeier Brot und Wein tatsächlich in den Leib und das Blut Christi verwandeln? Wo hingegen nach der Auffassung Luthers Jesus Christus zwar im Abendmahl leiblich gegenwärtig ist, doch verwandelt sich das Brot nicht wirklich in den Leib Christi. Und dennoch, dachte Alfred, sind wir alle Christen, vereint im Glauben, und feiern das Abendmahl im Gedenken an den Tod und die Auferstehung Christi.
„Ich möchte zahlen, Theo.“
„Fünf zwanzig.“
Alfred legte sechs Euro auf die Theke, trank sein Bier aus und stand auf. Letzteres war gar nicht so einfach, denn der Barhocker klebte an seinem Hintern. Verlegen schielte er nach den Weber-Brüdern, doch die waren Gott sei Dank mit einem handfesten Streit um den Starttermin der Fußball-Bundesliga beschäftigt.
Karl war der Meinung, dass die Bayern auf keinen Fall wieder Meister werden dürften, auch wenn er dafür seinen Brüdern eigenhändig die dürren Hälse umdrehen müsste.
Theo wühlte umständlich in einem Beutel mit Wechselgeld. Nahm eine Handvoll Münzen raus, betrachtete sie stirnrunzelnd und ließ sie stöhnend in den Geldbeutel zurückfallen.
„Lass nur, Theo. Es stimmt so.“
„Danke, Herr Pfarrer.“ Theo ließ zufrieden den Geldbeutel zuschnappen und warf ihn in die Schublade unter der Theke.
Alfred überlegte und drehte sich noch einmal um, bevor er aus der Tür ging. „Theo, deine Frage beantworte ich dir gerne, wenn du zu mir ins Pfarrhaus kommst. Aber bring viel Zeit mit. Ich muss nämlich weit ausholen. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch ein Gebet zusammen sprechen.“
Die Weber-Brüder prusteten los.
„Nein, danke, Herr Pfarrer. Das wäre sehr nett von Ihnen, aber lassen wir’s besser sein. Ich kann ja hier nicht weg. Außer am Ruhetag, und da gehen wir einkaufen“, beeilte sich Theo zu antworten.
Alfred zog fragend die Augenbrauen hoch.
„Und wenn wir mal nicht einkaufen gehen, habe ich zu Hause jede Menge zu tun. Sobald die Hitze rum ist, will ich das Wohnzimmer tapezieren und den Flur und das Schlafzimmer und das Esszimmer.“ Theo suchte händeringend nach weiteren Entschuldigungen.
„Ist schon gut, Theo“, entließ ihn Alfred gnädig.
Theo nickte dankbar und wünschte Alfred einen schönen Abend.
„Gelobt sei Jesus Christus“, murmelte Alfred und verließ die Kneipe.
Als er auf den Bürgersteig trat, war ihm, als liefe er gegen eine Wand aus heißer Luft. Die Augusthitze ließ seine schwarze Priesterkluft an ihm kleben wie einen nassen Plastikduschvorhang. Obwohl es schon kurz nach halb acht war, schien es noch immer über 30 Grad zu sein. Bierbach lag da wie ausgestorben. Nicht einmal die Frauen waren auf der Straße, die sich für gewöhnlich gegen Abend zum Friedhof aufmachten, um die Gräber zu gießen.
Er schaute über die Straße hinweg in die Aue. Die Blies lag dunkel und schwer da, als wäre der kleine Fluss zu einem stehenden Gewässer geworden. Sein Pegelstand lag weit unter normal.
Langsam ging er die Pfalzstraße dorfeinwärts. Die Stimmen und Geräusche aus der Wirtschaft wurden mit jedem Schritt leiser, bis sie nicht mehr zu hören waren.
Es war totenstill in Bierbach. Totenstill und ausgestorben.
Wie totenstill und ausgestorben, korrigierte er sich. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass ihm der Angstschweiß ausbrach. Und plötzlich wurde ein Schalter in seinem Kopf umgelegt und die Zeit drehte sich um dreißig Jahre zurück.
Es war an einem heißen Sommertag gewesen, genau wie heute.
Dreißig Jahre zuvor. Und sie hatten…. Ja, was hatten sie getan? Er musste nur kurz überlegen und schon lief der Projektor warm und der Acht-Millimeter-Film mit seiner Erinnerung lief ab. Manche Szenen waren nur undeutlich zu erkennen. Das war jedoch kein Problem für jemanden, der, wie er, den Film bereits kannte.
-IV-
Bierbach, 15. Mai 1972
Sie hatten viele Stunden in der Kneippanlage neben der Kanzel im eiskalten Wasser geplanscht, die Sechs Unzertrennlichen: Jessica Lück, Margot Klaus, Wolfgang Lenhard, Günter Strobel, Birgit Altpeter und er, Alfred Bubel.
Die Anlage war zwar noch nicht ganz fertig, aber es war schon genug Wasser im hellblau gestrichenen Becken, um mit den Knien am Boden ein paar kurze Schwimmbewegungen zu machen und vor allem genug, um sich gegenseitig zu tunken.
Es war ihnen ausdrücklich verboten worden, in der halbfertigen Anlage zu spielen. Doch das war ihnen egal. Sie wussten, die Männer der Freiwilligen Feuerwehr würden erst gegen Abend ins Grohbachtal kommen um an ihrem Projekt weiterzuarbeiten.
Später waren sie zum Spielplatz, der weiter oben im Pirmannswald lag, gegangen und hatten dort weitergespielt. Zu Alfreds großer Not hatten sie ihre Geschicklichkeit im Weitspringen von der Kettenschaukel gemessen. Keiner, so wusste er, stellte sich dabei so ungeschickt an wie er. Dann war es Jessica zu langweilig geworden und sie hatte vorgeschlagen, tiefer in den Wald zu gehen und Robin Hood im Sherwood Forrest zu spielen.
Der Vorschlag wurde angenommen und gemeinsam jagten sie am Fischweiher vorbei, den Schwarzen Weg hinauf, in Richtung der Sieben Fichten. Die anderen vorneweg und er schwer keuchend hinterher.
Auf der Lichtung bei den Sieben Fichten angekommen, wurden Birgit und er zu englischen Edelleuten bestimmt, die von Jessica, Wolfgang, Margot und Günter überfallen und ausgeraubt werden sollten.
Er hatte sich ein gutes Versteck ausgesucht, um dem Überfall zu entgehen. Ein Versteck, das seinen ganzen Mut erforderte. So viel Mut, wie ihm die anderen nicht zutrauen würden. Es war ihm klar, dass er nicht zu Robins Bande gehören durfte, weil ihn die anderen für zu dick und zu feige hielten. Er ließ Birgit zurück, die sich lieber in der Nähe der Lichtung verstecken wollte, und lief den Weg auf Kirkel zu. Nach ein paar Minuten bog er in den Felsenpfad ein.
Der Felsenpfad war eine einmalige Attraktion für jeden Wanderer in dem Wald zwischen Bierbach und Kirkel. In späteren Jahren sollte er zu einem Dorado des Freeclimbings werden. Doch Alfred hatte keinen Sinn für die bizarre Schönheit dieser ungewöhnlichen Gesteinsformationen mitten im Wald. Sein Herz schlug wild und sein grünweißes Hemd war an vielen Stellen dunkel von Schweiß. Mutig und mit zusammengebissenen Zähnen setzte er einen Fuß vor den anderen.
Die in Schichten aufgeworfenen Felsen aus Buntsandstein hingen drohend über ihm, als er den schmalen Pfad entlangging. Er kam sich unter ihnen noch kleiner und schutzloser vor, als er es ohnehin schon war. Feuchte, kühle Luft stieg aus den bemoosten Spalten unterhalb der Felsen hervor. Obwohl er schwitzte, war er dankbar für jeden Sonnenstrahl, der durch die Baumkronen fiel.