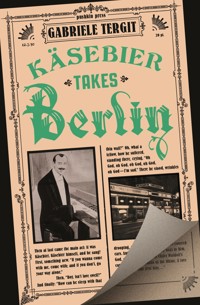21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wer die blutigen Konflikte der Gegenwart zwischen dem israelischen Staat und den Palästinensern verstehen will, der sollte, nein, der muss dieses Buch lesen. Denn es legt die politischen und kulturellen Wurzeln schon lange vor der Gründung des Staates Israel 1948 frei.« Claus-Jürgen Göpfert, Frankfurter Rundschau 1933 muss die Berlinerin Gabriele Tergit aus Deutschland fliehen und gelangt über Tschechien nach Palästina. Schreibend bahnt sie sich ihren Weg durch das Völkergewimmel in Jerusalem, Haifa und Tel Aviv und erlebt ein Land im Aufbruch. In hier teils erstmals veröffentlichten Porträts und Reiseschilderungen vermittelt sie ein sinnliches Bild von der ungeheuren Vielfalt Palästinas in den 1930er Jahren, lange vor der Staatsgründung. Tergit trifft einen Fleischer aus Brest-Litowsk, der sich eine japanische Decke um den Bauch bindet und melancholisch Wurst schneidet;eine Berliner Zionistin, tüchtig und patent, die unermüdlich arbeitet und Feste organisiert, und einen Frommen aus Deutschland, den die jungen Leute auslachen. Zusammen mit den faszinierenden Fotos aus dem Archiv Abraham Pisarek gewähren Tergits Geschichten Einblicke in eine Welt, in der manche Hoffnung zerbrach und doch vieles möglich schien. Erstmals um neunzehn ursprünglich von der Autorin für den Band vorgesehene Texte aus dem Nachlass erweitert, gewährt Im Schnellzug nach Haifa einen ganz neuen Einblick in die Entstehung des heutigen Israels.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gabriele Tergit
Im Schnellzug nach Haifa
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Nicole Henneberg
Mit Fotografien von Abraham Pisarek
Schöffling & Co.
Inhalt
Im Schnellzug nach Haifa
Überfahrt 1933
Klima
Landschaft
Wirrnis Jerusalem
Die Altstadt oder Intra Muros
Geschäftsstadt
Das Getto von Jerusalem
Die Engländer im Kino (1934)
Zwei Kurdinnen
Rechavia
Postämter
Akko und Haifa
Zweimal Tel Aviv
Bethlehem
Fahrt zum Toten Meer
Sozialistische Siedlung
Privat-Siedlung I
Privat-Siedlung II
Privat-Siedlung III
Privat-Siedlung IV
Landwirtschaftliche Gemeinschaftssiedlung
Herbstfeste in Jerusalem
Pessach
I. Samaritaner
Pessach II.
Pessach III.
Soziale Begriffe der Juden
Gespräch mit einem alten Russen
Der Jude und sein Wirtsvolk
Frommer aus Deutschland
Kleiner Exkurs
Von den Kuchen der Völker, die uns hinauswarfen
Von den Kleidern der Völker, die uns hinauswarfen
Von den Liedern der Völker, die uns hinauswarfen
Junger Mann aus Polen
Frau Doktor
Theater
Der Religionsunterricht
Der Zufriedene
Revolutionäre aus Galizien
I.
II.
Fünfmal Dienstmädchen
1933
1934
1934
1935
Polnisches Dienstmädchen in Tel Aviv
Ehrgeiz
Petersburger Jüdin
Berliner Zionistin
Die Rede des hebräischen Schriftstellersoder Die Geburt der Nation aus dem Mysterium der hebräischen Sprache
Galuthexistenz
Frau aus dem Baltikum
Musiker aus Russland
Deutscher Jude
Reichtum
Polnischer Hausbesitzer über die deutsche Alijah
Der Baalaboss
Deutscher auf der Gemeinschaftssiedlung
Der Kutscher
Abstieg
Mädchen
Orthodoxie
I.
II.
Zwei Christen
I.
II.
Sephardim
Russisch-jüdischer Arbeiter
Fabrikant aus Deutschland
Der Weltverbesserer
II.
III.
Fleischer in Tel Aviv (1934)
Der jüdische Held
Der Schlosser aus Brest-Litowsk
Jüdische Mutter
Legenden I
Legenden II
»So stand ich einsam im unbefreundeten Kosmos«
Nachwort von Nicole Henneberg
Im Schnellzug nach Haifa
Überfahrt 1933[1]
Im Jahr 1933 sind in Palästina 30327 Juden eingewandert, davon 5515 aus Deutschland. 1934: 42359, davon 6941 aus Deutschland. 1935: 61000, davon 5464 aus Deutschland. 17 Millionen Juden leben in der ganzen Welt, 500000 in Deutschland. Also wanderte jährlich etwa ein Prozent aus Deutschland nach Palästina, aber aus der übrigen Welt nur ein Promille. In der ganzen Welt herrscht Not. Der Jude, der Kaufmann, der Vermittler, nicht zugelassen zu den krisenfesten Berufen, leidet wie der Arbeiter als Erster, die Krise trifft die Ungeschütztesten zuerst. 1920 bis 1934 kamen 197000 Juden nach Palästina, davon über 100000 aus Polen.
Auf dem Schiff nach Palästina fahren die Chaluzim[2], die Pioniere des Bodens, die friedlichen Eroberer des Landes, kommend vom Ende einer Zivilisation, wie die früheren Mönche gefahren sind, den Boden zu beackern und die Menschen einer neuen Gemeinschaft zu gewinnen, getragen von einer Idee. Die Kwuzah,[3] das Kollektiv zur Bearbeitung eines Stück Landes, ist ihr Kloster, und ringsum werden sie ihre neuen Methoden vortragen, um Frucht zu gewinnen. Die Pioniere tanzen und singen. Tanzen sie jüdisch? Singen sie jüdisch? Sie tanzen russisch. Sie singen russisch auf hebräisch. Sie sind kräftig, und sie haben den hellen, guten Blick, den die Beschäftigung mit der Erde gibt.
Auf dem Schiff fahren alte, gesetzestreue Juden, der Religion ergeben, dem Geist und der Vergangenheit.
Ein Rabbi aus einer kleinen amerikanischen Gemeinde spricht jiddisch den Menschen Mut zu: »Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ich stärke dich, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.«
Auf dem Schiff fährt eine Familie aus Moskau, Vater, Mutter, Tochter von neunzehn, Sohn von dreizehn. Sie mussten 400 Goldrubel zahlen, um Russland verlassen zu können. Verwandte im Ausland haben ihnen Geld gegeben und sie eingekleidet. Sie waren auf Reisen in Karlsbad und Italien, und so sehen sie auch aus. Bürgerliche Leute, denen es gut geht. Die Tochter ist sehr elegant, das Gesicht zurechtgemacht. Sie ist nicht einverstanden mit den Eltern, die nach Palästina fahren. Sie ist, elegant wie sie ist, dem Kommunismus zugetan. Sie ist recht unfreundlich, recht unliebenswürdig mit den Bürgern auf dem Schiff, die größtenteils keine mehr sind, sondern entwurzelte, nichts mehr besitzende deutsche Juden. Die Eltern sind still und liebenswürdig, benehmen sich wie gut erzogene wohlhabende Leute. Die Tochter ist neunzehn Jahre alt, das heißt, sie war vier Jahre alt, als die Sowjets die Macht übernahmen. Sie kennt nichts anderes. Die Eltern wollen wieder bürgerlich leben, nicht besser, aber bürgerlich. Die Kinder wollen kommunistisch leben, besser, aber kommunistisch. Sie wissen nicht mehr, wie es früher war. Und wir Leute, die schon vor 1914 lebten, wir vergessen immer, wie wenig Menschen wissen, die 1914 erst geboren wurden. Ein derartig junger Mann, ein halbwegs gebildeter Kaufmann aus Breslau, fragt mich: »Und wie ist es mit der Tschechoslowakei? Hat sie auch so durch den Versailler Vertrag gelitten?« Er weiß nicht, dass es ein Kaiserreich Österreich gab. Er weiß nicht, dass es aufgeteilt wurde. Er weiß nicht, dass Jugoslawien Serbien war. Und da meinen Staatsmänner, man könnte den Menschen von Problemen sprechen. Sie kennen nichts, was früher war, als die Zeit, da sie vierzehn Jahre alt wurden. Vorher war immer die Sintflut.
Auf dem Schiff fahren jetzt die Deutschen. Bald viele, bald weniger viele – ein unaufhörlicher Strom. Sie stehen an der Reling, im städtischen Anzug, in langen Hosen. Der Wind kommt, die Sonne, sie haben nur eine Reisemütze, als Einziges, das sie sportlich macht, sie sehen aus wie Herren, zu denen der Arzt gesagt hat: »Ihre sitzende Lebensweise verlangt, dass Sie einmal eine Schiffsreise machen, Ihre Nerven gründlich auskurieren.« Es sind keine Flüchtlinge mit roten Betten und geschnürtem Bündel, es sind nur Reisende, aber der Boden wurde ihnen unter den Füßen weggezogen und ihre Namen gelöscht von der Tafel der Börsenmakler, Rechtsanwälte und Kaufleute.
Auf dem Schiff sitzt eine hübsche, gepflegte, gut angezogene Frau. Ihr Mann war Getreidehändler. Die Erlaubnis zum Handeln wurde ihm entzogen. Sie hat zwei kleine Kinder. Sie hat über ihre Füße eine Decke aus bester Wolle, in feinsten Farben gelegt. Sie trägt einen hellen Pelz, der in einem silbergrauen Ton gefärbt wurde. Sie liest einen neuen Roman, einen Bestseller, ein gutes Buch, das Mode ist. Sie nimmt aus einer Bonbonniere auf anmutige Weise ein Stückchen Konfekt. Sie ist – kurzum – eine Frau der Großbourgeoisie, wie sie in allen Ländern Europas ist. Heroismus ist keine Eigenschaft dieser Schicht. Aber nun wird Heroismus von ihr verlangt. Sie soll ablegen Bestseller, Wolldecke und gepflegte Haut, sie soll – 38 Jahre wie sie ist – ihr vergangenes Leben für einen Irrtum erklären, dieses Leben aus Sorge für einen guten Haushalt und gute Kleider, dieses Leben aus Ehe und Kindern, und sie soll das Pflegen von Kühen, das Setzen von Orangenstecklingen in trockener Erde unter glühender Sonne ansehen als Ziel für künftige Generationen, dem sie sich zu opfern hat. Diese reiche Frau besitzt nichts als die 1000 Pfund[4], die der Palästinaauswanderer 1933 ausführen durfte, die in der ganzen Welt kein Kapital sind und nun plötzlich in Palästina ein Kapital sein sollen.
Auf dem Schiff fahren die jüdischen Ärzte, seit 1000 Jahren jüdische Ärzte, gelehrte und ungelehrte. Spezialisten und Nichtspezialisten. Ihr Wissen ist eitel geworden, eitel ihr Wollen. Die Welt braucht sie nicht. Hier in Palästina werden einige Hundert arbeiten können.
Auf dem Schiff fahren jüdische Verkäuferinnen, die tagaus, tagein Mäntel verkauft haben oder Schuhe oder Lebensmittel im Warenhaus – eine von ihnen trägt ein goldenes Armband mit dem Davidstern. Ihre Kollegenschaft, organisiert in der Nazizelle, die sie aus der Arbeit entließ, hat es ihr zum Abschied geschenkt.
Ankunft in Tel Aviv, 1936
Ein Herr mit dünnen Beinen, einem dicken Bauch und einem kleinen, unschönen Stadtgesicht, ist hier auf dem Schiff im Angesicht von Meer und Himmel und dem felsigen Eiland eine komische Figur, aber hinter dem Schreibtisch ein guter Anwalt des Rechts oder ein förderungswilliger Redakteur oder ein gewissenhafter Arzt oder ein Kaufmann für Mäntel oder Emaillegeschirr.
Auf dem Schiff fahren Mutter und Tochter. Die Mutter ist eine alte, vornehme Berliner Bürgerin. Sie spricht mit dem Steward Italienisch, kann es, wie alle Damen ihrer Generation, die es für die Italienreise lernten, die man zwischen 1890 und 1914 machte. Sie denkt an Berlin, wo sie eine Dame der Gesellschaft war, wohltätig und liebenswürdig. Sie liegt im Liegestuhl, schmal, blass und schön, mit feinen hochhackigen schwarzen Halbschuhen. Die Tochter trägt Stiefel und Windjacke, aus der die geöffnete Sportbluse heraussieht, die glatten Haare sind männlich kurz geschnitten. Sie ist klein und dick, eine nette, tüchtige Arbeiterin, sie wird aufs Land gehen, Kühe zu melken und Hühner zu füttern. Ihr sind die Formen der Gesellschaft, ihre Ansprüche an Kultur und Luxus gleichgültig, tief gleichgültig auch ihre geistigen und seelischen Probleme, ihr Ringen um Kunst und Wissenschaft. Sie hält den Aufbau eines national jüdischen Lebens – kleines Leben auf eigenem Boden – für wichtiger.
Auf dem Schiff fahren zionistische Akademiker. Viele von ihnen waren von echter Bewegtheit. Sie waren keine Emigranten, sondern Heimkehrer, erfüllt von unklaren Erwartungen, in denen sich die Sehnsucht nach einer Vereinigung mit anderen Volksgenossen mischte mit dem uralten Blutsgefühl, dem Messiasglauben an Erlösung durch das Land Israel. Wer mit einem leidvollen Herzen nach Palästina fuhr, galt ihnen als Hochverräter. Sie betrachteten die Katastrophe mit Erklärungen, nicht mit Empörung. Sie hatten alles erwartet. Die deutschen Ereignisse würden sich morgen in Frankreich und übermorgen in England wiederholen. Die Entwurzelung der deutschen Juden bestehe seit der Emanzipation, die Entwurzelung nämlich aus dem Judentum. Eine Verwurzelung im Deutschtum gebe es nicht. »Durch die deutschen Judengesetze«, sagte ein Herr auf dem Schiff, »ist die Lüge der Emanzipation aufgehoben worden, die Lüge, dass die Juden keine Nation seien. Es gibt keine Auswanderung nach Palästina, es gibt nur eine Repatriierung.« Sie unterschieden zwei Rassen, Zionisten und Assimilanten. Brücken führten zu den Blut- und Bodentheorien des Nationalsozialismus, aber keine Brücke führte zum Assimilanten. Es gab keine Tragödie der deutschen Juden, sondern nur eine Komödie der Irrungen seit 150 Jahren.
Auf dem Schiff fahren vergnügte Leute. Sie waren fleißige Bürger aus kleinen Städten, aus einem unfreien Leben, und diese Vertreibung auf ein Luxusschiff hatte für sie eine ununterscheidbare Ähnlichkeit mit einer Vergnügungsreise auf dem Mittelmeer. Man spielte Bridge und knüpfte Beziehungen an, und das Leben ging weiter.
Andere, die ihrer Heimat beraubt und unter bitteren Leiden aus ihren Berufen geworfen waren, blieben, Verzweifelte, in ihrer Kajüte, weil sie die Verkleinerung ihrer Schmerzen nicht ertrugen. Im Galuth[5] gab es Mitgefühl. Das ist kein Brot. In Palästina würde es Brot geben. Aber der Mensch lebt nicht von Brot allein.
Dort drüben lag Hellas. Aus der gerundeten Säule war alle Schönheit Europas aufgestiegen. Teilgenommen und mitgeschaffen hatten an Europa fünf Generationen deutscher Juden. Wir fuhren nach Asien zum großen Menschenbrei, wo von Ewigkeit zu Ewigkeit der leidenden Kreatur die Helfer erwuchsen. Aber die Mehrzahl der Passagiere bekannte sich weder zu Hellas noch zur leidenden Kreatur, sondern zur Politik.
Als wir an Land kamen, sah ich, dass der Mond nicht mehr ging, sondern – ein Boot – auf dem Rücken schwamm, und das Sternbild des Wagens stand nicht mehr auf seinen Rädern, sondern fuhr schief nach unten. Mond und Sterne, letzter himmlischer Trost fürs irdisch leidende Herz, ich erkannte sie nicht mehr.
»Sehen Sie«, sagte ich, »der Mond liegt doch hier, er sieht uns nicht mehr an.«
»Meinen Sie?«
Niemand bemerkte es.
Die Freiheit war untergegangen und der Humanismus, und sie bemerkten es nicht. Aber sie sahen auch nicht, dass die Gestirne ihrer Jugend eine andere Bahn liefen.
Und so stand ich einsam im unbefreundeten Kosmos.
Klima
Nur der Norden kennt den Rhythmus der Jahreszeiten, die Kurve aus Blüte, Frucht und Tod. Nur hier ist der Frühling Ereignis, nur hier das grüne Blatt, entkeimt aus weißem Tode, Leben gebärend, nur hier der Sommer heiße Lohe, zu entzünden, zu betäuben, zu verbrennen. Nur hier ist Wille zu Neuem und Bewegung.
Im Süden geht die Natur ihren Gang und der Mensch seinen ganz anderen.
Im Vorderen Orient, woher die Religionen Europas, Amerikas und Vorderasiens stammen, begleitet das Klima den Menschen nicht, es widersteht ihm.
Zwei Zeiten hat die orientalische Erde, die trockene von Mai bis Oktober, die nasse von Oktober bis Mai. Nicht riecht es nach Keim und Schöpfung, wenn der Schnee schmilzt, und im Oktober flammt nicht Rot und Gelb, nicht fällt die Frucht, reif und herbstlich, vom Baum. Das ganze Jahr ist Ernte und Blüte zu gleicher Zeit. Immer reift etwas und immer blüht etwas. Alle Bäume bringen ihre Frucht zu ihrer eigenen Zeit.
Im September ist die Hitze noch immer sehr groß. Die Bäume sind grau von Staub, die Straßenränder, die Felder braun und grau. Die Erde ist rissig von Dürre. Alle Büsche, Blätter, Nadeln, Palmen sind dick mit Staub belegt, sodass man mit dem Gartenschlauch herumgehen möchte, Blätter sauber machen. Es war im Juli und August viel heißer, aber nun fängt man an, müde zu werden, schlapp, und man sehnt sich nach Kühle. Man möchte heraus aus dem Dampfbad, aber es ist überall gleich heiß. Wenn in Europa der Tag glüht und die Luft voll von Spannung ist, wartet man, dass der Wind sich erhebe, der dem Gewitter vorangeht. So wartet man hier zwei Monate. Im Oktober beginnen die Gebete der Juden um Regen.
Eines Tages ist der Regen da, und nun spricht man von wenig anderem: »Früh ist der Regen da«, oder: »Spät ist der Regen da«. »Stark ist der Regen«, oder: »Schwach ist der Regen«. Aber man weiß seit Tausenden von Jahren: Es beginnt im Oktober zu regnen, und es hört auf im Mai.
Nach dem ersten Regen beginnt das Land zu grünen. Auf den Äckern sprießt es. An den Wegrändern zeigen sich die ersten Blumen, Wiesenschaumkraut, das hier gelb ist, grünes Blättergras, Löwenzahn.
Und nun kommen die Januarstürme, Donner und Blitz. Regen ist nicht mehr Tropfenfall, Regen ist Wolkenbruch, ist Kübelguss. Regen fällt nicht mehr lotrecht vom Himmel, Regen peitscht schräg an die Häuser. Nichts hält ihn ab, unpassierbar wird das Land, Eisenbahndämme brechen ein. Der Regen dringt über die Terrassen, durch die Türspalte, durch die Fenster, durch Rollläden und Fensterläden. Auf die Fensterbretter legt man Tücher, trotzdem sind im Nu die Zimmer überschwemmt. Das Meer überflutet den Strand von Tel Aviv. Die ungepflasterten Straßen der Jerusalemer Vororte sind nur hüpfend zu passieren. Vom Karmel stürzen die Wassermassen, Bächen gleich, durch die bergigen Straßen Haifas. Dagegen hilft kein Schirm, kein Regenmantel, nur Gummistiefel und Lederjacke.
Währenddessen ist Apfelsinenernte, währenddessen ankern im Hafen von Jaffa im Sturm die Schiffe für die Apfelsinen.
Aber nicht täglich regnet es. Man kann nicht sagen: »Nun den Ofen geheizt für drei Monate oder vier.« Es ist ein ständiger Wechsel. Pelzjacke und Wollkleid und Tuch um den Hals in der kalten Wohnung, das ist nur ein Tag. Schon am nächsten Tag scheint die Sonne. Schon am nächsten Tage ist es warm, man sitzt im Freien, liest in der Sonne, freut sich am Blühen, denn überall sind jetzt rote Anemonen oder kurze rote Mohnblumen dicht über der Erde. Die Obstbäume blühen und die Wiesen, das Getreide ist grün, und die Orangenblüten duften. Und es ist richtig warm, 18, 19, 20 Grad, Mittelmeersüße, bis wieder zwei Tage später Regenguss einsetzt, sintflutartig, als wollte es vierzig Tage und vierzig Nächte regnen.
Wo blieb Frühling, wo Sommer, wo Winter, wenn am blühenden Orangenbaum die goldene Herbstfrucht hängt und daneben blätterlos die Akazie trauert und der Oleander graues Wintergestrüpp zeigt?
Immer ist Ernte. Blumenkohl, groß wie kleine Wagenräder, reift im Dezember, und im Januar kommen die ersten Tomaten. Im April sind Stoppeln auf den Feldern, und gelb wogt das Getreide da im März und da im Mai. Im April beginnen die Oleander zu blühen, Akazien, Goldregen, Mimosen. Im Mai stehen die Gärten in voller Blüte: Büsche von Margeriten, Büsche von Geranien. Im Mai reifen Melonen und Gurken.
Im Mai kommt der Chamsin, ein Wind aus der arabischen Wüste, der unberühmte Bruder des berühmten Samum. Der Samum aus der Sahara geht nach Europa, er weht durch Italien als Scirocco, geht über die Schweizer Berge als Föhn, und noch in Wien werden die Menschen zärtlich, müde oder nervös, weil in der Wüste Tausende von Kilometern entfernt ein Wind sich erhob. Der Chamsin ist glühend. Die Luft steht. Der Himmel ist grau. »Es ist Chamsin«, sagt früh der Erste, und man schließt rasch die Fenster, macht die Läden zu, geht nicht aus dem Haus. Die Geschäfte stehen still. Verabredungen werden nicht eingehalten. Im Freien wird nicht gearbeitet. Die Straßen sind leer. Glühend weht ein heißer Wind von Osten. Alles fasst sich an wie gekocht. Die Betten sind warm wie mit einem Wärmekissen.
Ein ungeheurer Kampf hat eingesetzt. Die Wüste, tötend und lähmend, schickt sich an, das Land zu überfallen, um alles Lebendige auszudörren. Das Meer ist wie Blei. Unbewegt und hinter grauen Nebeln versinkt eine trübe Sonne.
Im Kampf der Natur steht man abseits, verhält sich ruhig, ist wie gelähmt. Nur nichts tun müssen! Nur liegen können! Säuglinge überleben diese Tage schwer, kleine Kinder müssen zu Hause bleiben. Die Lilien im Garten werden dünne Stängel. Die Rosen verwelken. Diese Tage ließen die Reisenden in der Wüste vor Durst sterben, und die Skelette der Kamele waren das Wahrzeichen des alles tötenden Chamsin.
Da erhebt sich das Meer. Es wird grün und blau, es tanzt, es hat weiße Schaumköpfe. Die Sonne steht strahlend, legt sich – glühende Schönheit – in ein von rauschenden Vorhängen blau und violett und gelb umwalltes Bett. Das Meer hat gesiegt. Da hört man sie rufen wie Herolde, den Milchmann, den Eismann, Kutscher, Chauffeure: »Der Chamsin ist vorbei.«
Und es weht der Westwind, kühlende Brise vom sieghaften Meer.
Während Juli, August, September herrscht die normale Hitze des Sommers, der trockenen Zeit. Längst ist alles verblüht. Auch die Bäume werden grau und schmutzig. Sand und Dürre treten an die Stelle des Schnees. Es ist ein hässlicher Tod.
37 Grad im Schatten ist die Durchschnittstemperatur des Sommers, aber es gibt wenig Schatten im Land.
Der Tag hat fast immer die gleiche Länge. Rasch steigt morgens die Sonne; wenn sie sinkt, ist es rasch kalt und rasch dunkel. Es gibt keine blaue Stunde, es gibt keine Dämmerung. Jäh ist der Wechsel. Glühend endet der Tag, und schon ist es zu kalt, um im Garten Abendbrot zu essen. Nass wie nach starkem Regen sind die Stühle am Abend vom Tau, und die Wäsche trocknet nur in der Sonne.
Wunderbar sind die Nächte, erfüllt von Sternen, im Februar wie im Dezember, im Mai wie im August. Der Himmel ist höher als im Norden. Der Mond steht im Zenit wie die Sonne. Die Hälfte des Monats beherrscht der Mond die Nacht, bringt in den großen Städten das elektrische Licht zum Schweigen durch seine Helligkeit, wirft einen kurzen, scharfen, schwarzen Schatten. Der Mond ist feierlich und streng, wie Wüste und Sonne.
Das Klima ist nicht gemäßigt. Von Oktober bis Juli ist drei viertel aller Tage schönes Sommerwetter, blauer Himmel und Wärme. Es ist Riviera, aber ohne Stille. Wind herrscht, Bergwind oder Seewind. Immer klappern Fenster und Türen, immer heult der Wind, immer fängt er sich wie im Segel in der Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt ist, immer fliegen Sand und Staub ins Zimmer, immer raschelt Papier, immer bewegen sich die Lampenpendel an der Decke, immer huschen Gespenster, miauen Katzen, schreien Esel, klingt der Schritt nächtlicher Kamelkarawanen auf dem Pflaster oder dem Sand, steigt aus Geklapper und Geheul die Angst der Kreatur. Immer herrscht das Klima, nicht der Mensch, reißt der Sturm, stürzt der Regen, brennt das Gestirn.
Landschaft
Palästina ist ganz klein. Es ist so groß wie Sardinien oder eine deutsche Provinz. Aber es reicht vom Meer bis zum Schneeberg, umfasst Ebene, Gebirge, die tiefste Stelle der Erdoberfläche, höchste Fruchtbarkeit und Wüste. Es gibt das kalte Jerusalem und das glühende Jericho. In dem winzigen Land ist zwischen der Jordanebene und dem Gebirge ein Unterschied von sechs Wochen in der Reifezeit des Getreides. Es gibt die nordischen Obstbäume und die tropische Banane, Akazien und Palmen.
Das Land liegt hingestreckt zwischen Mittelmeer und Jordan, der von Norden nach Süden die heutige Grenze bildet, ein schmaler Streifen am östlichen Mittelmeer.
Dort drüben liegt Griechenland. Braune Segel, Fischer und Schiffer seit Odysseus, Klippen und Inseln, tausend Inseln, tausend Häfen, Meer und Land umarmen sich. Meer dringt vor und Land weicht zurück. Land dringt vor und Meer weicht zurück.
Dasselbe Meer ist hier. Aber es gibt keine Beziehung zwischen Land und Meer. Das Meer bespült das Land, das ist alles. Es gibt keine Häfen, es gibt keine schützende Bucht. Am Horizont fahren Fischerboote, weiße Segler am tiefblauen Himmel. Sie kommen von Malta. Am Horizont fahren Dampfer, italienische und französische. Sie kommen von Triest und Marseille. Es gibt keine palästinensische Schifffahrt. Die Juden Palästinas, braun und großartig, dem Wind vertraut, der Welle befreundet, lieben das feuchte Element und denken wie Ben Gurion, der Führer der jüdischen Arbeiterschaft: »Das Meer darf nicht die Grenze bilden, sondern wir müssen das jüdische Erez Israel ausbreiten und erweitern, wir müssen jüdische Schiffe mit jüdischen Kapitänen, jüdischen Matrosen haben und so die Verbindung mit den großen jüdischen Zentren und den Kulturzentren der ganzen Welt herstellen.«
Aber vor Palästina liegt eine Sandbank, dahinter erst leben die Fische, Krabben und Hummer. Das Meer ist tot an der Küste Palästinas. Das Gesicht des Landes ist nach der Wüste gekehrt. Auch die Juden kamen einst von der Wüste her. Alle Eroberer Palästinas kamen den Landweg. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird es jetzt vom Meer her besiedelt.
Palästinas Küste ist sandig. Hinter den Dünen beginnt die Orangenzone. Meilenweit stehen dunkelgrüne Büsche auf rotem Boden, eingefasst von gelb blühenden Mimosen oder von schmalen, kleinen, jungen Zypressen oder von grotesken Stachelkakteen. Meilenweit ist nichts zu sehen als die grüne Ebene der Orange, die Plantage, die soldatisch gepflanzte Fruchtproduktion. Dazwischen die rote Erde. Adam heißt Erde, adom heißt rot. Rot und Erde sind Synonyme. Adam, der rote Erdenkloß, aus der zähen, fruchtbaren, fetten, roten Erde Palästinas gebacken.
Zwei Türme kehren immer wieder: Der eine ist viereckig, von einer schwarzen Pyramide gekrönt, das ist der Turm der christlichen Kirche. Der andere ist rund, von einem Kegel gekrönt, das ist der Turm der mohammedanischen Moschee, das Minarett. An der Straße immer wieder die gleichen Bäume: der Eukalyptus, ein Baum aus Australien, glatter, hoher, grauer Stamm wie der Buchenstamm, Zweige wie die der Weide; ein dicker feister Baum, der Johannisbrotbaum; abseits der Straße vereinzelt die Sykomore, die Eiche des Orients, stark und knorrig, von grotesken Formen.
Im endlosen Grün der Orangenzone liegen arabische und jüdische Dörfer, arabische Städtchen und einzelne Herrenhäuser.
Die Häuser der alten arabischen Dörfer haben rote Dächer oder flache mit gewölbten Kuppeln, rundbogige Fenster, Terrassen und Außentreppen, sie sind bewachsen und umrankt. Seit Neuestem bauen auch die Araber modern, Schlitzterrassen, flache Dächer, gerade Fenster mit Schattenplatten darüber, genau wie die Juden. Wie in der ganzen Welt nimmt das Eigenleben, das Bodenständige ab und das Internationale zu, aber zugleich wächst der Nationalismus, das Trennende wird betont und das Zusammenwachsen der Kulturen verschwiegen. Die arabischen Dörfer sind gewachsen, die jüdischen sind angelegt und noch nicht von Grün umgeben. Die arabischen Häuser sind geworden aus endloser, nie unterbrochener Tradition. Die jüdischen kommen bestenfalls aus dem Katalog oder dem Wettbewerb: »Siedlungshäuschen zu 50 bis 200 LP.« Das kann nicht anders sein. Europa dringt in den Orient ein. Kolonialgebiet steht neben Uraltem. Uraltes ist überall schön, Kolonialgebiet ist überall hässlich.
Die Orangenbäume hören auf – der Aktivposten der palästinensischen Handelsbilanz –, und es beginnt die uralte Heimat des Menschen. Ölbäume, dick und grau, stehen im Getreidefeld. Das ist das biblische Palästina, das unveränderte; es ist das arabische. Bei den Schafen steht im weiten Mantel der gute Hirt, das Lamm im Arm und den Stock in der Hand. Es sicheln die Männer das Getreide, und Ruth geht hinter den Frauen, die die Ähren sammeln und in kleinen Bündeln auf die Erde legen. Sie trägt ein langes, weißes, rotbesticktes Gewand und ein langes, rotes Tuch über dem Kopf. Elieser, der Knecht, steht am Brunnen, aus dem Rebekka das Wasser schöpft. Man nährt sich von den Früchten des Feldes und schlachtet einen Hammel bei hohen Festen. So leben 500000 Fellachen.
Zwischen den Getreidefeldern der Juden liegt die moderne flachdachige Siedlung, in der Mitte das zweistöckige Kinderhaus, daneben auf hohen Betonpfeilern das Wasserreservoir. Die Häuser der Fellachen sind aus Lehm gebaut, aus der palästinensischen Erde selber, die jüdischen aus Holz oder Beton.
Arabische Frauen auf der Straße
Der arabische Bauer trägt das uralte lange Gewand des Ostens und ein Tuch auf dem Kopf. Er pflügt mit Pferd und Holzdorn. Im Dorf liegt auf allen Wegen das Getreide. Auf dem Dorfplatz drischt es der Ochse, und es wird ihm nicht das Maul verbunden.
Der jüdische Arbeiter trägt auf dem Felde im Winter die blaue Russenbluse über der Hose, Lederjacke und Schirmmütze, im Sommer Kakihose, den Oberkörper nackt, und runden Strohhut. Er bedient die großen Maschinen, den Traktor, die Dreschmaschine, die das Getreide zugleich schneidet und drischt und das Stroh bündelt. Längst wurde der Getreidebauer Maschinist.
Das arabische Palästina ist das biblische geblieben durch die Jahrtausende, das jüdische ist russisch. Die arabische Frau ist verhüllt. Auch die Fellachin, die das Gesicht frei hat, arbeitet im langen Kleid, sie trägt buntes gesticktes Gewand, farbige Ketten, Reifen um die Arme, Münzen um den Kopf. Die jüdische Frau arbeitet auf dem Felde mit nackten Schenkeln, kurzen Hosen, blauer Arbeiterinnenbluse, mit slawischem Kopftuch, mit manchmal geschminktem Mund, und zwischen der schweren Arbeit raucht sie eine Zigarette.
Der Araber reitet auf einer bunten Wolldecke mit Troddeln, er trägt Tuch über Tuch und einen goldenen Reif auf dem Kopf. Schönheit und Romantik des Orients um jeden Einzelnen. Der jüdische Wächter mit der Schirmmütze und der blauen Bluse reitet auf knappem Lederzeug oder sattellos, und wenn er einen Karabiner umgehängt hat, so wirkt er wie in russischen Filmen die Soldaten der Roten Armee von 1920, kühn, revolutionär, mit blauen Augen.
Dort sitzt in der Klematislaube bei sinkender Sonne der Scheich mit seinen Frauen, mit seiner Mutter, mit seinem Bruder, mit seinen Kindern. Hier wandern die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaftssiedlung dem Speisehaus zu, Spaten geschultert, Jüngling und Mädchen, die Kinder sind im Kinderhaus.
Dort ist noch alle Rohheit der Frau gegenüber. Der Araber reitet bequem auf dem Esel, lässt seine Frau, die sechzehn Stunden arbeitet, mit der schweren Last auf dem Kopf über die glühende Landstraße zu Fuß hinter sich hertraben.
Hier gibt es zum ersten Mal in der Welt einen Achtstundentag für die Hausfrau in der jüdischen Gemeinschaftssiedlung. Dort auf dem Dach des Hauses tanzen im Mondschein zwei Frauen vor ihrem Mann, der die Wasserpfeife raucht, sie wehen mit den Tüchern, und es ist sehr seltsam.
Hier sehen die beleuchteten Fenster der Gemeinschaftssiedlung in die Mondnacht. Politische Diskussion findet statt, und es wirbelt durcheinander halbgebildeter Unsinn und anständigste Gesinnung, Ringen um die letzten Fragen, Nation und Antikapitalismus, Arbeitsverteilung für den nächsten Tag und dass die Weltjudenheit nicht genug Geld gibt. Und das Weib schweigt nicht in der Gemeinde.
Dort bringt der Araber auf Kamel und Esel die Ernte fort. Hier fährt sie der Jude im Lastauto. Dort bringt die Fellachin, die Bäuerin selber, in einem Korb auf dem Kopf ihre Ware zur Stadt, um sie anzubieten. Hier gibt es die jüdische Verkaufsorganisation, die mit Lastautos die genormte Ware zur Stadt bringt, um sie in Spezialläden zu verkaufen.
Beim Fellachen laufen die Hühner im Hof hinter der Mauer. Im jüdischen Land sieht man die Wellblechhühnerställe, wissenschaftlich erprobt.
Dort lebt der bunte Hahn, hier die weiße Legerasse. Dort kommt ein winziges Ei heraus, hier das landwirtschaftliche Musterprodukt. Dort lebt eine Kuh, mager, knochig, klein, mit zottigem, dichtem Fell wie ein drahthaariger Foxterrier, mit schlechtem Fleisch und magerer Milch. Hier wird nach wissenschaftlicher Methode eine Kuh gezüchtet, die den Vergleich mit den besten Rassen der Welt nicht zu scheuen hat, prall und stark, mit glänzendem Fell, ausgezeichneter Milch.
Das Gehöft des Arabers versinkt hinter der Mauer mit dem gerundeten Tor. Die jüdische Siedlung umgibt der Drahtzaun. Dort weiden die Ziegen der Beduinen und fressen die jungen Triebe der Bäume und lassen so das Land seit Jahrhunderten immer mehr Wüste werden.
Hier bohren die Juden nach Wasser Hunderte von Metern tief, hier ziehen die Juden Kanäle, und aus der gewässerten Erde strotzt das Gemüse. Dort lässt der Fellache seit Jahrhunderten seinen Weinberg wachsen, den Ölbaum, die Feige. Hier raufen die Juden die Weinberge aus, um Orangen zu pflanzen, und wiederum die Orangenbäume, um Gemüsefelder anzulegen, je nach der Rentabilität.
Dort ist Allah und hier ist Erfolg. Dort sind Dornen und hier ist Versuchsland. Dort ist Morgenland, hier nicht Europa, sondern eine Mischung aus Russland und Amerika.
So ist das Land. Dazwischen blieb Christliches. Krankenhaus, Kloster, Schule an den heiligen Orten. Nüchternes Europa. Sieht aus nach dem, was es ist: nach russischer Orthodoxie, nach italienischem Franziskanerkloster, nach französischen Schwestern von Notre Dame. Es ist eindruckslos. Es ist saubere Zivilisation, wie die Gebäude, die meist aus dem 19. Jahrhundert stammen. Das Christentum in Palästina ist europäische Wohlfahrtspflege. Auf die jüdischen Kinder, die christliche Schulen besuchen, und es gibt ihrer manche, macht das Geregelte, die Autorität, die Ordnung, großen Eindruck, aber mit den Evangelien hat das nichts zu tun.
Die Kirche ist nur ein in den Orient versetztes Europa. Ihr Standort ist Rom, ist Genf, ist Wittenberg. Mitten im Getreidefeld großartig einsam ein Kreuzfahrerturm. Turm von der Ostsee von 1250. Dieser romanische Turm neben der Palme gibt eine seltsame Vision, Vision von dem Irrsinnigen der Kreuzzüge.
Dort ist eine kleine arabische Stadt. Viereckiger Kirchturm und kleines rundes Minarett. Stadtgarten wie in einem europäischen Badeort: Blumenbeete, Palmen, Bänke und Gitter. Bata-Schuhfiliale, Friedhof, wo die steinernen Bänke mit dem steinernen Fez, die Gräber der Araber, im Schatten hoher Eukalyptus ruhen. Großes offenes Café, Araber rauchen glucksend die Wasserpfeife, trinken aus kleinen Tassen Mokka.
Die Ebene endet. Gepflanzter Regierungswald[6] beginnt. Klein und kümmerlich standen noch vor zwei Jahren kleine Zypressen zwischen den Steinen. Jetzt hat sich alles entwickelt, Wurzel geschlagen, die Steine sind mit Grün bedeckt. Die Pinien sind schon wie Backfische. Johannisbrotbäume entwickeln sich und dazwischen ein rosa blühender Busch, der Rizinusstrauch, der Kikajon[7] des Propheten Jona.
Das Gebirge wird höher. Die Berge sind runde Kuppen, völlig kahl, ausgeglüht. Die Natur hat alles hergegeben an tausend Geschlechter, ist greisenhaft geworden, ist verkarstet. Hoch oben, auf uneinnehmbarem Berg, liegt ein Haus wie eine Burg, beherrschend das Land.
An die Berge sind Dörfer geklebt, die Häuser aus viereckigen Steinklötzen gemauert. Kaum zu erkennen. Es ist die heroische Landschaft des Bibelbildes. Dazwischen liegen blühende Täler.
Hier wächst der Feigenbaum des Paradieses, hier ist der Dornbusch, aus dem Gott zu Moses sprach, hier fällt das Samenkorn zwischen die Steine und wird vom Winde verweht wie im Gleichnis vom Sämann, hier ist der Weinstock Noahs und hier wächst der Ölzweig, den die Friedenstaube heimbrachte und der jenseits der Völkerscheide zu Olympia den Sieger kränzte. Auf solchen Felsen weidete Abel die Schafe und zogen Labans Herden und Jakobs Lämmer, Ziegen springen von Stein zu Stein und fressen die lila Disteln. Um die Feige rankt sich der Weinstock. Obstbäume mit gekalktem Stamm stehen im Tal. Vor den flachdachigen Häusern blüht der Granatapfelstrauch dunkelrot.
Nur noch Oliven wachsen weiter aufwärts in den Senken zwischen dem kahlen Gebirge, mächtige, hohle Stämme, wie uralte Weiden, grau und großartig. Lang gestreckte schwarze Beduinenzelte, die nach einer Seite völlig offen sind. Ein kalter Wind weht. Hoch oben sieht man wie Berghütten in der Schweiz Safed liegen oder Jerusalem.
Wirrnis Jerusalem
Jeruschalajim ist die heilige Stadt der aschkenasischen Juden, der sephardischen Juden, der orientalischen Juden aus Bagdad, Jemen, Nordafrika, Syrien, Mesopotamien, Persien und Buchara.
Jerusalem ist die heilige Stadt der griechisch-orthodoxen Christen, der katholischen Christen, der armenischen Christen, kurzum der Christen aller Kirchen und Bekenntnisse.
El Kuds – so heißt Jerusalem auf arabisch – ist, nach Mekka, die heiligste Stadt der arabischen Mohammedaner aller Länder.
Jerusalem ist der Sitz des High Commissioner, des Oberhauptes der englischen Mandatarmacht, Sitz der englischen Verwaltung des Landes. In Wellblechbaracken lagert das englische Militär. Tank und Flugzeug, Maschinengewehr und Kanone.
Jerusalem ist der Sitz des Mufti, Sitz des obersten mohammedanischen Rates, Sitz der herrschenden arabischen Familien.
Jerusalem ist Sitz der zionistischen Beamtenschaft, Sitz der Verwaltung des Nationalfonds, der zionistischen Institutionen. Sitz auch des obersten Rabbiners der Aschkenasim, des obersten Rabbiners der Sephardim.
Jede dieser Welten hat ihren Berg für sich, abgeschieden durch ein Tal von der nächsten Welt.
Getrennt durch das Tal Rephaim liegt der Palast des High Commissioners auf einem Berg im Südwesten.
Auf dem Skopus[8] liegt die Universität.
Im Nordosten sitzen die großen Araber auf ihrem Berg.
Durch das Kidrontal getrennt liegt die Burg des Keren Kajemeth im Nordwesten auf ihrem Berg.
Und getrennt von all dem liegt die Altstadt, wieder eine Welt für sich.
Die Altstadt oder Intra Muros
Die Altstadt ist rings von hohen grauen Mauern umgeben, mit gewaltigen Toren, mit zackigen Türmen. Die Stadt aus Stein scheint nicht gebaut, Häuser sind nicht zu erkennen, sie sind Gestein. Dach des einen Hauses ist Straße des nächsten Hauses. Aus dem Felsen wächst ein Haus, uneinnehmbare Burg, mitten in der Stadt. Schicht auf Schicht wohnt dort das Volk. Niemand kennt das Alter seiner Wohnung, vielleicht 2000 Jahre, vielleicht 400 Jahre alt … Nur schmale Gassen, kein Weg für Pferd mit Wagen, geschweige für Auto, in einer Stadt von ungefähr 15000