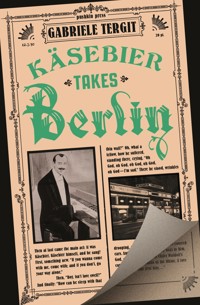14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Effingers ist ein Familienroman - eine Chronik der Familie Effinger über vier Generationen hinweg. Außer dass sie Juden sind, unterscheidet sich ihr Schicksal in nichts von dem anderer gutsituierter gebildeter Bürger im Berlin der Jahrhundertwende. Alle fahren sie im sich immer wiederholenden Lebenskarussell, das sich durch Glück, Schmerz, Leichtsinn, Erfolg und Scheitern dreht. Effingers ist ein typisch deutsches Bürgerschicksal in Berlin, wie es das der Buddenbrooks in Lübeck war. Als der Nationalsozialismus sich breitmacht, wird das deutsche Schicksal zu einem jüdischen. Wer wachsam ist, wandert aus. Die Geschichte der Familie Effinger beginnt mit einem Brief des 17-jährigen Lehrlings Paul Effinger, und sie endet mit einem Brief: dem Abschiedsbrief des nunmehr 80-Jährigen kurz vor seiner Deportation in die Vernichtungslager.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1188
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Zitat
1. Kapitel
Ein Brief
2. Kapitel
Kragsheim
3. Kapitel
London
4. Kapitel
Ein Versuch in Kragsheim
5. Kapitel
Reise nach Berlin
6. Kapitel
Ankunft
7. Kapitel
Eine Empfehlung
8. Kapitel
Besuch im Comptoir
9. Kapitel
Fabrik 1884
10. Kapitel
Der Anfang
11. Kapitel
Bankier Oppner kauft ein Haus
12. Kapitel
Aus Biedermeier wird achtziger Jahre
13. Kapitel
Krise
14. Kapitel
Waldemar Goldschmidt
15. Kapitel
Schraubengeschäft
16. Kapitel
Karl errichtet ein Konto
17. Kapitel
Visite
18. Kapitel
Konjunktur
19. Kapitel
Ein Ausflug
20. Kapitel
Festesvorbereitung
21. Kapitel
Die Einweihung
22. Kapitel
Verlobung
23. Kapitel
Besuch in Kragsheim
24. Kapitel
Der erste Enkel
25. Kapitel
Frühling
26. Kapitel
Der Sonntagmittag
27. Kapitel
Wege der Kinder
28. Kapitel
Zeitenwende
29. Kapitel
Gasmotoren
30. Kapitel
Theodor will heiraten
31. Kapitel
Der schienenlose Wagen
32. Kapitel
Die Musiker packen die Instrumente zusammen
33. Kapitel
Die Kinder kommen zurück
34. Kapitel
Sofie
35. Kapitel
Hochzeitsaufführung
36. Kapitel
Ein Hochzeitsdiner
37. Kapitel
Feierabend
38. Kapitel
Gasmotoren unter Preis
39. Kapitel
Kragsheim
40. Kapitel
Akkumulatoren-Debakel
41. Kapitel
Paul und Klara
42. Kapitel
Verlobung
43. Kapitel
Eine Ehescheidung
44. Kapitel
1900
45. Kapitel
Theodor verlobt sich
46. Kapitel
Theodor heiratet
47. Kapitel
Schulsorgen
48. Kapitel
Ein Autoausflug
49. Kapitel
Testament
50. Kapitel
Sofie im Fasching
51. Kapitel
Zwei kleine Mädchen
52. Kapitel
1907
53. Kapitel
Eine neue Jugend
54. Kapitel
Der Sonntagmittag
55. Kapitel
Unterschlagung
56. Kapitel
Emmanuel stirbt
57. Kapitel
Autorennen
58. Kapitel
Goldene Hochzeit
59. Kapitel
Zukunftsprobleme
60. Kapitel
Frauenversammlung
61. Kapitel
Tanzstunde
62. Kapitel
James
63. Kapitel
Einkäufe
64. Kapitel
Sommerreise 1911
65. Kapitel
Aufbruch der Jugend
66. Kapitel
Der Maskenball
67. Kapitel
Sommerreise 1912
68. Kapitel
Frühling
69. Kapitel
Der Judenstaat
70. Kapitel
Aufsichtsratssitzung
71. Kapitel
Doktor Merkel
72. Kapitel
Der 28. Juni 1914
73. Kapitel
Kriegsausbruch
74. Kapitel
Fahnen
75. Kapitel
Die verlorene Schlacht
76. Kapitel
Erwin wird Soldat
77. Kapitel
Lottes neuer Anfang
78. Kapitel
Sofies Erlebnis
79. Kapitel
James im Osten
80. Kapitel
Winter 1916 – 1917
81. Kapitel
Mehlkiste
82. Kapitel
Nachricht von Alexander
83. Kapitel
Gefangennahme
84. Kapitel
Rußland
85. Kapitel
Gefangenschaft
86. Kapitel
Sofiens Reise 1918
87. Kapitel
Kragsheim 1918
88. Kapitel
Kriegsende zu Hause
89. Kapitel
Kriegsende auf dem Balkan
90. Kapitel
November 1918
91. Kapitel
Das Ende einer Bürgerin
92. Kapitel
Briefwechsel Martin/Marianne
93. Kapitel
Die Seuche
94. Kapitel
Eine neue Welt
95. Kapitel
Herbert
96. Kapitel
Sonntagmittag 1919
97. Kapitel
Flucht
98. Kapitel
Brief
99. Kapitel
München, Winter 1919–1920
100. Kapitel
Das Kolleg
101. Kapitel
Kragsheim 1920
102. Kapitel
Wirrungen und Lösungen
103. Kapitel
Ein Brief
104. Kapitel
Erkenntnis
105. Kapitel
Heidelberger Sommer
106. Kapitel
Ein philosophisches System wird gefunden
107. Kapitel
Die Katze
108. Kapitel
Marianne
109. Kapitel
Ein Kind
110. Kapitel
Wohnungssuche
111. Kapitel
Zwei Generationen
112. Kapitel
Volksauto
113. Kapitel
Das junge Mädchen
114. Kapitel
Harald
115. Kapitel
Sonntagmittag 1921
116. Kapitel
Bühne
117. Kapitel
10000 Mark waren einen Dollar wert
118. Kapitel
30000 Mark waren einen Dollar wert
119. Kapitel
47000 Mark waren einen Dollar wert
120. Kapitel
Eine Million Mark waren einen Dollar wert
121. Kapitel
Zwei Millionen Mark waren einen Dollar wert
122. Kapitel
Fünf Millionen Mark waren einen Dollar wert
123. Kapitel
Stabilisierung
124. Kapitel
Kragsheim
125. Kapitel
Eine Illustrierte
126. Kapitel
Kipshausen
127. Kapitel
Selmas Geburtstag
128. Kapitel
Mord
129. Kapitel
Begegnung zu Landro
130. Kapitel
Gemütlicher Abend
131. Kapitel
Frühling 1930
132. Kapitel
Abschluß eines Menschenlebens
133. Kapitel
Die große Krise
134. Kapitel
Bankrott
135. Kapitel
Der graue Salon
136. Kapitel
Zum letztenmal
137. Kapitel
Vermieten
138. Kapitel
James ist krank
139. Kapitel
Begegnung mit Schröder
140. Kapitel
Wen die Götter lieben
141. Kapitel
Der letzte Stolz
142. Kapitel
Macht
143. Kapitel
Anfang vom Ende
144. Kapitel
Es geht alles noch eine Weile weiter
145. Kapitel
Paul verliert die Fabrik
146. Kapitel
Der goldene Wimpel
147. Kapitel
Besuch auf einer Gemeinschaftssiedlung
148. Kapitel
Brandfackeln
149. Kapitel
Sommer 1939
150. Kapitel
Waldemar
151. Kapitel
Ein Brief
Epilog
Nicole Henneberg »Mich interessieren Menschen«
Stammbaum
Autorenporträt
Über die Herausgeberin
Über das Buch
Impressum
»… Uns hebt die Welle, Verschlingt die Welle, Und wir versinken.
Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben, Und viele Geschlechter Reihen sie dauernd, An ihres Daseins Unendliche Kette.«
Goethe
1. Kapitel
Ein Brief
Ein junger Mann, Paul Effinger, siebzehn Jahre alt, schrieb 1878 einen Brief:
»Meine hochverehrten Eltern!
Euren 1. Brief vom 25. cr. habe ich empfangen, und beeile ich mich, denselben zu beantworten.
Auch hier merkt man den großen Aufschwung, der überall zu bemerken. Ich arbeite nun in der Eisengießerei, und ich kann sagen, es ist eine schwere Arbeit. Wir fangen um 5 Uhr früh an und hören um 6 Uhr am Nachmittag auf, das sind elf Stunden Arbeit. Vielfach wird aber auch erst um 7 Uhr aufgehört. Für die Arbeiter ist das schrecklich. Sie wohnen oft weit entfernt und kämen nur fünf Stunden zur Ruhe, wenn sie nach Hause gehen würden. So machen sie sich in den Fabriksälen selber eine Lagerstatt und liegen dort, nach Geschlechtern nicht getrennt, in der scheußlichsten Weise durcheinander. Der Arbeiter ist hier tatsächlich nur ein besserer Bettler. Ich denke über diese Dinge viel nach. Abends versuche ich, mich technisch fortzubilden. Auch höre ich zweimal in der Woche Handelslehre. Französisch treibe ich auch.
Aber nun die Hauptsache, was Euch, meine sehr verehrten Eltern, gewiß viel Freude machen wird. Ich war am Sonntag zum Mittagessen bei meinem verehrten Chef eingeladen. Alle, die ausgelernt haben, waren eingeladen. Es war sehr schön. Es gab Wein, und ich saß neben der Dame des Hauses, was mir eine fast zu große Ehre scheint. Es ist auch eine Tochter da. Aber die Tochter hat nichts für die jungen Leute übrig. Sie sprach nur mit einem Leutnant. Die Leutnants sind hier angebetet wie die Herrgötter. Herr Rawerk läßt Euch grüßen.
Es wird Euch interessieren, daß der Kaiser und Bismarck anläßlich der Kaisermanöver hier durchgekommen sind. Herr Rawerk und wir alle wollten dem ehrwürdigen Kaiser und dem großen Bismarck unsere Ovation darbringen. Aber wie das machen? Da kam unser Werkmeister auf eine geniale Idee. Und sie wurde auch ausgeführt. Als der Extrazug passierte, hatte sich ein großer Teil der Arbeiter auf die Backsteinpfeiler der Fabrikseinzäunung gestellt, jeder mit einem Stoß Kohlen, sogenannten Briquetts, im Arm und eine möglichst monumentale, oft recht malerische Stellung annehmend. Der Anblick war höchst originell und für das industrielle Rheinland gewiß sehr charakteristisch. Kaiser Wilhelm grüßte denn auch mehrmals aus dem Zuge.
Ihr seht, ich lebe hier mitten in der großen Welt. Am Sonntag aber war ich in St. Goar. Ich bin mit dem Rheindampfer hinuntergefahren. Es war sehr voll und die Menschen sehr ausgelassen. Damit Ihr nicht denkt, daß ich sehr leichtsinnig bin, muß ich Euch sagen, es war die erste Rheinfahrt seit drei Jahren, und ich lege auch jeden Pfennig meines Salärs zurück.
Nun lebt wohl, grüßt alle Geschwister
und empfangt die innigsten Grüße Eueres
Euch tief verehrenden
Sohnes Paul.«
Der junge Mann, ein kleiner, unscheinbarer, hellbraunhaariger Mensch, nahm mit raschen und tüchtigen Bewegungen die Streusandbüchse und trocknete das Geschriebene. Dann schrieb er mit schwungvoller Kaufmannsschrift:
»Wohlgeboren Herrn Uhrmacher Mathias Effinger, Kragsheim«, nahm eine Marke und trug den Brief zur Post.
2. Kapitel
Kragsheim
Kragsheim bestand aus drei Schichten. Gegen den Bergrücken die alte Stadt, Häusergeschachtel, leise Südlichkeit der Straßen, Lindengeblüh, Flieder und Goldregen, Gassen, Laternen an den Fachwerkhäusern. Hier waren die Läden und der Markt, Bögen gegen Regen und Sonnenhitze. Hier saß das Handwerk, im Tor der Schmied, in der Werkstatt Schuhmacher und Schneider, hier saß Mathias Effinger, der Uhrmacher. Die Häuser hatten alte Namen, sie hießen »Blauer Schlüssel«, »Goldene Krone«, »Weißer Flieder«. Über allem aber standen die Türme von St. Jacobi, Drohung und Schutz und Ewigkeit für das gegiebelte kleine Gewimmel. Die Kirche war innen weiß. Die Stadt war protestantisch, hatte die Freiheit eines Christenmenschen tapfer verteidigt gegen die katholische Liga, Gustav Adolf Quartier gewährt. Dreißigtausend Einwohner hatte die Stadt, als der Dreißigjährige Krieg begann, dreitausend krochen verwildert, verhungert, scheu aus den Häusern, als er geendet hatte, und die Schweine liefen über die Gassen.
Im Jahre 1878 hielt die alte Mauer noch immer Zünfte und Bürger in engen Schranken.
Vor dem Tor mit Voluten und Kugeln begann die zweite Schicht. Man kam vom 16. ins 18. Jahrhundert, vom ehrenamtlichen Ratsherrn zum bezahlten Beamtentum, vom Landsknecht zum Offizier. Zwischen gelagerten einfachen weißen Häusern führte eine breite Kastanienallee zum glühheißen weiten Platz vor dem gewaltigen Schloß, dem Ziel. Hier wurden einst Prinzessinnen eingeholt, von hier ritt der Landesherr mit seinen Freundinnen zur Jagd, achtspännige Karossen, die Pagen auf dem Trittbrett, auf den Pferden die Lakaien mit weißem Zopf und hellblauen Seidenfräcken und rosa Westen bis zum Knie. Tief bückte sich der Untertan, ertrug Abgaben und Einquartierung, bewunderte den Glanz des Schlosses, das nie völlig bezahlt worden war. Die napoleonischen Kriege hatten schließlich die Handwerkerrechnungen zerfetzt. Jetzt gingen Fremde ins Schloß, sahen Park, Wasserkünste, Naturtheater, künstliche Ruinen, das fächerförmige Teehaus, rot mit hellblauen Ornamenten. Im Schloß saß der Fürst. Er ließ sich einfache Zimmer herrichten, aber an großen Tagen, wenn der Kaiser aus Berlin kam, brannten in der Spiegelgalerie, im Porzellanzimmer, im blauen und gelben Kabinett immer noch die hundertkerzigen Kristallkronen und beleuchteten den Märchenglanz einer versunkenen Welt aus amaranthrotem Damast und verwaschenen Silberrahmen und Stuck, der wie Schaum an die Decke geschlagen war.
Dahinter begann die dritte Schicht. Fluß, Wiese, Landstraße und Dorf, Berge und Wälder, duftvoll von Quellengeriesel. Von den Bergen sah man auf die rotgieblige Stadt hinterm Rokokotor. Hoch wuchs der Weizen, fruchtbares süddeutsches Land. Auf dem Brücklein stand der heilige Christophorus und am wogenden Acker der Gekreuzigte. Schon im nächsten Dorf läutete das Ave. Schon im nächsten Dorf war der alte Glaube, der Katholizismus, geblieben.
Die Husaren zogen durchs Tor mit den Kugeln und Voluten. Blaue Husaren mit weißer Verschnürung, kleine Fähnchen an der Lanze. Die Leute liefen ans Fenster. Hinter den Husaren kam der Postwagen. Der Schwager spielte: »Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus.« Der Postbote im gelben Rokokofrack klingelte beim »Auge Gottes«, einem Haus mit Fachwerkgiebel, das vorn drei Etagen hatte, aus deren oberster man hinten in den Obst- und Grasgarten kam. Unten war der Uhrladen.
Die Türglocke gab hellen Laut durchs ganze Haus. Effinger nahm das Vergrößerungsglas aus dem Auge. Er trug ein schwarzes, rotgesticktes Samtkäppchen und einen hellbraunen Backenbart, wie Wilhelm der Erste und Kaiser Franz Joseph von Österreich, zu deren Generation er gehörte.
»Grüß Gott«, sagte der Postillon, »viel Post, Herr Effinger!«
»Lauter Liebesbrief’.«
»Ich glaub’s auch.«
»Was zu bezahlen?«
»Nein.«
»Ihr seids billige Leut.«
»Auch net überall. Grüß Gott.«
»Grüß Gott.«
Er setzte sich behaglich hin, um zu lesen. Eine Bestätigung kam von den Bankiers Gebrüder Effinger in Mannheim, seinen Brüdern, über 200 Gulden erspartes Geld, das Effinger nach Mannheim gesandt hatte: »Teilen wir Ihnen mit, daß wir Ihnen 200 Gulden gutgeschrieben haben.«
Ein Brief aus dem Schloß: Er solle doch kommen und die Uhren nachschauen. Der Hahn in der Turmuhr, der immer die Stunden ausgerufen habe, rufe nicht mehr.
Es war ein Ticken im Raum wie von einem Regiment Spechte. Das Ticken ging durcheinander. An der Wand hingen und standen sie: weiße Porzellanuhren mit eingelassenem Zifferblatt, hübsch mit Gold und Blümchen bemalt, der Dom von Köln in Alabaster unter einem Glassturz, eine Pariser Uhr, goldbronzene Schäferin, die mit einem Stab auf ein Glöckchen die Stunden anschlug, viele Taschenuhren, die dicken der Bauern, flache, dünne der Kavaliere vom Hof, der Herren Offiziere und der Herren von der Regierung und kleine Damenuhren an Ketten.
Es war acht Uhr in der Früh. Die Uhren schlugen hell, die Turmuhr schlug tief und dumpf dazwischen. Nie schlugen die Uhren gemeinsam. Es war nicht zu erreichen.
Effinger hörte einen Augenblick zu, dann öffnete er ein neues Kuvert. Angebot einer Uhren-Engroshandlung: »Da zur Zeit die Wohnungen im altdeutschen Geschmack eingerichtet werden, biete ich Ihnen einen Regulator in Form eines Hauses in deutscher Renaissance an. Derselbe kann neben jedes Möbelstück einer modernen stilreinen altdeutschen Einrichtung aufgehängt werden.« Effinger ärgerte sich über das Angebot, murmelte: »Ein schöner Schund wird das sein«, nahm die Privatkorrespondenz zur Hand und ging durch den geräumigen weißen Flur, auf dem ein riesiger brauner Schrank stand, in das Wohnzimmer im ersten Stock, wo Frau Effinger im Erker saß und einen Hefeteig rührte.
»Ein Brief vom Paul.«
Minna Effinger, eine große, knochige Frau, wischte sich die Hände an der Schürze ab und las den Brief.
»Na, was sagst dazu?« fragte sie.
Aber Mathias sagte nur: »Hier ist noch ein Brief aus Heidelberg.«
»Von der Amalie wohl.«
»Meine Lieben!
Entschuldigt, wenn ich heute geradezu mit meinem Anerbieten komme. Soweit ich weiß, ist Eure Helene nun ins heiratsfähige Alter gekommen, und da Ihr sie sicher bei Euren vielen Kindern gern versorgt, will ich Euch eine gute Heirat antragen. Der junge Mann, Julius Mainzer, ist siebenundzwanzig Jahre alt, gesund und von gutem Herkommen. Er hat einen Manufakturladen in Neckargründen, und ist er ein tüchtiger Kaufmann. Er bräuchte eine Mitgift von einigen tausend Mark. Ich habe ihm erzählt, daß Helene eine so tüchtige Person ist, eine gute Schafferin und Hausfrau. Er ist sehr einverstanden, vorausgesetzt, daß sie ihm und er ihr gefällt. Denn das müssen sie schon. Ich schlage Euch vor, daß Ihr kommenden Samstag herüberkommt. Für ihn ist es ja ein Katzensprung. Gefällt er Euch, dann soll Helene bald auf Logierbesuch kommen.«
»Was hältst du davon?« fragte Frau Effinger. »Ich hätt’ das Mädel gern noch im Haus behalten. Man kann doch gar nicht wissen …«
»Jung gefreit hat noch niemand gereut«, sagte Effinger. »Wir fahren am Samstag hinunter an den Neckar.«
»Gott segne uns«, sagte Frau Effinger.
»Amen«, sagte Effinger. Er zog die Tür hinter sich zu, ging hinunter, steckte das Vergrößerungsglas ins Auge und untersuchte die Rädchen. Als die Tür zu war, wußte Frau Effinger, daß in einem halben Jahr die Helene hinterm Ladentisch in Neckargründen stehen würde. Der Vater erlaubte nicht, daß die Mädchen auf höhere Schulen kamen. »Handwerkerskinder sind Handwerkerskinder«, sagte er.
Benno, ihr ältester Sohn, war in England, er arbeitete in einer Wirkwarenfabrik in Manchester. Karl lernte in einem Bankgeschäft in Berlin. Paul war im Rheinland. Willy lernte beim Vater Uhrmacher. Vier tüchtige Söhne. Sie wischte sich die Tränen ab. Helene würde nach Neckargründen heiraten. Blieb die kleine Bertha. Frau Effinger saß im Erker und schlug den Hefeteig, manchmal klapperte ihr Schlüsselbund.
3. Kapitel
London
Paul Effinger stand neben seinem Bruder Benno 1883 auf der London Bridge. »Ich bin überzeugt«, sagte er, »daß Deutschland eines Tages genau so viel exportieren und verdienen kann wie England. Wenn ich nur etwas mehr Kapital hätte!«
Benno trug sich englisch in einem weiten Anzug aus derbem Stoff, nannte sich Ben und sprach mit etwas englischem Akzent. Es war schnell gegangen. »Come along«, sagte er, »reiß dich los von der englischen Handelsmarine. Wir wollen lunchen. Ich sage dir noch einmal: Bleib in London! England ist England! In Deutschland ist alles eng. England ist die Welt. Hier kommt man vorwärts.«
»Ja, du«, sagte Paul, »der ›Herr Lord‹ haben wir immer von dir gesagt.«
Ben lachte: »Und du hast immer gesagt: ›Bei mir muß es mal rauchen.‹«
»So, hab’ ich das gesagt?«
Die Brüder aßen Pastete und nahmen scharfe Saucen daran.
»Was denkst du?« fragte Ben.
»Ich denke, England ist ein fremdes Land.«
Benno sah auf, verstand ihn nicht: »Findest du?«
Paul sagte: »Ich bin ja überzeugt, daß die Zukunft bei den Gasmotoren liegt, aber um sich auf ein so unerprobtes Gebiet zu begeben, dazu gehört viel mehr Geld. Ich werde mit Schrauben anfangen.«
»Wieviel hast du denn?«
»Ich habe 5000 Mark.«
»Aber 5000 Pfund ist doch genug. Hast du so günstig operiert?«
»Was sagst du, 5000 Pfund? Nein, wo denkst du hin, nicht 5000 Pfund, 5000 Mark.«
»Das ist gar nichts.«
»Bei meinem Salär von 120 Shilling war’s eine ganze Menge. Vielleicht helfen mir Gebrüder Effinger in Mannheim.«
»Du meinst einen Kredit?«
»Ja.«
»Ausgeschlossen«, lachte Ben.
»Du wirst schon recht haben, warum sollten sie mir einen Kredit geben.«
»Versuch’s doch in Amerika«, sagte Benno.
»Nach Amerika gehen Kassendefraudanten und Schwindler. Ich hab’ doch nicht nötig zu verschwinden.«
»Amerika«, sagte Benno, »ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt nicht nur Gauner dort. Ich will dir doch nur zureden, in der Welt zu bleiben. Was hast du in Deutschland verloren?«
»Ich versteh dich nicht. Deutschland ist doch unsere Heimat.«
Benno lehnte sich zurück und sagte bitter: »Ein Land, wo der Kaufmann ein verachteter Koofmich ist, gut zum Steuerzahlen, wo der kleinste Leutnant dem ältesten Universitätsprofessor, von Handel und Industrie ganz zu schweigen, auf den Kopf spucken darf! Hier bist du frei.« Und er machte eine weite Geste mit dem rechten Arm.
»Als ob du die Habeaskorpusakte verkündetest«, lächelte Paul.
»Unterschätze das nicht«, sagte Ben, »dieses Land ist so groß, daß es ohne Kleinlichkeit ist. Ich verstehe nicht, weshalb du wieder nach Deutschland willst.«
»Ich will kein entwurzelter Mensch werden, kein Fremdling. Ich möchte vorerst mal nach Kragsheim, da werd’ ich weitersehen.«
»Kragsheim«, sagte Ben voll Spott, »du hast merkwürdige Sehnsüchte. Ganz oben der Herzog, und dann gar nichts, und dann der Herr Major und der Herr Oberleutnant und der Herr Leutnant, und dann sehr lange gar nichts, und dann der Herr Regierungspräsident und die Herren Regierungsräte, und dann hört die Welt auf, und wo gar nichts mehr ist, kommt die misera plebs, Ladenbesitzer und Handwerker. Du willst die deutsche Romantik, Flieder und Fachwerk und den Gang vors Tor, und zugleich beschäftigst du dich mit Gasmotoren. Wenn ich nicht wüßte, was du für ein klarer Kopf bist, würde ich dich einen Phantasten nennen; aber ein Träumer bist du, und das wird dir weiter hinderlich sein.«
»Ohne daß die Menschheit von Siebenmeilenstiefeln geträumt hätte, gäb’s keine Eisenbahn. Und was hat das damit zu tun, daß ich nicht auswandern will? Wer wandert denn aus, wenn er nicht gezwungen ist? Nimm es mir nicht übel, aber du bist doch sehr ehrgeizig, Benno, und du meinst, daß deine großen Pläne sich leichter in England verwirklichen lassen, aber das Normale ist das nicht.«
»Es scheint, du hast was gegen mich?«
»Ja.«
»Du findest, ich mach’ es mir zu leicht?«
»Ja, du läufst davon, unserer Heimat, den Eltern, uns. Du bist in der Gefahr, ein ›sujet mixte‹ zu werden, wie Bismarck Ludwig Bamberger im Reichstag nannte.«
»Ich will die Kragsheimer Eierschalen loswerden. Ich bin nicht sentimental. England ist so groß, daß es niemanden zu unterdrücken braucht. In Paris und in London kann man leben, aber in Deutschland oder gar in Preußen! Aber jeder muß wissen, was er tut.«
»Wir sind kleine Leute«, sagte Paul, »man soll nicht in andere Kreise kommen wollen.«
Benno spottete: »Bleibe im Lande und nähre dich redlich!«
Paul gab keine Antwort, stocherte in seiner Pastete.
»Ich hab’ auch den Uhrenladen sehr gern«, sagte Benno, »wenn es bimmelt im ganzen Haus. Und jetzt, wo es nach Backwerk riecht.«
»Weißt du noch, wie wir im Sommer im Wald Räuber und Gendarm gespielt haben? Und die Walderdbeeren und Blaubeeren und Brombeeren?«
»Natürlich weiß ich das«, sagte Benno und rief den Kellner.
Sie standen gegenüber der Bank von England. Sie standen im Mittelpunkt der Welt. Die Bank von England, weiße griechische Säulen. Der Tempel. Die Göttin, die in der dunklen Cella lagerte, war der Wertmaßstab der Welt; hier lagerte das Gold, hier lagerte das englische Pfund. Was auch in der Welt geschah, das Pfund stand sicher wie der Tempel zu London, sicher wie die Bank von England. Zwei junge Süddeutsche ergriff der Hauch der großen Welt. Ware kam, Ware ging, wurde teurer, wurde billiger. Alles Wachstum der Erde, alle Arbeit der Erde wurde Ware, wertbar nach dem Pfund. Sie, die Kaufleute, ließen sie auf Schiffen, auf Eisenbahnen, auf hochgetürmten Speditionswagen über die Erde fahren, verteilten sie in die Lagerhäuser in Hamburg, in Antwerpen, in Nischni-Nowgorod, in Rotterdam, in Marseille, in London, sie verteilten sie in die winzigen Läden der Farmerstädte der Vereinigten Staaten, in die winzigen Läden des rauchigen Lancashire, in die winzigen Läden in Kolmar, in Wilna, in Sens.
Aus der Bank von England kamen die Herren im Zylinder. Ben sah die Zukunft.
Paul sagte: »Die Herren der Welt.«
Ben meinte: »Man kann dazugehören.«
»Als lächerliche Figur«, sagte Paul.
»Man muß den Uhrenladen abschütteln können«, sagte Ben ärgerlich.
»Warum denn? Man soll wissen, wo man herkommt.«
»Ich will noch in den Klub. Laß mich wissen, wann du reist.«
Ben ging sehr groß und vornehm davon, ein junger Engländer in derbem Tweed, viele Berlocken an der Uhrkette.
In seinem Boardinghaus schrieb Paul seine Ausgaben auf, wälzte das Kursbuch, packte seine Sachen. Ein altes Notizbuch fiel ihm in die Hand. Vorn war eine Bleistiftskizze vom ältesten Wirtshaus Deutschlands, dem »Riesen« in Kragsheim, und eine lange Reihe von Nummern. Es waren die Nummern der Lokomotiven, die durch Kragsheim fuhren. Und er überlegte, ob er wohl noch einmal so glücklich werden würde wie damals, als er, ein kleiner Junge, mit dem Bauch auf der Erde, vom Wald her auf die Schnellzüge sah und die Lokomotivnummern aufschrieb.
4. Kapitel
Ein Versuch in Kragsheim
Es war Freitag nachmittags. Paul saß mit der Mutter im Erker. Sie hatte eine weite blaue Schürze an mit einem Latz, der mit zwei Trägern hinten angeknöpft wurde, und schlug einen Hefeteig.
»Dem Benno geht ’s sehr gut«, sagte Paul.
»Bleibt drüben?«
»Bleibt drüben.«
»Der macht seinen Weg. Du bist zu bescheiden, Paul.«
Die hellen Glöckchen an der Tür klingelten.
»Das ist der Willy«, sagte die Mutter.
Willy kam, wiegte sich in den Hüften.
»Grüß Gott! Ach, unser kleiner Engländer! Was machen die Pfunde? Bringst einen Sack voll?«
»Ach, Willy, wie du alleweil daherredest.«
»Meine Geschäfte sind im Aufblühen«, sagte Willy und steckte sich eine Zigarette an. »Bekomme ich einen Kaffee, Mutter?«
»Ja, und frischen Kuchen.«
»Du denkst wahrscheinlich, wir in der Provinz können gar nichts, wir Landpomeranzen. Aber ich werd’ dir einmal zeigen, was wir können. Bitte, was ist das?«
»Ein Koffer.«
»Aber was für einer! Sieh dir das an.« Und er machte den Koffer auf, in dem nun wie auf einem Ladentisch die Uhren auf rotem Samt lagen. »Bitte? Was sagst du dazu? Meine Erfindung!«
»Wirklich ausgezeichnet!« sagte Paul.
»Ich verkaufe das Dreifache, seit ich den Musterkoffer habe. Man kommt hinein, legt die Ware hin, braucht bloß zu fragen: Uhren?«
»Sprichst schon wieder von deinem Koffer?« sagte der alte Effinger. »Ich will nix mehr von dem Koffer hören.«
Da kam schon die bauchige Kanne mit dem heißen Kaffee und eine Schüssel mit kleinen Kuchen, die mit Vanillezucker dick bestreut waren.
Der alte Effinger sagte: »Kuchen am hellerlichten Werktag, was sind das für neumodische Sachen?«
»Aber wir haben doch Besuch.«
»Der Koffer, Willy, will mir gar nicht gefallen. Früher haben die Leute auf das Inwendige gesehen, jetzt muß man ihnen das Auswendige gut präsentieren.«
»Das ist der Zug der Zeit«, sagte Paul. »Man muß mit ihm gehen!«
»Ich bin zu alt dazu. Die Leute wissen, was in meinen Uhren ist, da brauch’ ich keinen roten Samt, damit sie sie kaufen. Aber wenn das einreißt, daß man die Uhren von fremden Leuten kauft, da ist freilich allem Schwindel Tür und Tor geöffnet.«
»Na, na, Vater«, sagte Willy.
»Fabriksware womöglich.«
Die Mutter bot die Kuchen an.
»Siehst, so was bekommst auch nicht beim Bäcker.«
Samstag vormittag ging Paul Besuche machen. Die Vettern fragten ihn, wie es ihm gehe. Er sagte: »Nicht sehr gut«, teils, weil er die anderen nicht neidisch machen wollte, teils, weil er es wirklich fand. Er kam aus London, sie waren in Kragsheim. »Ihr habt nichts verloren an der großen Welt«, sagte er. Sie waren beruhigt. Sie saßen, die Frauen in schweren schwarzen Atlasgewändern, um einen runden Tisch. Vor jedem stand ein Glas Südwein.
Um zwölf Uhr war Mittagszeit. Über dem Brot lag eine weiße Serviette. »Mahlzeit«, sagte der alte Effinger, wusch sich die Hände am messingnen Gießfaß, trocknete sie am gestickten Handtuch ab, das an der Wand hing, nahm die Serviette vom Brot, sprach das Tischgebet. »Amen«, sagten alle.
Es gab Rindfleisch und Gemüse, ein ausgiebiges Essen. Der Vater redete Paul zu: »Das Stückle Rindfleisch hast noch nicht gegessen.«
»Aber eben doch.«
»Aber das Stückle sicher noch nicht.«
So waren seine Witze. Er sagte: »Wenn es einem am besten schmeckt, muß man aufhören.«
Die Magd räumte ab. Es gab noch Krapfen, ein fettes, in viel Gänseschmalz gebackenes Gericht. Als alles aufgegessen war, rückte der alte Effinger das Käppchen zurecht und sprach das Tischgebet. »Amen«, sagten alle.
Es war Montag. Willy reiste ab, um Uhren zu verkaufen. Er kam erst Freitag abend wieder.
Paul ging in die Stadt. Er klingelte am Laden von Weckerle, mit dem er zusammen zur Schule gegangen war.
»Grüß Gott, Franz.«
»Ach, grüß dich Gott, Paul. Wie geht’s? Nett, daß du dich mal wieder sehen läßt. Du bist weit herumgekommen, habe ich gehört.«
»Ach nein, gar nicht. Und du?«
»Ich bleib’ hier im Laden.«
»Wie gehen denn die Geschäfte?«
»Schlecht, bei den Zeiten. Es bleibt doch keiner in Kragsheim.«
»Man müßte Industrie herbekommen, find’ ich.«
»Das hat der Bürgermeister auch gesagt. Aber der Herzog will doch nicht. Die Industrie könnte nur auf der Seite vom Schloß liegen, und das will der Herzog nicht.«
»So. Und die Geschäfte gehen alle schlecht? – Bist du verheiratet?«
»Nein, verlobt mit Lise Schnack.«
»Vom Hofbäckermeister?«
»Ja, vom Hofbäckermeister.«
»Da gratulier’ ich dir aber, so ein schönes Mädle.«
»Ja, ein schön’s Mädle.«
Aber dann war’s auch aus. Eine Frau kam herein und wollte Stoff kaufen.
»Ich wer’ gehen«, sagte Paul.
»Also, hat mich sehr gefreut«, sagte Franz und gab ihm die Hand.
Paul ging in den Wald. Es war sehr heiß jetzt am frühen Nachmittag. Das Moos war ganz trocken. Überall hopsten kleine Frösche, leise zirpten die Grillen. Paul breitete ein Taschentuch aus und setzte sich auf einen Baumstumpf. Unten lag die gegiebelte Stadt, rote Dächer mit vielen Schornsteinen, der weiße Kasten des Schlosses, dahinter der Park, davor der heiße Schloßplatz, baumlos.
Paul sehnte sich danach, in Kragsheim zu bleiben, wie der Vater seinen Schoppen zu trinken, sorglos zu sein im kleinen Rahmen. Er liebte Land, Eiche und Felder, fast schon mit der sentimentalen Liebe des Stadtkindes. Von allen Rokokoschlössern hatte das Kragsheimer für ihn das schönste Porzellan, die schönsten Wasserspiele und die schönste gotische Ruine im Park. Er beneidete Franz im Stoffladen. So wollte auch er leben. Fromm, gläubig, bescheiden.
Mit einem schweren Seufzer nahm er das Buch, das er mitgenommen hatte, und vertiefte sich in »Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin und Deutschland«. Das war ein Buch, über das Paul sich auf jeder Seite ärgern mußte. Er fand aber, man müsse die Meinung des Gegners kennen.
Es fing an kühl zu werden, und er ging nach Haus.
Bertha beaufsichtigte das Holzeinbringen. In großen runden Körben wurde das Holz von der Straße immer noch an das gegiebelte Dach gezogen. Die Tür bimmelte. Die Mutter sah herunter und rief: »Was willst?«
»Grüß Gott«, sagte Paul, »ich geh’ gleich wieder.«
Er zog sich einen frischen Kragen an und ging aufs Rathaus, ließ sich beim Bürgermeister melden.
Der empfing ihn, ein dicker, großer Mann mit Bauch und langem, grauem Vollbart, strich sich den Bart und sagte: »Ja, der Herr Effinger, kommen Sie wieder einmal in die Heimat?«
»Ich möchte sogar hierbleiben.«
»Ja, als was denn, wenn ich fragen darf?«
»Ich möchte eine Fabrik für Schrauben errichten, Herr Bürgermeister. Fabrik ist viel zuviel gesagt, eine Werkstätte mehr, und ich wollte fragen, wie es sich hier mit dem Grund und Boden und den Steuern verhält?«
»Ich glaub’, Herr Effinger, ich muß Sie da sehr enttäuschen. Wir haben hier natürlich ein Interesse an der Industrie, wir sind ja moderne Menschen, die’s mit dem Fortschritt halten, aber das muß wohl abgewogen werden. Sie haben recht, es wandert alles aus, und nicht nur aus Arbeitsmangel. Der Zug in die Großstadt ist eine große Gefahr für unser Volk. Die Landflucht! Vergnügungssucht und Hoffart. Jawohl!«
»Gewiß, Herr Bürgermeister, aber dagegen gäbe es doch nur eins, die Industrie in die kleinen Städte zu bringen und so eine Verbindung zwischen Landwirtschaft und Industrie zu schaffen.«
»Ja, aber da müssen wir genau erwägen, was wir an Steuern gewinnen und an Arbeitsmöglichkeiten für die Jugend, kurzum, was wir an Vorteilen haben und an Nachteilen. Da müssen wir womöglich die Volksschule erweitern und dann das Spital …«
»Aber die Stadt ist doch unterbevölkert«, sagte Paul, »das große alte Palais vom Grafen Wittrich ist für 3000 Mark zu haben. Fürs Zehnfache ist es nicht neu zu bauen.«
»Sicher nicht. Aber wir haben doch auch Unkosten, müssen Sie verstehen. Wenn Sie die Fabrik auf den Rödernschen Wiesen errichten wollen, wird doch eine Straße gebaut werden müssen. Die Gemeinde hat genug Lasten. Und dann sieht es Seine Hoheit sehr ungern. Seine Hoheit ist doch nur ein halbes Jahr in Nizza, im Sommer residiert Seine Hoheit hier, und die Geschäftsleut’, Ihr Vater wird das doch wissen, sind auf Kundschaft vom Hofe angewiesen. Wenn dann auf den Rödernschen Wiesen Fabriken sind – erstens weiß man gar nicht, bei dene Anarchisten, was wir da für Elemente bekommen, und dann wird bei den hiesigen Westwinden der Rauch grad’ zum Schloß hingetrieben …«
»Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister. Ich hätte mich gerne hier niedergelassen.«
»Wo werden Sie denn nun hingehen?«
»Nach Berlin!«
»Na ja, alles muß zu dene Preußen. Es hält’s ja keinen hier.«
Paul wollte erwidern. Er sagte aber nur: »Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister.«
»Lassen Sie sich’s gutgehen!« sagte der Bürgermeister. »Grüßen Sie den Herrn Vater.«
Paul ging über die flache große Treppe hinab, hielt sich am wunderbar geschmiedeten Rosengitter.
Die Mutter und Bertha saßen im Grasgarten und stopften Wäsche. Der Flieder war verblüht. Es roch nach Heu. Unten floß der Main.
Sie hatten einen großen Korb dastehen, und die Mutter sagte: »Alle Handtücher werden dünn. Man müßt alles wegtun.« Aber das tat sie nicht. Mit derselben Stopfnadel, die sie vor dreißig Jahren in die Ehe mitgenommen hatte, stopfte sie ein Handtuch nach dem andern. Bertha schnitt aus einem der Tücher viereckige Flecke, die sie in andere Tücher heftete und dann sorgfältig nähte.
»Was sagst, daß sich die Theres mit dem Amtsrichtersohn verlobt hat? Ist immer kokett gewesen. Solche schaffen’s«, sagte die Mutter und sah bitter auf Bertha.
»Sprang immer den Herren gleich an den Hals«, sagte Bertha. Und dann schnitt sie weiter Vierecke aus den Tüchern. Sie dachte: Die Theres putzt sich immer. Nur unfeine Mädchen putzen sich. Die Mutter war genau so herb. Sich für den Mann zu schmücken, ja, nur die Schürze abzutun, wenn er nach Hause kam, galt ihr als Würdelosigkeit. Bertha schämte sich, wenn sie sich nett machte.
»Die Theres hat ein Kleid aus Seide, mit dem rauscht sie, wenn sie auf der Straße geht«, sagte sie zur Mutter.
»Ist das wahr?«
»Ja, bestimmt«, und sie setzte die Vierecke ein.
»Schrecklich! Ja, wenn ein Mädchen keine Mutter mehr hat! Die Mutter würd’ sich im Grab umdrehn. War eine so bescheidene Frau.«
»Aber nun hat sie den Amtsrichtersohn«, sagte Bertha.
Es wurde langsam dunkel und kühl. Paul saß am alten Sekretär und schrieb Briefe. Die Mutter steckte die Petroleumlampe an und deckte den Tisch. »Helene hat’s auch nicht leicht«, sagte sie. »Drei kleine Kinder, und’s nächste erwartet sie. Der Julius plagt sich zwar, aber ob sie was zurücklegen können, glaub’ ich nicht. Und vom Ben hört man so wenig. Er macht schon Fehler in den Briefen, als ob er nicht mehr Deutsch könnte. Er schreibt von einem Fräulein Mary. Wer ist denn das? Kennst du die Leut’?«
»Nein, es sollen aber sehr gediegene Menschen sein, reiche Leut’. Sie hatten mich einmal sonntags eingeladen zum Krokettspiel, aber ich bin nicht gegangen.«
»Warum denn nicht?« fragte die Mutter.
»Was soll ich da? Sie spielen alle so gut Krokett, und bloß, damit sie noch einen jungen Mann da haben? Was ist man? Ein Landpomeranz und ein kleiner Clerk dazu.«
»Benno verkehrt aber dort?«
»Na ja, Benno.«
»Von einem goldenen Wägelchen fällt oft ein goldenes Nägelchen«, sagte die Mutter. »Der Karl ist auch mehr für die Welt als du. Er fühlt sich sehr wohl in Berlin.«
Die Magd kam. Sie hatte Holzschuhe an, kurze Röcke und eine große blaue Schürze. »’s Biergeld, Frau.«
Frau Effinger langte in die Rocktasche, zog die Pfennige.
»Für ’n jungen Herrn a?«
»Magst?«
»Ein Viertel.«
»A Halbe und a Viertel. Muß noch Geld ham.«
Frau Effinger langte in die Rocktasche, zog noch ein paar Pfennige. »Heller« sagten noch alle.
»Erinnerst dich an den französischen Kriegsgefangenen, den wir hier hatten Anno 70/71?« fragte die Mutter.
»Ja, natürlich, ich hab’ ihn immer spazierenführen dürfen.«
»Ja, weißt noch, seine Eltern haben ihn doch noch hier besucht. Und jetzt haben sie geschrieben, der Vater soll ihnen doch eine kleine Taschenuhr schicken. Eine goldene glatte Uhr, nur ein großes Monogramm darauf.«
Die Sonne sank überm Rhein.
Effinger schloß den Laden, betete das Abendgebet. So vom Morgengebet zum Abendgebet rundete sich der Tag. Er wusch sich die Hände am messingnen Gießfaß, trocknete sie am gestickten Handtuch ab, nahm die Serviette vom Brot, sprach das Tischgebet. »Amen«, sagten alle.
Die Magd brachte in den offenen Gläsern das Bier. Sie kam ohne anzuklopfen herein, sagte: »Wohl bekomm’s« und verschwand. Bertha folgte ihr; sie trug einen großen Rinderbraten mit viel Sauce, dazu Knödel und eine Schüssel mit grünem Salat.
»Beim ›Schwarzen Schaf‹«, sagte Effinger, »habe ich heute den Hinterederer gewinnen lassen, hat er nix mehr wegen seiner Uhr gesagt, so sind die Menschen.«
»Was war mit der Uhr?«
»Sie gefällt ihm nicht mehr. – Du warst heut’ beim Herrn Bürgermeister, hat mir der Schöppenbeck erzählt. Von Fremden erfährt man’s.«
»Es ist nicht wichtig. Ich dacht’, man könnt’ sich vielleicht hier niederlassen.«
»Warum?« fragte der Vater.
»Na ja, ich dacht’, hier kennt man alles.«
»Es ist besser, in eine große Stadt zu gehen, daheim wird man nichts.«
»Ich will auch nächste Woche nach Berlin.«
»Schon?« sagte die Mutter.
»Er hat ganz recht«, sagte der Vater. »Man hat sich gesehen. Man weiß, daß man gesund ist. Was hat die Besuchlauferei für einen Sinn? Er muß jetzt sehen, daß er vorwärtskommt.«
»Aber bis dahinauf!« sagte die Mutter, als ob Berlin in Sibirien läge. »Bist denn gut genug ausstaffiert, bräuchst nicht noch Hemden?«
»Nein, ich hab’ übergenug aus London!«
»No ja, aus London«, sagte die Mutter bewundernd.
Effinger sprach das Tischgebet. »Amen«, sagten alle. Dann ging er noch in die Wirtschaft »Zum gläsernen Himmel«.
Effinger ging jeden Abend in eine andere Wirtschaft, in den Gläsernen Himmel, ins Schwarze Schaf, ins Goldene Rad, in den Riesen, in den Silbernen Maulesel, um ein Bier zu trinken, Tarock zu spielen und eine Virginia zu rauchen. Alle Männer von Kragsheim machten es so. Die Frauen saßen zu Hause. Sonntags gingen alle in den Schloßgarten. Dort trank man unter einer weißen Säulenhalle Kaffee. Familien grüßten sich oder grüßten sich auch nicht.
Bertha räumte ab. Die Mutter sah ihr nach: »Es ist schwer, für so ein Mädle einen Mann zu finden, wenn man ihr nur 20000 Gulden mitgeben kann.«
Dann nahm sie ihr Ausgabenbuch und schrieb ein: Bier 12 Pfennige, 2 Pfund Rindfleisch 100 Pfennige.
»Weißt«, sagte sie zu Paul, der dabeisaß und ein Buch las, »weißt, daß das Rindfleisch jetzt 50 Pfennige das Pfund kostet? Voriges Jahr – es war ja auch ein schrecklich heißer Sommer, und man soll sich so etwas nicht wünschen, auch wenn man den Vorteil davon hat, so heiß, daß die Bauern haben ihr Vieh schlachten müssen – hat’s nur 38 Pfennige gekostet.«
Sie schrieb weiter: Weißen Stoff fürs Flicken 14 Pfennige.
Dann räumte sie mit Bertha den Laden auf.
5. Kapitel
Reise nach Berlin
Paul fuhr nach Berlin. Zwanzig Stunden lang. Er fuhr mit einem schweren Herzen. Es war nicht mehr wie vor zehn Jahren. Ja, dachte er, 1872, das waren noch Zeiten gewesen. Hochkonjunktur. Die Löhne hoch, die Gehälter hoch, die Dividenden fett. Da konnte man rasch ein Vermögen verdienen und ein reicher Mann werden.
Ein gepflegter Herr mit einem runden, hellbraunen Vollbart saß ihm gegenüber. »Sehen Sie da drüben«, sagte er, »die Kalkwerke arbeiten auch nicht mehr.«
»Schwere Zeiten«, sagte Paul.
»Es ist nicht mehr wie vor zehn Jahren«, sagte der Herr mit dem Vollbart.
»Hochkonjunktur«, sagte Paul und nickte mit dem Kopf.
»Ja, die Löhne hoch, die Gehälter hoch, die Dividenden fett. Jetzt unterbietet einer den andern. Fressen sich gegenseitig auf. Die Leute haben gedacht, die Hochkonjunktur kann nie aufhören, haben zu wahnsinnigen Preisen ihre Fabriken erweitert, und nun, seit dem Wiener Krach, ist alles aus. Preise, bei denen keiner mehr was verdient. Die Löhne sind so heruntergegangen, tiefer geht’s schon nicht mehr. Wenigstens soll die Fabrik nicht zum Stillstand kommen. Lieber mit Verlust arbeiten, als das Anlagekapital ganz in den Schornstein schreiben. Wissen Sie, junger Mann, ich sage das allen jungen Leuten: Sparen wird wieder groß geschrieben werden. Sparen muß wieder groß geschrieben werden.«
»Ja«, sagte Paul. »In Deutschland sind die Leute alle so großspurig geworden. Wenn ich an die Büros in der Londoner City denke! Da ist man konservativ und weiß, daß man auch auf einem Holzstuhl Geschäfte machen kann. In Deutschland muß jetzt alles gepolstert sein.«
»Wie schön«, sagte der Ältere, »daß man noch solche Ansichten hört! Man verzweifelt manchmal an der Jugend. Es liegt alles an diesem sogenannten modernen Geschäftsgeist. Wir alten Berliner Maschinenfabrikanten wollten nichts als anständige Maschinen bauen, jeden Kunden individuell bedienen. Wir haben nicht an den Gewinn gedacht. Einen ›Ertrag‹ nennen das jetzt die Unternehmer.«
»Wie?« fragte Paul.
»Nein, wir haben nicht kalkuliert. Wir haben unsere Maschinen gebaut und haben sie abgegeben und waren stolz, der Menschheit gedient zu haben. Jetzt höre ich, daß sie in Amerika nicht mehr auf Auftrag arbeiten, sondern Dampfmaschinen nach Preislisten verkaufen, als ob eine Dampfmaschine eine Elle Kattun wäre, wo doch jede Dampfmaschine ein besonderes individuelles Erzeugnis ist, ein Stolz des Hauses.«
»Warum?« sagte Paul.
Der Ältere lehnte sich zurück. Warum? fragte dieser Mensch.
»Warum? Weil jede Dampfmaschine ein besonderes Erzeugnis ist. Sie sind wohl Ingenieur?«
»Nein«, sagte Paul.
»Na, dann geht’s ja noch. Das kommt nämlich jetzt auch auf, daß die Herren Ingenieure glauben, sie könnten die Männer der Praxis ersetzen. Praxis ist alles! Werkstatterfahrung braucht man. Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum. Sehen Sie, wir sind Handwerker und Wissenschaftler zugleich, wir alten Berliner Maschinenbauer. Wir sind keine Unternehmer. Sie wollen wohl Unternehmer werden?«
»Ich bin Kaufmann«, sagte Paul.
»Ich hab’ mir das schon gedacht, als ich vorhin hörte, daß Sie sich darüber wunderten, daß wir nicht kalkulieren.«
»Und wie berechnen Sie den Preis der Maschinen?«
»Das weiß man so ungefähr, und wir verdienen ganz nett dabei. Und mit was wollen Sie anfangen, junger Mann?«
»Mit Schrauben. Aber bei diesem geschäftlichen Niedergang kann man wirklich zurückgeschreckt werden. Es ist doch in all und jedem eine Überproduktion da.«
»Maschinell wollen Sie das machen? Als Kaufmann?«
»Ja. Im großen. Ich habe da eine Schraubenschneidemaschine in London gesehen. Die dreht dreitausend Schrauben in der Stunde. Wenn ich die einführen könnte!«
»Aber was sind das für komische Ideen, junger Mann! Was soll man denn mit den vielen Schrauben? Was wollen Sie denn alles verschrauben? Nee, nee, nee, einfache Drehbank und Handarbeit, das ist ja viel vernünftiger. Das ist billiger als die Arbeit der teuren Maschinen. Was wollen Sie denn mit den teuren Maschinen? Die können doch nicht gegen die billige Handarbeit aufkommen.«
»Meinen Sie?« sagte Paul. Er wollte genaue Schrauben in Massen herstellen, vielleicht war das doch falsch.
»Wollen wir in Gera Mittag essen? Da ist Maschinenwechsel. Das Bahnhofslokal möchte ich haben. Das ist eine Goldgrube. Übrigens mein Name: Schlemmer. Schlemmer aus Berlin.«
»Effinger.«
»Effinger?« sagte Schlemmer. »Von dem Bankhaus in Mannheim?«
»Verwandt«, sagte Paul.
Sie stiegen in Gera aus. Schlemmer bestellte einen Gänsebraten.
»Ne jute jebratene Jans is ne jute Jabe Jottes. Das ist eine Berliner Redensart, verstehen Sie, Gans und Gurkensalat und denn ’ne Weiße mit Schuß und sonntags raus nach Treptow. Berlin is schön, Berlin is groß. Ich bin nämlich der Inhaber von C.L. Schlemmer, Maschinenfabrik. Ich stehe Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Etablieren ist nicht einfach. Was brauchen Sie alle Kinderkrankheiten durchzumachen! Kommen Sie mal zu mir. Sehen Sie sich meine Fabrik an.«
Paul sah hinaus. Erst war es nicht viel anders als die Gegend um Kragsheim. Aber hinter Jena hörte es auf. Es begann unbewohntes Land, Sand, Sand, ein bißchen Gras, Kiefern. Wieder Sand, wieder Kiefern, hohe Stämme, oben ein paar Zweige.
»Es ist eine dumme Frage«, sagte Paul, »aber ist es möglich, daß dahinter noch eine große Stadt kommt?«
»Ja«, lachte Schlemmer dröhnend. »Preußisch-Berlin, natürlich, und Sie werden staunen, was für ’ne Stadt. Breite Straßen und hohe Häuser, na, großartig, und Theater und Varieté und für so’n jungen Mann auch Nachtleben. Na, großartig.«
»Wirklich?« sagte Paul.
Auch hier wuchs Korn, aber wie es dastand, so kärglich, so jämmerlich, was für Zwischenräume zwischen den grünen Sprossen! In Süddeutschland war immer etwas los. Der Maibaum wurde aufgerichtet. Es war Kirchweih oder Fronleichnam oder auch nur Viehmarkt. Fahnen wehten, Leute mit Abzeichen zogen durch die Stadt. Es gab Bewegung, Leben. Über die üppigen Felder läutete die Abendglocke, und ein voller Tag sank in die Stille.
Paul sah die Landschaft, und sein schweres Herz wurde noch schwerer. Sein Traum fiel ihm ein aus der letzten Londoner Nacht, wie er im Landauer einzog in Kragsheim über die breite Schloßallee mit den blühenden Kastanien, mit zwei feurigen Rappen, die mit den Köpfen nickten, üppige Mähnen und silbernes Geschirr hatten. Man würde hier arbeiten in diesem flachen Land, um sich möglichst bald, möglichst früh zur Ruhe setzen zu können und seinen Schoppen zu trinken im »Gläsernen Himmel« in Kragsheim.
6. Kapitel
Ankunft
Plötzlich begann eine Stadt. Grau in grau. Hinterhäuser, enge Höfe. Viele Gleise. Paul stand am Fenster und sah in der Bahnhofshalle Karl stehen, der gut aussah, mit einem blonden, starken Schnurrbart, vor den netten Augen ein Zwicker mit breiter, schwarzer Einfassung an einem breiten, schwarzen Band, das er um den Hals trug. Der schwarze Rock war nach der Mode der Zeit hoch geschlossen; er trug dazu eine breite Krawatte mit einem dicken goldenen Hufeisen darin, blaßgraue Hosen und eine Nelke im Knopfloch. Karl sah aus wie ein naives Gigerl. Auch Ben ist elegant, dachte Paul, Ben sieht sich nach der Meinung der Welt um, Karl aber ist ein Kind.
Paul hatte einen braunen Vollbart und eine weiche Welle in die Stirn. Er war ein kleiner, schlecht angezogener junger Mann, dessen Krawatte verrutscht war und der einen altmodischen Liegekragen trug. Ein feiner Herr holt seinen Angestellten ab, hätte man denken können.
»Ach, da bist du ja. Grüß Gott, Paul.«
Paul hatte den Koffer neben sich gestellt. Sie schüttelten sich die Hände.
»Ich habe ein Zimmer für dich«, sagte Karl eifrig.
»Das ist aber nett. Wieviel kostet es denn?«
»Vierzig Mark mit Kaffee im Monat.«
»Ist hier alles so teuer?«
»Ja, doch wohl.«
»Ich kann ja sehen, daß ich bald was Billigeres finde, ich habe doch keine Stellung wie du und muß jeden Pfennig sparen, damit ich anfangen kann.«
»Du willst dich selbständig machen, schreibt die Mutter? Warum eigentlich?«
»Fühlst du dich so wohl bei Zink & Brettschneider?«
»Ich bin sehr stolz, zu solch vornehmer Firma zu gehören. Stell dir vor, alles bar Kasse.«
»Ist das so etwas Besonderes hier?«
»Es gibt hier viele Firmen, die auf ziemliche Sicht erst zahlen, jetzt in der Depression.«
»Unsolide.«
»Willst du keinen Träger?«
»Nein, danke, ich trag’ die Sachen lieber selber.«
»Gib dein Billett ab, wir nehmen einen Wagen«, sagte Karl.
»Muß man denn einen Wagen nehmen? Kann man nicht mit der Pferdebahn fahren?«
»Nein«, sagte Karl, »das geht nicht.«
Sie fuhren nach dem Westen der Stadt. Paul kam von London. Er hatte die großen Omnibusse gesehen, die Fülle der Droschken, die von hinten gelenkt wurden. Berlin erschien ihm unbelebt. Nur ein paar Droschken kamen, einige Equipagen mit zwei Pferden und Kutscher und Lakai, kleine Arztkupees, ein paar Lastwagen. Aber als sie tiefer in die Friedrichstraße kamen, dachte Paul, hier beginnt’s. Die weißgrauen zweistöckigen Häuser wurden abgerissen. Daneben stieg Gerüst um Gerüst himmelan. »Das werden alles Geschäftshäuser«, sagte Karl. Da stand schon eines, vier hohe Etagen, vier Giebel, ein Eckturm, sämtliche Renaissancemotive an einem Haus wie das Rathaus einer alten Stadt. Es war ein Geschäftshaus für eine Bleistiftfirma. Firmenschild in schwarzem Glas und goldenen Buchstaben. Etagenhohe Glasschaufenster. Daneben der Bau einer Lebensversicherung mit einer drei Meter hohen Siegesgöttin auf dem Dach.
Eines der kleinen Häuser stand schon ohne Dach, halb abgerissen, man sah noch den Stuck, zierliche Rokokokränze. Auf der Leiter standen die Maurer – Herrgott, was für Kerle! – zwischen Himmel und Erde und fuhrwerkten wie die Berserker, um alles dem Erdboden gleichzumachen. Man sah in ein Zimmer, feine weiße Tapete mit grünen Efeugirlanden. Der Maurer schlug hinein. Es flog der Staub.
»Schade«, sagte Paul.
»Wie meinst du?«
»Schade um das Haus.«
»Das ist doch wohl nicht dein Ernst! Sieh nur diese großartigen neuen Renaissancegebäude, da ist Großzügigkeit und Fortschritt, da offenbart sich der Kunstsinn. Berlin wird Weltstadt. Und das hier ist die berühmte Straße Unter den Linden«, sagte Karl. »Du willst dich also selbständig machen? In welcher Branche?«
»In Schrauben«, seufzte Paul, »später habe ich an Maschinen, vielleicht Gasmotoren gedacht.«
»Gasmotoren?« sagte Karl, »wäre mir unheimlich.«
»Man muß abwarten«, sagte Paul. »Als Angestellter hat man ein ruhigeres Leben.«
»Warum willst du denn ein Fabrikant werden?«
»Als Angestellter lebt man in ewiger Unsicherheit, kann jeden Tag entlassen werden.«
»In meiner Firma hat gestern der erste Buchhalter fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert. Aber unsere Firma ist auch etwas Besonderes. Wenn Herr Zink einen anspricht, fühlt man sich wirklich geehrt, und was sie für Weihnachtsgratifikationen bezahlen – kolossal!«
»Es ist schön, daß du so anständige Chefs hast, aber in einem fremden Geschäft weiß man doch nie, was passiert. Man steckt nicht drin.«
»Wie kannst du so was sagen?« rief Karl empört. »Zink & Brettschneider …«
Sie schwiegen.
»Dort ist die Wilhelmstraße. Das Palais vom Reichskanzler und das Auswärtige Amt, dort werden die Schicksale der Völker entschieden. Kutscher, halten Sie.«
Sie saßen still. Ehrfurcht überkam sie. Dort hinten lebte Bismarck, der große Kanzler.
Der Kutscher drehte sich um. »Heute is parlamentarischer Bierabend. Sind alle da, der kleene Windthorst von der Zentrumspartei und dann die Konservativen, Kleist-Retzow, den fahr’ ich alle Tage, wenn er in Berlin is, und sogar Eugen Richter. Und dann is da der Herr von Vollmar, so’n süddeutscher Herr. Der hätte seine fünfzig Gäule im Stall und Kutscher mit Kokarde, würden Sie denken. Is aber nich. Is Sozialdemokrat. Jawoll, Sie. Der is für das arbeitende Volk. Und wenn die Herren fremd sind, das da is das Brandenburger Tor, wo die Truppen einmarschiert sind 70/71, oben die Quadriga. Die haben se falsch aufgestellt. Na, is doch schön mit die vielen Ferde. Und das da is das Palais Redern.«
»Schönes Palais«, sagte Paul.
Trommelwirbel ertönte. Durch das Tor kam ein Hofwagen, der Leibjäger mit weißem Federbusch, er und der Kutscher schwarz und silbern. Der alte Kaiser in Generalsuniform. »Hoch«, »Hoch«, »Hurra«, »Hurra«.
»Seine Majestät kommt von Babelsberg herein. Muß was los sein«, sagte der Kutscher.
»Schon gut«, winkte Karl ab.
»Es hätte mich sehr interessiert, was der Mann meint«, sagte Paul.
»Wahrscheinlich wegen des bulgarischen Konflikts.«
»Wir haben ja Bismarck.«
»Ja, unser Bismarck.«
Hinter dem Brandenburger Tor begann der märkische Sand. Sie hielten.
Ein Wächter kam, der eine Glocke schwang, hinter ihm fuhr die Eisenbahn.
»Das hört jetzt bald alles auf«, entschuldigte Karl Berlin. »Der Magistrat weiß, was er der Haupt- und Residenzstadt schuldig ist. Solch veraltete Sachen passen ja wirklich nicht mehr in die heutige Zeit.«
»Ach, das würde mich nicht so sehr stören. Aber die Stadt ist ohne jeden Charakter, scheint mir. Die Linden sind ja ganz schön. Aber dieses sonstige Durcheinander. Und wo in aller Welt soll ich denn noch hinkarjolen?«
»Ich habe dir ein Zimmer im Westen gemietet. Der Westen ist das Kommende, weißt du.«
Da hielt der Kutscher mit einem Ruck. Alle Wagen standen. Und nun sah Paul Pferde kommen, breitbrüstige, große braune Pferde, erst zwei, dann vier in einer Reihe, fünf Reihen, achtzehn Pferde. Die Kutscher in blauen Blusen liefen daneben, die Peitschen erhoben. Und dann kam es: ein Lastwagen, ächzend drehten sich die Räder, und darauf stand sie, glänzend, grün lackiert, Messing und Kupfer, blinkend und strahlend, die große Babel, Lilith, Schöpferin und Zerstörerin zugleich: die Dampfmaschine, die Lokomotive. Zwei Bahnbeamte liefen hinterher und ein Schutzmann.
Paul war aufgestanden. Neudeutschland begrüßte ihn. Nicht das Brandenburger Tor, nicht die Linden waren Berlin, – das war Berlin: achtzehn Pferde, die eine Lokomotive zur Bahn brachten. Noch waren die Dichter nicht erstanden, die die Melodie der neuen Zeit sangen, aber Paul fühlte sie: »Quer durch Europa von Westen nach Osten rittert und rattert die Bahnmelodie!« Nicht die Häuser waren das Wesentliche dieser Stadt, sondern das, was zwischen den Häusern sich bewegte. Wagen voll mit gleichen Kisten, »New York« stand darauf. Wagen voll mit gewaltigen Paketen, »London« stand darauf. Paul sah Handwagen mit neuen Nähmaschinen und Handwagen mit Fensterrahmen und Handwagen mit Kinderwagen und Frauen mit großen, schwarzen Bündeln. Er wußte nicht, daß dies die Berliner Konfektion war, Frauen, die Röcke zum Zwischenmeister brachten. Aber er sah: das war Berlin. Auch für ihn würde es Arbeit bereit halten, Möglichkeiten, Maschinen, Kohle, Dampf und Motoren.
»Da wären wir also«, sagte Karl. »Laß mich die Droschke bezahlen.«
»Was sind das für Geschichten!« sagte Paul.
»Nein, das laß ich mir nicht nehmen«, sagte Karl.
»Und der Koffer?« fragte Paul und sah den Kutscher an.
»Ick kann doch det Ferd nich hier allein lassen.«
»Sie bekommen auch ein Trinkgeld«, sagte Karl sehr großartig.
Karl bezahlte den Kutscher, der mit dem weißen Zylinder, dem blauen Kutscherkragen und der roten Weste mit Silberknöpfen im Zimmer stand. »Jute Injewöhnung«, sagte er.
Paul packte nicht aus. Morgen wollte er gleich ein billigeres Zimmer suchen, denn er gedachte lange in Berlin zu bleiben. Dann nahm er seine Schreibmappe, in die seine Schwestern ein großes Monogramm gestickt hatten, und schrieb nach Hause: »Das ist hier eine sehr häßliche Stadt, in die so bald keiner zum Vergnügen reisen wird. Aber es ist alles sehr für den Gewerbefleiß prädestiniert, und der Fortschritt wird hier nicht aufgehalten wie in Kragsheim.«
7. Kapitel
Eine Empfehlung
Paul verließ früh das Haus, um einen Brief vom Bankgeschäft Effinger aus Mannheim auf der Post abzuholen.
Seine Bitte um einen Kredit war abgelehnt worden. Als Paul das mittags im Restaurant erzählte, war Karl empört: »Unerhört.«
Paul sagte: »Vielleicht würden wir grad so handeln, wenn wir älter wären. Wir haben noch gar nicht bewiesen, daß wir etwas leisten.«
»Aber wir sind doch Neffen.«
»Du kennst sie doch, für sie ist ein Verwandter ein unsichererer Kunde als jeder Fremde. Ich werde ihnen eine genaue Spezifikation geben, den Kundenkreis beschreiben, meine übrigen Vermögensteile …«
Schnell kam die zweite Ablehnung: »Wir sehen keinen Vorteil in Schrauben. Gebr. Effinger sind keine Industriebank, und überhaupt wird in Berlin ein solcher Schwindel mit Gründungen getrieben … Wir haben genug von dem Wiener Krach. Wir haben nur sichere Debetsaldos. Mit Hochachtung …«
»Eine Frechheit«, sagte Karl. Paul verbarg den Ärger und fühlte sich gedemütigt.
Er schlug Adreßbücher nach und orientierte sich über alle Industrien, die Schrauben brauchten. Der Vater bot ihm 5000 Mark an, dazu kamen seine eigenen Ersparnisse in Höhe von 5000 Mark.
»Ich bräuchte noch 10000 Mark zum Anfangen.«
Er schrieb an Ben.
Der antwortete postwendend:
»Mein lieber Paul!
Ich habe Dein 1. Schreiben vom 24. cr. erhalten. Benutze gern die Gelegenheit, Dir auch von meinem Ergehen Mitteilung zu machen. Ich habe mich mit einem Mädchen aus erstem Hause verlobt. Meine Braut ist ungewöhnlich schön, und ich gehe einem glücklichen Leben entgegen. S.G.W.
Ich werde mit der Mitgift eine Fabrik für Werkzeuge neuester Konstruktion in London errichten. Die Verhältnisse in England sind ungemein angenehm. Es kümmert sich kein Mensch um die Errichtung einer Fabrik. Polizeiliche Vorschriften gibt es überhaupt nicht, soweit ich es übersehe. Obgleich es also keinerlei Arbeiterschutz gibt, fühlen sich die Arbeiter nicht schlechter als in Deutschland. Beweis: Es gibt hier keine sozialistische Bewegung. Es scheint mir so, als ob hier eine Art von Sozialismus auf dem Wege der Faulheit eingeführt worden ist. Die Herren, denn auch die Arbeiter sind Herren, arbeiten genau so viel, so lange und so schnell, wie es ihnen paßt. Hinzukommt, daß sie alle ihr eigenes Häuschen haben und so jener sittliche Tiefstand fortfällt, den die Mietskaserne hervorbringt. Im übrigen ist mir ein fauler Arbeiter, der nicht aufsässig ist, lieber als ein fleißiger, der mein Feind ist. Es ist eine merkwürdige Sache um die hiesige Freiheit. Die Leute brechen in Jubel aus, wenn sie die Queen sehen – aber das Parlament hat ihr keine Mitgiften für ihre Kinder bewilligt.
Was nun Deine Anfrage wegen eines Kredites betrifft, so bin ich bereit, Dir eine Empfehlung an das Bankhaus Oppner & Goldschmidt zu geben, und zwar an Emmanuel Oppner selber. Er ist ein alter Achtundvierziger, hat in der Pfalz mitgekämpft, ist nach Paris geflohen, wo er sehr bald die Revolution an den Nagel hängte, offenbar angewidert von der fruchtlosen Verschwöreratmosphäre der Emigranten. Er trat bei Leroyfils ein. 1866 kehrte er nach Deutschland zurück als begeisterter, mir zu begeisterter Deutscher und wurde von Bismarck bei der Einführung der Goldwährung zugezogen. Er hat in Berlin eine Goldschmidt geheiratet und ist zugleich in das alte Bankhaus eingetreten.
Goldschmidt sowohl wie Oppner sind Juden geblieben. Goldschmidt ist sogar sehr fromm. Er ist mit einer Petersburgerin verheiratet und sehr wohltätig, hat das Asyl für Obdachlose gestiftet, und es heißt, daß niemand vergeblich bei ihm klopfe. Sein Bruder ist ein bekannter Rechtsgelehrter. Es ist also eine hochgebildete und höchst angesehene Familie. Eine Bankverbindung dorthin wäre außerordentlich günstig für Dich. Es ist eine merkwürdige Idee von Dir, ohne genügendes Kapital anzufangen.
Bevor Du endgültige Entschlüsse faßt, möchte ich im Anschluß an unser letztes Gespräch in London Dich noch einmal fragen, ob Du Deine Pläne nicht doch lieber hier verwirklichen willst. Ich weiß, daß Du mich für einen Verräter an allen Idealen hältst, an Thron, Vaterland und Altar, aber ich möchte Dich auf eine kleine Broschüre aufmerksam machen. Sie heißt ›Die goldene Internationale‹ und ist das gemeinste Pamphlet gegen die Juden, das Du Dir denken kannst, und verfaßt – von einem hohen Richter!! Das ist hier undenkbar! Zum Teil hängt das mit der Verachtung des Kaufmanns und des von diesem verdienten Geldes in Deutschland zusammen. Der Kaufmann gilt als ein besserer Betrüger und, sobald er Jude ist, nur noch als ein Betrüger. Es gibt keinen Respekt vor kaufmännischer Redlichkeit und Ehre, denn es gibt nur einen Respekt vor militärischer Ehre. Hinzukommt, daß man mit humanistischen Idealen keine Karriere machen kann, wahrscheinlich in den meisten Ländern, daß man aber mit Antisemitismus aufsteigt zum Hofprediger, Volksführer und Reichstagsabgeordneten. Es ist der leichteste Weg zum Gipfel. Siehe Stöcker. Dies gebe ich Dir zu bedenken. Die großen und von reinstem Willen erfüllten Gestalten im deutschen Volk verschwinden immer mehr. Also überleg noch einmal.
Nun leb wohl. Sei herzlich gegrüßt von Deinem Dich innig liebenden Bruder Ben Effinger.«
8. Kapitel
Besuch im Comptoir
Ludwig Goldschmidt, ein kleiner, dicker Mann im langen Gehrock mit einem runden, schwarzen Vollbart, sagte zu seinem Schwager Emmanuel Oppner:
»Ich gehe noch zu einer Kuratoriumssitzung des Armenvereins. Eugenie und ich haben beschlossen, ein Altersheim für gebrechliche Alte zu stiften. Ein sehr geeignetes Grundstück hat mir Brinner schon angeboten. Die Soloweitschick-Werke haben 15% Dividende ausgeschüttet. Phantastisch, was die Industrie in Rußland für Verdienstmöglichkeiten hat, und sie scheint von allein zu gehen. Mein Schwager ist schon wieder mal in Paris.«
»Übrigens, weil du von Brinner sprachst, er hat mir das Haus von Mayer angeboten«, sagte Emmanuel Oppner.
»Ein schrecklicher Fall! Ist mit der Nachmittagspost noch was gewesen?«
»Für 200000 Papiere von Gebrüder Effinger aus Mannheim. Die Mitteilung auf einem abgerissenen Zettel und natürlich ohne Porto, das müssen wir tragen. Die setzen noch die alte Tradition fort.«
»Ein solides Haus«, sagte Goldschmidt.
»Weil du solide sagst: es ist noch eine Mitteilung von einem neugegründeten Bankhaus gekommen, ich muß dir direkt mal die Briefbogen zeigen. Hast du schon mal einen solchen Briefkopf gesehen?«
»Na, ja«, sagte Goldschmidt, »aus Wien! Was willst du, Wiener Schwindler. In Wien sind sie doch alle größenwahnsinnig. Da sind mir die kleinlichen Effingers mit ihrer Abwälzung der Portospesen schon lieber.«
Der Lehrling Hartert brachte die Messinglampe.
»Laufen Sie und holen Sie mir Stöpeln.« Stöpel war ein Droschkenkutscher, der jahraus, jahrein Ludwig Goldschmidt fuhr. Fragte man ihn, warum er nicht Pferd und Wagen habe, so sagte er: »Wozu, ich habe doch Stöpeln.«
»Adieu«, sagte Ludwig, »grüß zu Haus.«
»Gleichfalls«, sagte Oppner.
Es klopfte. Oppner wurde eine Karte gebracht: »Paul Effinger. Kragsheim.« Kragsheim war durchgestrichen. Dabei lag ein Brief.
»Nehmen Sie bitte Platz«, sagte Oppner und zeigte neben seinen Schreibtisch, wo der grüne Schirm über der Petroleumlampe ein ungemein angenehmes Licht verbreitete. Beide Hände an der Schreibtischplatte, wippte er mit dem Stuhl nach hinten: »Sie wollen sich also selbständig machen und eine Fabrik gründen? Warum denn?«
Paul war erschrocken: »Verzeihen Sie mir, Herr Oppner, aber auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet.«
»Ihr Bruder Ben schreibt mir das. Ihr Bruder Ben ist ein ehrgeiziger Jüngling, liebenswürdig, weltlich, mit klaren Zielen. Wenn er Phantasie hätte, er hat wahrscheinlich keine, so schwebte vor seinem geistigen Auge ein Haus in Mayfair und ein Parlamentsgestühl. Aber Sie, Sie sind nicht ehrgeizig, das sehe ich an Ihrem Anzug und an Ihrer Visitenkarte. Warum wollen Sie eine Fabrik gründen?«
»Ich verstehe Sie nicht, Herr Oppner, ein junger Mann muß doch ein Streben haben. Ich möchte doch nicht immer Angestellter sein.«
»Das verstehe ich, aber, sehen Sie, ich habe einmal berechnet, ob sich die Industrie überhaupt lohnt. Sie lohnt sich nicht. 90% aller Fabrikanten setzen ihr Geld zu. An Aktien ist auf die Länge der Zeit immer mehr Geld verloren als verdient worden. Reich wird der Mensch an Bodenrenten, Hausrenten, Grundstücken, als Bankier. Aber als Fabrikant? Sie sitzen da und denken sich: Komischer Bankier. Vergessen Sie nicht, ich bin in meiner Jugend Journalist gewesen. Aber, Herr Effinger, ganz ernst gesprochen: Sie laden sich so schwere Sorgen auf, wie Sie es bei Ihrer Jugend sicher nicht übersehen. Sehen Sie zu, daß Sie einen sehr kapitalkräftigen Teilhaber finden. Mit einem kleinen Kredit von uns ist nichts getan.«
Paul dankte und verabschiedete sich. Er machte einen so gedrückten Eindruck, daß Oppner zu ihm sagte: »Herr Effinger, lassen Sie sich nicht von meiner Absage niederdrücken, kommen Sie ruhig einmal wieder, wenn Sie einen Rat brauchen.«
Paul bekam eine zweite Empfehlung an das Bankhaus Birken. Birken war ein feudaler Herr. »Ein unbekannter junger Mann aus irgendeinem Nest, danke«, sagte er zu dem Anmeldenden. Paul saß im Vorzimmer und bekam einen ablehnenden Bescheid durch den Boten.
Ein anderer Bankier rümpfte die Nase: »Warum geben Ihnen denn die Gebrüder Effinger in Mannheim keinen Kredit?«
Paul setzte sich in ein Café und sah den »Arbeitsmarkt« durch. Vielleicht war wirklich alles Unsinn. Vielleicht sollte man eine Stellung suchen, bekäme Prokura, arbeitete sich hoch. Im Arbeitsmarkt stand eine Anzeige, die ihm gefiel. Er fuhr in sein trübseliges Zimmer, setzte sich hin und antwortete mit seiner schwungvollen Kaufmannsschrift, die wie gestochen aussah, schickte Lebenslauf, Photographie, Zeugnisse. Er sah auf das von Rawerk nie ohne eine gewisse Rührung. So große Leute und … »zu unserer allergrößten Zufriedenheit …«
Aus, dachte er, als der Brief im Kasten lag. Er stand noch einen Augenblick vor dem blauen Briefkasten, in dem er seine Hoffnungen begraben hatte: Ich wollte zwar zu Schlemmer gehen, aber wozu soll ich mir noch eine Fabrik ansehen?
Paul wartete in dem handtuchförmigen Hinterzimmer mit dem Blick auf die graue Mauer. Täglich wurde das Zimmer kahler. Jeden Tag trug die Wirtin ein anderes Stück davon, den Bettvorleger, die weiße gehäkelte Kommodendecke, die rote tuchene Bettüberdecke mit den Samtapplikationen. Jeden Tag trank er auf der roten Samtdecke mit der weißen Serviette den Kaffee, den ihm die Wirtin auf einem abgeschlagenen schwarzen Brett brachte. Dieses abgeschlagene schwarze Brett, diese rote Samtdecke, dieses schreckliche Hinterzimmer gaben ihm ein Gefühl der Redlichkeit, des Sparens, Einteilens und Hochhungerns.