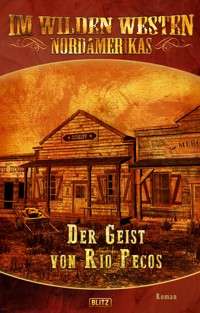
Im wilden Westen Nordamerikas 09: Der Geist von Rio Pecos E-Book
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Im Wilden Westen Nordamerikas (Neue Abenteuer mit Old Shatterhand)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Drahtzieher zahlreicher Überfälle auf Weiße und Indianer befindet sich noch immer auf freiem Fuß. Mit einem Heißluftballon versucht er, sein Gebiet zu kontrollieren.Old Shatterhand trifft auf Ned Buntline und dessen Show. Neue Berichte über einen singenden Geist bei den Comanchen, bestätigen eine ungeheuerliche Vermutung.Die Printausgabe umfasst 154 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
2201 Aufbruch ins Ungewisse
2202 Auf der Spur
2203 Der schwarze Josh
2204 In den Fängen des Ku-Klux-Klan
2205 Heiße Fracht für Juarez
2206 Maximilians Gold
2207 Der Schwur der Blutsbrüder
2208 Zwischen Apachen und Comanchen
2209 Der Geist von Rio Pecos
H. W. Stein (Hrsg.)
Der Geistvon Rio Pecos
Aufgeschrieben von Thomas Ostwald
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2019 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-439-8Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
1.
Staunend hatten die Apachen die Ballonfahrt von John Wise verfolgt. Der Schuss aus dem Gefährt auf eine Vorrichtung im Tal, bei dem ein kleinerer Ballon aus einer Halterung befreit wurde und anschließend in den blauen Himmel hinaufschwebte, versetzte die Indianer in helle Begeisterung. Ein solches Schauspiel hatte noch niemand von ihnen erlebt, und auch mein Blutsbruder Winnetou zeigte sich begeistert, als wir zu dem kleinen Ort Lamy hinunterritten. Dort kündete der dicke Qualm aus dem Schornstein einer Lokomotive von den Fortschritten des Eisenbahnbaus.
Allerdings war es nicht bloße Neugierde, die uns nach Lamy führte. Wir waren bei der Verfolgung der Comanchen auf die Spur von fünf Reitern gestoßen, die direkt in den kleinen Ort geritten waren. Und dabei trafen wir erneut auf den auffälligen Hufabdruck, der uns schon mehrfach bei der Spurensuche aufgefallen war. Zwar bestand nur wenig Hoffnung, ausgerechnet in einem Eisenbahncamp den Reiter zu finden, der an so vielen Orten fürchterlicher Verbrechen gewesen sein musste – aber wir wollten nichts unversucht lassen.
Die Apachen blieben etwa eine Meile vor dem Ort zurück, und nur Winnetou begleitete mich auf seinem herrlichen Rappen, als wir langsam in die Stadt ritten. Wir wollten uns ein Bild vom Ausbau der Eisenbahnstrecke verschaffen und uns in dem Ort umsehen. Und ich hoffte, dabei auch auf John Wise zu treffen. Winnetou bestand darauf, mich zu begleiten. Der Gedanke, dass die bloße Anwesenheit des Apachen uns in einer solchen Stadt, in der sich das übliche Gesindel im Gefolge der Eisenbahn versammelte, zu Schwierigkeiten führen könnte, schreckte weder ihn noch mich ab. Allerdings hielt Winnetou seine Silberbüchse in der rechten Hand, und ich hatte den Henry-Stutzen bereit, als wir uns Lamy näherten.
Hier bot sich uns ein pittoreskes Bild. Wer schon einmal eine der buchstäblich über Nacht aus dem Boden wie Pilze schießenden Städte entlang einer neuen Bahnstrecke erlebt hatte, kann sich dieses Bild ausmalen. Für meine lieben Leser in der Heimat aber ist ein wenig mehr Beschreibung erforderlich, denn gar zu verwunderlich zeigt sich dem Auge der menschliche Erfindungsgeist in solchen Städten.
Schon der Anblick der Häuser wäre für jeden braven Bürger in der Heimat ein Schock, so auch hier, in Lamy. Wir ritten auf der Main Street in den Ort, und dabei handelte es sich keineswegs um eine befestigte Straße, sondern um einen von Schlamm und Dreck aufgewühlten Bereich, an dem sich die Häuser entlangzogen. Auch die Bezeichnung der Hauptstraße, die in ungelenken Buchstaben mit schwarzer Farbe auf ein einfaches Holzbrett geschrieben und an einen entasteten Baumstamm zu Beginn des Ortes genagelt war, mochte irreführend sein. Denn neben dieser Hauptstraße gab es gar keine weitere.
Überall zeigte sich jedoch lebhaftes Treiben. Am Ortsanfang begrüßten uns kräftige Hammerschläge, die laut zu uns herüberdrangen. Wuchtig schlug ein Schmied auf ein Eisenstück ein und formte das noch glühende Ende zu einem großen Haken. Der Mann sah nicht von seiner Arbeit auf, als wir an ihm vorüberkamen, und auch die Menschen, die versuchten, auf einem dürftigen Holzsteg voranzukommen und zum Teil große Lasten dabei schleppten, nahmen keine Notiz von uns.
Ich bemerkte, dass zahlreiche große Holzfassaden mit zum Teil sehr dilettantisch ausgeführten Bildern zwar den Betrachter einluden, in einen der Stores einzutreten – aber dahinter befand sich sehr häufig nichts weiter als ein geräumiges Zelt. Öffnete man die einfache Holztür, so musste man sich oft noch etwas bücken, denn die Zelte hatten mitunter noch nicht einmal die Höhe eines erwachsenen Menschen. Aber es gab in ihnen auch teilweise Öfen, wie die einfach durch einen Dachausschnitt oder seitlich herausführenden Rohre bewiesen. Unwillkürlich schauderte ich zusammen, als ich im Vorüberreiten das alles für mich vermerkte. Ein heimlicher Blick zu dem neben mir reitenden Apachen und ich staunte wieder einmal über das stoische, gleichgültige Gesicht meines Blutsbruders. Hatte er beim Anblick des Ballons vor Kurzem tatsächlich lächelnd seine Begeisterung gezeigt, so war seine Miene in dieser Eisenbahnerstadt hart und verschlossen. Ich konnte es ihm nachempfinden, denn hier wurde er erneut Zeuge der Zerstörung seiner Heimat.
Mit dem stählernen Band, das sich quer durch die Gebiete der Indianerstämme zog, kamen immer mehr Weiße in das Landesinnere. Es waren keineswegs nur friedliche Siedler, die auf ein Stück eigenes Land hofften. Vielmehr trieben diese Boomstädte Gesindel in das Indianergebiet, und dabei konnten feindliche Berührungen nicht ausbleiben.
Wir hatten etwa die Mitte der Stadt erreicht, als ich vor einem zweigeschossigen, stabil wirkenden Holzhaus anhielt. Mein Blick war auf das Schild über der Tür gefallen, und der Name des Hauses lockte mich an. Unter einem etwas plump ausgeführten, dicken Vogel prangte der deutsche Name Zur blanken Schwalbe, und das gab für mich den Ausschlag, hier einzukehren. Ein rascher Blick zu Winnetou genügte für sein Einverständnis, und wir banden unsere Pferde an den Ringen fest, die man zu diesem Zweck an der Hausfront angebracht hatte. Die Fenster sahen sauber und geputzt aus – eine Seltenheit in diesen Städten, denn für solche Dinge hatte der geschäftstüchtige Yankee zumeist keine Zeit.
Als wir in das Halbdunkel des großen Raumes traten, erlebte ich eine weitere, positive Überraschung. Auf den Holztischen lagen weiße Tischdecken, die im Hintergrund mit zahlreichen Flaschen angefüllte Theke war ebenfalls ordentlich, der große Spiegel blitzte und blinkte im Licht zahlreicher mehrarmiger Kerzenleuchter.
„Herzlich willkommen“, begrüßte uns ein hagerer, älterer Mann freundlich und wies auf einen Tisch. Sein Akzent schien tatsächlich auf einen Deutschen zu deuten, sein Aussehen war allerdings dem eines amerikanischen Wirtes angepasst. Allerdings zeigten auch sein weißer Hemdkragen und die darüber ordentlich sitzende Weste keinerlei Flecken oder Schmutzränder auf.
„Möchten die Herren ein schön gekühltes Bier genießen?“, erkundigte sich der Mann fröhlich, als wir Platz genommen hatten.
„Sehr gern, Landsmann“, antwortete ich, und der Hagere verzog sein schon von zahlreichen Falten übersätes Gesicht zu einem glücklichen Lächeln.
„Landsmann?“, antwortete er dann mit einer höflichen Verbeugung. „Na ja, vielleicht nicht ganz, mein Herr, ich stamme aus dem Elsass, bin Bierbrauer und kann mein selbst gebrautes Bier nur empfehlen!“
„Na, das ist ja vortrefflich!“, antwortete ich. „Zwar haben wir Sachsen ja eine sehr alte Brautradition, aber das elsässische Bier soll uns ein Genuss ein!“
Der Hagere verbeugte sich erneut und eilte nach hinten zum Tresen, um dort von einem großen Holzfass das Bier in zwei Krüge laufen zu lassen.
„Etwas zu essen vielleicht dazu? Kennt Ihr Flammkuchen? Ich kann ihn in wenigen Minuten servieren!“, rief er von hinten zu uns herüber. Wir waren die einzigen Gäste, und der Mann schien glücklich zu sein, sich mit uns unterhalten zu können.
„Habt Ihr denn den Teig bereits zubereitet?“, erkundigte ich mich verblüfft, und gleich darauf wieselte der hagere Elsässer mit den beiden wohl gefüllten Bierkrügen heran und stellte sie vor uns ab.
„Das will ich wohl meinen, Mister – meine Flammkuchen sind eine berühmte Spezialität. Selbst die rauen Eisenbahner kommen dafür gern nach der Arbeit zu mir herüber – also erst am späten Abend. Ihr werdet es vielleicht kaum glauben, aber der schmeckt selbst den Chinesen, die sonst immer nur ihr eigenes Essen in ihrem Camp zubereiten!“
„Es gibt hier Chinesen? Ist mir gar nicht aufgefallen!“
„Will ich gern glauben, Mister. Die werdet Ihr auch im Ort nicht erleben, außer, wenn sie einmal zu mir kommen. Ihr wisst es wahrscheinlich selbst, aber niemand mag die Zopfträger in seiner Nähe haben. Die Männer behaupten, dass sie Hunde, Katzen und selbst Ratten essen. Ich halte das für eine Übertreibung, denn wer meinen Flammkuchen schätzt, kann nicht solche ekelhaften Dinge essen wollen. Zum Wohl, die Herren!“
„Haben die Chinesen denn einen eigenen Koch mitgebracht?“, erkundigte ich mich, weil mir ein Gedanke gekommen war. „Oder gibt es in diesem Camp keine Streitigkeiten zwischen den anderen Arbeitern und den Chinesen?“
Der Elsässer lachte laut heraus.
„Und ob es die gibt, Mister! Aber das Camp wird vom General geleitet, und der lässt keinen Streit zu. Als es einmal doch eine Prügelei wegen eines angeblichen Diebstahls gab, trennte er die Streitenden und hielt anschließend Gericht. Schnell stellte es sich heraus, dass der beschuldigte Chinese unschuldig war – er hatte an diesem Tag gar nicht an der Bahnstrecke gearbeitet, sondern dem erkrankten Koch geholfen. Na, schließlich hat der General den Arbeiter rausgeschmissen und damit gezeigt, dass er für die Gerechtigkeit eintritt, auch wenn es sich um Chinesen handelt!“
Ich verzog das Gesicht und musterte den Gastwirt.
„Und das ist tatsächlich so geschehen? Er hat den Weißen entlassen?“
„Ganz sicher, Mister! Der Mann war am Abend hier, hat sich sinnlos betrunken und wollte dann hinausgehen, um den Chinesen über den Haufen zu schießen, wie er es laut verkündete. Aber als er den Revolver zog und damit hier herumfummelte, kam gerade der General herein, erfasste die Situation, ließ den Mann entwaffnen und aus der Stadt werfen.“
Nachdenklich nickte ich zu seinen Worten und bemerkte dazu:
„Das muss ja ein ungewöhnlicher Mensch sein, dieser General. War er tatsächlich einmal Offizier in der Armee?“
„Ja, aber auf der falschen Seite, wenn Ihr versteht, was ich meine, Landsmann. Er diente im Süden!“
Damit zog er sich zurück, denn ich hatte zugestimmt, seine Spezialität einmal zu probieren. Ich war gespannt auf die Wirkung, die dieser Hefeteig mit Zwiebeln und Speck bei meinem Blutsbruder erzeugen würde. Aber Winnetou war stets genügsam und würde schon aus Höflichkeit eine solche Speise nicht ablehnen. Das Bier schmeckte ihm jedenfalls auch, wenn er auch nur mäßig und in kleinen Schlucken davon trank. Ich selbst war ebenfalls begeistert, der elsässische Brauer hatte uns nicht zu viel versprochen.
Wir waren gerade mit unserer Mahlzeit fertig und ich amüsierte mich über das Gesicht meines Blutsbruders, der den Geschmack von Zwiebeln und Speck noch immer im Mund hatte. Jedenfalls bewegte er seine Zunge auffällig an den Zähnen entlang, als wollte er auch das letzte Stück dazwischen herausholen. Da betraten fünf Männer die noch immer leere Gaststube, warfen uns einen raschen Blick zu und gingen dann direkt zur Theke hinüber.
Unwillkürlich spannten sich meine Nackenmuskeln an, als ich diese Männer in ihren schweren Stiefeln, die vor Dreck starrten, den roten Minerhemden und den Hosen aus grobem Drillichstoff langsam durch den Raum gehen sah. Von ihnen ging etwas Bedrohliches aus, erfüllte die Luft im Raum und schien den hageren Brauer in seiner Bewegung zu lähmen. Besonders bedrohlich wirkte aber ein großer, kräftiger Mann, der sich schon in der Kleidung von den anderen unterschied. Er schien der Wortführer zu sein und trat jetzt an den Tresen heran.
Der Mann wollte gerade ein paar gespülte Gläser mit einem trockenen Lappen ausreiben und verharrte jetzt bewegungslos, als die fünf vor ihm stehen blieben und einer von ihnen mit rauer Stimme nur ein einziges Wort an ihn richtete:
„Whisky!“
Endlich kam Bewegung in den Elsässer, er griff eine Flasche und wollte gerade die Gläser füllen, als der Sprecher sich erneut meldete.
„Nicht den Fusel für die Bahnarbeiter. Den unter dem Tresen.“
Gehorsam griff der Brauer zu der Flasche unter dem Tresen und schenkte fünf Gläser voll. Die Männer ergriffen sie, stürzten sie in einem Zug hinunter und der Sprecher orderte erneut fünf Gläser. Dann drehte er sich mit dem wieder gefüllten Glas in der Hand zu uns herum und musterte uns interessiert.
Das also war der General. Sein Gesicht war leicht gebräunt und zeigte scharfe Linien um den Mund und die Nasenflügel. Militärisch kurz geschnittene, schwarze Haare und ein sauber ausrasierter Schnurrbart, ergänzt durch einen kurzen Kinnbart.
Seine Augen schienen zu glitzern, als er uns scharf musterte. Er war vollkommen in das Grau der Südstaaten gekleidet, allerdings ohne ein militärisches Abzeichen. Hose, Weste und Rock waren makellos sauber, eine schwere, goldene Uhrkette führte zu der kleinen Westentasche.
Alle fünf Männer hatten im Hosenbund ihrer Beinkleider Revolver stecken, dazu in einem schwarzen Ledergürtel lange Messer. Ihre Gesichter wirkten auf mich wie die der Männer von Parker, die wir zuletzt beim Blockhaus von Tom Holmes erlebt hatten. Sie waren sonnengebräunt wie bei den Bahnarbeitern, aber ihre Physiognomien erinnerten stark an eine Schlägertruppe. Wulstige Lippen, narbige Wangen, hart zusammengepresste Lippen, Blicke aus eiskalten Augen. Mit ein wenig weniger Erfahrung hätte ich mich schon durch ihren Auftritt beeindrucken lassen. Aber in den letzten Jahren hatte ich so viele Strolche gesehen, dass ich mich hier weder von Blicken provozieren ließ noch von der ganzen Art der fünf Männer, die jetzt nebeneinander nachlässig am Tresen lehnten und uns beobachteten.
„Franzmann!“, ließ sich jetzt der Sprecher wieder vernehmen. „Hast du noch deinen warmen Speckkuchen für uns?“
„Ja, natürlich, General. Für Euch immer, ich weiß doch, was Ihr und Eure Jungs mögt!“
„Dann bring uns endlich etwas davon, ich habe seit einem erbärmlichen Kaffee heute Morgen im Camp nichts mehr genossen!“, antwortete der mit dem Offiziersrang angesprochene Mann. General? Ich schüttelte insgeheim den Kopf über diese Bezeichnung, hütete mich aber, zu auffällig zu ihm herüberzusehen. Dafür starrte der Mann noch immer zu uns herüber, und ich erwartete jeden Augenblick den Ausbruch einer Konfrontation, verursacht durch die Anwesenheit Winnetous. Unbemerkt von den Männern hatte ich deshalb den kleinen Colt open top aus der Tasche gezogen und hielt ihn unter dem Tisch bereit. Winnetou hatte sich während der gesamten Zeit nicht zu den Männern herumgedreht, sondern starrte wie versteinert durch das Fenster hinaus auf die Straße.
Zu meiner Überraschung schritten die fünf Männer jetzt aber zu einem benachbarten Tisch hinüber, als der Elsässer Brauer frischen Flammkuchen auf einem Blech herübertrug. Dort ließen sie sich nieder und begannen mit ihrer Mahlzeit, schnitten sich mit den großen Messern Stücke vom Flammkuchen und schoben sie in den Mund, um dann laut und unappetitlich zu kauen.
Diese Gelegenheit ließ ich mir nicht entgehen, stand auf und ging zum Tresen, um unsere Rechnung zu begleichen. Der Elsässer schaute verlegen zu der wilden Gruppe hinüber, zuckte die Schultern und bedankte sich schließlich für das erhaltene Geld. Als ich mich herumdrehte, stand Winnetou bereits an der Tür und hatte auf unauffällige Weise die Silberbüchse schussfertig in der rechten Hand. Ohne Zwischenfall traten wir auf die Straße hinaus, und als wir unsere Pferde losbanden und aufstiegen, fiel mir buchstäblich ein Stein vom Herzen.
Gemächlich trabten wir weiter auf der verschlammten Straße zum Eisenbahnercamp, das in einiger Entfernung vor der Stadt lag.
2.
Überwiegend Zelte, aber auch einige schnell zusammengenagelte Hütten bildeten das Camp der Eisenbahner, das man längs des schon verlegten Schienenstranges aufgebaut hatte. In der Mitte befand sich die Lokomotive mit den Arbeitswaggons, die wir von den Bergen aus erblickt hatten. Sie stand nicht unter Dampf, was ungewöhnlich war. Aus meiner Zeit als Ingenieur für die Bahn kannte ich ein etwas anderes Bild. Mit dem ersten Lichtstrahl eines frühen Morgens wurde die Arbeit aufgenommen, die Schwellen verlegt, dann kamen die Schienen und die Arbeiter, die sie befestigten. So ging es stetig langsam vorwärts, der Bauzug folgte auf dem gerade noch zusammengeschraubten Schienenstück nach, und unermüdlich wurde hier geschaufelt, geschraubt, gehämmert und geschuftet. Nichts davon zeigte sich hier im Camp, aber Stille herrschte deshalb nicht. Es gab ein mächtiges Stimmengewirr, als wir uns näherten, aber offenbar keinerlei Arbeitstätigkeit. Noch bevor wir die ersten Hütten des Camps erreicht hatten, krachte plötzlich ein Schuss, und damit waren die lauten Stimmen schlagartig verstummt.
„Damit das für alle klar ist, sage ich es noch einmal deutlich: Nehmt sofort eure Arbeitsgeräte in die Hand und geht zum Bahndamm. Wer dort nicht in einer Viertelstunde auftaucht, ist entlassen. Ausstehender Lohn wird nicht mehr ausbezahlt!“
Die Stimme hatte rau und befehlsgewohnt geklungen. Wir zügelten unsere Pferde direkt neben dem Bauzug am Bahndamm und konnten von hier aus die Szene überblicken. Dicht zusammengedrängt standen auf der einen Seite die chinesischen Bahnarbeiter. Alle waren in dunkelblauen Arbeitsdrillich gekleidet, mit kleinen, blauen Kappen auf ihren schwarzen Haaren, die zu einem Zopf geflochten auf dem Rücken hingen. Das war keineswegs Ausdruck ihrer eigenen Kultur, sondern eine Vorschrift aus ihrer Heimat. Alle Chinesen waren auch im Ausland dazu gezwungen, aus Loyalität zum chinesischen Kaiserhaus ihren Zopf zu tragen.
Ihnen gegenüber stand ein wilder Haufen Weißer, deren Gesichter allerdings alle Hautschattierungen aufwiesen. Diese Männer wirkten gegenüber den Chinesen zerlumpt und verschmutzt, trugen dazu alle Sorten von Kopfbedeckungen, um sich vor der Sonne zu schützen, und starrten die andere Gruppe mit wilden Blicken an. Offenbar waren wir gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt eingetroffen. Alles deutete auf einen Streit zwischen den weißen und den chinesischen Bahnarbeitern hin.
In der Mitte der beiden Gruppen stand ein untersetzter, aber sehr muskulös wirkender Mann in blauer Drillichhose und rotem Minerhemd. Seinen Revolver, aus dem er gerade in die Luft geschossen hatte, um sich Gehör zu verschaffen, schob er eben zurück in den Hosenbund. Den breitrandigen Hut hatte er sich in den Nacken geschoben, sodass man sein wutverzerrtes Gesicht gut erkennen konnte. Der dichte, rote Bart und das feuerrote Haar, das unter dem Hut hervorquoll, zeigten deutlich den irischen Typus, und als der Mann jetzt in den Gürtel griff, zog er nicht etwa einen Revolver hervor, sondern eine lange Peitsche, die er geschickt entrollte und mit einem peitschenden Laut durch die Luft schlug. Das zeigte bei den Chinesen eine Reaktion, denn die gesamte Gruppe wich von ihm ein paar Schritte zurück. In der dadurch entstehenden Unruhe kämpfte sich jemand aus der blauen Masse heraus, der seine Mitmenschen mindestens um Haupteslänge überragte. Gleich darauf stand er vor dem Iren, der etwas irritiert zu dem Mann aufsah.





























