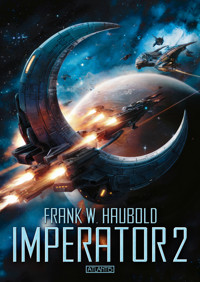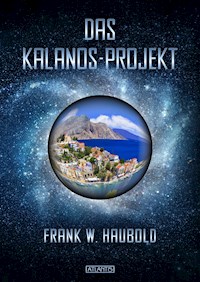8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit Hunderten von Standardjahren herrscht Frieden im Reich von Jemed, dem »Ewigen«, der die Planeten der ehemaligen Föderation unter seiner Herrschaft geeint hat und schon zu Lebzeiten zur Legende geworden ist. Doch jenseits der Grenzen des Reiches schreitet die Evolution der Maschinenintelligenzen voran und bedroht nicht nur die Menschen und ihre Unterstützer, sondern ruft auch eine Macht auf den Plan, die imstande ist, ganze Universen auszulöschen. Doch von alldem ahnt man auf dem beschaulichen Bücherplaneten Libaria Rock nichts, wo der junge Railan Cortez in Geborgenheit aufwächst, bis er in einen Strudel von Ereignissen gerissen wird, die ihm schon bald seine Bestimmung offenbaren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
IMPERATOR Buch I Der verlorene Gott
Prolog
1 Der Perlenmeister
2 Der Bücherplanet
3 July und Morgana
4 Die Überfahrt
5 Der Ordensplanet
6 Die Heimsuchung
7 Das Sichelschiff
8 Die Ausbildung
9 Der traurige Kaiser
10 Der Zweikampf
11 Auf Jagdkurs
12 Die Feuerprobe
13 Die Begegnung
14 Abbitte
15 Duino
16 Die Offenbarung
17 Die Geschichte des Meisters
18 Die Vorladung
19 Das Faustpfand
20 Die Absprache
21 Die Herausforderung
22 Die Audienz
23 Erwartung
24 Die Entscheidung
25 Machtspiele
26 Die Thronrede
27 Im Grauen Fort
28 Die Botschaft
29 Aufbruch
Weitere Atlantis-Titel
IMPERATOR Buch I Der verlorene Gott
Prolog
Vor 500 Standardjahren opferten sich Miriam Katana und Commander Raimond Farr, um die Energiebasis der Spieler (abtrünnige KIs, die in menschlichen Klonkörpern zu Hybridwesen wurden) zu zerstören.
Dadurch brach auch die Invasion zusammen, die die rachsüchtige Geliebte eines Spielers mithilfe einer hochgerüsteten Klonarmee gegen ihre alte Heimat führte. Viele Planeten der Föderation wurden zerstört, aber der Schlüsselplanet Patonga konnte bis zuletzt gehalten werden, sodass die Verteidiger über ein geheimes Portal nach Terra fliehen konnten, der seinerzeit durch den Krieg fast entvölkerten alten Erde.
Die halbmenschliche Ailin Ramakian (Tochter eines Spielers und einer Menschenfrau) wurde zur ersten Herrscherin der Neuansiedlung, gefolgt von ihrem Sohn Jemed, dem ein Seher eine große Zukunft vorhergesagt hatte.
Jemed Ramakian organisierte in der Folge nicht nur die Wiederbesiedlung der alten Erde, sondern vereinte auch die verbliebenen Planeten der ehemaligen Föderation unter seiner Herrschaft. Mithilfe einer Macht, die im Verborgenen bleibt, errichtete er den sogenannten Limes, der verhindern sollte, dass versprengte Spieler Zugang zum Reichsgebiet finden. Die Maßnahme bewährte sich, und nachdem Jemed die kaiserliche Flotte zu einem militärischen Machtfaktor hochgerüstet hatte, verpflichteten sich selbst die wehrhaften Sikhaner, die Reichsgrenzen zu respektieren.
Um Glaubenskriege wie damals auf Terra für immer auszuschließen, verbot Jemed sämtliche religiösen Aktivitäten im Reichsgebiet, sodass auch der ehrwürdige Orden der Heiligen Madonna der letzten Tage seine Heimstatt außerhalb der Reichsgrenzen nehmen musste.
Von gelegentlichen Scharmützeln mit Raumpiraten oder räuberischen Söldnerclans wie den Mareen abgesehen, herrscht nun seit Hunderten Standardjahren Frieden in Jemeds Reich, auch wenn dem Langzeitherrscher selbst persönliches Glück versagt blieb und ihm die Amtsgeschäfte immer mehr zur Last werden.
Doch die Zeiten von Frieden und Prosperität neigen sich ihrem Ende zu. Die Zerstörung ihrer Basis hat die abtrünnigen KIs zwar geschwächt, aber nicht geschlagen. Daran ändert auch die hartnäckige Verfolgung ehemaliger Spieler durch das sikhanische Sichelschiff Amesha nichts, das wie sein Kommandant Admiral Okura inzwischen selbst zur Legende geworden ist.
Die Evolution der Maschinenintelligenzen schreitet dennoch voran und bedroht nicht nur die Menschen und ihre Unterstützer, sondern ruft auch eine Macht auf den Plan, die imstande ist, ganze Universen auszulöschen.
Doch von alldem ahnt man auf dem beschaulichen Bücherplaneten Libaria Rock nichts, wo eifrige Archivare das Schrifttum der Menschheit sammeln und bewahren und der junge Railan Cortez in Geborgenheit aufwächst …
1 Der Perlenmeister
Ein Misston! Daran bestand kein Zweifel, auch wenn gewöhnliche Sinne außerstande gewesen wären, die kaum merkliche Störung der Harmonik überhaupt wahrzunehmen. Doch wie ein begnadeter Dirigent, der unter Dutzenden Violinisten mit Leichtigkeit den Urheber eines falschen Tones herauszufinden vermag, war der Meister in der Lage, jede Unregelmäßigkeit in den akustischen Mustern des aus Hunderten Quellen gespeisten Klangteppichs, der den Perlensaal erfüllte, herauszufiltern.
Dazu bedurfte es nicht einmal besonderer Aufmerksamkeit, denn die Beziehung zwischen dem Objekt seiner Fürsorge und den eigenen Sinnen war inzwischen beinahe symbiotischer Natur. Für einen Außenstehenden mochte die winzige Tonabweichung angesichts der vielstimmigen Wucht der Harmonien vernachlässigbar sein, dem Meister bereitete sie jedoch fast körperlichen Schmerz wie ein haarfeiner Stachel im Fleisch.
Schlagartig war er hellwach, auch mit jenen Bereichen seines multiplen Bewusstseins, die mangels Beschäftigung normalerweise im Halbschlaf dahindämmerten oder sich aus dem unerschöpflichen Reservoir des Traumlandes bedienten.
Wie unsichtbare Fingerkuppen glitten die geschärften Sinne des Meisters über die Oberflächen der frei im Raum schwebenden Perlen und tasteten sie ab, ohne ihre jeweilige Position jedoch auch nur um einen einzigen Millimeter zu verändern. Jede noch so winzige Abweichung würde das fragile Gebilde beschädigen und Disharmonien hervorrufen, die in ihren Folgen unkalkulierbar waren. Allein die Vorstellung war ein Sakrileg, weshalb der Meister den Gedanken sofort wieder aus seinem Bewusstsein verbannte.
Zudem war die Ursache des Übels schnell gefunden – eine unscheinbare Perle vergleichsweise geringer Größe, die sich äußerlich in nichts von ihren Nachbarn unterschied. Dennoch war die Normabweichung signifikant, sowohl mathematisch als auch in ihrem Schwingungsverhalten, was bedeutete, dass ihr inneres Gleichgewicht zumindest punktuell gestört war. Zweifellos – so absurd die Vorstellung auch schien – gingen dort Dinge vor, die sich ihrer Kontrolle entzogen, gefährliche Dinge. Natürlich hatte es Ähnliches schon gegeben – wenn man so lange Dienst tat wie der Meister, gab es wenig, was wirklich neu war –, aber das war eine halbe Ewigkeit her und nach der Reorganisation der betroffenen Objekte waren die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft worden. Wenn jetzt erneut eine Welt außer Kontrolle geriet, hatte jemand versagt: der Hüter!
Da das Objekt inzwischen eingeordnet war, benötigte der Meister nur wenige Augenblicke, um die Identität des Hüters festzustellen und eine Kontaktanforderung auszulösen. Doch zu seiner Überraschung blieb die Nachricht unbeantwortet, selbst nach Wiederholung mit erhöhter Dringlichkeitsstufe. Entweder der Hüter verweigerte den Kontakt, was angesichts der Konsequenzen einer derartigen Insubordination kaum vorstellbar war, oder ihm war etwas zugestoßen.
Auch das war extrem unwahrscheinlich – Hüter waren innerhalb ihres Verantwortungsbereiches unsterblich und mit Fähigkeiten ausgestattet, die jeden physischen oder mentalen Angriff auf ihre Person zur Aussichtslosigkeit verdammten –, aber ein gewisses Restrisiko bestand immer. Zumindest hatte es in der Vergangenheit vereinzelt Fälle gegeben, in denen Hüter Hilfe angefordert hatten, weil sie bestimmten Entwicklungen nicht mehr Herr wurden. Tatsächlich zu Schaden gekommen war allerdings keiner von ihnen, was das Schweigen seines Untergebenen noch mysteriöser machte.
Allerdings konnte es auch ein psychologisches Problem sein, das den Hüter an einer Antwort hinderte. Zwar waren dem Meister keine diesbezüglichen Präzedenzfälle bekannt, wohl aber Berichte, nach denen die emotionale Beziehung zwischen Hüter und Schutzbefohlenen im Einzelfall zu Konflikten geführt hatte. Die Betroffenen waren auf eigenen Wunsch abgelöst worden, es war allerdings durchaus denkbar, dass das System der Selbstkontrolle bei extremer Belastung auch einmal versagte.
Der Schaden, den ein psychisch gestörter Hüter anrichten konnte, war unter Umständen immens, aber solange es keine konkreten Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario gab, waren dem Meister die Hände gebunden. Er brauchte dringend Informationen, die es ihm gestatteten, sowohl Art und Umfang der Normabweichungen einzuschätzen als auch die Ursache für das sonderbare Verhalten des Hüters herauszufinden.
Aufgrund der komplexen Struktur des Systems und der begrenzten Kommunikationsmöglichkeiten war es ihm jedoch unmöglich, selbst Recherchen vor Ort anzustellen. Zwar gab es eine direkte Verbindung zwischen den Welten und ihrer jeweiligen Entsprechung im Perlensaal, die beschränkte sich aber auf den Austausch von für das geometrisch-harmonikale Gesamtbild relevanten Informationen. Offenbar blieb ihm keine andere Wahl, als die Seherinnen um Unterstützung zu bitten, was er jedoch nur ungern tat.
Das hatte nichts mit persönlichen Animositäten zu tun, so gut kannten sie einander nicht. Vielmehr irritierte ihn die Aura des Außergewöhnlichen und Geheimnisvollen, mit der sich die Seherinnen bei all ihren Aktivitäten umgaben. Der Meister war ein Freund klarer Strukturen, Formen, Modelle und Harmonien. Unschärfen waren ihm suspekt, ebenso wie Vorgänge, deren Wirkprinzip er nicht zu durchschauen vermochte. Genau das traf jedoch auf die Fähigkeit der Seherinnen zu, sich selbst oder vielleicht auch nur Teile ihres Bewusstseins an Orte zu versetzen, die auf herkömmlichem Wege nur mit enormem zeitlichen und energetischen Aufwand erreichbar waren. Zudem besaßen sie einen gewissen Hang zur Theatralik, den der Meister nicht nur als deplatziert, sondern auch als ausgesprochen unprofessionell empfand.
Doch die Situation duldete keinen Aufschub, sodass ihm keine andere Wahl blieb, als sich mit ihren Eigenheiten abzufinden. Wenigstens reagierten die Seherinnen umgehend auf seine Anforderung, wenngleich ihre Abgesandte die Gelegenheit zu einem bühnenreifen Auftritt nutzte, indem sie auf einem geflügelten Fabeltier in Nebel gehüllt in sein Blickfeld schwebte. Kaum abgesessen, erkundigte sie sich nach einer devoten Verbeugung in ironischem Tonfall: »Womit können wir Nichtswürdigen dem gestrengen Bewahrer der Weltenordnung zu Diensten sein?«
»Ich brauche Informationen über auffällige Vorgänge, die möglicherweise stabilitätsgefährdend sind«, erwiderte der Meister kühl und übermittelte eine Darstellung des betroffenen Objekts. »Eventuell liegen die auslösenden Ereignisse zeitlich auch schon etwas zurück. Die Normabweichungen sind jedenfalls signifikant.«
»Wie Ihr befehlt.« Die in schimmernden Nebel gehüllte Gestalt verbeugte sich ein weiteres Mal. »Und was ist mit dem zuständigen Hüter?«
Die Frage war zu naheliegend, als dass der Meister ihr hätte ausweichen können.
»Kein Kontakt«, erwiderte er lakonisch. »Aber im Moment ist das zweitrangig. Die Priorität liegt auf der Ermittlung von Art und Umfang der Störung, damit wir die notwendigen Maßnahmen einleiten können. Die Angelegenheit ist dringlich.«
»Selbstverständlich. Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.« Der ironische Unterton war verschwunden. Offenbar war es ihm gelungen, den Ernst der Lage klarzumachen. Die schimmernde Gestalt und ihr Reittier verschwanden ohne die befürchtete Abschiedsvorstellung. Die Verbindung war getrennt.
Trotz ihrer speziellen Fähigkeiten würden die Seherinnen einige Zeit brauchen, um ihren Auftrag zu erfüllen. In der Zwischenzeit konnte der Meister nur darauf hoffen, dass sich die Störung nicht ausbreitete und ihn zum Handeln zwang. Es war weniger der Misston selbst, den er fürchtete, selbst wenn dieser sich noch verstärkte, als vielmehr die Gefahr des Übergreifens des unbekannten Phänomens auf benachbarte Objekte.
Die Harmonik in ihrem komplexen Zusammenspiel stand über allem und die Aufgabe eines Perlenmeisters war es, sie unter allen Umständen zu bewahren. Die Mittel, die ihm dafür zur Verfügung standen, waren vielfältig und reichten von der Isolation über die schrittweise Säuberung bis hin zur vollständigen und unwiderruflichen Auslöschung der außer Kontrolle geratenen Welten.
Was den Meister davon abhielt, sie schon jetzt zum Einsatz zu bringen, waren keine wie auch immer gearteten Skrupel – Sentimentalitäten waren ihm fremd –, sondern reiner Pragmatismus. Es widerstrebte ihm, Ressourcen zu vernichten, die möglicherweise durch einen gezielten Eingriff am rechten Ort stabilisiert und im System gehalten werden konnten. Außerdem hoffte er weiterhin auf ein Lebenszeichen seitens des Hüters, der sich nach wie vor innerhalb des Objektes aufhalten musste, wo auch immer er sich verbarg.
Dennoch musste er für alle Eventualitäten gerüstet sein. Auch wenn der Einsatz der Fänger noch längst nicht beschlossen war, konnte es nicht schaden, ihnen einen Besuch abzustatten. Vor Ort war das unmöglich, selbst wenn der Meister willens gewesen wäre, den Perlensaal zu verlassen. Die harte Strahlung im Zwinger schloss physische Nähe aus. Die einzige Verbindung zur Außenwelt bildete der Wächter, ein intelligentes Überwachungssystem mit eigener Persönlichkeit, dessen Komponenten in strahlungssicheren Feldblasen untergebracht waren. Wie alle bewussten Entitäten verfügte der Wächter über eine Traumlandverbindung, die es ihm in Ruhephasen gestattete, den Mangel an Ansprache und äußeren Reizen zu kompensieren.
Dennoch reagierte er sofort, als der Meister über die Direktverbindung Kontakt herstellte: »Welche Überraschung, der Hüter der Harmonik selbst gibt sich die Ehre!« Trotz der leisen Ironie schwang eine Spur Besorgnis in der Begrüßung mit. »Gibt es ein Problem?«
»Möglicherweise«, gab der Meister zu. »Die Recherchen laufen noch. Im Grunde wollte ich mich nur versichern, dass Ihr wohlauf seid und Eures Amtes waltet.«
»Das ist sehr fürsorglich von Euch«, erwiderte der Wächter amüsiert. »Aber abgesehen von allerlei praktischen Hemmnissen hättet ihr längst Nachricht erhalten, wenn ich desertiert wäre.«
»Das stimmt, vor allem, wenn Ihr vorher Eure Schützlinge von der Kette gelassen hättet.«
»Ohne autorisierte Zielvorgabe sind Fänger vollkommen harmlos«, erklärte der Wächter gekränkt. »Ihre bescheidene Intelligenz ließe im Übrigen gar keine Alleingänge zu.«
»Dann erübrigt sich die Frage der Motivation«, versetzte der Meister trocken. »Es ist immerhin schon einige Zeit her, dass wir ihrer Dienste bedurften.«
»ST 14, ich erinnere mich.« Die Stimme des Wächters klang nachdenklich. »Eine Komplettlöschung – tragische Geschichte.«
»Nicht tragisch, sondern zwangsläufig. Es war der einzige Weg, einen Flächenbrand zu verhindern.«
»Ich weiß, trotzdem hoffe ich, dass es dieses Mal nicht so weit kommt.«
»Das hoffen wir alle«, pflichtete ihm der Perlenmeister bei. »Aber wenn es doch zum Äußersten kommt, darf es keine Verzögerung geben.«
»Natürlich nicht. Die Fänger sind jederzeit einsatzbereit, wie Ihr Euch gern überzeugen könnt.«
Das Wesen, das im nächsten Moment im Blickfeld des Meisters erschien, ähnelte mit seiner schimmernden Haut und dem stromlinienförmigen Körper, der in einer Art Schwanzflosse auslief, eher einem überdimensionalen Raubfisch als einer sternverschlingenden Kampfmaschine, dennoch ging etwas Bedrohliches von ihm aus. Die bläulich fluoreszierende Aura, die das Geschöpf umgab, verstärkte diesen Eindruck noch. Obwohl er sich nicht bewegte, wirkte der Fänger auf schwer zu erklärende Weise lebendig und energiegeladen. Zweifellos würde er auf einen entsprechenden Befehl hin sofort wie von der Sehne geschnellt losjagen, um das Ziel aufzuspüren und zu vernichten – präzise und gnadenlos, wie es seiner Bestimmung entsprach …
Falls der Meister je Zweifel an der Einsatzbereitschaft der Fänger gehabt hatte, waren sie jetzt beseitigt.
»Danke, das genügt!« Die Projektion verschwand augenblicklich. »Ich wusste, dass wir uns auf Euch verlassen können.«
»Stets zu Diensten, Perlenmeister.« Wieder die leise Ironie, die das Unbehagen des Wächters jedoch nicht kaschieren konnte. Eine tödliche Waffe zu verwahren, war etwas anderes, als sie einzusetzen …
»Gut, ich melde mich, falls es notwendig wird.« Der Meister trennte die Verbindung, bevor der Wächter antworten konnte. Sentimentalitäten lagen ihm fern und es gab ohnehin nichts mehr zu besprechen. Was jetzt kam, lag nicht mehr in ihrer Hand …
2 Der Bücherplanet
Railan Cortez, der Sohn des Großarchivars, war ein stiller, nachdenklicher Junge. Er hatte ein intelligentes, fein geschnittenes Gesicht, dunkle Haare und rauchblaue Augen, die manchmal leicht abwesend wirkten, als nähme er seine Umwelt gar nicht wahr. Railan war hochgewachsen und ein wenig schmal für seine Größe, aber zäh und ausdauernd, wenn er sich einmal an den Spielen und Wettkämpfen der Gleichaltrigen beteiligte.
Trotz seines zurückhaltenden Wesens war er beliebt, denn er prahlte nie mit seinem Wissen und half großzügig, wenn ihn jemand darum bat. Provokationen ließ er ins Leere laufen, indem er sich so defensiv verhielt, dass jede Form von Gewalt den Angreifer sofort ins Unrecht gesetzt hätte. Es gab nur eine Schule auf Libaria Rock und jeder kannte jeden.
Seine schulischen Leistungen waren überdurchschnittlich, aber nicht so perfekt, dass er als Streber geächtet worden wäre. Es gab allerdings Lehrer, die argwöhnten, dass Railan manchmal bewusst Fehler und Unsicherheiten einstreute, um die anderen nicht zu brüskieren. Beweisen ließ sich das natürlich nicht, auch wenn es den einen oder anderen wurmte, dass der Junge mit seinem Wissen hinterm Berg hielt. Auf diese Weise hatte Railan jedoch kaum Neider, was ihm nur recht sein konnte, denn obwohl er nach außen hin stets gleichmütig wirkte, war er durchaus harmoniebedürftig.
Die Schule betrachtete er allerdings eher als ein notwendiges Übel, das seine Zeit weit über das notwendige Maß beanspruchte. Railans einzige Leidenschaft galt den Büchern, die zu Tausenden und Abertausenden im Archiv seines Vaters gespeichert waren, das offiziell »Belletristisches Zentralarchiv der kaiserlichen Hofakademie« hieß, im Grunde aber nichts weiter war als eine riesige Bibliothek. Natürlich existierten all diese Bücher nicht körperlich, sondern nur als elektronische Kopien, die in Hunderten vernetzter Modulblöcke in den Katakomben des Planetoiden gespeichert waren.
Die Nutzung und Bewahrung dieses Schatzes war die zentrale und eigentliche Aufgabe der Bewohner von Libaria Rock, das einzig zu diesem Zweck ausgewählt und terraformt worden war. Fast jeder, der hier lebte und arbeitete, hatte in irgendeiner Weise mit der Bibliothek zu tun, sei es als Archivar, Dokumentar, Informatiker oder Wartungstechniker. Neben den unterirdischen Datenspeichern und den Bereichen Organisation und Recherche verfügte die Bibliothek über eine hochmoderne Dirac-Anlage, über die tagtäglich Tausende von Abfragen aus allen bewohnten Welten eingingen und beantwortet wurden.
Hatte der Dienst auf Libaria Rock in den Anfangsjahren hauptsächlich durch die großzügige Bezahlung und diverse Vergünstigungen Bewerber angezogen, so hatte im Lauf der Jahrzehnte ein gewisses Statusbewusstsein Einzug gehalten. Wer hier arbeitete, versah nicht nur irgendeine Tätigkeit, sondern half mit, das Erbe der Menschheit zu bewahren und zugänglich zu halten. Nicht wenige der Jungen, die nach Schulabschluss ein Studium auf der Akademiewelt aufgenommen hatten, kehrten anschließend nach Libaria zurück, um die Familientradition fortzusetzen.
Dieser Weg war auch für Railan vorgezeichnet, obwohl er sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden konnte, für eine gewisse Zeit keinen direkten Zugriff mehr auf seine geliebten Bücher zu haben. Anders als sein Vater, dem Ordnung über alles ging, interessierten Railan die Mechanismen der Datenspeicherung und Zugriffsorganisation nur am Rande. Er lebte mit und in den Büchern, die er las, tauchte ein in die Welt, die der Autor vor seinem inneren Auge erstehen ließ, und hatte manchmal sogar Mühe, danach in sein gewohntes Umfeld zurückzufinden. Auch deshalb empfand er den Schulunterricht häufig als langweilig und sogar störend, es sei denn, seine Lieblingsfächer Literatur und Geschichte standen auf dem Programm.
Mit zunehmendem Alter änderte sich jedoch Railans Sicht auf das Gelesene. Hatte er anfangs hauptsächlich die Handlung verfolgt und mit den Protagonisten mitgefiebert, suchte er jetzt nach Zusammenhängen, die über das konkrete Geschehen hinausgingen. Er versuchte, sich die Welt vorzustellen, in der der Autor gelebt hatte, und fragte sich dabei auch, was jenen letztlich zum Schreiben bewogen hatte. Nicht immer war seine Suche nach einer offenen oder verborgenen Botschaft erfolgreich. Insbesondere bei älteren Büchern, die aus der Zeit vor dem Exodus stammten, blieb ihm vieles fremd. Offenbar spielte Religion damals eine bestimmende Rolle, ein Begriff oder vielmehr Phänomen, das im Lauf der Jahrhunderte fast vollkommen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden war.
Als er seinen Vater danach fragte, erfuhr er zu seiner Überraschung, dass vor allem eine der alten Religionen nach wie vor ihre Anhänger hatte. Es handelte sich um einen christlichen Orden, der auf einem Planetoiden im Grenzland ansässig war, einer dünn besiedelten Region außerhalb der Geschützten Welten. Neben dem Hauptsitz auf Agion Oros existierten angeblich einige noch weiter abgelegene Abteien, in denen jeweils nur eine Handvoll Mönche ein bescheidenes Eremitendasein fristete.
Die Vorstellung faszinierte Railan auch wegen der Kompromisslosigkeit, mit der die Mönche ihren von niemandem eingeforderten Dienst versahen. Es mussten tiefe innere Überzeugungen sein, die sie dazu brachten, ihr Leben fernab der Annehmlichkeiten und Zerstreuungen der modernen Welt einzig dem Gebet und der Betrachtung zu widmen. Natürlich hatte Railan in alten Büchern häufiger von Mönchen, Nonnen und Klöstern gelesen, aber das war in jenen gefahrvollen Zeiten gewesen, in denen die Klöster auch Schutzräume und Orte der Bildung gewesen waren. Heute war Bildung jedoch nur noch eine Frage des eigenen Anspruchs und das Leben im Grenzland gefahrvoller als unter dem Schutz der kaiserlichen Autorität …
Einmal auf diese Spur gebracht, fiel es Railan nicht schwer, Literatur über besagten »Orden der Heiligen Madonna der letzten Tage« zu finden, dessen Wurzeln tief in das föderale Zeitalter, lange vor dem Zusammenschluss der Geschützten Welten zurückreichten. Railan las, und je tiefer er in die Geschichte eindrang, umso mehr wuchsen seine Faszination und sein Respekt vor den Männern, die um ihres Glaubens willen der Welt entsagt hatten.
Sie sind ein bisschen wie ich, dachte er manchmal, wenn er las, mit welcher Ernsthaftigkeit und Akribie sie ihre Exerzitien verrichteten, die heiligen Schriften studierten und ihr eigenes Archiv ergänzten und betreuten. Ihr Glaube blieb Railan zwar fremd – wozu sollte man eine angeblich allmächtige Gottheit anbeten, wenn sie am Ende doch niemals eingriff, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen? –, aber die grundlegenden Fragen, die sie sich stets aufs Neue stellten, waren durchaus auch die seinen.
Mit dem Begriff »Seele« tat Railan sich ein wenig schwer, vermutlich war damit jedoch nichts anderes gemeint als das Ich-Bewusstsein, das der Wissenschaft nach wie vor Rätsel aufgab. Wo kam es her und erlosch es tatsächlich wie eine Kerze, wenn man starb? Und selbst wenn es irgendwie überdauerte, wie es die Gläubigen von ihrer Seele annahmen, womit beschäftigte es sich dann für den Rest der Ewigkeit? Sich für alle Zeiten im Glanz und der Herrlichkeit besagten Gottes zu sonnen, erschien ihm dann doch als eine etwas zu kindliche Vorstellung, selbst an einem Ort allumfassender Liebe und Barmherzigkeit. Aber was blieb, wenn er dieses Hilfskonstrukt verwarf? Nur der Weg in ein Nichts, das alles Erworbene und Erlernte sinnlos machte, ebenso wie den unter Mühen und Irrtümern gefundenen Weg zu der einen oder anderen Einsicht oder einer gewissen inneren Harmonie? Keine Melodie, kein Gedicht, kein Märchen ging jemals für immer verloren, aber ein ganzes Menschenleben schon? Das war weder gerecht noch sinnvoll, sondern im Gegenteil zutiefst deprimierend, es sei denn, überhaupt alles, was Railan war und empfand, beruhte auf einer Täuschung. Aber wenn man sich erst in der Wüste des Zweifels verirrte, blieb am Ende nicht einmal eine verwehte Spur im Sand. Oder eine Grabinschrift wie die jenes antiken Dichters: »… dessen Name in Wasser geschrieben war.«
Für einen Jungen von kaum 16 Jahren waren das sehr abgeklärte Erwägungen und zweifellos auch die Folge seiner Beschäftigung mit den großen Autoren der Literaturgeschichte, angefangen mit Homer und Hesiod über Spötter wie Swift, Heine oder Houellebecq bis hin zu den Chronisten der Großen Invasion und des Zusammenbruchs der Föderation. Das wenigste davon hätten ihm seine Lehrer zur Lektüre empfohlen, was man ihnen kaum zum Vorwurf machen konnte, denn inzwischen war Railan nicht nur seinen Altersgenossen ein großes Stück voraus. Doch mit dem Wissen wuchs auch der Abstand zu seiner Umgebung und trotz seines freundlichen und ausgleichenden Wesens fiel es Railan zunehmend schwer, seine Ansichten mit anderen auszutauschen oder gar ihr Vertrauen zu gewinnen. Auch das war ein aus der Literatur bekanntes Phänomen, aber es war etwas anderes, die Kühle und Einsamkeit am eigenen Leib zu spüren, die diese unfreiwillige Distanz mit sich brachte. Intellektuell hätte es ihm wohl weniger ausgemacht, aber in jüngster Zeit war etwas in sein Leben getreten, dem mit distanzierter Betrachtung kaum beizukommen war.
3 July und Morgana
Was Railan zunehmend beschäftigte, war ebenso bekannt wie unausweichlich und all sein Wissen nützte ihm wenig, als es wie aus heiterem Himmel Macht über ihn gewann. Die körperlichen Veränderungen waren allmählich gekommen. Er war zwar immer noch schlank, aber breitschultriger und muskulöser als noch vor ein, zwei Jahren. Der Flaum auf seinen Wangen war kräftiger und dunkler geworden und er musste sich rasieren, um nicht wie ein Landstreicher auszusehen. Zwar gab es keine Landstreicher auf Libaria, aber in Railans Büchern schon, die nach wie vor einen dominierenden Teil seines Lebens darstellten.
Aber auch anderes ließ sich nicht länger ignorieren: nicht die abschätzenden und manchmal sogar einladenden Blicke der Mädchen, denen die Veränderungen an ihm vermutlich eher aufgefallen waren als Railan selbst; nicht sein Interesse gerade für jene früh erblühten Schulschönheiten, deren intellektuelle Schlichtheit er früher gelegentlich belächelt hatte; nicht die heftige Reaktion seines Körpers selbst auf die banalsten und durchschaubarsten Darbietungen realer oder imaginierter Paarungsbereitschaft, wobei die Grenzen zunehmend verschwammen; und erst recht nicht die zunehmend obsessiven nächtlichen Vorstellungen, in denen besagte Schulschönheiten eine dominante Rolle spielten. Es war würdelos und oft schalt er sich hinterher einen Narren, aber eben erst nachdem er sich Erleichterung verschafft hatte.
Zum ersten Mal vermochten ihm die Bücher nicht zu helfen, obwohl Liebe, Leidenschaft und sexuelle Obsessionen das zentrale Thema sogar einiger der berühmtesten Werke waren. Es gab kein Entkommen aus den Fallstricken der Libido, die sich um intellektuelle Eitelkeiten ebenso wenig kümmerte wie um moralische Bedenken. Natürlich konnte Railan versuchen, sie so lange wie möglich zurückzudrängen, doch das würde die zwangsläufige Eruption nur verzögern, aber niemals aufhalten. Und eigentlich – und das war eine nicht unbedingt intellektuell begründete Einsicht – wollte er das auch gar nicht. Wenn eine Frucht reif war, fiel sie irgendwann vom Baum und er konnte nur hoffen, dass der Aufprall nicht allzu heftig sein würde.
Es bedurfte nicht viel, um Railan zu Fall zu bringen, vermutlich nicht einmal der zwei oder drei Gläser Wein, die er an jenem Abend auf dem Sommerfest eines Schulfreundes getrunken hatte. Das Mädchen hatte sich ihm so plötzlich in den Weg gestellt, als er gedankenverloren durch den Garten streifte, dass er erschrocken aufsah.
»Du bist Ray, nicht wahr?« Ihr Lächeln war betörend und sie musterte ihn so aufmerksam, dass Railan den Blick niederschlug. Natürlich kannte er sie. Es war Juliette aus der Abschlussklasse und es gab wohl keinen Jungen an der Schule, der nicht vernarrt in sie war.
»Railan eigentlich«, murmelte er verlegen und fragte sich, was sie im Schilde führte.
Juliette trug ein hellblaues Sommerkleid, dessen Saum zwei Handbreit über den Knien endete, eine Art Schärpe als Gürtel und bestimmt keinen Büstenhalter. Das rotbraun gelockte Haar fiel ihr weit in den Nacken und ihre Haut war so weiß wie die einer Porzellanfigur. Ihre saphirblauen Augen waren leicht schräg angesetzt wie die einer Katze und ihre vollen Lippen dunkel, fast schwarz geschminkt. Railan würde von ihr träumen, selbst wenn sie sich jetzt abwandte und ihrer Wege ging. Doch ihrem Blick nach zu urteilen, der ihn nach wie vor gefangen hielt, hatte sie etwas anderes vor.
»Ray gefällt mir besser, genauso wie July«, bemerkte sie leichthin und beugte sich dann plötzlich vor, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern: »Laila Estefan sagt, du wärst schwul?«
»Bin ich nicht!«, wehrte er sich empört und spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg.
»Pst, nicht so laut!« Sie lächelte und legte den Finger auf die Lippen. »Ich sehe ja, dass es nicht stimmt. Wollen wir ein Stück gehen?«
Für einen Moment verschlug es ihm die Sprache und er nickte nur heftig. Selbst ohne die Einladung ihres Blicks wäre er ihr überallhin gefolgt.
»Dann geh schon mal vor zum Parkplatz. Ich muss mir nur noch mal kurz die Nase pudern.« July hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und eilte hüftschwingend davon. Verwirrt und immer noch ein wenig ungläubig sah er ihr nach, beeilte sich dann aber, möglichst unbemerkt zum Treffpunkt zu kommen.
Der Parkplatz lag jenseits der Festwiese im Halbdunkel. Railan erkannte nur die Konturen von ein paar E-Quads und einem Kopter auf dem Landekreuz. In der Dunkelheit verrannen die Sekunden noch langsamer und nach einer Weile begann Railan zu fürchten, dass sie ihn versetzt hatte.
Doch dann kam sie, leichtfüßig und mit einer Handtasche über der Schulter. Offenbar sollte es ein längerer Ausflug werden.
»Da bin ich«, erklärte sie ein wenig außer Atem und lächelte, als sie seinen versunkenen Blick bemerkte. »Nun komm schon!« Sie griff nach seiner Hand. »Sehen wir zu, dass wir von hier wegkommen.«
»Und wohin wollen wir?«
»Zur Wolfsaue, dort haben wir immer als Kinder gespielt.« Es klang so unbefangen, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, mit jemandem, den sie kaum kannte, einen derart abgelegenen Ort aufzusuchen.
»Ja, wir auch manchmal«, erwiderte er, nur um überhaupt etwas zu sagen. »Das ist gar nicht so weit weg.«
»Deswegen ja.« Sie drückte seine Hand. »Ich habe es nämlich ein bisschen eilig.«
»Willst du etwa noch weg?«, frage er verwirrt und erschrak, als sie plötzlich hell auflachte.
»Nein.« Sie unterdrückte erneut ein Kichern, wurde dann aber sofort wieder ernst. »Aber du weißt schon, worauf du dich einlässt?«
»Na ja«, wich er aus. »Ich hätte, was das angeht, zumindest eine Idee …«
»Und die wäre?«, erkundigte sie sich mit leisem Spott. Es machte ihr Spaß, ihn in Verlegenheit zu bringen.
»Sag nichts«, flüsterte sie ihm ins Ohr, als er nicht gleich antwortete. »Später vielleicht.«
Obwohl es kaum mehr als eine Andeutung war, genügten die geflüsterten Worte und ein Hauch ihres Parfums, um seinen Verstand fast aussetzen zu lassen. Er begehrte July mehr, als er selbst in den wildesten Träumen je ein Mädchen begehrt hatte, und die Erregung wurde fast übermächtig. Noch vermochte er sich zu beherrschen, aber etwas in ihm riss immer heftiger an den Fesseln.
Es war still, als sie in das Dunkel des Waldes eintauchten, dessen dichtes Blätterdach selbst die Sterne auslöschte. Ein würziger Geruch nach Laub und ausgedörrtem Gras trieb ihnen entgegen, seltsam vertraut wie eine Erinnerung aus alten Tagen. Dann knarrte doch irgendwo, ganz in der Nähe, ein Ast und Railan zuckte fast zusammen. Die Lichtung war jetzt nicht mehr weit, doch bevor der Pfad breiter wurde, blieb das Mädchen plötzlich stehen und wandte sich ihm zu.
»Du kannst immer noch zurück, Railan Cortez«, sagte sie mit einer Stimme, die kühl und dunkel war wie die Schatten ringsum. »Dann bleibt alles, wie es war, und wir haben nur einen kleinen Spaziergang gemacht.«
»Und wenn ich das nicht will?«
»Dann wirst du die dunkle Seite kennenlernen.« July lächelte und fuhr sanft mit den Fingern über seinen Arm. »Das hier zum Beispiel.« Im nächsten Moment bohrten sich ihre Nägel in seine Haut, gaben ihn aber sofort wieder frei und der Schmerz verging. Sie beugte sich über die Wunde, umschloss sie mit den Lippen und saugte das Blut auf. Als sie aufblickte und sich mit der Zunge über die Lippen fuhr, leuchteten ihre Augen: »Willst du das, Ray?«
Darauf gab es keine Antwort, zumindest keine in Worten, und so nahm er sie nur in die Arme und spürte beglückt, wie sie sich an ihn schmiegte. Er presste sie an sich, so fest, dass sie seine Erregung fühlen musste.
»Dann heißt dann wohl ›Ja‹«, bemerkte sie trocken, bevor sie sich ihm entgegenbeugte und seinen Mund mit einem besitzergreifenden Kuss verschloss. Es war nicht mehr als ein erstes Abtasten und ein Versprechen für später, aber allein das Spiel ihrer Zunge und der Duft ihres Haares genügten, um seine Erregung ins fast Unerträgliche zu steigern.
Mit unerwarteter Behändigkeit löste sie sich aus seiner Umarmung, schlüpfte aus ihren Schuhen und nahm sie in die Hand.
»Na, komm schon!«, rief sie bereits im Laufen und winkte ihm übermütig zu. »Wer zuerst da ist!«
Jetzt gab es kein Halten mehr, selbst wenn Railan noch imstande gewesen wäre, klar zu denken. Etwas ihn ihm hatte den Ruf gehört und die Fesseln zerrissen. Er jagte ihr nach wie ein Raubtier seiner Beute, atemlos und fast außer sich vor Gier.
Aber July war keine Beute, das wurde ihm schnell klar, als er sie auf der Lichtung eingeholt hatte und sie zusammen ins weiche Gras fielen. Ihre Wildheit stand seiner in nichts nach, als sie sich gegenseitig die Kleider von Leib rissen und sie ihn sich aufnahm und ihrem Willen unterwarf. July war wie eine Woge, weich und anschmiegsam zuerst, aber von unwiderstehlicher Kraft, wenn sie sich schließlich aufbäumte, ihn umschlang, auspresste und mit ihm verging.
Sie war es, die über Aufstieg und Fall entschied, auch wenn sie manchmal zum Schein seinem Drängen nachgab, um seine Leidenschaft noch mehr anzustacheln. Und wie ein gezähmtes Tier nahm Railan die Lehre an, denn ihr gehörte die Nacht, das hatte er instinktiv begriffen, und alles, was sie ihm gewährte, war ein Geschenk.
»Du wirst wiederkommen«, sagte sie irgendwann, als sie erschöpft voneinander abgelassen hatte, und diesmal klang es nicht nach einer Anzüglichkeit, eher traurig. »Egal, was sie dir erzählen.«
»Warum sollte mich das interessieren?«, fragte er und tastete nach ihrer Hand.
»Weil es wahr ist, was sie sagen«, erwiderte sie ruhig. »Aber es wird dir nichts ausmachen, das weiß ich.«
»Natürlich nicht.« Er schüttelte den Kopf und sah etwas beunruhigt zu ihr hinüber. Aber July lächelte schon wieder und in ihren Augen tanzten herausfordernde Fünkchen.
»O, da braucht wohl jemand Zuspruch«, erklärte sie munter und beugte sich über seinen Schoß. »Aber das bekommen wir hin …«
Sie behielt recht. In jeglicher Hinsicht.
Railan erfuhr es schon am nächsten Tag. Und seltsamerweise von seinem Vater, der sich normalerweise nie in seine Angelegenheiten mischte. Aber jemand hatte sie wohl beobachtet, als sie gegen Morgen splitternackt zum See gelaufen und noch eine Runde geschwommen waren, und nichts Besseres zu tun gehabt, als seinen Vater zu informieren.
Natürlich ging es nicht ums Baden, sondern um July. Sie war angeblich eine Hure, und da es nur eine Handvoll in der Stadt gab, wusste das auch jeder – jeder außer Railan. Ihre Pflegeeltern hatten sie rausgeworfen und deshalb wohnte sie in einem kleinen Cottage am Rand des Stadtparks. July war längst volljährig und besuchte die Schule nur, wenn sie Lust hatte, weshalb sie schon ein paarmal durch die Abschlussprüfung gefallen war. Jedenfalls wäre diese junge Dame kein Umgang für ihn.
Ist sie doch, dachte Railan trotzig, gab sich aber überrascht und reumütig. Sein Vater klopfte ihm auf die Schulter und ließ ihn allein. Das war auch gut, sonst hätte er ihn vielleicht gefragt, woher er das alles so genau wusste. Immerhin war Railans Mutter schon vor vielen Jahren weggegangen und Salvatore Cortez immer noch ein attraktiver Mann … Aber er wollte keinen Streit, sondern nur in Ruhe gelassen werden. Im Grunde war er nicht einmal besonders überrascht. Dass July Geld dafür nahm, war natürlich ein Schock, ihre Erfahrung mit anderen Männern aber kaum. Auf der dunklen Seite gab es keine Unschuld …
Railan las nicht viel an diesem Abend, und eine halbe Stunde nachdem sein Vater zu Bett gegangen war, schlich er sich mit klopfenden Herzen aus dem Haus. Zum Glück wusste er, wo July wohnte, auch wenn er sie am Morgen nur bis zum Park begleitet hatte. Er klopfte an der Tür, erst schüchtern, dann ein wenig lauter, und die Frau ließ ihn ein – an diesem Abend und all jenen, die folgten.
Irgendwann brachte Railan den Mut auf, sie zu fragen, ob sie tatsächlich Geld dafür nahm.
»Ziemlich viel sogar«, erwiderte sie mit einem amüsierten Lächeln. »Bin ich es etwa nicht wert?«
»Doch, aber es ist …« Er suchte vergeblich nach Worten.
»So, wie es ist«, brachte July seinen Satz zu Ende. »Sie nehmen dir nichts weg, oder hattest du den Eindruck?«
Railan schüttelte heftig den Kopf und kam nie wieder darauf zurück.
Er war ihr verfallen.
Dennoch verlief sein Leben, abgesehen natürlich von den nächtlichen Ausflügen, weitgehend in den gewohnten Bahnen. Zwar rechnete er immer damit, dass seine Beziehung zu July auffliegen könnte, aber es geschah nicht. Railans Vater war offenbar der Meinung, dass er Vernunft angenommen hatte, und in der Schule schien niemand davon zu wissen. Wenn sie sich dort zufällig begegneten, tauschten sie nur einen kurzen Blick und ein Lächeln, zu unverfänglich, um von Außenstehenden bemerkt zu werden. Und als Versprechen genügte es allemal.
Railan begann auch wieder zu lesen, wobei sich seine Interessen zwangsläufig verlagert hatten. Er las Bohldaus »Regentin«, die ihn ebenso abstieß wie de Sades »120 Tage von Sodom«, Morrisons »Katzenfrau«, deren unbefangene Grausamkeit ihn faszinierte; Nabokovs Klassiker »Lolita« empfand er dagegen als eher befremdlich, während ihn Houellebecqs »Elementarteilchen« trotz des deprimierenden Fazits zutiefst beeindruckte. Vielleicht lag es daran, dass er beide Seiten kannte, die das ungleiche Brüderpaar repräsentierte: die unterkühlte Distanz des Wissenden und das obsessive Verlangen fernab jeder Vernunft. Das Scheitern der Helden erschien zwangsläufig, dennoch klammerte sich Railan an die Hoffnung, dass es zwischen ihm und July anders sein würde. Er würde sie jedenfalls niemals aufgeben, auch wenn er gelegentlich argwöhnte, dass er vielleicht doch nur ein Spielzeug für sie war.
Immerhin fing er sich nach einer Phase vollkommenen Desinteresses an Schule und Zukunftsplänen wenigstens so weit, dass er es schaffte, sein Leistungsniveau einigermaßen zu halten. Nichts konnte er weniger brauchen als besorgte Anfragen bei seinem Vater, die zwangsläufig dessen Misstrauen erregen würden. Er würde noch früh genug erfahren, dass Railan seine Pläne geändert hatte und nirgendwohin gehen würde, wo July nicht war. Aber bis dahin war glücklicherweise noch etwas Zeit und so bemühte er sich, den Anschein von Normalität zu wahren. Dazu gehörte auch, die Distanz zu seinen Mitschülern nicht noch zu vergrößern, so wenig er sich auch für sie interessierte. Es gab ein paar Ausnahmen, Florian zum Beispiel, ein behinderter, aber durchaus intelligenter Junge, mit dem er sich gern unterhielt oder eine Partie Schach spielte, oder Morgana, ein Mädchen aus der Parallelklasse, das er schon immer nett gefunden hatte.
Morgana gehörte nicht zu den »Schulschönheiten«, die inzwischen ohnehin keinerlei Faszination mehr auf Railan ausübten. Dabei war sie durchaus hübsch mit ihren kastanienbraunen Augen, dem dunklen Haar und dem mediterranen Teint. Allerdings war sie nicht besonders groß, eher dezent gekleidet und ganz gewiss nicht für Albernheiten wie künstliche Fingernägel oder gar Leucht-Tattoos zu haben. Offenbar verspürte sie keinerlei Neigung, im Mittelpunkt zu stehen, was er irgendwie sympathisch fand.
Unterhalten hatten sie sich bislang nur über Schulisches oder allgemeine Dinge, aber er mochte ihr Lächeln, wenn sie sich trafen, und ihren neugierigen offenen Blick. Wenn sie sich für ihn interessierte, dann auf eine angenehm zurückhaltende, fast schon altmodische Art. Deshalb war Railan auch überrascht, als sie im Lesesaal – es war eine Freistunde, die er zumeist mit Recherchen an einem der allerdings frustrierend langsamen Terminals verbrachte – plötzlich dastand und fragte, ob sie sich neben ihn setzen dürfe.
»Klar doch, gerne«, erwiderte er galant. »Es ist mir eine Ehre.«
»Das ist wenigstens nett geschwindelt.« Sie lächelte eine Spur verlegen. »Ich störe dich bestimmt.« Die leicht umständliche Art, mit der sie Platz nahm, amüsierte ihn, zumal er das Kontrastprogramm kannte.
»Überhaupt nicht«, versicherte er. »Diese Terminals sind derart lahm, dass man dabei Kaffee trinken könnte.«
»Deins zu Hause ist bestimmt schneller.«
»Ja, ein bisschen schon.« Er lächelte und fragte sich weiter, weshalb sie ihn gesucht hatte.
»Ich habe deinen Aufsatz gelesen«, erklärte sie schließlich. »Den über den Trojanischen Krieg … Das Geschichtsreferat hat ihn ins Netz gestellt«, fügte sie fast entschuldigend hinzu.
»Ich weiß.« Aus irgendeinem Grund fühlte er einen Anflug von Enttäuschung. »Eigentlich ist es eher Literatur als Geschichte; vermutlich hat Homer die Berichte und Gerüchte nur gesammelt und den Rest dazuerfunden.«
»Es liest sich aber so, als wäre dir die Geschichte wichtig. Ich könnte mir jedenfalls all die Einzelheiten niemals merken.«
Seltsam, dass ihr das aufgefallen war. Normalerweise interessierte sich kaum jemand für die Arbeiten, die die Fachbereiche ins Netz stellten. Morgana dagegen hatte den Text nicht nur gelesen, sondern sogar über seine Motivation nachgedacht. Entweder war ihr das Thema besonders wichtig oder aber …
»Das stimmt«, gab er zu. »Als Kind fand ich es immer ungerecht, dass die Trojaner verloren haben. Wahrscheinlich wünscht man sich immer, dass David gegen Goliath gewinnt.«
»Das spürt man irgendwie beim Lesen; es schwingt immer so etwas wie Bedauern mit.« Sie runzelte die Stirn, als suche sie nach den richtigen Worten. »Trotzdem sind da noch ein paar Sachen, die ich nicht so richtig verstanden habe. Ich weiß, es ist bestimmt zu viel verlangt, aber wenn du irgendwann mal Zeit haben solltest …« Sie brach ab und wurde tatsächlich rot. »Ich meine, falls du mich nicht albern findest …«
Er sah, wie ihre Mundwinkel zu zucken begannen, und begriff, welche Überwindung sie die Frage gekostet hatte. Morgana war keine selbstbewusste Frau wie July, die sich einfach nahm, was sie haben wollte, sondern einfach ein nettes Mädchen, das ihm gerade auf ziemlich verquere Weise eine Liebeserklärung gemacht hatte. Das Problem war, dass Railan ihr nicht wehtun konnte, obwohl eine klare Absage wahrscheinlich der vernünftigste Weg war. Wie auch immer er jetzt reagierte, am Ende würde es falsch sein …
»Ich finde dich nicht albern«, sagte er, bemüht, es weder herablassend noch väterlich klingen zu lassen. Er wollte nach ihrer Hand greifen, ließ es dann aber, weil es ihm allzu vertraulich erschien. »Und natürlich kann ich dir helfen, wenn du magst.«
»Wirklich?« Ihre Augen leuchteten. »Wir könnten zu dir gehen und uns gleich euer Terminal ansehen?« Diesmal war sie es, die nach seiner Hand griff, und natürlich ließ er sie gewähren.
Es war falsch. Er hatte ihr Hoffnungen gemacht, die er niemals einlösen konnte. Das Problem war nicht, dass er Morgana nicht liebte. Immerhin mochte er sie und hätte alles getan, um sie glücklich zu machen. Das Problem war, dass es keinen Weg zurück gab. Selbst wenn er es fertigbrachte, sich von July zu lösen, würde sie immer präsent bleiben …
»Das wird schwierig«, versuchte er ihren Eifer zu dämpfen. »Mein Vater und ich haben gerade ein paar Meinungsverschiedenheiten …«
»Schade.« Es klang traurig und er fragte sich, ob sie wirklich so naiv war oder ihrerseits versuchte, ihn zu manipulieren. Energisch schüttelte er den Gedanken ab. Morgana war nicht July.
»Wir könnten woanders hingehen«, schlug er vor. »Zum Stausee zum Beispiel, da gibt es sogar einen Hotspot an der Anlegestelle. Ich könnte mein Skypad mitbringen …«
Schlagartig hellte sich ihre Miene auf und sie strahlte wie ein Kind, das ein Geschenk bekommen hat. Nur dass seines eine Mogelpackung war, wie ihm sofort schmerzhaft bewusst wurde. Er würde sie entweder enttäuschen oder – was noch schäbiger wäre – ihre Naivität ausnutzen und sie zu sich herabziehen. Allein der Gedanke tat weh.
»Heute Abend?« Ihre Augen baten und er konnte jetzt nicht mehr Nein sagen, nachdem er doch selbst den Vorschlag gemacht hatte.
»Ja, um sieben«, sagte er und rang sich ein Lächeln ab.
»Dann bis später!«, strahlte sie, sprang auf und gab ihm tatsächlich einen Kuss auf die Wange, bevor sie sich umdrehte und ging. Railan sah ihr nicht nach, obwohl er ahnte, dass sie noch einmal an der Tür stehen bleiben würde, um ihm zuzuwinken. Und dann tat er es doch und winkte zurück. Es war hoffnungslos …
Er war ein verdammter Narr. Natürlich hätte er es niemals so weit kommen lassen dürfen, aber Selbstvorwürfe halfen jetzt auch nicht weiter. Er musste irgendeinen Ausweg finden, ohne Morgana wehzutun. Natürlich konnte er sich eine Ausrede für heute Abend ausdenken und absagen, aber das würde das Problem nur verschieben. Einfach nicht hingehen war auch keine Lösung und feige dazu.
Aber wenn er sie traf, würde er früher oder später eine Entscheidung treffen müssen. Nein, es war sogar noch schlimmer, denn im Grunde hatte er sich bereits entschieden. Er konnte Morgana nicht ins Gesicht sagen, dass er nichts für sie empfand. Es stimmte ja auch nicht. Noch vor ein paar Wochen hätte er einem solchen Treffen entgegengefiebert und sich dazu Bilder ausgemalt, die garantiert nichts mit Homer und dem Trojanischen Krieg zu tun hatten. Und jetzt sollte er ihr ohne Not wehtun?
Er konnte natürlich versuchen, July vorzuschieben, aber würde sie das nicht noch mehr kränken? Vermutlich wusste selbst Morgana, wer oder was Juliette war. Außerdem war er nicht Julys Eigentum. Sie schlief mit Männern, die er nicht einmal kannte, und er sollte nicht mit einem Mädchen flirten, das selbst die Initiative ergriffen hatte? Wie er es auch drehte und wendete, es gab keinen Königsweg. Um Grunde konnte er nur darauf hoffen, dass sich die Dinge irgendwie von selbst ordneten, ohne dass es zum Eklat kam …
Morgana war pünktlich. Sie besaß einen kleinen Elektroroller, dessen Summen Railan schon von Weitem gehört hatte. Um diese Zeit war die Anlegestelle leer und verlassen. Das letzte Ausflugsboot hatte um sechs angelegt und natürlich hatten sich die Gäste mittlerweile in alle Richtungen zerstreut.
Railan sah das Mädchen näher kommen, lächelnd und gelöst, und wusste, dass es schieflaufen würde. Die Indizien waren eindeutig: Morgana trug nicht nur das Haar offen, sondern auch ein eng anliegendes T-Shirt und einen für ihre Verhältnisse knapp geschnittenen Rock. Das khakifarbene Shirt war dezent gemustert, zeigte aber etwas weniger dezent, dass sie nichts darunter trug. Und sie hatte sich die Lippen geschminkt, nicht besonders auffällig, aber doch so, dass Railan es bemerkte.
Nichts an ihrer Erscheinung wirkte aufdringlich oder gar geschmacklos, die Botschaft war dennoch eindeutig. Das war jetzt keine Sackgasse mehr, sondern ein ganzes Labyrinth, aus dem er kaum wieder herausfinden würde. Dennoch musste er versuchen, damit klarzukommen …
Also stand er höflich auf, musterte sie von Kopf bis Fuß und machte ihr ein Kompliment: »Du siehst toll aus.«
Sie errötete vor Freude und drückte ihm links und rechts einen Kuss auf die Wange.
»Danke, wenigstens machst du dich nicht lustig: ›Die graue Maus auf dem Kriegspfad.‹«
Sie lachten und er musste zugeben, dass er sich getäuscht hatte. Morgana war nicht naiv. Sie hatte die Situation besser im Griff als er. Und ihr Parfüm war ebenso sorgfältig ausgewählt: unaufdringlich, aber dennoch so, dass der Geruch in Erinnerung blieb. Da er dabei sogar einen leisen Anflug von Erregung verspürt hatte, war es nicht unmöglich, dass es noch etwas anderes enthielt. Aber so viel Raffinesse traute er ihr eigentlich nicht zu.
»Willst du dich nicht setzen?«, schlug er vor und deutete auf die Bank hinter ihnen. »Sonst werde ich noch verlegen.«
»So schlimm wird’s nicht sein«, wehrte sie ab, schien sich aber dennoch zu freuen, dass er ihren Auftritt zu würdigen wusste. Diesmal nahm sie eine etwas entspanntere Sitzhaltung ein als vorhin im Lesesaal, ohne dass es jedoch zur Schaustellung geriet, wie er es von July gewohnt war.
»Also der Trojanische Krieg«, versuchte er zur Tagesordnung überzugehen und schaltete das Skypad ein. »Was möchtest du wissen?«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, aber es galt vermutlich nur dem wenig eleganten Übergang und nicht dem Thema an sich. Selbst wenn ihre angeblichen Unklarheiten nur vorgeschoben waren, würde sie natürlich die Form wahren.
»Die Schlacht selbst und die Zweikämpfe interessieren mich gar nicht so sehr«, begann sie dann auch durchaus ernsthaft. »Es geht mir mehr um die Rolle der Götter.«
»Wer auf welcher Seite steht? Da hätte ich eine Grafik.« Bevor sie etwas sagen konnte, schaltete er das Hologramm aktiv. Über dem stilisierten Schlachtfeld erschienen die Köpfe der wichtigsten Gottheiten: Hera, Athene und Poseidon auf griechischer Seite, Aphrodite, Ares und Apollo auf der trojanischen und jeweils dahinter noch ein paar weitere Namen.
»Schön übersichtlich«, gab sie zu. »Aber eigentlich wollte ich auf etwas anderes hinaus. Ich verstehe nicht, weshalb sie sich überhaupt so direkt einmischen und nicht aus der Ferne Einfluss nehmen. Hier sieht es manchmal so aus, als kämpften eher die Götter und als wären die Menschen nur Schachfiguren. Und woher wollen der oder die Erzähler das überhaupt so genau wissen? Sie werden ja kaum Zugang zum Olymp gehabt haben.«
»Ich weiß es nicht«, gab Railan zu. »Aber die Gottheiten der griechischen Mythologie sind auch sonst so beschrieben, als wäre ihnen nichts Menschliches fremd gewesen. Die damaligen Vorstellungen von Göttern waren eben so. Das ist in der nordischen Mythologie ja nicht anders.«
»Du meinst, sie haben nie existiert?«
»Natürlich nicht.« Er sah sie erstaunt an. »Es sind reine Fabelwesen, die nie jemand wirklich gesehen hat.«
»Kann schon sein«, erwiderte sie wenig überzeugt. »Aber dagegen sprechen eigentlich die ziemlich konkreten Beschreibungen in der Geschichte. Lässt man die Götter weg, wird das Ganze ausgesprochen unlogisch. Irgendetwas muss also daran sein.«
»Und so, wie du darauf bestehst, hast du auch schon eine Idee«, versuchte er sie aus der Reserve zu locken.
»Es ist vielleicht Unsinn«, gab sie zu. »Aber der Gedanke ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Du darfst mich aber nicht auslachen.« Sie musterte ihn mit gerunzelter Stirn, als erwarte sie nichts Gutes.
»Natürlich nicht«, versprach er. »Eigentlich wissen wir ja alle nicht allzu viel darüber.«
»Also gut: Wenn es keine richtigen Götter waren, was ja wohl feststeht, dann könnte es ja auch jemand anderes gewesen sein, der gar nicht aus diesem Zeitalter kam. Die Trasse zwischen Patonga und der alten Erde hat bestimmt damals schon funktioniert und vielleicht gab es sogar noch andere.«
Die Idee war so bizarr, dass es Railan für einen Moment die Sprache verschlug. Es galt zwar inzwischen als gesichert, dass sich die KIs Zugang zur alten Erde verschafft und gelegentlich auch Einfluss genommen hatten, aber dass sie bis in die Antike gelangt sein sollten, fast 3000 Standardjahre zurück? Andererseits gab es kaum verlässliche Quellen über die KI-Ära, sodass im Grunde alles möglich war.
»Ich weiß nicht«, erwiderte er zögernd. »Warum hätten sie das tun sollen, vor allem über einen so langen Zeitraum? Die Belagerung Trojas dauerte insgesamt fast 10 Jahre.«
»Aber die ›Ilias‹ schildert nur 51 Tage.« So schnell gab sich Morgana nicht geschlagen. »Das konnte schon als eine Art Abenteuerurlaub durchgehen, zumal sie sich ja offenbar prächtig amüsiert haben. Es ist erwiesen, dass sie Klonkörper benutzten, um menschliche Gefühle und Leidenschaften ausleben zu können. Für mich passt das eher zu dieser Geschichte als irgendwelche mythischen Gestalten. Und wahrscheinlich war es ja auch nicht erste Mal, dass sie dort als ›Götter‹ aufgetreten sind.«
»Es bleibt trotzdem eine Hypothese«, wandte er ein. »Und es dürfte schwierig sein, Belege dafür zu finden. Trotzdem wundere ich mich, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Mir wäre so etwas nie eingefallen.«
»Na, das war doch wenigstens ein halbes Kompliment«, konstatierte sie zufrieden. »Ich weiß zwar lange nicht so viel wie du, aber ein blindes Huhn findet auch manchmal ein Korn – oder was es eben dafür hält.« Sie zuckte mit den Schultern, vermutlich als Zeichen dafür, dass das Thema Troja damit für sie erledigt war.
»Dr. Craison wäre vermutlich wenig begeistert von der Idee, die griechische Götterwelt vagabundierenden KIs zuzuschreiben«, hakte Railan dennoch unter Anspielung auf ihren Geschichtslehrer nach.
»Muss er auch nicht.« Sie lächelte hintergründig. »Ich wollte eigentlich nur sehen, wie du reagierst.«
»Und habe ich den Test bestanden?«
»Nun, sagen wir: mit 6 von 10 Punkten. Dafür, dass du die Idee für blödsinnig hältst, hast du dich gut gehalten.«
»Und womit hätte ich 10 Punkte verdient?«
»Du hättest sagen können, dass ich genauso klug bin wie schön. Das wäre zwar gelogen gewesen, aber Mädchen hören so was nun mal gern. Und natürlich hättest du versuchen können, mich zu küssen.« Diesmal war es nur ein leichter Hauch von Rot, der ihre Abgebrühtheit Lügen strafte, aber das änderte nichts daran, dass sie ihm keine Wahl ließ. Die Frage war nur, wie weit sie gehen würde.
»Natürlich bist du genauso klug wie schön«, ging er auf das Spiel ein. »Aber wenn ich es so gesagt hätte, hättest du mir vielleicht unlautere Motive unterstellt.«
»Ich mag unlautere Motive«, erwiderte sie mit einem Lächeln, das kaum zu missdeuten war. Er hätte aus Stein müssen, um nicht darauf zu reagieren. Er roch den Duft ihres Parfüms, als sie sich zu ihm neigte und ihre Lippen sich berührten, und dann lag sie auch schon in seinen Armen. Das Karussell nahm Fahrt auf und es gab nichts, was er dagegen tun konnte, obwohl ihm auf einer anderen Ebene seines Bewusstseins durchaus klar war, dass es nicht gut gehen würde. Dabei war es noch nicht einmal ein unkontrollierter Ausbruch wilder Begierde, sondern ein sanftes, aber dennoch zielstrebiges Vorwärtstasten von beiden Seiten, das zwangsläufig immer intensiver wurde. Sie schlang ihre Arme um seinen Nacken, während seine Hand sich ihren Weg aufwärts bahnte und schließlich unter den Saum ihres Schlüpfers glitt. Ihr Atem wurde heftiger, als er sie dort berührte, und dann von einem Augenblick auf den anderen war alles vorbei.
»Nicht!« Für einen Moment verkrampfte sich ihr Körper und er zog seine Hand erschrocken zurück. Morganas Gesicht war blass, als sie sich aus seiner Umarmung löste, und in ihren Augen war aller Glanz erloschen.
»Ich kann nicht«, flüsterte sie mit brüchiger Stimme. »Es geht einfach nicht.« Es klang beinahe verzweifelt und trotz seiner Enttäuschung über die Zurückweisung tat sie ihm leid.
»Entschuldige«, murmelte Railan verlegen. »Ich dachte nur …« Er brach ab. Alles, was er sagen konnte, hätte unpassend geklungen.
»Nein, es ist meine Schuld«, sagte sie tonlos und schluckte. »Ich dachte, ich könnte wie sie sein, aber dann …« Sie schluckte erneut und er sah, wie ihre Mundwinkel zu zucken begannen. Gleich würde sie anfangen zu weinen.
Sie weiß von July!, dachte er bestürzt. Sie hat es die ganze Zeit über gewusst … Eigentlich hätte er erleichtert sein müssen, jetzt, da es nichts mehr zu verbergen gab, dennoch fühlte er sich schäbig. Morgana war zu ihm gekommen, obwohl sie von ihrer Beziehung wusste, und er hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als ihr an die Wäsche zu gehen. Dass sie es selbst provoziert hatte, änderte nichts daran. Er war sie nicht wert. Jemand, der sich nachts zu einer Hure schlich – und das war July, auch wenn sie kein Geld von ihm nahm –, hatte ihre Liebe nicht verdient. Vielleicht hatte Morgana das im letzten Moment begriffen …
»Du gehst doch noch zu ihr?«, fragte sie in diesem Moment so kläglich, dass es ihm wehtat. Es war unmöglich, die unausgesprochene Hoffnung dahinter zu überhören, an die sie sich immer noch klammerte.
»Nein, nicht mehr«, hörte er sich zur eigenen Überraschung antworten und das Merkwürdige daran war, dass er es in diesem Moment selbst glaubte.
»Wirklich?«, fragte sie zweifelnd, während die Farbe in ihr Gesicht zurückkehrte. »Und das sagst du nicht nur, weil ich es hören will?«
»Nein«, wiederholte er und sah, wie ihre Augen aufleuchteten. Und dann fiel sie auch schon in seine Arme und bedeckte sein Gesicht mit Küssen, die er zärtlich, aber ein wenig zurückhaltend erwiderte. Seine Erregung war verflogen und er hatte auch nicht vor, die Situation auszunutzen. Natürlich bemerkte sie es und gab ihn widerstrebend frei.
»Schade«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Aber ich habe dich vorhin wohl zu sehr erschreckt.«
»Ein bisschen schon«, gab er zu. »Ich dachte zuerst, dir wäre plötzlich der Wert der Jungfernschaft bewusst geworden.« Er grinste, um seine Verlegenheit zu überspielen.
»Frechheit!«, empörte sie sich und kniff ihn ziemlich unsanft in die Wange. »So grau ist die Maus nun auch wieder nicht.«
Sie lachten und so war wenigstens für diesen Tag alles wieder gut zwischen ihnen. Railan brachte sie noch zu ihrem Roller. Sie küssten sich, und bevor Morgana losfuhr, drohte sie ihm noch einmal mit dem Zeigefinger: »Du weißt, was du versprochen hast!« Railan nickte. Er hatte sein Wort gegeben und es war ihm durchaus ernst damit. Aber er war auch nicht so naiv zu glauben, dass es leicht sein würde. Dazu beschäftigte ihn noch etwas anderes, das ihn beinahe noch mehr beunruhigte als das Wissen um die eigene Schwäche …
Railan hielt sechs Tage lang durch, bevor er sein Versprechen brach. Er wollte es nicht, aber etwas war stärker als er. Dabei hatte er alles versucht, um July aus seinem Bewusstsein zu verdrängen. Solange Morgana bei ihm war, mit der er fast jede freie Stunde verbrachte, fiel es ihm leicht, aber irgendwann kam die Nacht mit ihren Bildern …
Vielleicht hätte er noch länger ausgehalten, wenn er nicht July zufällig in der Schule begegnet wäre. Ihr Blickkontakt war nur kurz, aber ihr spöttisches Lächeln war ebenso wenig misszuverstehen wie ihre im Vorbeigehen gemurmelten Worte, die nur er hören konnte: »Du kommst wieder.« Er versuchte, sie zu ignorieren, aber es war aussichtslos. Die Bilder ließen sich nicht mehr vertreiben und auch nicht das, was sie in ihm auslösten. Sein Versprechen Morgana gegenüber war wie ein Damm aus morschen Ästen, den die Sturmflut mühelos überspülte. Er schämte sich dafür, aber selbst das war ohne Belang.
Er spürte die Erregung so intensiv wie schon lange nicht mehr in sich aufsteigen, kaum dass Morgana gegangen war. Obwohl er versucht hatte, sich nichts anmerken zu lassen, hatte sie wohl doch bemerkt, dass er mit seinen Gedanken woanders war, und sich noch früh am Abend verabschiedet. Railan fühlte sich schäbig dabei, aber Ungeduld und Gier waren stärker. Er wartete nicht einmal, bis sein Vater zu Bett gegangen war, als er sich aus dem Haus schlich. Er hatte das Versprechen in Julys Augen gelesen und nichts konnte ihn jetzt noch aufhalten.
»Da bist du ja.« Die Frau schien wenig überrascht, Railan zu sehen. Trotz der frühen Stunde, es war erst kurz nach neun, trug sie nicht mehr als ein hauchzartes schwarzes Negligé, das ihre Reize eher betonte als verbarg. »Sieht aus, als hättest du mich vermisst«, bemerkte sie mit einem vielsagenden Blick unter seinen Gürtel. Dennoch warf sie noch einen aufmerksamen Blick nach draußen, bevor sie die Tür schloss.
»Na, komm schon«, sagte sie dann und ließ das seidige Etwas fallen. Mehr bedurfte es auch nicht, um Railan den letzten Rest an Selbstbeherrschung zu nehmen. Noch im Flur fielen sie übereinander her, erfasst von einer Woge des Verlangens, die sie weder aufhalten konnten noch wollten. Doch diesmal trug sie ihn höher, so erschien es Railan jedenfalls, als jemals zuvor, und als sie über ihnen zusammenschlug, fiel er mit einem erlösten Aufschrei ins Bodenlose.
Später – mittlerweile hatten sie es wenigstens ins Schlafzimmer geschafft, einem von Kerzen erhellten Raum, dessen Möblierung sich auf einen flauschigen Teppich und ein halbes Dutzend Sitzkissen beschränkte – trieben Railans Gedanken träge aus der Dunkelheit nach oben. Die Erinnerung kehrte bruchstückhaft zurück, Bilder und Szenen von fast unwirklicher Intensität, die ihn zweifeln ließen, ob er all das tatsächlich getan und zugelassen hatte. Aber der Schmerz in seinem Nacken war real, wo Julys Fingernägel ihre Spuren hinterlassen hatten, ebenso wie die Bisswunde an seinem Hals, die zum Glück nur oberflächlich war und kaum noch blutete.
Sie ist verrückt, dachte er, aber falls das stimmte, war er es auch. July hatte nichts getan, was er, wenn auch unbewusst, nicht herbeigesehnt hatte. Jetzt lag sie neben ihm, und obwohl er zu erschöpft war, um sich umzudrehen, wusste er, dass sie ihn ansah mit jenem sphinxhaften Lächeln, das wie eine Maske war. Was verbirgt sie dahinter?, fragte er sich und wieder schlich sich jener eigentlich vollkommene absurde Gedanke in sein Bewusstsein, den er bis dahin erfolgreich verdrängt hatte.
»Wieso gerade ich?«, fragte er aus einer Eingebung heraus.
Für einen Moment glaubte er, July hätte ihn nicht verstanden, aber dann antwortete sie doch: »Weil wir uns ähnlich sind, ein bisschen jedenfalls.«
»Inwiefern?«, fragte er überrascht.
»Wissen macht einsam, erzähl mir nicht, dass du das nicht wüsstest.« Ihre Stimme klang kühl und beherrscht, aber es lag etwas darin, das ihm Angst machte. Vor allem fragte er sich, welche Art Wissen es sein sollte, das sie beide betraf. Aus den Archiven konnte ihres nicht stammen, so wenig, wie sie sich damit beschäftigte …
»Kann sein«, erwiderte er zweifelnd. »Aber du und einsam? Das kann ich mir nur schwer vorstellen.«
»Das musst du auch nicht«, entgegnete sie knapp. »Es ist trotzdem die einzige Antwort, die ich dir geben kann. Frag bitte nicht weiter.« Ihre Hand fand die seine und drückte sie sanft.
»Und wenn doch?«, fragte er so störrisch wie immer, wenn er das Gefühl hatte, dass sie ihn wie ein Kind behandelte.
»Dann könnte es alles verderben«, erwiderte sie ernst. Er spürte, wie der Druck ihrer Hand fester wurde, beinahe schmerzhaft, bevor es ihr wohl bewusst wurde und sie wieder locker ließ.
Und plötzlich, eigentlich ohne wirklichen Anlass, wurde der Gedanke übermächtig, der ihn schon die ganze Zeit über beschäftigt hatte. Er war vielleicht unsinnig, aber er musste es wissen.
»Du bist kein Mensch, nicht wahr?«, brach es aus ihm heraus, bevor er sich, erschrocken über die eigenen Worte, auf die Lippen biss. Was war nur in ihn gefahren? Es musste sich anhören, als hätte er den Verstand verloren. Gleich würde sie ihn auslachen oder im schlimmsten Fall sogar hinauswerfen …
Aber July lachte nicht. Stattdessen beugte sie sich zu ihm hinüber und sah ihm mit starrer, völlig ausdrucksloser Miene ins Gesicht.
»Nein«, sagte sie dann und es war wie ein kurzer trockener Schlag in die Magengrube. Für einen Moment hörte Railans Herz auf zu schlagen. Er wartete auf den Schmerz, der aber ausblieb, weil irgendetwas alle Empfindungen blockiert hatte. Er konnte nichts anderes tun, als sie anzusehen, gebannt von ihrem Blick, der ohne Wärme und Hoffnung war.
»Nein«, wiederholte sie mit sorgfältiger Betonung. »Aber das darf niemand je erfahren. Versprichst du mir das?« Es war eine Frage, die nur eine Antwort zuließ.
»Ja«, erwiderte er mit brüchiger Stimme und presste die Beckenmuskeln zusammen, um sich nicht einzunässen. Der Tod war noch immer nur einen Lidschlag entfernt.
»Dann ist es ja gut.« Er konnte sehen, wie sich ihr Körper entspannte. Dann lächelte sie sogar und strich ihm sanft, beinahe gedankenverloren über die Wange. »Du bist ein kluger Junge, Ray. Es wäre mir auch schwergefallen, von hier wegzugehen. Libaria hat mir von Anfang an gefallen Es ist genau der richtige Ort, um noch ein wenig Spaß zu haben und dann zu sterben.«
»Wieso sterben?«, fragte Railan eher verwirrt als betroffen. Der Schock saß immer noch tief.
»Ach, das ist eine lange Geschichte.« Sie lehnte sich zurück und stieß hörbar die Luft aus. Als sie weitersprach, klang ihre Stimme so unbeteiligt, als ginge es gar nicht um sie selbst.