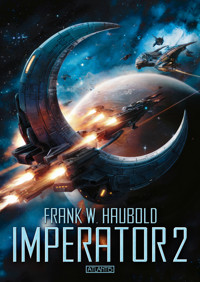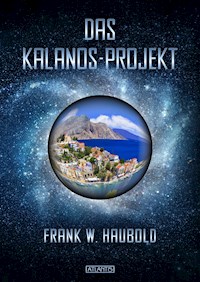Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Allgemeine Reihe
- Sprache: Deutsch
FRANK W. HAUBOLD, wurde 1955 in Frankenberg geboren und lebt im sächsischen Meerane. Er studierte Informatik und Biophysik in Dresden und Berlin. Zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich der Phantastik, sowie Herausgabe mehrerer Anthologien. Für seinen Roman Die Schatten des Mars und die Kurzgeschichte Heimkehr erhielt er 2008 den Deutschen Science-Fiction-Preis in beiden Kategorien. Zuletzt erschienen die Erzählungssammlung Die Sternentänzerin und die Anthologie Der Traum vom Meer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BÜCHER DIESER REIHE
DIE KINDER DER SCHATTENSTADT
ALLGEMEINE REIHE
BUCH 2
FRANK W. HAUBOLD
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2012 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Umschlaggestaltung: Mark Freier, München
Alle Rechte vorbehalten
eBook Satz: Gero Reimer
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-300-1
7002 vom 19.07.2024
INHALT
Prolog
Erster Teil
Der Schacht
Schwarzer Atem
Lena
Schattenbruder
Stille Nacht
Sirien
Die Fassade
Das steinerne Auge
Im Fadenkreuz
Zweiter Teil
Die Botschaft
Die Lieferanten
Countdown
Der Rote Platz
Schlaflos
Das Heilige Land
Dritter Teil
Die Büchse der Pandora
Die Straßen der Verdammnis
Am dunklen Fluss
Der Auftrag
Die Festung
… die Sterne hell und klar
Epilog
Nachwort
Über den Autor
PROLOG
THORS HAMMER
April 1945
Endlich wurde es Tag.
Graue Nebel schlichen sich von Osten her heran und tauchten die Landschaft in diffuses, milchiges Licht.
Der Mann auf dem Feldbett starrte auf das schmutzig graue Fensterviereck und fragte sich, wie viel Zeit ihm noch blieb. Das Warten und das nie verstummende Gewittergrollen der näher rückenden Front zerrten an den Nerven.
Etwa eine Woche noch, schätzte der Mann, dann war so oder so alles vorbei.
Auch für ihn.
Ursprünglich hatte er vorgehabt, sich vor dem Einmarsch der Russen eine Kugel durch den Kopf zu schießen. Das würden jetzt vermutlich andere besorgen.
Der Mann hatte keine Angst vor dem Tod. Der Krieg ging mittlerweile in das siebente Jahr, und der Mann hatte Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte. Er hatte seine Familie, den Glauben an sein Land und zuletzt Gott verloren. Er war müde und freute sich auf das stille Dunkel, das ihn erwartete.
In einer Februarnacht hatten Fliegerbomben die Stadt zerstört, in der der Mann bis zu seiner Einberufung gelebt hatte. Ein Volltreffer hatte das kleine Reihenhaus in der Südvorstadt in einen Krater verwandelt und ausgelöscht, was ihn am Leben gehalten hatte. Von seiner Frau und den Zwillingen war nichts geblieben, was man hätte begraben können. Es war, als hätte es sie nie gegeben.
Danach hatte der Mann nächtelang wach gelegen und nachgedacht. Und als er schließlich zu dem Ergebnis gekommen war, dass es keinen Gott gab, hatten die Träume angefangen.
In seinem wirklichen Leben war der Mann nur ein einziges Mal geflogen, und das war unmittelbar nach seiner Verwundung gewesen. Damals hatte er einen Granatsplitter im Oberschenkel und lag fiebernd im Laderaum einer klapprigen Ju 52, durch deren kleine Bullaugenfenster er so gut wie nichts erkennen konnte.
Doch in seinen Träumen flog der Mann immer.
Er saß auf dem Rücken eines riesigen Vogels, der sein Gewicht mit Leichtigkeit trug. Das unheimliche Wesen schwebte mit weiten Schwingen über dem Land dahin und stieß dabei Töne aus, die sich manchmal zu einer traurigen Melodie reihten.
Sein Flug begann stets in großer Höhe, wo Felder und Wiesen wie braune und grüne Rechtecke auf einem großen Flickenteppich aussahen, gesäumt von Nähten aus silbernen Flüssen. Der Mann konnte erkennen, wie klein die roten Dächer der Häuser in den Tälern dagegen waren und wie winzig die Menschen und Tiere auf den Feldern.
Es gab auch Autos, Panzer und Lastwagen in den Träumen des Mannes, die aus der Vogelperspektive wie Spielzeug aussahen.
Erst als sie an Höhe verloren, bemerkte der Mann, dass der bunten Spielzeugwelt dort unten etwas zugestoßen sein musste.
Es war still, zu still.
Kein Rauch drang aus den Schornsteinen der Häuser. Autos und Lastwagen standen kreuz und quer auf Straßen und Feldwegen. Pferdegespanne waren umgekippt, und die Kadaver der Zugpferde verwesten schwarz in der Sonne.
Noch konnte der Mann keine Einzelheiten erkennen, aber ihm war klar, dass die dunklen Häufchen vor den Häusern tote Menschen sein mussten. Und dass sie wie die Pferde und die anderen Tiere einen ebenso überraschenden wie grausamen Tod gestorben waren.
Ich will das nicht sehen!, schrie der Mann lautlos, doch niemand hörte ihn. Sie verloren weiter an Höhe, der Mann bemerkte, dass der Vogel den Kopf gedreht hatte und ihn mit leuchtenden Augen anstarrte.
„Die Spur der dunklen Reiter“, sagte eine Stimme in seinem Kopf, die ihm seltsam vertraut erschien.
Welcher dunklen Reiter?, fragte der Mann.
„Es bleibt nicht mehr viel Zeit“, antwortete die Stimme scheinbar zusammenhanglos und ließ ihn mit seinen Gedanken und Zweifeln allein.
Sie kreisten jetzt nur noch wenige Meter über den Dächern eines Dorfes, durch das der Sommerwind kaum sichtbare, gelbliche Nebelschwaden trieb.
Die Türen der meisten Häuser standen offen. Offenbar hatten sich ihre Bewohner mit letzter Kraft hinaus ins Freie geschleppt. Viele hatten sich in ihrer Verzweiflung sogar aus den Fenstern gestürzt. Die Menschen waren keinen leichten Tod gestorben. Die meisten von ihnen hatten sich im Todeskampf übergeben und die Reste ihrer zerfetzten Lungen ausgespien.
Ganze Familien lagen, wie von einer gewaltigen Faust niedergestreckt, neben den Kadavern ihrer Haustiere. Unter Bäumen und Sträuchern sammelten sich die grauen Federhäufchen verendeter Vögel. Das Verhängnis, das über das Dorf und seine Bewohner hereingebrochen war, hatte nicht einmal vor den niedrigsten Kreaturen haltgemacht. Der letzte Regen, der hier gefallen war, war ein schwarzer Regen lebloser Insekten.
Der Mann wollte die Augen schließen, sich abwenden, doch eine unsichtbare Kraft hielt ihn gefangen, während sich die Bilder in sein Hirn brannten:
Schwarze Lippen grinsten über gebleckten Zähnen. Hände mit abgebrochenen Fingernägeln hatten sich tief in die Erde gekrallt. Aus aufgedunsenen Gesichtern starrten trübe Augäpfel wie weiße Eierschalen ins Leere. Weit aufgerissene Münder schrien lautlos um Hilfe. Ein kleines Mädchen hielt seine Puppe im Todeskampf fest umklammert, in deren goldenem Haar schwarz erbrochenes Blut klebte.
Der Mann weinte.
Er wünschte sich, winzig klein zu sein, sich in einen Winkel verkriechen zu können und nie wieder etwas sehen zu müssen.
Kreischend schlug der riesige Vogel mit den Flügeln und stieg steil nach oben.
Der Mann fror plötzlich.
Die Kälte fraß sich in seine Glieder, und er spürte, dass er jeden Augenblick das Gleichgewicht verlieren würde. Vergebens versuchte er, sich am Hals der Kreatur festzukrallen. Plötzlich verwandelte sich der Körper des Wesens in glattes Eis, sodass der Mann abrutschte und schreiend in die Tiefe stürzte.
Das Letzte, was seine Augen registrierten, war eine Panzerkolonne, deren Geschütztürme sich ineinander verkeilt hatten, während die winzigen Körper der Soldaten wie erdfarbene Häufchen die graue Straße säumten.
Am Ende erwachte der Mann schweißgebadet und ohne das Gefühl der Erleichterung, das sonst das Erwachen aus einem Albtraum begleitet. Die Bilder blieben.
Der Mann wusste mittlerweile, wer die dunklen Reiter waren, auf die die Stimme in seinem Traum angespielt hatte. Und er wusste auch, dass sie anders als auf Dürers Holzschnitt nicht auf feurigen Rossen daherkommen würden.
Als ihm nach seiner Genesung das Kommando über die neu zusammengestellte Wachkompanie übertragen worden war, war ihm schnell klar geworden, dass es kein gewöhnliches Waffendepot war, das er hier mit seinen Männern bewachen sollte.
Schon die seltsame Reaktion der Bewohner der nahe gelegenen Kleinstadt auf der Herfahrt hatte ihn stutzig gemacht. Ein Nest namens Meerburg mit holprigen, beinahe menschenleeren Straßen. Die wenigen Passanten musterten die Ankömmlinge misstrauisch und verweigerten jede Auskunft. Keiner von ihnen war bereit gewesen, den Soldaten den Weg zum ehemaligen Silberbergwerk zu zeigen. Eine alte Frau mit verweinten Augen hatte sogar etwas von Henkern gemurmelt und ausgespuckt. Eine Bemerkung, die sie leicht hätte den Kopf kosten können.
Dabei führte eine frisch asphaltierte Straße unmittelbar zum Stützpunkt, der sogar einen eigenen Eisenbahnanschluss besaß. Die von einer dünnen Rostschicht bedeckten Gleise führten direkt in den Hauptstollen, dessen Tor wie sämtliche Zugänge zum ehemaligen Bergwerk verschlossen und versiegelt worden war.
Der Mann hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl gehabt, das sich noch verstärkte, als sie das Gelände bei ihrem Eintreffen völlig verlassen vorfanden. Mit Ausnahme einer massiven Baracke waren sämtliche Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt.
Dabei deutete nichts auf einen Bombenangriff hin. Es gab keine Krater, und der hohe Stacheldrahtzaun wies keinerlei Beschädigungen auf.
Nein, hier hatte jemand absichtlich Spuren verwischt, und der Mann machte sich keine Illusionen darüber, wer.
Trotz seines unguten Gefühls hatte der Mann seine Leute antreten lassen, die Unterbringung geregelt und Wachen eingeteilt. Aber sein Misstrauen war geweckt. Und sein Misstrauen war auch der Grund dafür, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben über den direkten Befehl eines Vorgesetzten hinweggesetzt hatte.
Müller II hatte ihm geholfen. Müller II war ein kraftstrotzendes Original aus den Hinterhöfen Berlins und hatte das Kunststück fertiggebracht, sich bis zum Herbst 44 vor der Einberufung zu drücken. Wie, darüber machten Gerüchte die Runde, die mit Protektion und einer hochgestellten Persönlichkeit der Berliner Gesellschaft zu tun hatten – einer weiblichen Persönlichkeit. Vor diesem Hintergrund war es wohl auszuschließen, dass es sich bei Müller II um einen Fanatiker handelte. Vermutlich hatte er nur ein Interesse: gesund nach Hause zu seiner Wohltäterin heimzukehren. Von Beruf war Müller II Schlosser, und das war der andere Grund, weshalb der Mann ihn ins Vertrauen gezogen hatte.
Er hatte ihn bei einer Postenkontrolle beinahe beiläufig gefragt, ob er sich zutraue, das Schloss am Haupttor zu öffnen.
„Klar doch, Herr Oberleutnant. Aber was ist mit dem Siegel?“, hatte Müller II grinsend geantwortet, und dem Mann war klar geworden, dass er ihm etwas anbieten musste.
„Manchmal verschwindet jemand über Nacht“, hatte der Mann vorsichtig geantwortet, „und die anderen merken es erst Stunden später. Und wenn der KC Meldung machen will, ist die Telefonleitung gestört. Hat es alles schon gegeben.“
„Zufälle gibt es, Herr Oberleutnant“, hatte der hochgewachsene Soldat leichthin erwidert, doch seine Augen waren sehr wachsam geworden. Und dann hatte er die Stimme gesenkt und in beschwörendem Tonfall geflüstert: „Sie sollten da nicht allein reingehen, Herr Oberleutnant. Niemand kommt da lebend wieder raus.“
„Woher wollen Sie das wissen, Müller II?“
„Weil ich mich umgehört habe, kurz bevor ich aus Berlin weg musste.“ „Wie umgehört?“ „Na, es gab da eine Bekannte, die hatte was mit jemandem aus dem Reichssicherheitshauptamt. Einer von diesen Totenköpfen, für die wir sowieso bloß 'n Haufen Dreck sind. Sie wissen schon, Herr Oberleutnant.“
„Weiter, Müller II!“
„Wenn der einen in der Krone hatte, hat er fortwährend vom Endsieg und einer neuen Wunderwaffe gefaselt.“ „Daran glauben auch Leute, die völlig nüchtern sind.“ „Ja, aber als dann die Rede auf das Kaff hier und den Schacht kam, bin ich hellhörig geworden.“ „Wissen Sie Einzelheiten?“ „Die haben schon dafür gesorgt, dass niemand quatscht“, sagte der Soldat und deutete auf die verkohlten Gebäudereste hinter ihnen, „aber es gibt 'nen Tarnnamen, unter dem das Projekt bei den Totenköpfen läuft.“
„Und?“, hatte der Mann gespannt eingeworfen.
„Thors Hammer, Herr Oberleutnant.“
Thors Hammer ... Urplötzlich waren die Bilder wieder da.
Im Todeskampf erstarrte Körper und das kleine Mädchen mit der goldhaarigen Puppe. Es hatte kein Gesicht mehr.
„Ist ihnen nicht gut, Herr Oberleutnant?“, drang eine Stimme aus dem Nebel und holte den Mann in die Gegenwart zurück.
„Schon vorbei“, sagte der Mann leise. „Mir war nur ein wenig übel.“
Daraufhin sagte der hochgewachsene Soldat etwas sehr Merkwürdiges: „Sie schlafen wohl auch nicht mehr viel, Herr Oberleutnant.“
Es klang nicht wie eine Frage.
Unter normalen Umständen hätte sich der Mann Vertraulichkeiten dieser Art verbeten, doch in der Stimme des Postens lag ein Unterton, der ihn stutzig machte. Erst jetzt bemerkte er die dunklen Ringe unter den Augen des Soldaten und die spitz unter der gebräunten Haut vortretenden Wangenknochen. Müller II war entweder krank, oder ihn bedrückte etwas, das der Mann zu ahnen glaubte.
So wunderte er sich auch nicht, als der Soldat mit gesenkter Stimme fortfuhr: „Sie können mich einsperren lassen, Herr Oberleutnant, aber ich hätte längst die Knarre weggeworfen und wäre abgehauen, wenn der verdammte Traum nicht wäre. Jede Nacht seh' ich die Toten, und dann stell' ich mir vor, dass das Mädchen mit der Puppe meine Jule ist. Irgendwas steckt in diesem verdammten Stollen, und Gnade uns allen Gott, wenn sie es rauslassen!“
Der Mann schwieg betroffen.
Er war also nicht der einzige, der von diesem Albtraum verfolgt wurde. Und ausgerechnet Müller II, den alle für einen oberflächlichen Weiberhelden hielten, musste ihn damit konfrontieren. Dass er sich in seiner Beurteilung getäuscht hatte, war nicht weiter schlimm, er kannte die Männer ja erst seit wenigen Tagen. Was ihn sprachlos machte, war die Gleichartigkeit der Träume, die offenbar bis ins Detail ging.
Der Mann glaubte nicht mehr an Gott, aber er glaubte auch nicht an Zufälle. Und wenn diese unheimliche Übereinstimmung kein Zufall war, dann blieb ihnen nur noch wenig Zeit.
„Wer könnte noch davon wissen?“, fragte er mit heiserer Stimme.
„Darüber gesprochen hat bis jetzt noch keiner. Aber Hartwig und Zimmermann auf jeden Fall. Hartwig redet im Schlaf, und Zimmermann sieht aus wie der leibhaftige Tod, wenn er früh aus der Koje kriecht.“
Wie der leibhaftige Tod, dachte der Mann, kein Wunder. Als er die weiteren Befehle gab, versuchte er seine Verunsicherung durch betonte Forschheit zu überspielen: „Wir treffen uns Punkt vier während Ihrer dritten Wache, Müller II. Bringen Sie das notwendige Werkzeug mit.“
„Jawohl, Herr Oberleutnant. Und was ist mit Hartwig und Zimmermann?“
„Könnte sein, dass wir sie später brauchen. Bis dahin zu niemandem ein Wort!“
„Jawohl, Herr Oberleutnant!“
Müller II war zwar kein besonders guter Soldat, aber er erwies sich als äußerst geschickter Handwerker. Es dauerte keine fünf Minuten, bis er sowohl das Torschloss als auch das zusätzliche Vorhängeschloss gewaltlos geöffnet hatte. Ohne zu zögern, erbrach der Mann das Siegel und schob die schweren Torflügel zurück.
Es roch nach feuchtem Beton, nach Maschinenöl und ganz schwach, aber unverkennbar, nach Verwesung.
Der Mann kannte diesen Geruch nur zu gut.
So überraschte es ihn auch nicht, als sie in einem Nebenstollen abseits der blitzenden Gleise, die in die Tiefe des Berges führten, auf die Bewohner der niedergebrannten Baracken stießen. Die Henker hatten ihre Opfer in dieser Höhle zusammengetrieben und dann aus schweren Maschinenwaffen das Feuer eröffnet. Die großkalibrigen Projektile hatten ihr Vernichtungswerk so gründlich verrichtet, dass die Zuordnung der von geronnenem Blut bedeckten Körper und Gliedmaßen kaum noch feststellbar war.
Müller II erbrach sich würgend.
Der Mann war nicht stolz darauf, dass er den Anblick ertragen konnte. Es war kein Verdienst, abgestumpft zu sein.
„Wir müssen weiter“, sagte er leise und fasste den Soldaten an der Schulter.
„Tschuldigung“, murmelte Müller II beschämt und wischte sich den Mund ab.
Stumm folgten die beiden Männer dem Verlauf der Gleise, die nach Öl rochen und keine Spur von Rost aufwiesen. Ihre Schritte hallten dumpf von den Wänden der lang gestreckten Betonröhre wider. Nach etwa zweihundert Metern mündete der Tunnel in einer Art Halle, deren Größe sich im unsteten Licht ihrer Taschenlampen nur erahnen ließ.
In der Nähe der Einfahrt fand der Mann eine Verteilertafel und betätigte einen der Schalter. Weißes Licht flutete in den Raum und blendete die Augen.
Erst jetzt wurden die gewaltigen Ausmaße der unterirdischen Anlage offenbar. Die Gleise führten zu einer Drehbühne, wie sie der Mann von den Ausbesserungswerken der Reichsbahn her kannte. Von dort führte ein Dutzend Anschlussgleise strahlenförmig nach außen, und auf jedem dieser Gleise stand eine Lafette mit einem unter dunklen Abdeckplanen verborgenen Flugkörper für ihren Einsatz bereit.
Die beiden Männer entfernten eine der Planen und fanden bestätigt, was der Mann bereits vermutet hatte. Er kannte die stromlinienförmigen Flugkörper aus der Wochenschau und wusste, dass sie zwar das Transportmittel gefunden hatten, aber noch keinen Hinweis auf die Waffe selbst.
Suchend sahen sich die beiden Männer um. Ein beleuchtetes Schild mit der roten Aufschrift Personalschleuse auf der Gegenseite des Hangars erweckte ihre Aufmerksamkeit.
Summend glitt eine chromblitzende Schiebetür zur Seite, als sie sich auf etwa einen Meter genähert hatten.
Die Schleuse enthielt nichts außer zwei schmalen Schrankreihen vor und hinter einer rot beleuchteten Trennlinie und einer weiß gefliesten Duschzelle. Die Spinde auf ihrer Seite waren unverschlossen und leer. Zögernd überquerten die beiden Männer die Trennlinie und öffneten vorsichtig einen der dahinter stehenden Spinde. Er enthielt einen silberglänzenden Schutzanzug, Sauerstoffflaschen und einen Helm mit gläsernem Visier. An einem Ärmel des Anzugs klebten Reste einer gelblichen Substanz. Als der Soldat neugierig danach greifen wollte, riss ihn der Mann mit einer heftigen Bewegung zurück.
„Wollen Sie sich umbringen?“, flüsterte er heiser und bedeutete ihm, sich hinter die rote Linie zurückzuziehen.
Ausgangs der Schleuse befand sich eine mit einem Totenkopfsymbol gekennzeichnete Tür, die jedoch weder Klinke noch Schloss besaß. Offensichtlich handelte es sich dabei um eine Art Aufzug, denn unmittelbar daneben befand sich ein Bedienfeld mit einer großen Pfeiltaste und einer Telefonwählscheibe. Was auch immer sich hinter dieser Tür verbarg, ohne Kenntnis des Codes würden sie es nicht herausfinden.
Das war auch nicht mehr nötig, denn der Mann hatte genug gesehen. Er hatte auch die Kratzer auf dem Boden bemerkt, wo die Kanister mit dem Giftstoff umgeladen und an den Kranhaken der Laufkatze gehängt worden waren. Die Raketen trugen ihre tödliche Last bereits.
Als sie die Schleuse verließen, erläuterte er seinen Plan. Müller II hörte stumm zu, ohne Einwände zu erheben. Sie würden Zimmermann und Hartwig einweihen müssen, denn Zimmermann war bei den Pionieren gewesen, und Hartwig war sein bester Freund.
Müller II hatte tags darauf mit ihnen gesprochen, während sich der Mann darum gekümmert hatte, dass die Wacheinteilung entsprechend geändert wurde. Ob es ihnen auch gelungen war, ihre nächtlichen Aktivitäten vor dem Rest der Truppe geheim zu halten, würde die Zukunft zeigen.
Das alles war jetzt schon über eine Woche her, und seitdem wartete der Mann. Er hatte einen zusätzlichen Posten zur Beobachtung der Zufahrtsstraße eingeteilt, der mit einem Feldtelefon ausgerüstet war. Doch der Apparat in seinem Zimmer war bisher stumm geblieben. Und die Front rückte täglich näher.
In den letzten Tagen waren drei seiner Männer fahnenflüchtig geworden, und der Mann hatte die Vorkommnisse stets mit einer gewissen Verzögerung dem Stab gemeldet. Der diensthabende Offizier hatte seine Meldungen kühl zur Kenntnis genommen und die üblichen Durchhalteparolen von sich gegeben. Das offensichtliche Desinteresse seiner Vorgesetzten hätte den Mann eigentlich beruhigen sollen, bewirkte jedoch das genaue Gegenteil.
Vielleicht hatte man sie schon abgeschrieben.
Während der Arbeiten im Berg hatte der Mann ruhig und traumlos geschlafen. Jetzt kamen die Träume wieder. Und sie hatten nichts von ihrem Schrecken verloren. Während er wach lag, zermarterte sich der Mann den Kopf darüber, ob er wirklich alles bedacht hatte. Waren Müller II und die anderen auf ihren Posten?
Das Feldtelefon klingelte. Schlagartig war der Mann hellwach.
Scheinbar gleichmütig nahm er die Meldung des Postens entgegen: „Habe verstanden, drei Fahrzeuge im Anmarsch. Waffen-SS. Ein PKW und zwei Mannschaftswagen. In Ordnung, Fröhlich, bleiben Sie auf Ihrem Posten. Ende.“
Jetzt blieben ihnen noch etwa zehn Minuten. Zehn Minuten, die über das Leben von achtzig Soldaten entscheiden würden.
Er gab Alarm und ließ die Truppe antreten.
Der Mann hatte keine Befehle mehr zu geben, und so begnügte er sich mit einer knappen Darstellung der Situation. Die Männer begriffen schnell und handelten danach.
Als die Sturmtrupps Minuten später die Türen eintraten, fanden sie die Unterkünfte der Wachmannschaften leer und verlassen. Und die Auskünfte, die ihnen der einzig verbliebene Offizier erteilte, waren alles andere als befriedigend.
Zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten brachten den Mann nach draußen zu ihren Vorgesetzten.
Auf der Zufahrtsstraße wartete ein geschlossener Personenwagen, dessen dunkler Lack im rötlichen Licht der Morgensonne glänzte. Der Fahrer war ausgestiegen und hantierte mit einem Putzlappen an der Kühlerhaube.
Obwohl die beiden Männer im Fond Zivil trugen, erkannte der Mann seinen Gegner sofort. Der Kleinere, ein finster dreinblickender Kommisstyp, der die Scheibe heruntergekurbelt hatte und mit scharfer Kommandostimme Befehle bellte, schied aus.
Der andere Zivilist, ein hochgewachsener Mann mit blonden, fast weißen Haaren, hatte sich zurückgelehnt und lächelte amüsiert. Doch seine Augen lächelten nicht mit. Sie musterten den Ankömmling aufmerksam und abschätzend. Kommentarlos nahm er die Meldung der Uniformierten zur Kenntnis, während sein Begleiter wütend hervorstieß: „Was soll das heißen: Die Wachkompanie ist verschwunden? Fahnenflüchtig! Wieso erfahren wir das erst jetzt?“
„Ruhig, Kramer“, sagte der Mann mit den hellen Augen, der offensichtlich das Kommando innehatte. In seiner Stimme lag keine Spur von Unmut.
Als er Anstalten machte, auszusteigen, sprang der Fahrer hinzu und riss die Tür auf. Der Weißhaarige trug einen sportlich geschnittenen Maßanzug, konnte aber dennoch nicht den Uniformträger verleugnen. Er war ein halben Kopf größer als der Oberleutnant, und seine scharf geschnittenen Gesichtszüge hatten etwas Raubvogelhaftes an sich. Wie bei allen Weißblonden ließ sich sein Alter nur schwer schätzen. In seine Augenwinkel hatten sich winzige Fältchen gegraben, und das Lächeln wirkte wie festgefroren auf seinen schmalen Lippen.
Er reichte dem Oberleutnant die Hand, eine joviale Geste, die so unecht wirkte wie der Augenaufschlag einer Prostituierten.
„Sehr umsichtig, Herr Oberleutnant“, bemerkte er leutselig. „Die Herren haben also den Braten gerochen und das Weite gesucht. Das erspart uns Ungelegenheiten. Darf ich mich vorstellen, Roehner, SD. Ich habe hier das Kommando, das Himmelfahrtskommando sozusagen, ha ha ...“
Sein Begleiter und der Fahrer lachten mit. Doch ihre Gesichter blieben ernst. Es war offensichtlich, dass sie sich vor dem Weißhaarigen fürchteten. Warum, das wurde Augenblicke später offenbar. Ein weiterer Uniformierter war hinzugeeilt, und bat darum, Meldung machen zu dürfen.
Der Weißhaarige reagierte nur mit einer ungeduldigen Handbewegung.
„Mit dem Siegel am Haupttor stimmt etwas nicht“, stieß der Unteroffizier aufgeregt hervor. „Es ist ein Wehrmachtssiegel!“
„Was ist mit den Schlössern?“, unterbrach ihn der Blonde mit schneidender Stimme.
„Die ... die sind in Ordnung“, stotterte der Uniformierte ängstlich.
„Keine Kratzer?“
„Nein, k ... keine Kratzsp... spuren, Herr Standartenführer.“
„Lassen Sie es öffnen. Wegtreten!“
Der Unterscharführer salutierte und war fast augenblicklich verschwunden.
„Das werden Sie uns erklären müssen, Herr Oberleutnant“, wandte sich der Weißhaarige an sein Gegenüber. Seine Stimme klang weich und verbindlich, doch die hellen Augen musterten den Mann mit kalter Distanz.
Der Mann hatte Angst. Nicht um sein Leben, damit hatte er abgeschlossen. Er hatte Angst, dass sein Gegner ihn durchschauen könnte, dass diese kalten, prüfenden Augen in seinem Gesicht lesen könnten, was er wusste. Auch deshalb fiel seine Antwort nicht besonders überzeugend aus: „Das Siegel war bereits erbrochen, als wir hier ankamen. Wie Sie wissen, hat keine formelle Übergabe stattgefunden. Ich habe die Schlösser prüfen lassen und das Tor mit der Kompaniepetschaft versiegelt.“
Der Weißhaarige schwieg. Er hielt den Kopf ein wenig schräg, als würde er auf irgendein Geräusch lauschen. Doch es war nichts zu hören. Als er endlich zu einem Entschluss gekommen war, schwang in seiner Stimme ein Unterton von Bedauern mit: „Es tut mir leid, aber das hätten sie melden müssen. Kramer, führen Sie den Mann ab und lassen Sie ihn erschießen.“
Der Offizier hatte nichts anderes erwartet, doch er durfte sich nichts anmerken lassen. Es war sein Spiel, bis zuletzt. „Das können Sie doch nicht machen!“, schrie er mit überschnappender Stimme, während der vierschrötige Zivilist ihm seine Pistole in den Nacken bohrte. „Ich bin unschuldig ...“
„Sie sollten mir dankbar sein, Herr Oberleutnant“, sagte der weißhaarige Mann nachdenklich. Seine klaren, grauen Augen ruhten noch immer auf dem Gesicht seines Opfers und forschten nach einer Reaktion. „Das ist doch ein schöner, leichter Tod.“
Der Mann hatte verstanden, doch er spielte seine Rolle tapfer zu Ende. Er schrie und wand sich verzweifelt unter den Griffen der herbeigeeilten Soldaten. Er beschwor seine Unschuld, drohte mit dem Kriegsgericht und verstummte erst, als man ihn gefesselt zur Rückwand des Gebäudes gebracht hatte.
Zwei der Soldaten luden ihre Maschinenpistolen durch und brachten sie in Anschlag. Der Mann suchte nach einem Ausdruck in den Augen seiner Henker, fand aber weder Mitleid noch Hass. Er war ihnen gleichgültig. Sie befolgten nur ihre Befehle.
Er sah die Mündungsfeuer aufblitzen und spürte einen dumpfen Schlag auf seiner Brust. Als er fiel, fühlte er sich leicht, beinahe schwerelos. Er hatte keine Angst mehr.
Der erste sonnige Tag in diesem Jahr, dachte der Mann lächelnd, als er den blauen Himmel über sich sah, und starb.
Reinhold Roehner spürte, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte, als er das Kommando zum Aufsitzen gab und die kleine Fahrzeugkolonne in die Dunkelheit des Stollens eintauchte.
Eigentlich war alles nach Plan gelaufen, von dem Zwischenfall mit diesem zwielichtigen Wehrmachtstypen einmal abgesehen. Dass sich die Soldaten der Wachkompanie abgesetzt hatten, hatte ihn zwar zunächst irritiert, ersparte ihnen jedoch letztlich nur Zeit und Munition. Es war ohnehin nicht gut für die Moral der Truppe, die eigenen Leute liquidieren zu müssen. Dass mittlerweile ganze Einheiten desertierten, statt sich dem Feind entgegenzustellen, war nur ein weiteres Indiz für den Verfall von Ehr- und Pflichtbewusstsein bei der Wehrmacht. Warum sollte sich das Fußvolk auch anders verhalten als seine Führer? Jetzt, wo es galt, erhobenen Hauptes zu sterben, verkrochen sie sich wie Ratten in ihren Bunkern und versuchten, ihr Ende so lange wie möglich hinauszuzögern. Und ihn, Standartenführer Reinhard Roehner, hatte man trotz der enormen Bedeutung des Thor-Projektes in Berlin nicht einmal vorgelassen. Er hatte den Eindruck gehabt, dass man ihn als lästigen Störenfried betrachtete, der die Zeichen der Zeit noch nicht begriffen hatte. Einen Fanatiker, der an ein Vorhaben erinnerte, von dessen Umsetzung man längst Abstand genommen hatte.
Und Totila, der seine Ohren überall hatte, hatte ihm die unfassbare Nachricht zugetragen, dass diese Lumpen vorhatten zu kapitulieren! Das war so unwürdig, als hätte König Teja am Vesuv seine Streitaxt weggeworfen und zugesehen, wie die Frauen und Kinder des Gotenvolkes abgeschlachtet wurden. Die Nachwelt hätte bei der Nennung seines Namens ausgespien.
Die wahre Natur eines Führers offenbart sich nicht auf Siegesfeiern und Kundgebungen, sondern in seiner Haltung angesichts der Niederlage. Er, Reinhard Roehner, würde verhindern, dass Deutschland sich vor seinen Feinden demütigte. Seine Entscheidung stand auch ohne Totilas Zuspruch fest.
Den Preis dafür hatte er schon gezahlt. Gestern Nacht hatte er seine Frau Margot und seine beiden Töchter im Schlaf erschossen. Es hatte ihm beinahe das Herz zerrissen, aber es war notwendig gewesen. Er hatte gesehen, wie die Versuchstiere verendet waren und konnte nicht zulassen, dass seine Familie das gleiche Schicksal erlitt.
Angesichts der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, war sein persönlicher Verlust ohne Bedeutung. Das Dritte Reich würde als das letzte Reich der Deutschen in die Geschichte eingehen. Und für die Alliierten, die in Jalta das Fell des Bären schon zerlegt hatten, würde das Wort Pyrrhussieg eine völlig neue Bedeutung erhalten.
„Das Feige siegt – das Edle fällt –
Und Treu und Mut verderben:
Die Schurken sind die Herrn der Welt –
Auf, Goten, lasst uns sterben!“
summte Reinhard Roehner hingebungsvoll, während Hauptsturmführer Kramer ihn misstrauisch von der Seite beäugte. Der gute Kramer war der richtige Mann für handfeste Einsätze, aber intellektuell eine Niete. Kaum anzunehmen, dass er Tejas Abschiedslied aus dem Kampf um Rom kannte:
Noch hegt der Nord manch kühnen Sohn
Als unsres Hasses Erben:
Der Rache Donner grollen schon –
Auf, Goten, lasst uns sterben!
Reinhard Roehner lächelte zufrieden. Kramer und seine Leute waren zwar in groben Zügen über das Projekt informiert, aber eine wichtige Kleinigkeit hatte er ihnen vorenthalten.
Die Flugkörper auf den Eisenbahnlafetten hatten zwar theoretisch eine Reichweite von über tausend Kilometern, aber sie würden nicht so weit fliegen. Wenige Minuten nach dem Start würden sie die von ihm ausgewählten Orte im Reich erreichen und dann explodieren. Der schwarze Tod würde mit den Besiegten auch die Sieger auslöschen.
Der Krüppel im Capitol war zwar bereits tot, aber Churchill und Stalin würde der Verlust ihrer Streitmacht vermutlich das Genick brechen. Thors Hammer würde sie als Feldherren ohne Heer, ohne Jugend und ohne Zukunft zurücklassen. Nur die im Hinterland zurückgebliebenen Feiglinge und Krüppel würden überleben, und ihr krankes Erbgut würde die ohnehin schon fortgeschrittene Degeneration ihrer Nachkommenschaft noch beschleunigen.
Die Deutschen dagegen würden als ein Volk in die Legende eingehen, das anstelle der Knechtschaft den Tod gewählt hatte. Dass es Landsleute gab, die sich ihrer Berufung zu entziehen suchten, spielte vor der Geschichte keine Rolle. Wahrscheinlich hatte es auch in Troja oder am Vesuv Feiglinge gegeben. Doch die Geschichte hatte nicht zugelassen, dass sie den Glanz ihrer Helden besudelten.
Die besorgte Stimme seines unsichtbaren Begleiters riss ihn aus seinen Betrachtungen: Dieser Wehrmachtsoffizier war im Stollen! Er hat die Leichen gefunden.
Na und, dachte Roehner trotzig, genutzt hat ihm das verdammt wenig. So kurz vor dem Ziel ließ er sich selbst von Totila nicht mehr einschüchtern.
Doch die Stimme in seinem Kopf war nicht zum Schweigen zu bringen: Fahr langsamer, es könnte eine Falle sein!
Mit einem Schlag war Reinhard Roehner hellwach.
„Langsamer!“, befahl er heiser.
Der Fahrer reagierte augenblicklich und schaltete herunter. Der Wagen kroch im Schritttempo weiter. Obwohl die drei Männer wie gebannt auf die Fahrbahn starrten, bemerkte keiner von ihnen den winzigen Signalschalter, den der Gefreite Zimmermann unter der Abdeckung eines Revisionsschachtes befestigt hatte.
Das rechte Vorderrad des Wagens löste den Kontakt aus.
Nein!, rief die Stimme, die allein Reinhard Roehner hören konnte.
Erst jetzt sah er die dunklen Bohrlöcher, die die Betonwände des Stollens auf eine Länge von etwa zehn Metern wie Pockennarben bedeckten.
„Zurück!“, brüllte Roehner verzweifelt und packte den Fahrer an der Schulter.
Doch es war zu spät. Hundertachtzig Stangen Dynamit, die ursprünglich für eine Vergrößerung der unterirdischen Forschungsanlagen gedacht waren, zerfetzten in Sekundenbruchteilen die tragenden Wände. Tausende Tonnen Gestein stürzten herab und zerquetschten die Fahrzeuge, die Soldaten und auch den Mann, der sein Volk zur Legende machen wollte.
Bertram Müller, in besseren Zeiten auch der schöne Berti genannt, wartete voller Ungeduld. Er hatte die Schüsse gehört und wusste, dass der Alte nicht mehr am Leben war.
Armer Kerl, dachte Müller II bedauernd, hat den Tod seiner Familie nicht verkraftet. Sonst wäre er wohl mit ihnen gekommen.
Die drei Soldaten hatten ausgeknobelt, wer zurückbleiben musste, und Müller II hatte natürlich verloren. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Nun hockte er allein in dem provisorischen Unterstand, den sie letzten Dienstag zwischen Mitternacht und Morgengrauen in die Erde gegraben hatten, und wartete auf das Signal, das längst überfällig war.
Hoffentlich kamen diese Dreckskerle nicht auf die Idee, die Umgebung abzusuchen, dachte Müller II und tastete nach seinem Karabiner. Lebend werden sie mich jedenfalls nicht bekommen.
Die Klingel des Feldtelefons, das als Signalgeber diente, schrillte.
„Na also“, murmelte Müller II erleichtert. „Fahrt zur Hölle, ihr Mistkerle. Mit schönen Grüßen vom Alten.“
Er griff mit beiden Händen nach dem Bügel des Transverters und zog ihn mit aller Kraft nach unten durch. Einen Augenblick lang fürchtete er, dass der Mechanismus versagt haben könnte, doch dann begann der Boden unter seinen Füßen zu schwanken und ein tiefes Dröhnen erfüllte die Luft. Tausende Kubikmeter Erde waren in Bewegung geraten und hatten den Stollen mit all seinen dunklen Geheimnissen unter sich begraben.
Es war vorbei.
Bertram Müller verschwendete keinen Gedanken mehr an Thors Hammer und den schwarzen Tod. Sie waren nicht mehr als ein böser Traum, den er schon bald vergessen haben würde.
Als er sich pfeifend umzog – die Zivilkleidung hatte er schon seit Wochen in seinem Sturmgepäck versteckt – dachte er an seine Tochter Jule, die er schon in ein paar Tagen wiedersehen würde.
Wenn sich Bertram Müller am ersten Tag seiner neu gewonnenen Freiheit überhaupt allgemeineren Betrachtungen hingab, dann betrafen diese das bevorstehende Kriegsende und die große Zahl junger trostbedürftiger Witwen, derer er sich er nach besten Kräften anzunehmen gedachte.
Als der Donner der Explosion verhallt war, kroch eine schwere Staubwolke aus der Höhle des verschütteten Stollens und schob sich wie eine riesige dunkle Faust vor die Sonne. Denn das Wesen, das mit ihr kam, liebte die Dunkelheit.
Es war so alt, dass es schon immer da gewesen war, und so jung, dass es immer da sein würde. Die Menschen hatten ihm im Lauf der Zeit viele Namen gegeben, doch sie waren nur Ausdruck ihrer Furcht. Die Menschen gaben allen Dingen Namen, ganz gleich, ob sie sie verstanden oder nicht. Einer dieser Namen war Abaddon, und aus unerfindlichen Gründen hatte er sich über die Jahrhunderte gehalten. Das Wesen mochte den Namen, denn er klang dunkel und geheimnisvoll. Selbst benutzte es ihn allerdings nur selten. Für Reinhard Roehner war es Totila gewesen, der junge, tapfere Gotenkönig. Es war ihm leichtgefallen, dessen Gestalt anzunehmen und Roehners dumpfe Phantasien für seine Zwecke zu nutzen. Und beinahe wäre sein Plan aufgegangen.
Doch jetzt war Roehner tot und die Waffe unerreichbar. In wenigen Tagen würden sich Russen und Amerikaner treffen und den Krieg beenden. Die Zeit der Ernte war vorerst vorbei. Abaddon hatte viel erreicht, doch zuletzt hatte er eine Niederlage erlitten.
Er war allerdings erfahren genug, um zu wissen, dass Niederlagen ebenso wie Siege nie von Dauer waren. Die Treibladungen der Flugkörper waren jedenfalls nicht explodiert. Wer auch immer den Stollen gesprengt hatte, hatte – wohl aus Angst vor dem Gift – das Raketendepot unversehrt gelassen. Irgendwann würde sich eine Gelegenheit bieten, darauf zurückzukommen. Zeit spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Als sich die Dämmerung herabgesenkt hatte, verließ Abaddon den Schatten des Waldes und machte sich auf den Weg. Er würde ihn weit nach Westen führen, in die Wüste von New Mexico. Dort bahnten sich in der Nähe des kleinen Örtchens Alamogordo große Dinge an. Schon bald würde dort, mitten in der Wüste, eine Blume erblühen; eine feurige Blume, die die Menschen in ihrer Verblendung Trinity getauft hatten. Und er, Abaddon, würde seinen Teil dazu beitragen, dass es nicht dabei blieb.
ERSTER TEIL
DER DUNKLE VOGEL
Du bist der Vogel, dessen Flügel kamen,
wenn ich erwachte in der Nacht und rief.
Nur mit den Armen rief ich, denn dein Name
ist wie ein Abgrund, tausend Nächte tief.
Rainer Maria Rilke
DER SCHACHT
Die Luft war warm und trug eine Spur Brandgeruch mit sich, der von einem der herbstlichen Laubfeuer in den umliegenden Gärten stammen mochte. Vielleicht hatten aber auch die Funken aus dem Schornstein der Dampflokomotive, die die spärlich besetzten Waggons des Nachmittagszuges hinter sich her schleppte, irgendwo das ausgedörrte Gras der Böschungen entzündet.
Als Fabian mit den anderen Jungen der Talstraßenbande im Gänsemarsch den schmalen Pfad in Richtung Bahndamm hinaufstieg, fühlte er sich so unbeschwert und unternehmungslustig wie schon lange nicht mehr. Sein Stubenarrest war endlich aufgehoben worden und die ärgerliche Geschichte mit der MPi-Patrone, die er dem Göritz Bernd leichtfertigerweise für fünfzig Pfennige abgekauft hatte, schien damit erledigt. Im Augenblick fielen Fabian auch keine anderen Verfehlungen ein, deren mögliches Auffliegen sein Hochgefühl hätte beeinträchtigen können.
Dazu kam, dass heute Samstag war; ein Tag mit lächerlichen vier Schulstunden, die man auf einer Backe absitzen konnte, und ordentlichem Mittagessen, nicht dem üblichen Fraß aus den grünen Blechkübeln der Schulspeisung.
In den Taschen hatte er neben so wichtigen Dingen wie Taschenmesser, Streichhölzern und Katapult auch einen Beutel mit Kartoffeln, die er nachher am Lagerfeuer rösten wollte.
Jetzt, nach dem Ende der Sommerferien, war die Bande auch endlich wieder vollzählig, was von Vorteil sein konnte, wenn man mit der Konkurrenz aneinander geriet. Das betraf in erster Linie die Marmeladenfresser aus der Neubausiedlung am nördlichen Stadtrand, die schon mehrfach die mühselig errichteten Bauten der Jungen zerstört hatten. Einer direkten Konfrontation waren sie bislang allerdings aus dem Wege gegangen.
„Mal sehen, ob die feigen Säcke wieder das Blockhaus eingerissen haben“, verlieh Mark, der eigentlich Markus hieß, ihren Befürchtungen Ausdruck.
Blockhaus war allerdings eine sehr hochtrabende Bezeichnung für das abenteuerliche Konstrukt aus dünnen Birkenstämmen, Ästen und Weidenruten, das sich über einem eingebrochenen Fuchsbau erhob.
„Erst müssen wir mal über die Schienen, ohne an die Drähte zu kommen“, krähte der dicke Martens aufgeregt dazwischen. Wenn Fabian etwas auf die Nerven gehen konnte, dann war das der Dicke mit seinem Gequatsche. Martin, der vor ihm lief, sah das wohl ähnlich: „Bis jetzt hat's immer geklappt. War'n allerdings meistens keine Fettsäcke mit.“
„Selber Fettsack“, konterte der Dicke beleidigt und eindeutig unzutreffend. Seine Körperfülle, die, wenn man der Wahrheit die Ehre geben wollte, gar nicht so auffällig war, war allerdings nicht der einzige Grund für die ablehnende Haltung der anderen Jungen dem dicken Martens gegenüber.
Der Dicke war erst vor wenigen Jahren in die Stadt gekommen und wohnte aus Gründen, die keiner von ihnen so genau kannte, bei seiner Großmutter in einem kleinen Reihenhaus in der Talstraße. Über die Familie kursierten in der Schule allerlei Gerüchte. Dass seine Eltern im Westen wären oder gar im Zuchthaus. Natürlich erzählten die Leute viel, wenn der Tag lang war, aber ein wenig seltsam war das Ganze schon.
Dass die besagte Großmutter den Dicken nach Strich und Faden verwöhnte, war allerdings kein Gerücht. Sie beschwerte sich regelmäßig bei Elternabenden über das angeblich rüpelhafte Betragen seiner Mitschüler und ergriff auch sonst bei jedem Anlass lautstark dessen Partei. Eines Abends war sie sogar in mehr oder weniger berechtigter Empörung auf ein paar Jungs, die ihren Damian – was für ein bescheuerter Name! – vor ihrem Fenster gepiesackt hatten, mit einem Nudelholz losgegangen. Der Vorfall hatte sich natürlich herumgesprochen und den Dicken zum Gespött des ganzen Viertels gemacht. Von nun an konnte er anstellen, was er wollte, für seine Altersgenossen würde er immer das Großmaul bleiben, das sich hinter den Rockzipfeln seiner Oma versteckte, wenn es ernst wurde.
In den letzten Tagen hatte er allerdings keinen Vorwand geliefert, ihn von gemeinsamen Unternehmungen auszuschließen, sodass sie sich zähneknirschend mit seiner Anwesenheit abfinden mussten. Den Dicken einfach davonzujagen, wäre ihnen dann doch unfair erschienen, zumal es ja auch Phasen gab, in denen er sich zusammenriss. Heute brachte er es wider Erwarten sogar fertig, das Hindernis zu durchkriechen, ohne die rostigen Signaldrähte zu berühren.
Obwohl keiner von ihnen jemals einen Gleiswächter zu Gesicht bekommen hatte, waren die Jungen allesamt davon überzeugt, dass eine unvorsichtige Berührung der Drähte die sofortige Suche nach den Übeltätern zur Folge haben würde. In jedem Fall empfahl es sich, nach der Überquerung der Gleise die Beine in die Hand zu nehmen und sich unter das schützende Blätterdach des gegenüberliegenden Waldstücks zurückzuziehen.
Die Sorge der Jungen um den Zustand des Blockhauses erwies sich als unbegründet. Offensichtlich hatte das zur Tarnung benutzte Buschwerk seiner Funktion genügt, oder es war einfach niemand vorbeigekommen.
Es dauerte nicht lange, bis Martin und Mark ein Lagerfeuer entfacht hatten, an dem es sich die sechs Jungen bequem machten. Die von den umliegenden Müllplätzen stammenden Sitzgelegenheiten hätten wohl kaum den Beifall ihrer Eltern gefunden, was der allgemeinen Zufriedenheit jedoch keinen Abbruch tat. Mit Todesverachtung verzehrten die Jungen die halb rohen, halb verbrannten Röstkartoffeln und knallten dazu mit den Porzellanschnappverschlüssen der vom Lagerplatz der Firma Bier-Richter besorgten Limonadenflaschen.
Doch den Höhepunkt der Mahlzeit bildete ein gutes Dutzend russischer Zigaretten, sogenannter Papyrosi, die die Russen auf ihrem Rückzug aus der Tschechei paketweise von ihren Panzerwagen heruntergeworfen hatten, was zumindest bei der Jugend der Stadt Begeisterung ausgelöst hatte.
Dass der Rauch der grauen Dinger, die kaum zur Hälfte mit Tabak gefüllt waren, besonders gut schmeckte, ließ sich allerdings beim besten Willen nicht behaupten. Zudem hatte Fabian schon nach den ersten Zügen das Bedürfnis, einen einsamen Ort aufzusuchen, das er jedoch tapfer unterdrückte.
Der Dicke war, beinahe erwartungsgemäß, weniger klug: „Ich glaub', ich muss mal austreten“, murmelte er verlegen und verschwand unter dem spöttischen Gelächter der anderen nach draußen.
„Der Dicke scheißt sich ein!“, prustete Mark los, und der lange Henry setzte trocken hinzu: „Obwohl er ja auch sonst oft genug die Hosen voll hat ...“
Fabian lachte mit, vermied es aber, sich allzu hastig zu bewegen, um seinen Verdauungstrakt nicht noch mehr in Aufruhr zu bringen. Dabei dachte er darüber nach, wie er sich so unauffällig wie möglich verdrücken könnte. Schließlich beugte er sich lauschend nach vorn und flüsterte: „Habt ihr das auch gehört? Nicht, dass sich die Marmeladenfresser doch noch hier rumtreiben ...“
„Die hauen doch sowieso ab, wenn sie uns sehen“, murmelte Henry verächtlich.
„Wenn wir uns über den Hang verteilen und den Wald nach hinten durchkämmen, erwischen wir sie vielleicht doch“, erwiderte Fabian grimmig. „Außerdem gibt's im Moment jede Menge Pilze, und meine Alten haben mich nur gehen lassen, weil ich ihnen was vom Pilzesuchen erzählt hab.“
Überraschenderweise fand sein Vorschlag sofort Zustimmung, was er sich nur so erklären konnte, dass es den anderen nicht viel besser erging als ihm selbst.
„Wir treffen uns in einer halben Stunde hinten am Brunnen. Wenn jemand etwas Verdächtiges bemerkt, gibt er das Signal“, ordnete der lange Henry an. „Und sagt dem Dicken Bescheid, wenn er sich ausgeschissen hat!“
Unter leicht angestrengtem Gelächter trennte sich die Gruppe, und Fabian beeilte sich, den Forderungen seines Verdauungstraktes nachzukommen. Erleichtert machte er sich danach auf den Weg und unternahm nur hin und wieder einen kleinen Abstecher, um den mitgebrachten Beutel mit Pilzen zu füllen. Die Suche nach den Kontrahenten aus der Neubausiedlung überließ er großzügig den anderen.
Obwohl das Waldstück nur wenige Hektar groß war, änderte sich sein Charakter kurz vor dem Ziel auf merkwürdige Weise. Der immer wieder von kleinen Lichtungen unterbrochene Mischwald aus Eichen, Buchen und Ahornbäumen ging abrupt in einen düsteren, von riesigen Fichten dominierten Nadelwald über, dessen dichtes Dach kaum einen Sonnenstrahl durchließ. Was den Ort, den die Jungen als Treffpunkt gewählt hatten, jedoch vollends unheimlich machte, war der am Boden wuchernde Efeu, der den Eindruck eines alten, seit unendlicher Zeit verlassenen Friedhofs vermittelte.
Der Brunnen, der vermutlich Teil einer größeren Anlage war, die zur nahe gelegenen Färberei gehörte, wurde schon seit Jahren nicht mehr genutzt. Sein Mauerwerk war mit Moos und Efeu bewachsen, und das Gitter, mit dem der Schacht verschlossen war, wurde durch ein rostiges Vorhängeschloss gesichert.
Wenn man sich über die Mauer beugte, sah man die nach unten führenden Eisenbügel und in der Tiefe ein merkwürdiges Leuchten, als gäbe es dort eine Lichtquelle oder einen seitlichen Zugang zum Tageslicht.
Martin hatte einen Stein gefunden, den er durch das Gitter in den Schacht fallen ließ. Es dauerte vier oder fünf Sekunden, bis ein dumpfes Platschen den Aufschlag signalisierte.
Wie gebannt starrten die Jungen nach unten.
„Wenn das Schloss nicht wäre, könnte man unten nachsehen, woher das Licht kommt“, murmelte Martin nachdenklich.
„So'n altes Ding muss doch aufzukriegen sein“, sagte Mark und probierte der Reihe nach sämtliche Schlüssel, die er dabei hatte, erfolglos aus.
„Dann müssen wir den Bügel eben durchsägen“, verkündete Henry energisch, brachte ein Taschenmesser mit Sägeblatt zum Vorschein und begann den Bügel zu bearbeiten. Es dauerte jedoch nur wenige Minuten, bis er aufgab, ohne dem Schloss mehr als ein paar Kratzer beigebracht zu haben.
„Ich möchte schon wissen, was da unten ist“, murmelte Fabian träumerisch.
„Ein Bolzenschneider!“, krähte der Dicke los, als wäre ihm die Erleuchtung des Tages gekommen. „In unserer Bodenkammer liegt einer. Weiß ich ganz genau!“ Seine Wangen glühten vor Aufregung.
„Seit wann reiten denn Hexen auf 'nem Bolzenschneider?“, bemerkte Martin trocken. Die anderen lachten.
„Meine Oma ist keine Hexe, du blöde Sau!“, heulte der Dicke empört auf und stürzte sich auf den Kleineren.
Das war allerdings das Dümmste, was er tun konnte. Martin hatte sich vor zwei Jahren zusammen mit Fabian im städtischen Armee-Boxclub angemeldet und war noch immer mit Begeisterung dabei. Anders als Fabian, der es recht bald leid gewesen war, sich zum Gaudium der zuschauenden Soldaten ständig auf die Nase hauen zu lassen.
Der Dicke hätte mit den gleichen Erfolgsaussichten eine Windmühle anfallen können, und so dauerte es auch nicht lange, bis er mit blutender Nase die Flucht ergriff.
Fabian mochte den dicken Martens zwar nicht besonders, aber in diesem Augenblick tat er ihm beinahe leid. Allerdings nur bis zu dem Moment, in dem der Flüchtige sich zu ihnen umdrehte und losschrie: „Ihr blöden Rindviecher! Ihr seid ja sowieso zu feige, da reinzugehen. Das kann ich auch alleine!“
Die Jungen lachten. Der Dicke und allein in den Brunnen klettern. Das war ja wohl der Witz des Tages! Doch kurz darauf lachten sie nicht mehr.
Völlig außer sich kreischte der Dicke: „Und in den Knast gehört ihr außerdem. Genau wie der Bruder von Henry! Ihr Arschlöcher!“
Als Fabian sich nach Henry umsah, bemerkte er, dass der Lange blass geworden war. Seine Augen starrten finster geradeaus, während die Knöchel an seinen geballten Fäusten weiß hervortraten. Fabian ahnte, dass etwas nicht wieder Gutzumachendes geschehen würde, wenn der Lange jetzt durchdrehte und den Dicken irgendwie zu fassen bekam.
Und er war nicht der einzige.
„Lass den Fettsack doch laufen“, sagte Mark leise und legte seinen Arm um Henrys Schultern. „Der spinnt doch. Wer hört denn schon auf diesen Blödmann?“
Der Lange, immer noch weiß wie ein Laken, sagte leise: „Es weiß sowieso schon die halbe Stadt. Sie haben ihn irgendwo im Sperrgebiet erwischt. Und gestern Abend haben sie alles bei uns durchsucht.“
Fabian bemerkte die Tränen auf dem Gesicht des Langen und sah verlegen zu Boden.
Natürlich wussten sie alle, dass hin und wieder jemand versuchte, über die Grenze in den Westen zu kommen. Ihre Lehrer bezeichneten solche Leute als Republikflüchtige und Klassenfeinde