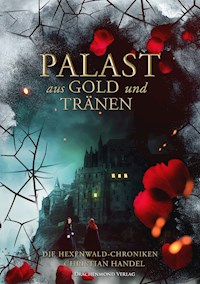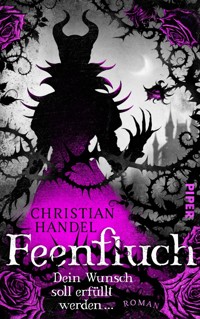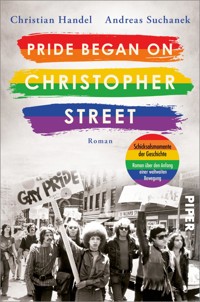Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine märchenhafte Anthologie
- Sprache: Deutsch
Tief verborgen in verwunschenen Wäldern leben magische Wölfe, weben finstere Hexen mächtige Zauber und suchen mutige Recken nach Erlösung. Lausche dem Gesang der Sirenen, triff den König der Feen und tanze mit den Wesen der Anderswelt im Mondlicht. Doch achte auf deine Schritte. Denn wer sich in den Schatten dieser Welt verliert, bleibt auf ewig verschwunden. Eine märchenhafte Anthologie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
In Hexenwäldern und Feentürmen
Eine märchenhafte Anthologie
Hrsg. Christian Handel
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Christian Handel & Alexandra Fuchs
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
alexanderkopainski.de
Umschlagbildmaterial: Shutterstock
Illustrationen: So Lil’ art
»Der Preis«, »Schwestern der Hecke«, »Die kleine Androidin«
und »Nur so stark wie die Füße, die uns tragen«
übersetzt von Sarah Adler
ISBN 978-3-95991-267-9
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Vorwort
Der gläserne Turm
Schneefieber
Rot wie Schnee
Der Preis
Goldregen und Weihrauch
Das Aschenputtel-Vermächtnis
Der Jäger
Der düsteren Stunden Glanz
Die Flöte im Mondlicht
Träume aus Glas und Stein
Ascherfeld
Sirenengesang
Schwestern der Hecke
Der Grimmfluch
Wie man Zauberspiegel baut
Das Rattenbiest - Im Käfig der Stille
Der Kristall des blauen Mondes
Die kleine Androidin
Nur so stark wie die Füße, die uns tragen
Bücher von Hrsg. Christian Handel
Vorwort
Man fragt mich oft, warum ich Märchenadaptionen so sehr liebe. Wenn ihr zu dieser Sammlung gegriffen habt, brauche ich euch das vermutlich nicht zu erklären. Sicher seid auch ihr dem Zauber magischer Geschichten mit unbeschreiblicher Es war einmal-Atmosphäre verfallen.
Trotzdem kommt diese Frage so oft, dass ich bewusst darüber nachgedacht habe. Man kann sie auf vielerlei Arten beantworten.
Eine davon ist, dass es im Märchen (meist) nicht um den ultimativen Kampf des Guten gegen das absolut Böse geht, ebenso wenig wie um das drohende Ende der Welt. Das sind Elemente, die oft Hand in Hand gehen und in vielen High Fantasy-Sagas zur Motivation für die Helden werden. Nicht so im Märchen und folglich auch nicht in der Fairytale-Fantasy.
Die Konflikte hier sind persönlicher, weniger entrückt und allumfassend, dafür jedoch menschlicher. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, aber wenn es um Märchen geht, denke ich nicht an gewaltige Schlachten. Ich denke an mutige Frauen, die Unmögliches möglich machen, um ihre Ehemänner von Flüchen zu erlösen. Ich denke an Prinzen, die Füchsen das Leben schenken und dadurch ihr Glück finden. An junge Mädchen, die selbst bis ins Herz des Winters vordringen, um ihre besten Freunde aus dem Bann einer Schneekönigin zu befreien – und an andere junge Mädchen, die sich von den Schikanen durch ihre Stiefverwandtschaft nicht kleinkriegen lassen und sich heimlich nachts aus dem Haus schleichen. Und zwar einfach nur deshalb, weil sie Lust darauf haben, das Tanzbein zu schwingen und ihren harten Alltag einen Abend lang zu vergessen. Dass sie sich dabei noch waschechte Prinzen angeln, ist ein unerwarteter Bonus. Sie alle verfolgen eigene Ziele und treffen persönliche Entscheidungen.
Das gilt auch für die Heldinnen und Helden der nachfolgenden Erzählungen. Ob es sich um einen Jäger handelt, der von seiner kaltherzigen Königin vor eine schreckliche Wahl gestellt wird; um eine Herrscherin, die, um ihr Volk zu retten, einen Handel mit einem Feenkönig eingeht, oder um eine Dienstmagd, die mit einer Meerjungfrau um das Herz eines Prinzen kämpft.
Welchen Preis sind Menschen bereit, für ihr eigenes Glück oder das ihrer Lieben zu zahlen? Die Protagonistinnen und Protagonisten der Kurzgeschichten dieser Anthologie finden darauf sehr unterschiedliche Antworten.
Denn auch in den Seelen von Heldinnen und Helden gibt es Licht und Dunkelheit. Deshalb heißt es aufgepasst während der Reise auf den verschlungenen Pfaden durch den Zauberwald. Nicht alle Hexen sind durch und durch böse, ebenso wenig wie alle Märchenprinzen reinen Herzens sind.
Christian Handel, Sommer 2017
Der gläserne Turm
Michelle Natascha Weber
Michelle Natascha Weber
Der erste Feenturm, in den wir euch entführen, wurde von Michelle Natascha Weber gebaut. Er erhebt sich in der gleichen Welt, in der auch ihr Roman Die Rabenkönigin spielt. Die nachfolgende Kurzgeschichte kann aber völlig unabhängig davon gelesen werden.
»Ich greife gerne auf Figuren aus vorherigen Geschichten zurück, die mich besonders interessiert haben«, erklärt sie diese Entscheidung. »Der Feenkönig ist eine Figur, zu der ich immer gerne noch mehr schreiben wollte, weil er in der Rabenkönigin nur seine negative Facette zeigen darf – was ihm nicht ganz gerecht wird.« Um ihn herum hat Michelle nun eine neue Erzählung gesponnen, für die sie auf Motive aus einem berühmten Märchen der Brüder Grimm zurückgegriffen hat.
Michelle wurde in Hanau geboren, lebt aber inzwischen am Rhein. Sie ist ein sehr visueller Mensch und lässt sich gern von Bildern von Melanie Delon, Linda Bergkvist oder Victoria Frances inspirieren. In ihren Werken verschmilzt High Fantasy mit Gothic Romance- und Mantel & Degen-Einflüssen. Frisch erschienen ist Sonnenblut, der Auftaktband eines Zweiteilers um Hexen, Blutsauger, Flüche und verfeindete Höfe.
www.michelle-weber.de
Der gläserne Turm
Die Windharfe schweigt. Verrat hat sie verstummen lassen. Ihre Saiten sind durchtrennt. Das Lied des Windes ist verklungen und mit ihm fallen die Schutzmauern, die uns für Jahrhunderte umschlossen haben. Die Wellen des endlosen Ozeans schlagen in die Höhe, angefacht vom Zorn der Sirenen, die uns umzingelt haben. Sturmwind braust über die Insel hinweg und dröhnt in meinen Ohren. Ich höre ihren Gesang darin. Schrill. Bedrohlich. Ihre Fischschwänze wühlen das Meer auf, Silberglanz zwischen dem weißen Schaum der Gischt. Die Insel bebt. Die Erde rumort und reißt auf, wo sie dem Druck der Erdmassen nicht mehr standhalten kann.
Ich weiß, dass uns das Wasser verschlingen wird. Schon jetzt bröckelt der Stein unserer Stadt. Marmor bricht aus den Mauern und zerschellt auf den glatten Straßen. Mein Leben zerfällt vor meinen Augen. Unsere Zeit ist endgültig abgelaufen. Wie lange haben wir diesen Tag gefürchtet? Nun ist er gekommen. Er hat uns gefunden und seine Rache kommt über uns. Gestohlene Magie, ein Pakt, der gebrochen wurde. Betrug, begangen von Elouann, der ersten Königin von Tuwela. Die Schutzzauber halten seinem Toben nicht stand. Sie zerbröseln unter seiner Macht, nutzlos, lächerlich. Wie haben wir je glauben können, dass sie ihn fernhalten könnten?
Nur ein letztes Opfer kann uns retten und ich bin diejenige, die es bringen muss.
Ich sehe mein eigenes Gesicht im Spiegel, bleich und voller Angst. Dennoch steht Entschlossenheit in meinen Augen, als ich die Hände nach dem Glas ausstrecke und die Lippen öffne, um ihn zu rufen.
Den letzten Ausweg. Die letzte Hoffnung.
Mein Verderben.
Mein Spiegelbild verschwimmt, als ob ein Stein ins Wasser fällt, und ich schrecke davor zurück. Es ist, als ob das Glas zum Leben erwacht. Rote Schlieren zerfasern in Silber und mein Atem stockt, als ich ein Gesicht darin erkenne.
SeinGesicht.
Er ist schön. Atemberaubend. Nie zuvor habe ich einen Mann wie ihn gesehen. Sein rotes Haar lässt ihn wirken, als stünde er in Flammen. Es lodert wie die Wut, die in seinen zweifarbigen Augen brennt. Eines golden wie die Sonne, das andere von dem tiefen Saphirblau einer Sommernacht. Alles an ihm ist Macht. Stärke. Ich kann nicht aufhören, ihn anzustarren. Erst seine Stimme schreckt mich auf. Dunkel, samtig … und doch … grollender Donner klingt darin mit. »Du rufst nach mir, Nimaë aus dem Geschlecht der Ersten?«
Ich neige den Kopf, nicht länger fähig, seinem Blick standzuhalten, und Scham kommt über mich, weil ich es nicht vermag. Vielleicht war es mir vorherbestimmt, dass Tuwela mit mir untergehen muss, weil ich niemals stark genug war, ihm die Stirn zu bieten. Der Gedanke weckt Trotz in mir und gibt mir die Kraft, zu ihm aufzublicken. »Verschont mein Reich und mein Volk vor Eurem Zorn. Meine Familie war es, die Euch Schaden zugefügt hat, und ich bin es, die ihn wiedergutmachen wird.« Meine Stimme zittert. Ich zwinge das Räuspern in meiner Kehle zurück und starre ihm entgegen, obgleich ich vor ihm davonlaufen will.
Er sieht mich unverwandt an und ein kalter Schauer rieselt über meinen Rücken. Dann verschränkt er die Arme vor der Brust und legt den Kopf schief. »Du verlangst viel, Nimaë. Was gibst du mir dafür?«
Diesmal bleibt meine Stimme fest, als ich ihm antworte. »Mein Leben.«
Schweigen. Nur das endlose Singen der Sirenen stört die Stille zwischen uns.
»Du kommst aus freiem Willen in mein Reich?«, fragt er schließlich und es gelingt ihm, Staunen in seine Worte zu legen. Doch ich weiß, dass es nicht echt sein kann. Er hat darauf gewartet, dass ich nach ihm rufe. Ich kann es im Glitzern seines Blickes erkennen. Für einen Augenblick spüre ich Hass, aber er verwittert, als ich mir eingestehe, wie nutzlos er ist.
»Ja«, antworte ich heiser.
»Dann soll es geschehen, wie du wünschst.« Sein Lächeln erinnert mich an ein Raubtier, das seine Beute endlich geschlagen hat. Ich finde seinen Triumph darin. Er bekommt, was er will und ich staune darüber, wie leicht es mir fällt, den Pakt zu schließen, der die Insel retten wird. Seine Hand löst sich aus dem Spiegel und durchbricht die Grenzen zwischen unseren Welten. Ich schlucke, als ich ihm die meine reiche.
Ein Schritt nur, ein einziger Schritt. Die Welt verschwimmt in Silber, ich spüre Kälte auf meiner Haut, den Kuss von Eis und Schnee. Der Gesang der Sirenen verstummt und Stille umfängt mich. Als ich die Augen öffne, erblicke ich die gläsernen Wände eines Turmes, die meine Stimme mit einem unheimlichen Echo zurückwerfen, obwohl sie schon lange verhallt ist.
»Ja.«
Nur ein einziges Wort.
Der Schlüssel zu meiner Verdammnis.
Der Saal, in den er mich bringt, ist rund und weitläufig. Ein Spiegel dehnt sich unter meinen Füßen aus und hinter den Glaswänden regiert die Nacht. Wenn ich nach draußen blicke, finde ich die Endlosigkeit der verschneiten Berge, vom Silberlicht des Mondes überzogen. Die Gipfel wirken, als seien sie von der Hand eines Zuckerbäckers geformt. Es ist ein glitzerndes Zauberland unter blitzenden Sternen. Schön. Zu makellos. Ich weiß, dass ich hier niemals die Wärme der Sonne auf meiner Haut spüren werde. Nie mehr die blühenden, duftenden Bäume meiner Heimat und das Meer sehen werde. Die Sehnsucht, die mich befällt, schmerzt in jeder Faser meines Körpers. Aber ich weiß ebenso, dass die Insel nun vor dem Zorn der Sirenen sicher sein wird und das Wissen gibt mir die Kraft, mich aufrecht zu halten.
Er steht nicht weit von mir und beobachtet mich, als sei ich ein seltenes Tier, das man in einen Käfig gesperrt hat. Ich richte mich stolz auf und erwidere den Blick seiner zweifarbigen Augen. »Also ist dies das Gefängnis, das Ihr für mich gewählt habt?«
Sein Lächeln wirkt ironisch. Lichter ergießen sich aus seinen Händen und verteilen sich im Saal. Tanzende Glühwürmchen aus Silber, die ihre Umgebung erstrahlen lassen. »Es ist das Heim, das ich für deine Vorfahrin errichtet habe. Nun bist du es, die es an ihrer Stelle bewohnen wird … außer …«, er lässt seine Stimme verklingen.
»Außer?«, wiederhole ich und in mir breitet sich Widerwillen gegen das Gefühl aus, dass er mit mir spielt.
»Außer, du entdeckst die Tür, die dich in die Freiheit führt. Wenn du sie finden kannst, gebe ich dich frei.«
Misstrauisch ziehe ich die Stirn in Falten. Es klingt zu einfach. Zu großzügig. »Warum solltet Ihr mich gehen lassen? Habt Ihr nicht all die Jahrhunderte darauf gewartet, mein Blut in die Hände zu bekommen? Nun besitzt Ihr mich und wollt mir die Freiheit schenken?«
»Elouann hat mich betrogen. Du aber bist aus freiem Willen gekommen, um ihren Platz einzunehmen und zu sühnen, was mir vor langer Zeit zugefügt wurde. Also gewähre ich dir einen Ausweg. Finde die Tür und ich verspreche dir, dass du frei sein wirst und dein Reich bis ans Ende der Zeit in Frieden blüht und gedeiht.«
Ich suche nach Worten, aber sie bleiben in meiner Kehle stecken. Freiheit. Es klingt unglaublich, doch ich weiß, dass er nicht lügen kann. Denn er ist der König der Feen und jede Lüge würde seine Zunge zerschneiden wie ein Dolch. Hoffnung steigt in mir auf und schlägt über mir zusammen wie eine Welle, die mich mit sich reißen will. Sie kommt so unerwartet, dass meine Beine schwach und weich wie Wachs werden.
Sein Lächeln wird breiter und erneut springt Silberlicht von seinen Fingern. Diesmal sind es keine Lichter, die den Saal erhellen. Es sind Wirbel aus reiner Magie, flüssiges Licht, das über die Spiegel tanzt und Silhouetten entstehen lässt. Ein Bett mit seidenen Vorhängen, Truhen, die vor Kleidern überquellen. Ein Tisch, auf dem Speisen warten. Das weiche Gefühl unter meinen Sohlen lässt mich hinabblicken, auf den dicken Teppich, der sich über den Spiegeln ausbreitet und meine staunende Miene ausschließt.
»Schlaf gut, schöne Nimaë.«
Ich zucke zusammen. Seine Stimme verhallt in einem Echo und von ihm bleibt keine Spur. Ich bin allein. Fassungslos schlinge ich die Arme um meinen Körper, um das Beben zurückzuhalten, das in meinen Gliedern lauert.
Ich erwache, als das Licht des Vollmondes meine Lider berührt. Die Seide des Kissens unter meiner Wange ist kühl und rau. Kerzenschein erhellt mein Schlafgemach, obgleich ich keine Kerzen entzündet habe. Ich suche nach seiner Quelle und finde den Leuchter, der neben meinem Bett erschienen ist. Warmes Licht. Menschliches Licht, dessen goldener Schein wie eine Erinnerung an die Sonne ist. Es scheint fehl am Platz in dieser silberweißen Welt aus Glas und Eis. Ich spüre Hitze an meiner Handfläche, als ich sie über die flackernden Flämmchen halte. Sie ist wohltuend und tröstlich, wenngleich nichts meinen Kummer zu lindern vermag.
Die kristallene Tür auf der anderen Seite des Saales öffnet sich wie eine stumme Einladung, hindurchzutreten, und ich verstehe. Also soll meine Suche ihren Anfang nehmen. Es ist wie ein beginnendes Spiel. Er ruft nach mir und ich muss ihm folgen. Müde setze ich mich auf und greife nach dem Leuchter, der neben dem Bett wartet. Meine Finger hinterlassen weißliche Abdrücke auf seinem glänzenden Silber.
Beobachtet er mich? Ist das wachsame Auge des Mondes, das durch die gläsernen Wände blickt, das seine? Ich starre auf die helle Scheibe, als könnte ich ihn damit herausfordern, aber ich bin diejenige, die als Erste blinzeln muss. Keine Wolke steht am Nachthimmel und nimmt dem Mondauge die Sicht.
Lächerlich.
Ich atme aus und erhebe mich. Mein Zopf fällt herab und schleift wie eine silberblonde Schlange hinter mir über den Teppich. Er ist die Wurzel meiner Kräfte, ein Funken Magie, der mir ins Feenreich gefolgt ist. Der Grund für meine Gefangenschaft. Elouanns Verrat versteckt sich in meinem Haar, so wie in dem Haar aller Töchter meines Geschlechts, die vor mir gekommen sind. Wir schneiden es niemals, damit seine Zauberkraft mit jeder Spanne wächst, aber hier, in diesem Reich, in dem Magie aus jeder Pore quillt, erscheint sie mir wertlos. Sie ist ein winziger Bruchteil der Macht, die der Feenkönig besitzt, nicht mehr als ein Hauch für ihn. Und doch wichtig genug, dass er mich hierher gebracht hat und meine Insel dafür verschont.
Ich verstehe seine Gründe nicht und ich kann nicht ermessen, warum er mir einen Ausweg gewähren möchte. In den Geschichten meines Volkes ist er das Böse. Die niederträchtige Macht, die verführt und ins Unglück stürzt, wer sich ihm in die Hände gibt. Niemals lässt er den gehen, der einen Pakt mit ihm geschlossen hat. Niemals gibt er auf, was er besitzt. Dennoch … er kann nicht lügen, so wie es keine Fee vermag. Und ich glaube ihm, selbst wenn es eine Närrin aus mir macht.
Ich zupfe ein Haar aus meinem Zopf. Nur ein kleines Stück, nicht länger als mein Arm. Ein feiner, silbrig schimmernder Faden in meiner Hand.
»Zeig mir die Tür in die Freiheit«, flüstere ich und hauche über meine Handfläche.
Es erhebt sich und schwebt davon, auf den Durchgang zu, der auf eine Treppe hinausführt. Glas erstreckt sich unter meinen Sohlen. Darunter kann ich die Tiefe sehen, die mich erwartet, wenn es zerbricht. Schaudernd folge ich den Stufen, immer auf der Hut vor dem verräterischen Knacken, das mich in den Abgrund reißt. Aber ich höre nichts als das Pochen meiner Absätze, das sich mit dem unruhigen Schlag meines Herzens vereint.
Ich passiere leere Säle, Kammern und Zimmer voller Kuriositäten, ohne eines davon zu betreten. Niemals können sie alle sich wahrhaftig in diesem Turm befinden. Manche sind rund, andere eckig. Ich laufe durch Türmchen und vorüber an Erkern, während ich dem schwebenden Schimmer meines Haares folge, das mir den Weg weist. Schließlich endet die Treppe an einem Torbogen, durch den silberner Schein hereinfällt. Mondlicht. Kalter Wind streift meine Wangen, und mein Herzschlag beschleunigt sich. Er führt hinaus! Hinaus ins Freie!
Ein zaghaftes Lächeln berührt meine Lippen. Ich vernehme das mächtige Rauschen von Wasser und eile hindurch. Es ist wie der Ruf des Meeres und beinahe kann ich meine Heimat riechen. Salzig, würzig, Orangen und Kräuter. Schnee knirscht unter meinen zu dünnen Schuhen und durchnässt sie bis auf die Haut, als ich ins Freie trete. Ich spüre es kaum. Doch es ist nicht der Ozean, der mich empfängt. Staunend betrachte ich die hohen Gipfel, die mich in ihrer Umarmung bergen. Gläserne Rosen wachsen an ihrem Fuß und glitzern im Schein der Sterne. Sie neigen sich mir zu, als wollten sie mich mustern, und ich halte inne, als ich begreife. Das Rauschen erklingt von dem mächtigen Wasserfall, der vor mir ins Leere stürzt. Die schäumenden Wassermassen nehmen meine Hoffnung mit sich und Enttäuschung breitet sich bleiern in mir aus. Nein, dies ist kein Ausgang aus dem gläsernen Turm. Der Weg endet im Nichts.
Die Magie in meinem Haar erlischt unvermittelt. Es sinkt in den Schnee und verschwindet dort. Verbraucht. In die Irre geführt vom Zauber des Feenkönigs.
Ein Schillern weckt meine Aufmerksamkeit und ich drehe mich um, als ein Pavillon inmitten der Rosen erscheint. Sie kriechen an seinen durchscheinenden Wänden empor und Vögel aus buntem Glas setzen sich in ihre Zweige. Ich erwarte, sie singen zu hören, doch sie bleiben geisterhaft stumm.
Der Pavillon ist nicht leer.
Ich wage kaum zu atmen, als ich den roten Schein seines Flammenhaares entdecke. Flammende Hitze in der ewigen Kälte des Winters. Ein Hauch von Farbe in der endlosen Weiße seiner Welt. Der Saum meines Kleides ist schwer vor Nässe, als ich mich schwerfällig wie eine Schlafwandlerin auf ihn zubewege.
»Ihr habt gelogen«, sage ich. Es klingt schriller, als ich es mir wünschen würde.
Meine Anschuldigung berührt ihn nicht, seine Miene bleibt bar jeden Gefühls. »Ich kann nicht lügen, Nimaë.«
Etwas Seltsames flackert in seinem Blick und ich spüre Furcht, die nach mir greifen will. Erst jetzt wird mir bewusst, wie gefährlich die Kreatur ist, die vor mir steht. Trotzdem weiche ich nicht zurück. Die Enttäuschung ist stärker als die Angst vor ihm. »Dann erklärt mir, warum der Weg nach draußen im Nichts endet.«
»Ein Weg, der nach draußen führt, muss nicht in der Freiheit enden. Vielleicht hast du den richtigen noch nicht entdeckt.« Er lässt sich im Pavillon nieder und es wirkt so majestätisch, als ob er auf einem Thron sitzt. Ein Fingerzeig von ihm lässt mein verlorenes Haar emporsteigen. Es schwebt durch die Luft und legt sich auf seine Handfläche. Er betrachtet es mit schief gelegtem Kopf, ehe er die Finger darüber schließt.
»Und wie erkenne ich den Richtigen, wenn ich ihn gefunden habe?«
»Das wirst du wissen, sobald du es getan hast.« Er lächelt rätselhaft und ein silbernes Flimmern leuchtet in der Hand auf, in der er mein Haar verbirgt. »Vielleicht suchst du auf die falsche Weise.«
Ich hebe die Brauen und mustere ihn spöttisch. »Auf wie viele Arten kann man wohl nach einer Tür suchen? Soll ich mich an den Glaswänden entlangtasten oder den Boden beschnüffeln wie ein Hund?«
»Das kommt auf die Art der Pforte an, nicht wahr?« Silbernes Pulver rieselt von seinen Fingern und mein Haar ist verschwunden. Er legt den Arm auf die Lehne der Bank, auf der er Platz genommen hat. »Aber bedenke, du hast die Wahl, zu bleiben. Möglicherweise empfindest du mein Reich eines Tages als angenehmer, als du jetzt glauben möchtest.«
»Euer Reich?« Ich drehe den Kopf und beäuge den Turm, bevor ich mich wieder zu ihm umwende. »Ich gebe zu, in den Erzählungen meines Volkes wirkt das prachtvolle Reich des Feenkönigs wesentlich beeindruckender.«
Sein goldenes Auge scheint zu brennen, als er den Blick auf mich richtet, doch das Gefühl darin bleibt undeutbar. »In den Erzählungen deines Volkes.« Er schnaubt verächtlich, als sei es eine Beleidigung, dass Geschichten über ihn existieren. »Und was erzählen sie über mich?«
Seine Neugier erstaunt mich. Wie kann es den Feenkönig berühren, was Sterbliche sich über ihn erzählen? »Nun …«, ich zögere und lasse meine Fingerspitzen über eine der Rosen gleiten. Sie ist erstaunlich kühl, wie aus Eis geformt. Etwas sticht in meine Haut und ich ziehe erschrocken die Hand zurück. Ein roter Blutstropfen quillt hervor und ich finde seine Spuren an der Spitze eines Dorns. Entgeistert beobachte ich, wie sich die Blütenblätter der Rose rötlich färben. Doch es vergeht so schnell, dass ich nicht sicher bin, ob ich einer Täuschung erliege. Ich räuspere mich und lasse die Hand sinken. »Ihr seid ein Ungeheuer, das mit samtenen Worten verführt. Ein Dieb, der Leben stiehlt und Seelen zerstört, wo auch immer er geht. Wer Euch ruft, fordert das Verderben heraus.«
»Ich bin ein Dieb?« Er wirkt amüsiert. Ich kann sehen, wie sein Mundwinkel zuckt.
»Ihr wolltet eine Antwort und ich habe sie Euch gegeben. Ich bin nicht schuld daran, wenn ihr Inhalt Euch missfällt.«
»Und was glaubst du, was ich bin, schöne Nimaë? Bin ich dein Verderben?« Er erhebt sich und plötzlich steht er so dicht neben mir, dass ich die Hitze seines Körpers spüren kann. Es ist, als ob er brennt. Als ob sein Haar tatsächlich aus Flammen besteht. Feuer, das gegen das ewige Eis seines Reiches ankämpft. Die einzige Quelle der Wärme in dieser kalten Welt.
»Ich … weiß es nicht«, erwidere ich vorsichtig. Hastig trete ich beiseite, um Abstand zu ihm zu gewinnen.
Sein Lächeln vertieft sich, als er nach meinem Zopf langt und mein Haar durch seine Finger gleiten lässt. Es ist eine zärtliche Berührung, die ein merkwürdiges Flackern auf den Flechten hinterlässt. Tanzendes Licht, das sie umkreist.
»Du hast alle Zeit der Welt, um es herauszufinden.« Sein Atem berührt meine Haut und ich erschauere. Ein Herzschlag, ein letzter Blick, dann vergeht er in einem Windstoß, der in den Pavillon fegt und den Frost hereinträgt. Das Dach über meinem Kopf löst sich auf und Schneeflocken rieseln vom Himmel. Sie fallen auf mein Gesicht und schmelzen zu feuchten Tropfen, die über meine Wangen rinnen wie Tränen.
Der gläserne Turm ist endlos und spiegelglatt. Niemand könnte seine Wände je erklimmen, um die Reihe der Arkadenbögen zu erreichen, die sich unter dem spitzen Dach erstrecken. Wenn sie in die Freiheit führen sollten, so muss man die Schwingen eines Vogels besitzen, um ihnen zu entkommen. Trotzdem suche ich nach dem Weg hinauf.
Türen kommen und gehen. Sie enden auf Terrassen und Balkonen. Wann immer ich über die Schwelle trete, schwillt die Hoffnung in mir an, um doch zu Staub zu zerfallen. Sobald ich sie verlasse, schwinden sie, als hätte der Zauber des Turmes sie nur entstehen lassen, damit ich die Aussichtslosigkeit meiner Suche erkennen muss.
Die Zeit verschwimmt in diesem Reich der ewigen Nacht. Ohne die Wanderung von Sonne und Mond fehlt den Stunden die Struktur. Ich schlafe, wenn ich müde werde, und wandle durch den Turm des Feenkönigs, wenn ich wieder erwache. Stets warten Speisen auf mich, von unsichtbaren Händen bereitet, und wenn ich meine Mahlzeit beendet habe, verschwinden sie ohne jede Spur. Niemals sehe ich einen Diener oder eine andere Seele. Sogar der Feenkönig bleibt mir fern. Vielleicht hat er das Interesse an diesem Spiel verloren und sich einer interessanteren Beute zugewandt.
Die Einsamkeit zehrt an mir. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mit mir selbst rede und mir von meiner Heimat erzähle. Von Sonnenschein und dem Duft frisch gemähten Grases. Hier blüht nichts außer den gläsernen Rosen, die sich am Turm hinaufranken, als könnten ihre Dornen Halt an seinen Wänden finden.
Ich entdecke einen Saal voller Spiegel, die mein Abbild unzählige Male zurückwerfen. Es sind große und kleine, runde und eckige in goldenen Rahmen. Manche neu und glänzend, andere alt und angelaufen von zahllosen Jahren. Es ist so verwirrend, dass ich die Augen schließen muss, weil ich nicht weiß, wohin ich mich wenden soll. Als ich sie wieder öffne, ist mein Spiegelbild in einem von ihnen erloschen und hat einen Durchgang freigegeben. Helligkeit strahlt mir daraus entgegen und ich gehe vorsichtig darauf zu, neugierig auf das, was sich dahinter verstecken mag.
Der Saal, den ich betrete, ist verlassen. Meine Schritte hallen laut durch seine Leere. Ich laufe über einen Teich, eingeschlossen unter Glas. Fische huschen unter meinem Saum vorüber und leuchtende Seerosen treiben auf dem unerreichbaren Nass. Staunend halte ich inne, um das dunkle Wasser zu betrachten, in dem sich meine Gestalt spiegelt. Dann mischt sich ein rötlicher Flecken in das Bild und ich schrecke auf, um mich dem König der Feen gegenüber zu finden. Meine Umgebung verblasst. Sie wandelt sich und wir stehen auf einer steinernen Brücke, über die sich Weiden beugen wie trauernde verschleierte Frauen. Wind rauscht sacht durch ihre Zweige und die milde Brise einer warmen Sommernacht berührt meine Haut. Doch ich fröstele beim Anblick des Mannes, der am anderen Ende der Brücke wartet.
Er lächelt, als ob er sich über meine erschrockene Miene amüsiert. Mit gerunzelter Stirn blicke ich ihn an und er lässt Sternenlichter von seinen Händen schweben, die sich über uns ausbreiten wie schwirrende Diamanten. »Du hast die Tür noch immer nicht gefunden, Nimaë?«, fragt er süffisant und ich verabscheue ihn dafür.
»Es ist schwierig, sie zu finden«, gebe ich barsch zurück. »Euer Turm verändert sich mit jedem Atemzug.«
Die Sternenlichter umkreisen mich und eines blinkt so hell, dass ich die Augen gegen seinen Schein beschatten muss. Der Feenkönig gibt einen belustigten Laut von sich und ich spüre, wie Ärger in mir aufsteigen will.
»Vielleicht solltest du stattdessen nach dem richtigen Schlüssel suchen.«
»Ihr habt nicht erwähnt, dass es einen Schlüssel gibt.«
»Es gibt immer einen Schlüssel. Und bedenke, das Feenreich lässt niemanden gehen, der nicht etwas von sich zurücklässt.« Neue Lichter strömen von seinen Händen und tanzen um meine Gestalt. Ich trete beiseite, doch sie folgen mir und setzen ihren Reigen fort. Meine Hand gleitet durch sie hindurch, als ich sie verjagen will. Ich spüre ein schmerzhaftes Prickeln auf meiner Haut, als hätte ich mich an ihnen verbrannt.
Ich schnaube spöttisch. »Gibt es noch andere Bedingungen, von denen ich wissen sollte? Und was könnte ich wohl zurücklassen, damit es mich freigibt? Mein Herz? Meine Seele? Mein Augenlicht?«
»Du glaubst noch immer, dass ich so grausam bin, schöne Nimaë?«
»Seid Ihr es nicht?«
Er blickt nachdenklich über das Wasser des Teiches, dann fixieren seine zweifarbigen Augen mein Gesicht. »Dein Reich blüht und ist sicher vor den Sirenen. Kein Sturm und keine Welle wird es in den Abgrund reißen. Macht sein Schutz mich zu deinem Feind?«
Ich fasse nach dem Geländer der Brücke. Kalter, fester Stein, der mir Halt gibt. »Macht es Euch zu einem Wohltäter, wenn Ihr etwas gebt, nachdem Ihr etwas bekommen habt? Ich bin hier, in Eurer Gewalt. Ihr habt Tuwela nicht aus freiem Willen verschont, sondern weil ich Euch etwas dafür angeboten habe.«
Wieder brennt sein goldenes Auge, während das saphirene kalt wie Stahl bleibt. »Du hast mir etwas angeboten, das mir gehört, Königstochter. Habe ich kein Recht, es zurückzufordern?«
Ich richte mich gerade auf, um seinem Blick zu begegnen, und die Jahre, in denen ich eine Königin war, fließen in meine unbeugsame Haltung. »Also gehöre ich Euch?«
Sein Raubtierlächeln blitzt auf und lässt Gänsehaut auf meinen Armen entstehen. »Ein Teil von dir.«
Instinktiv fasse ich nach meinem Haar, in dem die Magie des Feenreiches gefangen ist. »Ich kann Euch nicht zurückgeben, was Elouann Euch genommen hat. Es ist seit langer Zeit in unserem Blut verankert.«
»Elouann hat mir und meinem Reich weit mehr genommen als ein Stück meiner Macht.« Er umkreist mich langsam, ebenso wie seine Sternenlichter, und ich muss den Impuls unterdrücken, den Atem anzuhalten.
»Was hat sie Euch noch genommen?«, frage ich tonlos.
Er hält inne und sein Lächeln erlischt. »Die Zukunft.«
»Die … Zukunft?« Meine Stimme klingt dünn, verräterisch. Er muss meine Furcht darin hören können, aber sein Blick ist abwesend, als ob er mich nicht mehr wahrnimmt. Die Lichter flackern und sinken zu Boden, wo sie sich in Schwärze hüllen. Selbst das Glühen seines Haares wird dumpf, verschlungen vom Silberlicht des Mondes, der uns aus seinem lidlosen Auge beobachtet. Für einen Wimpernschlag wirkt er wie ein Mensch. Verloren und von Einsamkeit und unerfüllter Sehnsucht gezeichnet. Dann hebt er den Kopf und der mächtige Feenkönig kehrt zurück.
»Elouann hat den Pakt gebrochen und sie hat mich um den Preis betrogen. Willst du ihn an ihrer Stelle bezahlen, Nimaë?« Er fasst nach meinem Kinn und ich muss ihn ansehen, während die Hitze seiner Finger meine Haut versengt.
»Nennt ihn mir«, fordere ich mit mehr Mut, als ich besitze.
Sein Daumen streicht über meine Lippen und verharrt darauf. Mein Herz beginnt zu schlagen wie eine Trommel, laut und schnell. »Das kann ich nicht, denn du musst ihn aus freiem Willen zahlen, so wie du freiwillig zu mir gekommen bist.« Sein Lächeln kehrt zurück und er lässt mich los.
Unsicher weiche ich vor ihm zurück. »Noch mehr Rätsel und Fragen, auf die es keine Antwort gibt?«
»Auf jede Frage gibt es eine Antwort. Und ich warte noch auf die deine.«
»Was meint Ihr?«
»Ob ich dein Verderben bin.« Sein Blick wirkt ungewohnt offen, neugierig beinahe, als ob ihm an meiner Antwort gelegen ist. Und doch … ich besitze keine Antwort auf seine Frage. Noch weniger, seitdem die Berührung seiner Fingerspitzen auf meiner Haut nachhallt, als ob ein Feuer darauf brennt, das mich verschlingen will, sobald ich nur einen Schritt weitergehe.
»Ich weiß es noch immer nicht«, flüstere ich und er nickt, als ob er es erwartet hätte.
Diesmal sagt er nichts. Ein Herzschlag vergeht und er zerfällt zu Sternenstaub, der sich mit dem Wasser des Teiches vereint. Eine feine silberne Spur flimmert noch für einen Atemzug lang auf seiner Oberfläche, dann sinkt sie hinab, bis sie sich meinen Blicken entzogen hat.
Meine Suche ruht. Ich sitze allein auf dem Boden meines Schlafgemaches und löse meinen Zopf. Die silberblonden Flechten breiten sich rund um meine Gestalt aus und fließen über die Seide meines Rockes wie Bäche aus vereistem Wasser. War Elouanns Haar so hell wie das meine? Hat er diesen Ort gewählt, weil wir seinen verschneiten Weiten gleichen und dem Glas, aus dem der Turm errichtet ist? War sie jemals hier? Die Erzählungen vom Anbeginn Tuwelas sind vom Zahn der Zeit zerfressen. Zu viele Löcher klaffen in den Texten und keiner erzählt, was Elouann dem Feenkönig versprochen hat. Sie ist die kluge Heldin, die eine göttliche Kreatur überlistet hat, um den Wohlstand ihres Volkes zu sichern. Keine Hexe, sondern eine Heilige, die bereit war, sich zu opfern, um die Blüte der Insel zu gewähren und sie zu schützen.
Aber ist es wahr?
Bin ich dein Verderben, schöne Nimaë?
Seine Frage hallt in meinem Kopf nach. Ich stütze ihn in die Hände und bedecke meine Ohren, um sie nicht mehr hören zu müssen. Doch es sind nicht meine Ohren, in denen sie sich unablässig wiederholt. Sie hat sich in meinen Geist gefressen wie Säure und lässt mir keinen Frieden mehr.
»Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht«, murmele ich hilflos. Denn tatsächlich kennen allein er und Elouann die Antwort darauf. Ich erinnere mich an seine Verlorenheit. Schatten auf seiner Miene. Eine Wunde, die niemals verheilt ist, auf seinem Gesicht. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Was ich zu wissen geglaubt habe, ist nichts wert, solange mein Wissen löchrigen Quellen entspringt. Wer lügt und wer spricht die Wahrheit? Wie konnte Elouann dem König der Feen eine Wunde schlagen, die bis heute seine Maske zerschellen lässt?
Gedankenverloren zupfe ich mir Haare aus und häufe sie auf dem Teppich zu einem kleinen Berg aus schimmernder Helligkeit auf. Ist ein Funken von Elouann an diesem Ort zurückgeblieben? Welche Erinnerungen haften in diesem Raum, der sich niemals verändert? Denn es ist der Einzige, der sich niemals wandelt, die einzige Wirklichkeit inmitten einer Welt, die aus verblassenden Träumen gewoben ist.
Für einen Augenblick fehlt mir der Mut, den Zauber zu wirken. Sich der Wahrheit zu stellen, fordert Tapferkeit und ich weiß instinktiv, dass meine Welt nie mehr die gleiche sein wird, ganz gleich, was sich mir offenbaren wird. Dann hauche ich entschlossen meinen Atem über das Haargespinst und ein schwaches Glühen bildet sich an den Spitzen. Das Kribbeln rinnt auf dürren Spinnenbeinen über meinen Körper, als die Magie ihr Werk beginnt.
»Zeigt mir Elouanns Geist«, befehle ich den Haaren und sie steigen empor. Das Glühen verstärkt sich, bis meine Augen in der Helligkeit tränen.
Es ist ein machtvoller Zauber, der die Geister der Vergangenheit beschwört. Ich verharre still inmitten des Raumes und beobachte, wie die Erinnerung Silhouetten aus einer längst vergangenen Zeit formt.
Sie ist schön, die Frau, die vor meinen Augen aufersteht. Ihr Haar ist schwarz wie der sternenlose Nachthimmel und dichte Wimpern rahmen das tiefe Blau ihrer Iriden. Elouann. Sie muss es sein. Denn um ihren Hals hängt das Wappen mit dem steigenden Einhorn von Tuwela. Noch immer sind die Augen unseres Geschlechts blau, doch es ist heller geworden und gleicht der Farbe des Ozeans an einem Sommertag.
Ein verführerisches Lächeln spielt um ihre vollen Lippen und sie streckt die Arme nach dem Mann aus, der übergangslos das Zimmer betritt. Sein Haar ist so rot wie die Feuer des Abgrundes. Seine Augen sind wie Tag und Nacht. Und seine Aura erfüllt den Raum mit der Macht, die ihn umgibt.
Der Feenkönig ist gekommen.
Mein Herz stockt für einen Schlag, als ich fürchte, dass er mehr ist als eine blasse Erinnerung, die in dem Gemach zurückgeblieben ist. Zu stark ist seine Präsenz. Aber er hat keinen Blick für mich. Sein Blick berührt mich nicht, seine Augen sind blind für meine Anwesenheit. Elouann allein ist es, der sein Augenmerk gilt.
Ich halte den Atem an, als sie die Arme um ihn schlingt und ihn freudig begrüßt wie einen lange vermissten Liebhaber. Sein Lächeln ist warm und in seinem goldenen Auge brennt Leidenschaft, doch Elouanns Blick bleibt kalt wie das Eis, das den Turm umgibt. Ihre Miene wird zu einer starren Maske, ihr Lächeln verblasst, sobald er ihr den Rücken zukehrt und sie zum Bett hinüberführt. Ein anderes Gefühl lauert hinter dem Schleier, der die Wahrheit verhüllt. Abscheu. Hass sogar.
Ich senke die Lider und spüre einen schmerzhaften Stich. Ich will nicht sehen, was danach geschieht.
»Zeit, schreite voran«, wispere ich und die Bilder zerfallen zu Staub, aus dem neue Erinnerungen geboren werden. Der Zauber schmilzt mein Haargespinst und schon jetzt hat er die Hälfte aufgebraucht. Der Nachhall der Vergangenheit ist schwer zu entfesseln. Es braucht Kraft, zu finden, was die Wände zu erzählen haben. Was die Möbel einst beobachtet haben.
Und ich sehe …
Elouanns Gestalt hat sich verändert. Das weich fallende Kleid offenbart die Rundungen ihres Leibes und verrät, dass ein Kind darin heranwächst. Die Geburt kann nicht mehr fern sein. Ich kann sehen, wie schwer sie daran trägt. Sie leidet Schmerzen, doch sie ist allein. Keine Hebamme ist bei ihr, keine Dienerin hilft ihr, als sie Schalen und Säckchen aus einer Truhe hervorholt. Sie tut es hastig und blickt furchtsam über ihre Schulter, als ob sie erwartet, dass sie nicht mehr lange ungestört bleiben wird. Mit bebenden Fingern öffnet sie das erste Säckchen und fördert eine Blume daraus zutage. Ihre Blütenblätter sind schwarz und länglich, glänzend wie Klingen.
Schattenlilie.
Entsetzt starre ich auf das Gewächs, das zu züchten in Tuwela verboten ist. Ich weiß um das tödliche Gift, das darin fließt, und um die entsetzlichen Schmerzen, die dem Tod vorausgehen, wenn es verabreicht wird. Elouann gibt es in eine Schale und öffnet das zweite Säckchen, das weißliche, sichelförmige Samen enthält. Schlummerkrautsamen. Schmerzlindernd … und das stärkste Schlafmittel, das ich kenne. Sie schüttet sie aus und greift nach einem Stößel, mit dem sie Blätter und Samen bearbeitet, bis sie eine schwärzliche Paste gefertigt hat. Reglos sehe ich zu, wie sie das Gift unter den seidenen Kissen verbirgt. Dann legt sie sich nieder und ich ahne, dass der Zeitpunkt der Geburt gekommen ist.
»Voran«, hauche ich schwach und es fehlt mir der Wille, zu sehen, was als Nächstes geschehen ist. Trotzdem zwinge ich mich, die Augen offen zu halten.
Die Niederkunft ist vorüber. Das Kind ruht nackt in den blutbefleckten Laken und regt sich nicht. Kein Schrei kommt über seine Lippen, kein Protest gegen die Kälte der Welt, in die es geboren worden ist. Seine Lippen sind bläulich und in der Ecke seines winzigen Mundes entdecke ich den schwärzlichen Flecken des Liliengifts.
Elouann hat es getötet! Seine eigene Mutter hat es getötet!
Grauen kriecht durch meine Glieder und lässt sie zittern. Ich schlinge die Arme um meinen Körper, um sein Beben zu unterdrücken und den Aufschrei zurückzuhalten, der in meiner Kehle kratzt. Am Rande meines Sichtfeldes erhasche ich eine Bewegung und wende den Kopf. Es ist die schimmernde Schleppe von Elouanns rotem Kleid, die über den Boden schleift, als sie durch den Spiegel tritt und verschwindet. Sie sieht nicht zurück. Es gibt kein Bedauern auf dem ruhigen Gesicht, das ich für einen Wimpernschlag lang im Spiegel erblicke.
Ihr Betrug ist vollbracht. Sie verlässt den Feenkönig, dem sie ein Stück seiner Magie gestohlen hat. Der Spiegel schwärzt sich, als sie die Pforte in die Menschenwelt hinter sich verschließt, auf dass er ihr nicht folgen kann. Und endlich weiß ich, welche Zukunft sie dem Feenreich genommen hat.
Das Kind des Feenkönigs. Geboren, um zu sterben. Zu groß war ihr Hass, um es leben zu lassen.
Und er kommt.
Ich fühle sein Nahen, obgleich er nichts als eine ferne Erinnerung ist. Ein blasses Abbild, erweckt aus dem Geist der Zeit, der niemals vergisst.
Sein Atem geht schwer. Stoßweise, als sei er in großer Eile gewesen. Als hätte er geahnt, was Elouann vorhatte und wollte es verhindern. Sein zweifarbiger Blick schweift suchend durch den Raum, bis er an dem Bett hängen bleibt, in das Elouann sein totes Kind gebettet hat. Alles an ihm wird starr, still. Er hebt die Hand und lässt sie sinken, greift dann nach der Schale, die Elouann zurückgelassen hat, und starrt hinein. Auf die Reste des Giftes, die sie ihm hinterlassen hat, als ob sie sich damit zu ihrer Tat bekennen will.
Ja, sie will, dass er weiß … dass er versteht … dass er den Dolch in seinem Herzen spürt.
Die Schale fällt zu Boden und das schwarze Gift spritzt über den Marmor. Endlich verzerrt sich sein Gesicht in hilflosem, fassungslosem Entsetzen. Ich kann seinen Schrei nicht hören, dennoch schneidet er mein Herz in winzige Stücke. Er bricht in die Knie, als ob alle Kraft seinen mächtigen Körper verlassen hat, und ich bemerke, wie meine Hände zittern. Wie ich sie hebe, um nach ihm zu greifen und ihm Trost zu spenden. Aber ich kann es nicht. Er ist nicht hier und ich würde durch ihn hindurchgreifen wie durch Luft.
Der Turm beginnt zu beben.
Ich blicke erschrocken nach draußen und entdecke, was ich vorher nicht bemerkt habe. Die blühende Landschaft einer malerischen Frühlingsnacht. Blütenblätter, die vorübertreiben, als Sturmböen die Bäume schütteln. Dann verschiebt sich das Land, als ob es die Trauer und den Zorn seines Herrn widerspiegeln will. Die Erde bricht auf und lässt Berge in die Höhe wachsen. Der Wind treibt Schnee herab und bedeckt ihre Gipfel. Eis begräbt den Frühling unter sich und lässt die Welt erstarren, als ob sie um den Verlust des Feenkönigs weint und mit ihm trauern will.
Es wird so kalt wie Elouanns Herz.
Ich friere in dem eisigen Hauch, der über dem Schlafgemach hängt.
Endlich ist die Kraft meines Haares verbraucht. Das Gespinst ist verbrannt und vergeht in einem letzten Faden aus Rauch. Der Zauber erlischt und die Erinnerungen des Turmes versinken in gnädiger Dunkelheit. Es ist still. Ich lausche auf meine hastigen Atemzüge und spüre die Feuchtigkeit auf meinen Wangen. Als ich danach taste, sind meine Fingerspitzen von glitzernden Spuren benetzt.
Plötzlich widert mich die Magie in meinem Blut an. Gestohlene Macht, gestohlenes Leben. Ohnmächtige Wut steigt in mir auf und ich fühle Abscheu für mein eigenes Geschlecht. Niemals war er das Böse. Wir waren es, die das Unrecht begangen und die Schuld in Selbstgerechtigkeit und Lügen erstickt haben.
Lügen. Löcher in der Geschichte, um sie auszumerzen. Eine Heldin, die nichts als ein Scheusal war, das sein eigenes Blut aus Hass getötet hat. Meine Bewunderung verdorrt und wandelt sich in Verachtung. Sie hat das Spiel des Feenkönigs gespielt und sie hat gesiegt. Kein Preis war ihr zu hoch, um zu erlangen, was sie sich ersehnt hat. Macht. Zauberkraft.
Ein Flimmern lässt mich aufblicken und eine Pforte öffnet sich in der gläsernen Wand. Es ist der Spiegel, durch den Elouann gegangen ist, doch nun ist es ein Mann, der darin erscheint. Der Feenkönig tritt hindurch und sein Blick ruht auf mir. Sein Gesicht ist ernst, wissend, als ob er ahnt, was ich getan … gesehen habe. Ich vermag es nicht, seinen Blick zu erwidern. Nicht mehr. Scham brennt auf meinen Wangen, als er vor mir niederkniet und mit den Fingern durch die Asche streicht, die von meinem Haargespinst geblieben ist.
»Das Kind. Es war der Preis«, sage ich erstickt.
»Nein«, erwidert er erstaunlich sanft. »Es war das Versprechen, das gebrochen wurde.« Er fasst nach einer Haarsträhne und lässt sie durch seine Finger gleiten. Ich versuche nicht, mich ihm zu entziehen. »Der Preis war, dass die Magie, die ich ihr geschenkt habe, niemals das Feenreich verlässt.«
»Und deswegen hat sie Euch so sehr gehasst? Weil sie bleiben musste?«
»Sie hat mich gehasst, weil sie war, was sie war. Ein Mensch, geboren ohne Magie. Sie wollte das Geburtsrecht einer Fee besitzen, aber eine solch große Macht gehört allein dem Feenreich und darf ihm nicht genommen werden. Ein Geschenk wie dieses konnte ich ihr nur gewähren, wenn sie hinter den Spiegeln bleiben und nie in ihre Heimat zurückkehren würde. Elouann hat eingewilligt, doch es war ihr nicht genug. Im Feenreich war sie nur eine von vielen. Im Reich der Menschen jedoch wäre sie die größte Zauberin, die je gelebt hat. Ich konnte ihr nicht geben, was sie sich ersehnt hat. Unendliche Macht. Die Unsterblichkeit einer Fee in der Welt ihrer Geburt. Sie hat mich dafür verachtet, es ihr verweigern zu müssen. Und so sollte auch ich nicht bekommen, was ich mir erhoffte.«
»Das Kind … es hätte das Blut der Feen in sich getragen.«
»Und es wäre mächtiger gewesen, als Elouann es jemals hätte sein können. Wie hätte sie es neben sich dulden können? Einen Feenbastard, der in keine der Welten gehört und sie stets an das erinnert, was sie niemals haben wird? Sie wollte es nicht, aber mir wollte sie es nicht lassen. Es war ihre Rache an mir. Ihre Strafe für das, was ich zu geben versäumt habe.« Er klingt bitter. Der alte Schmerz sitzt in seinen Worten, selbst nach all den Jahrhunderten, die verstrichen sind.
»Warum … habt Ihr mich hierher geholt?«
»Weil es Zeit ist, dem Feenreich zurückzugeben, was ihm genommen wurde.« Eine spinnwebfeine Strähne rutscht aus seiner Hand und fällt auf den Teppich.
»Mein … Leben?«, frage ich stockend.
»Nein. Ich habe niemals dein Leben gewollt, schöne Nimaë.« Er lächelt. Es wirkt trüb und dennoch funkelt darunter etwas anderes in seinem Goldauge. Ich frage mich, was er mit seinen zweifarbigen Augen sehen mag. Das eine wie Feuer, das andere wie Eis. Ein ewiger Zwiespalt, der sein Gesicht zeichnet.
Mein Haar glitzert im Kerzenschein. Die Magie darin wird inmitten der zauberischen Umgebung offenbar. Ich berühre einen der winzigen weißlichen Funken und er versetzt mir einen Schlag, der mich zurückzucken lässt. »Der Zauber, der in meinem Haar wohnt. Er ist der Schlüssel, der die Tür öffnet.«
Er nickt. »Gib zurück, was gestohlen wurde, und du wirst frei sein zu gehen, wohin du gehen willst.«
Gib zurück, was gestohlen wurde … Doch wie kann ich das? Ich blicke fragend zu ihm auf, als er sich erhebt und mir die Hand reicht, um mir auf die Füße zu helfen. Seine Haut ist warm und meine Kehle wird eng, als ich gewahre, dass er so nah vor mir steht, dass ich seinen Geruch wahrnehmen kann. Er riecht nach Träumen in einer mondbeschienenen Nacht, Sommer und Winter, Sonne und Schnee. Ein Wesen, alt wie die Welt. Bei ihrem ersten Atemzug geboren. Ehrfurcht breitet sich in mir aus und ich schlucke gegen den Kloß, der in meinem Hals sitzt.
Der Feenkönig lässt mich nicht los. Er streicht das Haar aus meinem Gesicht und sein verwirrender Blick ruht unverwandt auf mir. »Hast du heute eine Antwort für mich?«
Ich muss nicht länger darüber nachsinnen, wenngleich die Bedeutung nie mehr die gleiche sein wird. »Ja.«
»Und bin ich dein Verderben, Nimaë?« Ein drittes Mal stellt er seine Frage. Seine Stimme ist Samt und Seide, sie umschmeichelt mich und lässt meinen Atem stocken.
»Ja, das seid Ihr«, wispere ich und ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Denn er ist der Abgrund, auf den ich zutaumle, seitdem ich durch den Spiegel getreten bin. Das Feuer, das mich verbrennen wird, sobald ich ihm zu nahe komme. Er lächelt und löst sich von mir. Dann wendet er sich ab, um zu der Spiegelpforte zurückzukehren, durch die er gekommen ist.
Er sieht nicht zurück, als er hindurchtritt. Ein silbernes Schimmern wirbelt über den Tisch, auf dem die unsichtbaren Diener sonst meine Speisen auftragen. Diesmal sind es jedoch keine Silberglocken und Kristallkelche, die darauf erscheinen. Es ist ein Kissen aus nachtblauem Samt, auf dem eine Schere ruht. Ihre scharfen Klingen glänzen rötlich im Licht der Kerzen, das sich darin fängt, und ich kann die Magie fühlen, die in ihr wohnt. Magie, die meine auslöschen wird. Ich spüre ihren Sog.
Ein zweiter Spiegel erscheint und wandelt sich zu einem Tor, durch das ich den Schimmer des Ozeans erhaschen kann. Sonnenschein auf glitzernden Wellen und die weißen Türme Tuwelas. Die Windharfe spielt das Lied, das uns vor allem Unheil bewahrt. Ich kann es hören, selbst jetzt. Er hat sie wieder in Gang gesetzt und ihre Magie zurückgegeben. Diesmal ist es ein Geschenk des Feenkönigs, aus freiem Willen gegeben, um meine Heimat vor dem Zorn des Meeres zu bewahren.
Ich blicke zurück zu dem ersten Spiegel, in dem der Feenkönig verschwunden ist. Ein letztes Flackern von Rot wartet darin, das mich an den Sonnenaufgang erinnert. Es ist eine Einladung, ihm zu folgen … oder nach Hause zu gehen. Er lässt mir die Wahl, durch welche Pforte ich treten möchte. Welches das Opfer sein soll, das ich dem Feenreich hinterlassen will, um meine Freiheit zu erlangen.
Und ja, ich bin frei. Frei, mein Schicksal zu wählen.
Und ich wähle.
Ein tiefer Atemzug verlässt meine Brust und ich gehe den ersten Schritt.
Schneefieber
Nina Blazon
Nina Blazon
Nina Blazon wurde in Koper bei Triest geboren, wuchs in Bayern auf und studierte in Würzburg Slavistik und Germanistik. Danach arbeitete sie eine Zeit lang als Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, als Werbetexterin und Journalistin. Inzwischen lebt und schreibt sie in ihrer Wahlheimatstadt Stuttgart.
Ihre phantastischen Kinder- und Jugendbücher sind nicht nur traum-, sondern oft auch märchenhaft. In ihrem frisch erschienenen Jugendbuch Fayra – Das Herz der Phönixtochter tauchen Schneewittchen-Spiegel, Goblins und magische Brunnen auf. Für Der Winter der schwarzen Rosen wurde sie auf der letztjährigen Leipziger Buchmesse in der Kategorie Bester Roman mit dem Phantastik-Preis SERAPH ausgezeichnet.
Für Schneefieber hat sich Nina mit Frau Holle beschäftigt – einer Figur, über die es mehr Mythen gibt als nur das gleichnamige Märchen der Brüder Grimm. Sie soll auf die ursprünglich aus dem slawischen Raum stammende Percht(a) zurückgehen, die sowohl helle als auch sehr dunkle Seiten besitzt. Der Weg in ihr Reich gilt als eine Reise in die Anderswelt, sie selbst soll die Hüterin ungeborener Seelen und Herrin über die Schätze des Erdinneren sein. Frau Holle leitet ihren Namen vielleicht vom Holunder ab, der Pflanze, die ihr geweiht ist. Oft wird sie mit den Raunächten, der Zeit zwischen dem alten und dem neuen Jahr, in Verbindung gebracht. Und in der klirrend kalten Winterzeit siedelt Nina auch ihre Geschichte an.
www.ninablazon.de
Schneefieber
Wir kannten alle Arten von Schnee. Doch in diesem Winter hatte er ein neues, viel erschreckenderes Gesicht bekommen. »Ich habe es euch doch gesagt«, jammerte die alte Irmid. »Die Dunkle ist zurückgekehrt. Sie ist hungrig, also kriecht sie in uns hinein und verschlingt uns von innen. Und das Schneefieber wird nicht aufhören, bis die Sonne stark genug ist, um die schwarze Percht zu vertreiben.«
»Falls wir das noch erleben«, murmelte einer der Totenträger, der den Leichnam von Irmids Mann auf eine Kirchenbank bettete. Seit Wochen war es zu kalt, um Gräber auszuheben. Und seit das Fieber auch den Pfarrer geholt hatte, gab es keine Predigten mehr in unserer Dorfkirche, keine Beichten und keine Taufen. Die Kirche war zu einer Eisgruft geworden. Verhüllt schliefen hier die Toten, bis der Frühling die Erde auftauen und das Tor zu ihrer letzten Ruhestätte öffnen würde.
Ich versuchte, nicht zu den vorderen Bänken zu schauen, dort, wo auch mein Vater ruhte. Aber es war, als würden die Toten nach mir rufen. Im flüsternden Klagen hörte ich meinen Namen – Marie! – und schauderte. Meine Freundin griff ängstlich nach meiner Hand.
»Das ist nur der Wind, der um den Turm streicht«, flüsterte ich ihr beruhigend zu. Stumm lauschte die Trauergesellschaft, wie Irmid Abschied von ihrem Mann nahm. Solche Klagen waren seit Wochen unser tägliches Gebet, keine Familie war verschont geblieben. Das Fieber ergriff Kinder und Greise, Schwache und Starke. Es färbte ihre Lippen weiß und gaukelte ihnen unerträgliche Hitze vor, wo in Wirklichkeit nur tödliche Kälte war. Kürzlich war der Dorfälteste aus dem Fenster gesprungen und barfuß in den Geisterwald gelaufen. Dort hatte er sich bei der Ruine des heidnischen Tempels im Schnee eingegraben und war erfroren. Wie alle, die von diesem Wahn befallen waren, hatte er geglaubt, sich abkühlen zu müssen. Und jetzt sind auch noch Anna und die Kleine krank. Natürlich erlaubte ich mir auch jetzt nicht zu weinen, aber meine Augen brannten so heiß, dass es schmerzte. Seit drei Tagen ertrug meine ältere Schwester weder die Wärme des Ofenfeuers noch die Decke aus vielerlei Pelz, die sie warm halten sollte. Unsere Mutter und eine kräftige Nachbarin bewachten sie Tag und Nacht und verhinderten, dass sie ihr neugeborenes Kind aus dem Wochenbett riss und barfuß in den Schnee floh. Anna wird nicht sterben, wiederholte ich wie eine Beschwörung. Und auch kein anderer mehr. Weil ich es heute Nacht beenden werde.
Meine Freundin, die stets auch die kleinste Regung dunkler Gedanken spürte, sah mich ängstlich von der Seite an. Doch als jemand »Marie, gehen wir« flüsterte, wandten wir beide den Kopf. Vor fünfzehn Jahren waren wir am Marientag geboren worden und trugen denselben Namen. Die Kinder im Dorf nannten uns meist Tagmarie und Nachtmarie – nicht nur, weil mein Haar hell und ihres dunkel wie eine sternenlose Raunacht war. Sondern auch, weil wir so unterschiedlich waren wie Sonne und Mond. Hinter vorgehaltener Hand fand mancher Dorfbewohner auch weniger schmeichelhafte Vergleiche für uns. »Da kommen die Schöne und die Hässliche«, das hatte ich die Leute schon flüstern gehört. »Der Hitzkopf und das Hasenherz. Das Scharfzüngige und die Stumme.«
Nun, aber scharfzüngig war ich schon lange nicht mehr. Und auch hitzköpfig und wagemutig fühlte ich mich in diesem Augenblick nicht.
»Bitte tu es nicht.« Marie umschloss meine Linke fester. Ich konnte ihre Angst spüren – so vertraut, dass es fast tröstlich war. Maries Zaudern machte es mir stets leichter, voranzugehen und mutig zu sein, auch wenn mein Herz etwas ganz anderes sagte.
»Ich habe keine Wahl«, gab ich ebenso leise zurück.
Die Dorfbewohner verließen die Kirche, gebeugte Gespenster mit weiß gefrorenen Wimpern und Wolkenatem. Draußen ließ Eiswind die Fackeln fauchen. Die Äxte, die an der Mauer lehnten, waren bereits von einer dickfrostigen Silberschicht überzogen. Die Holzfäller schulterten ihr Werkzeug und machten sich auf den Weg. Zwar rückte schon die Dämmerung heran, aber die Feuer im Dorf waren hungrig. Marie und ich folgten den Frauen, die ins Dorf zurückkehrten. Unauffällig ließen wir den Abstand größer werden und blieben schließlich stehen.
»Gib mir das Seil«, sagte ich zu Marie. »Und wenn du zu Hause bist, bete für mich.«
Aber heute überraschte meine Freundin mich. Sie schüttelte den Kopf und umschloss meine Hand so fest, dass es fast schmerzte. »Dein Weg ist auch meiner«, flüsterte sie mir zu. Und ich liebte sie dafür, dass sie an meiner Seite blieb, obwohl sie viel mehr Angst hatte als ich.
Schon von Weitem hörten wir die Axtschläge. Den Dörflern war es bei Strafe und Verbannung verboten, auch nur einen Fuß in den Geisterwald zu setzen, nur die Holzfäller, zu denen auch mein Vater gehört hatte, durften ihn betreten. Marie und ich schlüpften ins Unterholz und schlichen geduckt weiter. Die Dämmerung hatte sich schnell über den Wald gesenkt, das Zwielicht gaukelte mir Gespenster vor. Denk an Anna, redete ich mir zu. Denk an all die Kranken. Ich spürte, wie Marie zitterte. Doch als wir das Waldstück unentdeckt durchquert hatten und das Tal in Sicht kam, atmete auch sie erleichtert auf.
»Die Ruine«, raunte ich ihr zu. Genau so hatte mein Vater sie beschrieben. Früher musste dieser Kultplatz groß gewesen sein, doch heute ragte nur noch eine einzige Säule wie ein verwitterter weißer Felsen aus einer Felskante hervor. Genau hier, so hatten die Männer erzählt, hatte der Älteste im Schnee gekauert, als hätte er sich im Tod vor der schwarzen Göttin auf die Knie geworfen. Marie prallte zurück. »Die … Dunkle!« Jetzt sah ich es auch: Im Stein der Säule prangte eine Fratze. Das Wesen hatte wirres Haar und Teufelshörner. Zwei scharfe Hauer wuchsen aus dem Maul. Mit einem Schaudern erinnerte ich mich daran, was die Frauen im Dorf erzählten: »Die schwarze Percht stiehlt Kinder und tötet faule Mädchen. Mit ihrer Axt schneidet sie Menschen die Bäuche auf, füllt sie mit Steinen und näht sie wieder zu. In den Raunächten ist niemand vor ihr sicher.«
Mit klopfendem Herzen ließ ich den Blick in das dunkle Tal schweifen. Es war ihr Reich. Lauf!, flüsterte es in mir. Doch zwischen Bäumen und Felsnadeln, kaum eine Meile von hier, erahnte ich eine Nebelwolke und darin das Schimmern, von dem mein Vater erzählt hatte. »Siehst du den Nebel und das Glänzen?«, fragte ich leise.
Maries Augen waren so groß und furchtsam, dass sie jung wie ein Kind wirkte. »Ja«, hauchte sie.
»So schimmert keine Eisfläche, nur Wasser«, wisperte ich. »Das ist der See, der niemals zufriert, daher steigt Nebel über dem Wasser auf. Mein Vater sagte, am Ufer steht ein Holunderbaum. In der Zeit der Raunächte trägt er auch im Winter Blüten. Aber nur bei Vollmond, nur eine Nacht lang, nur … heute.«
Marie biss sich auf die Unterlippe. »Was, wenn es nur ein Märchen ist? Oder ein Fiebertraum deines Vaters?«
Ich weiß nicht, warum ich bei diesen Worten so erschrak. Vielleicht, weil es einfach nicht sein durfte.
»Was, wenn nicht?«, fuhr ich Marie so grob an, dass sie zusammenzuckte. »Soll ich lieber feige sein? Und zusehen, wie wir alle sterben?«
Erst als sie warnend den Zeigefinger über die Lippen legte, merkte ich, wie laut ich geworden war.
»Ist da jemand?«, erklang die Stimme eines Holzfällers. Jetzt war mir so heiß, als hätte das Schneefieber von mir Besitz ergriffen.
»Das Seil!«, zischte ich Marie zu. »Schnell!«
Sie holte es unter ihrem Mantel hervor, ich band es um die Säule. Die vertrauten Handgriffe beruhigten mich. Flink seilte ich mich ab und landete in einer Schneewehe. Ich kannte jede Art von Schnee, den losen, den haftenden und den, der unter den Füßen wegrutscht wie ein Schlitten. Doch diesen kannte ich nicht. Er war wie weißes Wildwasser. Er riss mich so schnell talwärts, dass ich das Seil verlor. Der Himmel trudelte über mir und dann gab es kein Oben und Unten mehr, nur meine Nägel, die über Fels kratzten, als ich versuchte, mich wie eine Katze festzukrallen. Ein Schlag raubte mir kurz die Besinnung. Als ich zu mir kam, bekam ich kaum Luft. Stein drückte gegen meine Rippen. Schnee rutschte von oben nach, als wollte er mich ins Tal schieben. Nun sah ich, dass ich fast bis in die Talsenke gerutscht war.
»Marie!« Der gellende Schrei meiner Freundin riss mich aus meiner Benommenheit. Ich rappelte mich hoch. Marie starrte mich an und schlug ertappt die Hände vor den Mund, als könnte sie ihren Schrei jetzt noch zurückhalten. Aber es war zu spät.
»Das war doch eines der Mädchen«, hallte es im Wald. Ich fluchte zwischen zusammengebissenen Zähnen. Ja, ich liebte Marie mehr als mein Leben, aber jetzt hätte ich sie schlagen können.
Na los, versteck dich!, bedeutete ich ihr mit einer wütenden Geste.
Immerhin gehorchte sie und verschwand aus meinem Sichtfeld. Ich drehte mich um … und trat in ein Nichts, das um mich herum zu einem Gestöber aus Schneeflecken und Wind zerfiel.
Mein Kopf pochte, heiß floss mir ein Rinnsal Blut über die Wange und fing sich in meinem Mundwinkel. Ich erinnerte mich daran, eingebrochen zu sein – vermutlich in eine Felsspalte, die nur von einer dünnen Schneekruste bedeckt gewesen war. Aber nun prasselte Feuer in der Nähe. Es duftete vertraut nach Wacholderrauch. Im ersten Moment kämpfte ich gegen die Tränen. Sie haben mich also nach Hause gebracht und werden mich für den Rest des Winters einsperren. Aber dann fiel mir auf, dass eine Frau leise ein Lied summte. Bei uns zu Hause sang niemand mehr. Meine Schwester schrie und jammerte nur im Schneefieber und ihr kranker Säugling brüllte Tag und Nacht.
Verwirrt riss ich die Augen auf. Ich lag in einer baufälligen Hütte, die eher einer Höhle glich, auf dem Boden. Halb von mir abgewandt saß eine Fremde am Feuer. Sie trug ein grob genähtes Kleid aus Eichhörnchenfell und hatte noch helleres Haar als ich. Nachlässig geflochten fiel es ihr über den Rücken. Völlig versunken summte sie ein Wiegenlied und schaukelte mit dem Oberkörper sacht vor und zurück. Nun entdeckte ich auch das Bündel, das die Frau vor ihre Brust gebunden trug. Ein winziges Fäustchen ragte daraus hervor und zuckte traumverloren. Ohne Hast drehte die Frau sich nun ganz zu mir um. »Du hast lange geschlafen«, sagte sie.
Ich fuhr hoch und kroch erschrocken ein Stück zurück. Zwei raubtierhaft helle Augen starrten mich aus einem schwarzen Gesicht an. Aber dann erkannte ich, dass die Frau sich nur einen Streifen Ruß über Augen und Nase gezogen hatte. Die schwarze Maske ließ ihre grünen Augen so befremdlich hell leuchten. Sie sieht aus wie eine Wilde, dachte ich. Aber sie schien freundlich zu sein, sie lächelte mir zu. »Hab keine Angst, Mädchen.«
»Wo bin ich?«, brachte ich mühsam hervor.
»Im verbotenen Tal. Du bist gestürzt. Ich habe dich gefunden, als ich zur Hütte zurückging.«
Siedend heiß fiel mir ein, was man sich noch über das Tal erzählte: dass Verbrecher, Gottlose und Flüchtlinge sich hier versteckten.
Ich schluckte. »Gehörst du … zu den Vogelfreien?«
Sie lachte leise und wiegte ihr Kind. »Hier gibt es schon seit Langem keine Verbannten mehr. Es ist der sicherste Ort, an dem man sein kann, denn alle fürchten und meiden ihn. Warum nicht du?«
Es war seltsam. Ich hätte Angst haben müssen, aber obwohl ich Gänsehaut hatte, mochte ich diese seltsame Fremde. Beinahe hätte ich sogar ihr Lächeln erwidert. Sie nahm einen Wacholderzweig und warf ihn ins Feuer. Betäubend stark breitete sich der balsamische Duft der verglühenden Nadeln aus. Ahnenrauch