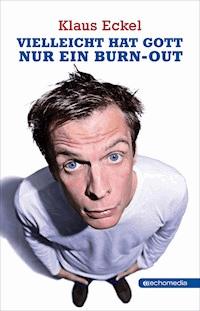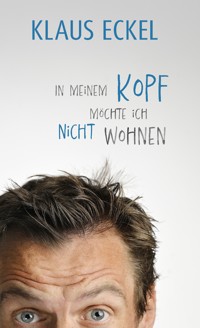
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine satirische Rundreise durch die Baustellen der Gesellschaft! Willkommen im Kopf von Kabarettist Klaus Eckel – wo das Chaos die Hausordnung schreibt. Seine Kreativität lässt alle Türen offen, seine Erinnerungen spielen gerne Verstecken, seine Neugierde dekoriert jeden Raum mit Fragezeichen und seine Ironie sitzt in der Ecke und kichert. Ständig ziehen bei ihm neue Gedanken ein und alte wieder aus. Doch keiner hinterlässt sein Gehirn so, wie er es vorgefunden hat. TRIGGER-WARNUNG: Dieses Buch enthält gedankenschwere Leichtigkeit, kombiniert mit ernsthaftem Witz! AUS DEM INHALT: In meinem Kopf befinden sich folgende Räume: Das sonnige Grübelzimmer - Fakten sind für Menschen ohne Vorstellungskraft Das Kabinett der verlorenen Gedanken Das Kabinett der verlorenen Gedanken Die Panikkammer Der Flur der flüchtigen Einfälle Das Büro für Prokrastination Der Salon der guten Hoffnung Die Sauna der heißen Diskussionen Das Atrium des Absurden Die Bibliothek der kraftlosen Geistesblitze Der poetische Wintergarten »Kluge Gedanken und Kinder im Ikea-Bällebad teilen ein Schicksal. Sie warten oft sehr lange darauf abgeholt zu werden.« (Klaus Eckel)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf em Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter
ÜBER DAS BUCH
Willkommen im Kopf von Kabarettist Klaus Eckel – wo das Chaos die Hausordnung schreibt. Seine Kreativität lässt alle Türen offen, seine Erinnerungen spielen gerne Verstecken, seine Neugierde dekoriert jeden Raum mit Fragezeichen und seine Ironie sitzt in der Ecke und kichert.
Ständig ziehen bei ihm neue Gedanken ein und alte wieder aus. Doch keiner hinterlässt sein Gehirn so, wie er es vorgefunden hat.
Eine satirische Rundreise durch die Baustellen der Gesellschaft.
TRIGGER–WARNUNG:
Dieses Buch enthält gedankenschwere Leichtigkeit, kombiniert mit ernsthaftem Witz.
Für das Finanzamt
(Weil ich immer mit euch rechnen darf)
INHALT
VORWORT
IN MEINEM KOPF BEFINDEN SICH FOLGENDE RÄUME:
DAS SONNIGE GRÜBELZIMMER
DAS KABINETT DER VERLORENEN GEDANKEN
DIE HELLHÖRIGE PANIKKAMMER
DER FLUR DER FLÜCHTIGEN EINFÄLLE
DAS BÜRO FÜR PROKRASTINATION
DER SALON DER GUTEN HOFFNUNG
DIE SAUNA DER HEIßEN DISKUSSIONEN
DAS ATRIUM DES ABSURDEN
DIE BIBLIOTHEK DER KRAFTLOSEN GEISTESBLITZE
DER POETISCHE WINTERGARTEN
VORWORT
Wenn der Kopf mit Gedanken überschwappt, wird der Mund zum Überlaufbecken. Das können die Besucher meiner Kabarettprogramme vermutlich bestätigen. Doch auch hinter dem Bühnenvorhang dreht sich mein Synapsenkarussell unermüdlich weiter. Zu Hause angekommen, glüht dann oft bis zum Morgen noch die Computertastatur. Meine tippenden Finger sind sozusagen Gedankenblitzableiter.
Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder Gedanke, der meinem Kopf entspringt, von erleuchtender Klugheit zeugt. Doch auch der dumme Gedanke erfährt bei mir keine Diskriminierung. Immerhin bringt er mich viel häufiger zum Lachen als sein smarter Kollege.
Das menschliche Gehirn hat den undankbarsten Job der Welt. Es muss unzählige Meinungen, Werte, Sinneseindrücke und Gefühle irgendwie zusammenhalten. Da müssen unter einer Schädeldecke Tausende Widersprüche auf engstem Raum zusammenleben. Aufgrund dieser Leistung ist der menschliche Kopf wahrscheinlich das beste Beispiel für gelungene Integration.
Seit vielen Jahren gieße ich die meinem Gehirn entsprungenen Gedanken in Kolumnen, Geschichten, Pointen und Gedichte. Manches davon wurde bereits veröffentlicht, doch für vorliegendes Buch habe ich sämtliche dieser Beiträge bis zur Unkenntlichkeit überarbeitet.
Die meisten Texte sind kurz. Man kann sie entweder aufmerksam hintereinander lesen oder bei aufkeimender Langeweile weiterwischen. Für die einen bleibt es damit ein Buch, für die anderen ist es vielleicht TikTok zum Blättern.
Übrigens, falls Sie diese ersten drei Absätze ohne Unterbrechung zu Ende gelesen haben, möchte ich Ihnen gleich aus zwei Gründen gratulieren. Erstens können Sie sich für die heutige Zeit überdurchschnittlich lange konzentrieren und zweitens gehören Sie zu einer vom Aussterben bedrohten Spezies: jener der Buch-Lesenden.
Im Zeitalter von VR-Brillen, Smartwatches und selbstfahrenden Autos wirken auf Papier gedruckte Worte eingeschlossen von zwei Pappdeckeln so modern wie eine Stereoanlage mit Doppelkassettendeck.
Ich hoffe, dieses antiquarisch anmutende Druckerzeugnis, das Sie jetzt in Händen halten, beschenkt Sie mit mindestens der Hälfte des Vergnügens, das ich beim Verfassen hatte.
Herzlichst
Ihr Humor-Nahversorger aus der Region
Klaus Eckel
DAS SONNIGE GRÜBELZIMMER
FAKTEN SIND FÜR MENSCHEN OHNE VORSTELLUNGSKRAFT
Meiner Selbsteinschätzung nach bestehe ich zu 10 Prozent aus Wasser und zu 90 Prozent aus Ausreden. Deswegen beschloss ich neulich, einer psychologischen Tagung beizuwohnen, und lauschte einem Vortrag über Prokrastination. Ein Redner erzählte, dass ihn jahrelang, wenn er bei einem Wäschekorb mit nicht gebügelter Kleidung vorbeiging, das schlechte Gewissen plagte. Bis vor wenigen Wochen das im Wäschekorb befindliche Gewand tatsächlich zu ihm sprach. Laut seiner Aussage riefen ihm die Kleidungsstücke zu: „Wir sind noch nicht bereit, gebügelt zu werden!“ Ich kippte vor Lachen beinahe vom Stuhl. Leider als Einziger. Der Rest des Publikums hing weiterhin gebannt an den Lippen des „Hosenflüsterers“.
In einem Nebensatz erwähnte der Anti-Aufschiebungs-Guru, dass er jetzt die früher verschwendete Bügelzeit zum Pilzesammeln nutze. Da dürfte ihm wohl einige Male statt einem Parasol ein Magic Mushroom ins Körbchen gerutscht sein. Doch die Idee ist genial. Das Erledigen meiner Buchhaltung habe ich jetzt um einen weiteren Tag verschoben. Bereits nach drei Gin Tonics sprachen die Belege zu mir: „Wir sind noch nicht bereit, gelocht zu werden.“ Die Realität ist sowieso nur ein Vorschlag. Meine Kenntnisse in der Quantentheorie sind ungefähr so fundiert wie die eines Maulwurfs über die richtige Wahl von Sonnencreme, doch eines habe ich mir gemerkt: Die Beobachtung beeinflusst den Gegenstand. Seitdem hat sich für mich jeder Depp zum Quanten-Depp weiterentwickelt. Er ist nur ein Depp, solange ich hinschaue. Im Straßenverkehr ist diese Einstellung durchaus hilfreich.
Vielleicht existiert auch weltweit kein einziger dummer Mensch, sondern lediglich Gehirne, die ihren Besitzern unablässig zuflüstern: „Ich bin noch nicht bereit, verwendet zu werden.“
DIE ERWARTUNGSFALLE
Im Haushalt ist der Kühlschrank oft das Epizentrum der Unzufriedenheit. Immer wieder öffne ich ihn voller Hoffnung und schließe ihn danach enttäuscht. Nur zehn Minuten später wiederhole ich diesen Vorgang.
Ein Phänomen, welches ich Kühlschrank-Demenz nenne. Diese Vergesslichkeit darüber, dass nichts drinnen ist. Vielleicht überprüfe ich auch nur, ob meine Ansprüche ausreichend gesunken sind, um das vorhandene Angebot zu verzehren. Um meine Enttäuschung zu mildern, habe ich ein Foto von unserem leeren Kühlschrank auf die Vorderseite geklebt. Mittlerweile lassen mich selbst eine vergraute Essiggurke und ein abgelaufenes Himbeerjoghurt in Jubel ausbrechen.
Ärger entsteht eben immer aus der Kluft zwischen Erwartung und Realität. Das trifft nicht nur auf Kühlschränke, sondern auch auf Kinder zu. Anfangs ist der Nachwuchs meist ein Ultraschallbild, auf das sich die Eltern freuen. Doch spätestens in der Pubertät reift die Erkenntnis, dass der Nachwuchs die Freude über die Existenz der Eltern nicht unbedingt teilt. Man sollte also seine Erwartungen von Anfang an zurückschrauben. Die Erziehung kann als gelungen betrachtet werden, wenn aus dem Ultraschallbild kein Fahndungsfoto wird. Alles andere ist Bonusglück.
Politiker stolpern regelmäßig über ihren selbst gesäten Optimismus. In den letzten Jahren las ich unzählige Male auf Wahlplakaten: „Der neue Weg“ und „Anstand, Haltung, Respekt“. Nur wenige Monate später hätte man diese Plakate mit einem „Achtung Satire!“-Sticker kennzeichnen müssen. Ich wäre mir gegenüber viel skeptischer. Auf meine eigenen Wahlplakate würde ich drucken lassen: „Unfair, aber zu allen“ und „Korrupt, korrupter, Eckel“. Zumindest könnten meine Wähler später über mich sagen: „Man kann ihm viel vorwerfen, aber ehrlich war er.“
WEISHEIT TO GO
Immer wieder begegnet mir der Ratschlag: „Liebe dich selbst, sonst kannst du niemanden anderen lieben.“ Das bezweifle ich. Mohntorte, Lissabon und meine Kinder liebe ich unentwegt. Mir selbst gegenüber scheinen die Schmetterlinge im Bauch einen Ausgang gefunden zu haben. Durchaus häufig enden meine Selbstgespräche mit den Worten: „Du hörst von meinem Anwalt!“
Ich behaupte, dass es jedem halbwegs reflektierten Menschen schwerfällt, sich ruhig vor den Spiegel zu stellen und nach einer halben Stunde der inneren und äußeren Selbstbetrachtung noch immer zu denken: Wow! Das gelingt wahrscheinlich nur, wenn man männlich ist, Amerikaner, als Frisur ein totes Eichkatzerl am Kopf trägt und sich für das Präsidentenamt bewirbt. Ich glaube, um mich zu lieben, müsste ich mich weniger kennen. Und sich sich selber schönzutrinken, ist vermutlich der Leber nicht zumutbar.
Genauso fragwürdig finde ich den überstrapazierten Hinweis: „In jeder Krise steckt eine Chance!“ Ein Satz, den ich als Kapitän der Titanic den Passagieren nicht zugerufen hätte. Als Zyniker hätte er nur noch hinzufügen können: „Ihr lernt jetzt alle Eisschwimmen.“ Manchmal steckt in der Krise auch nur eine Krise. Vielleicht ist es ein Merkmal der Gegenwart, dass wir inzwischen sogar versuchen, Niederlagen zu optimieren.
„Sei einfach du selbst!“ Bitte nicht! Internetforen sind voll mit Menschen, die sich hinter Pseudonymen wie Mifrogtjakaner 74 verstecken und die Allgemeinheit mit ihrem authentischen Ich belästigen. Ich plädiere dafür, dass jeder Mensch einen inneren Außenminister beschäftigt, der die Botschaften aus dem Gehirn annehmbar und vorstrafenfrei für den Mund aufbereitet.
Übrigens, wenn ich mich nicht wasche, dann rieche ich authentisch. Mein Sitznachbar im ÖBB-Speisewagen ist mir vermutlich dankbar, wenn ich mein authentisches Ich hinter etwas Duschgel verberge. Wenn mir eine einzige komprimierte Weisheit im Leben wirklich weitergeholfen hat, dann diese: „Sorgen sind wie Spaghetti. Man macht sich immer zu viel davon.“
ANTIANTIAGING
Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Körperfettwaage. Vorgestern zeigte sie mir nach der Messung beim biologischen Alter die Zahl 37 an. Dieses Kompliment machte mich derart verlegen, dass ich meiner Waage gleich zwei neue Batterien spendierte. Bei der Messung am darauffolgenden Tag stand beim biologischen Alter: 46. Ich bin in nur einer Nacht um neun Jahre gealtert. Meine alten Batterien waren eindeutig charmanter. Dabei absolvierte ich am Tag davor eine Mountainbike-Tour. Offenbar sandte mein Radcomputer an die Waage die Botschaft: „So wie der fährt, wird der nicht alt.“ Da ich befürchte, dass mir meine Waage in wenigen Tagen beim biologischen Alter die Zahl 74 anzeigt, habe ich jetzt einmal das Sportprogramm auf Eis gelegt. Ich warte bereits auf den Tag, an dem ich mich nach dem Duschen auf die Waage stelle und beim biologischen Alter steht: „Verstorben“. Diese Beurteilung würde ich sofort mit dem Handy fotografieren und an das Finanzamt schicken. Tote zahlen keine Steuern.
Die Wahrnehmung des Alters ist ohnehin eine facettenreiche Angelegenheit. Ronaldo ist mit 39 ein greiser Kicker, Papst Franziskus ist mit 87 ein blutjunger Pontifex. Im Vatikan spricht man sogar von einer Nachwuchshoffnung. Dem Lamine Yamal unter den Oberhirten.
Seit vielen Jahren gehe ich mit folgendem Gedanken schwanger: Wie wäre es, wenn niemand mehr sein Alter wüsste? Das Alter ist einer der Hauptfaktoren für Stress. Eine Zahl, die uns durchs Leben peitscht. Mit 18 sollte man mit der Schule fertig sein, spätestens mit 30 erste eigene Wohnung, mit 40 hört man ständig die Frage: „Warum hast du noch keine Kinder?“ Und mit 50 sollte man als Mann aus Rücksicht aufs Herz die Karriere ausklingen lassen. Stattdessen setzen sich 50-jährige Männer in viel zu engen Trikots aufs Rennrad und fahren damit zum drei Kilometer entfernten Heurigen, um dann dort vier Liptauerbrote zu verspeisen. Wenn am Horizont die eigene Endlichkeit auftaucht, neigt man oft zu seltsamem Verhalten.
Es wäre sinnvoll, das Feld für das Geburtsdatum auf Geburtsurkunden endlich frei zu lassen. Ich erkenne in der Unkenntnis über mein Alter ausschließlich Vorteile. Ich hätte dadurch vielleicht Trotzphase, Pubertät und Midlife-Krise verpasst. Natürlich wäre ich phasenweise weiterhin „a bissl deppad“ gewesen, aber niemand hätte gewusst, warum. Jedes Alter erfährt doch seine Altersdiskriminierung. Mit neun darfst du nicht wählen, mit 93 bekommst du nur ganz schwer einen Studentenrabatt. Ohne Alterswissen wäre das alles möglich. Ich könnte drei Tage hintereinander Geburtstag feiern. Weil mir danach ist. Nicht die Geburtsurkunde bestimmt, wie viele Kerzen auf der Torte stehen, sondern meine Befindlichkeit.
Ohne Alterswissen könnte jeder Mensch das Leben nach seinem Tempo ausrichten. Es gäbe dann „Kinder“, die noch mit dem Moped in die Volksschule fahren. Warum nicht? Sie wollen sich einfach für das Erlernen des kleinen Einmaleins mehr Zeit geben.
Endlich ein Ende von den zwei Todesphrasen der Lebensfreude: „Dafür bist du zu alt!“ und „Dafür bist du zu jung!“ Das Alter wäre endlich egal.
Vierjährige verwenden dann den Treppenlift und Achtzigjährige tauschen Pokémon-Karten. Im Ikea-Bällebad könnte eine eigene Rollator-Rutsche stehen. Und falls man bei der Landung das Gebiss verliert, kommt es zu einer generationsübergreifenden Schatzsuche. Das Wissen über das jeweilige Alter spaltet mehr, als es verbindet. Ohne Alterskenntnis würde im Büro niemand mit 65 den Stift fallen lassen, sondern erst dann, wenn die Hand den Stift nicht mehr halten kann.
Sie bemerken vielleicht, dass ich mich mit diesem Thema schon seit vielen Jahren beschäftige. Bereits in meiner Schulzeit wollte ich mit Freunden ein Volksbegehren für die Abschaffung des Alters initiieren. Bei der Behörde wurde uns gesagt: „Geht nicht, dafür muss man 18 sein.“
ERDUMDREHUNG MIT TEMPOLIMIT
Unser Planet ist vieles, aber sicher keine ruhige Kugel. In Anbetracht der letzten Jahre könnte sich die Erde durchaus eine kurze Auszeit auf einer Parkbank gönnen und tief durchatmen. Der abendliche Blick in den Himmel und auf andere Planeten beweist mir: Man kann’s auch gemütlicher angehen. Ganze Jahrtausende schrieben weniger Schlagzeilen als die vergangenen zwei Jahre. Ein weiterer Grund für die Erderwärmung ist vermutlich die permanente Erregungshitze.
Doch bevor wir die Welt in eine galaktische Burn-out-Klinik schieben und dort an eine Valium-Dauertropfinfusion anschließen, sei nochmals kurz nachgedacht. In den letzten Monaten war ich unglaublich dankbar, dass Österreich eine derart starre und bürokratische Republik ist. Es beweist, dass die Demokratie noch die Zügel in der Hand hält. Demokratie bedeutet das Verlangsamen von Prozessen. Hierzulande kann kein von der Leine gelassener Autokrat bestimmen: „Des bau ma, des schließ ma und Südtirol hol ma uns z’ruck!“
Wenn der Bundeskanzler auf den Tisch hauen will, dann müssen es zumindest elf Tische sein. Seiner, der vom Vizekanzler und die von den neun Landeshauptleuten.
Hinzu kommen noch 427 Katzentische. Deswegen gibt es in Österreich Brückenbauprojekte, die von der Planung bis zur Umsetzung über 70 Jahre benötigten. Vom stellvertretenden Kirchenbeirat-Stellvertreter bis zum bedrohten Ziesel, alle dürfen mitreden. Und das ist gut so.
Als Kind bewunderte ich Pyramiden. Mittlerweile sehe ich in ihnen einen geometrischen Haufen aus 25 Millionen Tonnen schweren Kalksteinen, errichtet für ein neun Kilo schweres Skelett. Damit ist eine Pyramide ein Mahnmal der totalen Selbstüberschätzung. Im demokratischen Österreich hätten die Gewerkschaft, das Umweltbundesamt und die Anrainer den Bau dieses sinnlosen Grabstätten-Porsche ganz sicher verhindert. Und wenn nicht die, dann zumindest eine Zieselfamilie.
ALLER GUTEN DINGE
In meinem letzten Buch unterhielt ich mich mit 18 verschiedenen Alltagsgegenständen über den Menschen. Darunter waren ein dementer Kühlschrank, ein panischer Fahrradhelm, eine tief gekränkte Jogginghose. Alle kamen zu Wort. Ich behaupte, dass Gegenstände uns aufschlussreichere Geschichten über ihre Eigentümer erzählen könnten als sämtliche Investigativjournalisten.
Ich frage mich, welche Relikte Archäologen in 5000 Jahren bei Ausgrabungen von uns wohl finden werden. Vielleicht den zerbrochenen Rückspiegel eines Tesla oder einen positiven Covid-Schnelltest? Im weniger schmeichelhaften Szenario könnten sie auf einen Selfie-Toaster, Einhorn-Hausschuhe oder beheizbare Schlafsocken mit Wecker-Funktion stoßen. Angesichts dieser Funde werden die Archäologen vermutlich einhellig urteilen: „Also Hochkultur war das keine.“ Moderne Gegenstände entziehen sich zusehends unserem Verständnis. Im 16. Jahrhundert konnte jeder begreifen, wie ein Tisch funktioniert. Aber wer versteht heute schon seinen Dampfgarer? Die letzte Innovation, die ich einigermaßen durchschaute, war der Klettverschluss.
Eine weitere Beobachtung: Viele Redewendungen enthalten Gegenstände – „Das fünfte Rad am Wagen“, „Du kannst mir meinen Schuh aufblasen“, „Dumm wie ein Ziegelstein“. Interessanterweise werden in Österreich die meisten Einfamilienhäuser mit Ziegelsteinen gebaut. Da stellt sich mir unweigerlich die Frage: Kann in dummen Häusern überhaupt intelligentes Leben wohnen?
BILDSCHIRMZEIT
Neulich zeigte der ORF am Hauptabend ein sieben Jahre altes Programm von mir. Und das zum neunten Mal. Langsam bekomme ich den Eindruck, der ORF-Bildungsauftrag lautet, dass die Bevölkerung Eckel-Pointen auswendig lernen soll. Vielleicht steht irgendwann doch wieder ein ehemaliger GIS-Beamter vor Ihrer Tür und fragt: „Was sagt er nach Zimtschnecke?“ In dem Programm sitze ich über eine Stunde auf einem knarrenden Holzsessel und rede schneller als mein Schatten. Ehrlich gesagt, viel mehr kann eine Darbietung nicht aus der Zeit gefallen sein. Kaum Schnitte, kein Lichtwechsel, keine Casting-Jury, keine Wasserleiche. Der ORF hätte vor meinem Programm „Dalli Dalli“ und danach das „Wetterpanorama“ vom 12.3.2012 ausstrahlen können. Am besten alles in Schwarz-Weiß. Das hätte sich nahtlos in die Modernität eingefügt. Trotzdem folgten erneut über 400.000 Zuschauer meiner Darbietung. Es ist vermutlich wie bei einem Autounfall: Man kann bei einem Realitätsverweigerer nicht wegsehen. Ich erwähne nämlich in diesem Programm den aktuellen Bundeskanzler Christian Kern.
Vielleicht surfe ich mit diesem minimalistischen Auftritt ja auch auf der aktuellen Detox-Welle. Verzichten ist das neue Anhäufen. Im Jänner gelten bei vielen Menschen die Regeln: kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Zucker, kein Ausatmen. Seit Jahren träume ich von einer Detox-Geburtstagsparty. Auf dieser darf niemand etwas mitbringen, sondern auf einem Tisch steht von mir angesammeltes Klumpert und jeder Gast muss verpflichtend einen Gegenstand mitnehmen.
Ich hoffe, dass dadurch Dinge wie Raclette-Set, Kirschkernentferner und Bananen-Tupperware endlich ein anderes Zuhause unglücklich machen. Vielleicht ist auch die Zukunft der ORF-Unterhaltungsabteilung das Detox-Kabarett. Sie zeigen dann eine Stunde lang nur noch das Testbild und die Zuschauer bauen sich im Kopf ihre eigenen Witze.
ALTES NEU DENKEN
Anlässlich eines Wirtschaftskongresses, bei dem ich als Überbrückungsunterhalter zwischen Frittatensuppe und Lungenbraten engagiert wurde, schwappte mir von einem Vortragenden wiederholt die Formulierung entgegen: „Wir müssen Produkte neu denken.“ Prinzipiell will ich neues Denken nicht verurteilen, weil neues Denken altes Denken voraussetzt. Die wenigsten Menschen sind an einer Überdosis Gedanken verstorben, die Gedankenlosigkeit füllt hingegen ganze Friedhöfe.
Auf diesem Kongress, der fest in der Hand von Sakkoträgern war, wurde eifrig über das Innovationspotenzial von Heizung, Auto und Laufschuh sinniert. Doch als ein frisch von der Fachhochschule geschlüpfter Business Consultant, welcher zumindest den vierten Platz beim Sebastian-Kurz-Lookalike-Wettbewerb hätte erringen können, meinte: „Man muss auch den Küchenschwamm neu denken!“, wurde ich hellhörig. Ich war tatsächlich der Einzige, der bei diesem Satz laut auflachte. Der Rest des Saals nickte zustimmend. Leider folgten von dem jungen Mann keine weiteren diesbezüglichen Ausführungen.Man muss den Küchenschwamm neu denken? Der Küchenschwamm ist eigentlich ein überschaubar komplexes Produkt. Gleichzeitig ist er dem Menschen nicht ganz unähnlich. Er besitzt eine weiche Seite, eine raue Seite, und drinnen steckt er voller Bakterien. Eine weitere, vielleicht etwas weit hergeholte Gemeinsamkeit: Egal ob man Schwamm oder Mensch drückt, beide verlieren Flüssigkeit. Vielleicht sind die Tränen der Rührung nur das Abwasser der Augen.
Der Küchenschwamm muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er sich seit seiner Erfindung im Jahr 1949 kaum weiterentwickelt hat. Er blieb von der Silicon-Valley-Fortschrittswalze völlig unbeeindruckt. Warum kann man eigentlich mit einem Küchenschwamm immer noch nicht telefonieren? Einmal drücken für „Abheben“, zweimal drücken für „Auflegen“, und dreimal drücken bedeutet „Kurzparkschein verlängern”. Der Küchenschwamm der Zukunft benötigt dringend ein Verschmutzungsnavi, welches mir beim Putzen Anweisungen gibt wie „Nach der Abwasch links abbiegen“. Falls ich jedoch im Reinigungsrausch an das Ende des Backrohrs stoße, sollte ein lautes „Bitte wenden!“ ertönen. Ein moderner Küchenschwamm braucht unbedingt eine eingebaute Gesichtserkennung.
Sollte der Putzende beim Säubern seines Wohnraums nicht lächeln, muss der Küchenschwamm seine Saugkraft sofort einstellen. Denn wie heißt es unter den Putzfluencern? „Nur wer beim Wischen Freude empfindet, kann seine Reinigungsziele erreichen!“
Ich vermute, mit diesen Küchenschwamm-Visionen hätte ich auf dem Wirtschaftskongress den Saal zum Beben gebracht. So viel Schwachsinn schreit danach, in eine Power-Point-Präsentation gegossen zu werden. Dann heißt es nur noch Venture-Capital-Firmen abklappern, denn wie lautet die Devise in der Start-up-Welt? „Every smart idea will open a wallet.“ Auf Wienerisch ist diese Formulierung eher bekannt unter: „Irgendan Deppaden findst immer.“
Doch manchmal überkommt mich auch inmitten von Technologie-Groupies eine tiefe Melancholie. In mir breitet sich dann ein „Ich komm da nicht mehr mit“-Gefühl aus. Der Boomer in meinem Kopf flüstert mir unentwegt dieselben beiden Gedanken zu: „Brauch ma des alles wirklich?“ und „Wir ham das auch ned g’habt!“
Im Leben der meisten Menschen gibt es den Zeitpunkt, an dem man beschließt, dem Fortschritt die kalte Schulter zu zeigen. Es gibt diese eine letzte Erfindung, bei der man zu sich sagt: „Dieses Produkt lasse ich noch in mein Leben, alle weiteren sind mir wurscht.“ Bei meiner Großmutter war das der Kelomat, bei meiner Mutter der Videorekorder, vielleicht wird es bei mir der KI-Küchenschwamm sein. Doch obwohl ich in mir eine technologische Fortschrittsskepsis orte, geht mir gleichzeitig so manch gesellschaftlicher Wandel viel zu schleppend voran. Zum Beispiel träume ich seit Jahren von einer Bildungsreform, die unsere Kinder nach ihren Talenten scannt und nicht nach ihren Mängeln. Als Mensch kann man eben beides gleichzeitig sein – stillstandsmüde und veränderungserschöpft.
WER NICHTS GLAUBT, MUSS ALLES WISSEN
Mein alter, durchaus gebildeter Schulfreund Ralf beginnt viele seiner Sätze mit: „Wie du sicher weißt ...“ Was dann folgt, ist in der Regel eine Information, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Das Einzige, was ich mittlerweile weiß, ist, dass ich mich nach der Einleitung „Wie du sicher weißt“ meistens wie ein Idiot fühle. Vielleicht verkleide ich mich im nächsten Fasching als Wissenslücke.
Bereits in meiner Schulzeit beantwortete ich die Prüfungsfragen meiner Lehrer recht häufig mit einem Kurt-Ostbahn-Klassiker: „I wüs gor ned wissn. Ned so genau.“ Das bescherte mir Probleme, gleichzeitig jedoch Lacher. Ich musste nicht lange abwägen. Jeder halbwegs gefestigte Jugendliche nimmt für zwei Schmunzler drei Nachprüfungen in Kauf. Wissen kann unheimlich belasten. Ein Satz, den man vielleicht nicht über jede Schule schreiben sollte, aber meine Beobachtungen nähren diese These.
Immer häufiger begegne ich im Supermarkt Menschen, die sich kopfschüttelnd die Inhaltsstoffe diverser Produkte durchlesen. Die wissen dann vom Waldhonig alles. Blütenquellen, Pantothensäuregehalt und vermutlich das WLAN-Passwort vom Imker. Doch der Vollerwerbs-Skeptiker hat am Supermarktausgang nichts im Einkaufswagen. Außer vielleicht zwei Bilder fürs Stickeralbum. Chronische Bescheidwisser sind ständig auf der Hut. Giftstoffe, Geldabwertung, Tigermücke. Informationen sind immer häufiger verkleidete Sorgen. Doch eine Mischung aus unerschütterlichem Vertrauen und atemberaubender Trägheit lässt in meinem Kopf gern den Gedanken zu: „Des wird scho passen.“ Aktive Ahnungslosigkeit ist ein Luxus, den ich mir gelegentlich gönne. Trost spendet mir auch folgende Überlegung: Ich bin nicht uninformiert, sondern ich habe nur mein Wissen an andere Gehirne ausgelagert.
KEINE WENDE OHNE ENDE
Tiere verabschieden sich nicht voneinander. Wenn beispielsweise Küstenseeschwalben nach 10.000 Kilometern gemeinsamer Wegstrecke auseinanderfliegen, gibt es kein herzliches „Pfiat di!“, kein lässiges „Servas!“ oder ein vertröstendes „Bis nächsten Mittwoch!“ Bei uns Menschen gestaltet sich der Abschied hingegen schwierig. Dabei müsste ich schon ein Vollprofi sein, wenn man bedenkt, von wie vielen Dingen ich mich schon verabschieden musste. Von der Jugend, dem Schilling, Hunderten zweiten Socken, den Milchzähnen, dem Traum vom Stabhochsprung.