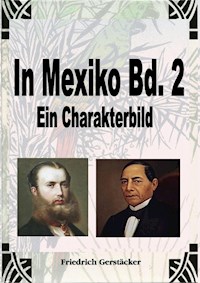
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass ein österreichischer Prinz Kaiser von Mexiko wurde, begeisterte seinerzeit ganz Europa. Man nahm großen Anteil am Schicksal des Erzherzogs Ferdinand von Österreich und seiner Frau Marie Charlotte, einer Prinzessin aus Belgien. Napoleon III. hatte Truppen nach Mexiko geschickt und vertrieb den Präsidenten Benito Juarez, setzte den Kaiser dafür ein und - prompt kam es zu neuen Aufständen. Der Klerus im Lande, der Maximilian anfänglich förderte, wandte sich gegen ihn, als er ihre Forderungen nicht erfüllte. Friedrich Gerstäcker reiste wenige Monate nach der Erschießung des unglücklichen Kaisers durch Mexiko und erhielt Berichte über die Ereignisse aus erster Hand geliefert. Eine wichtige Quelle wurde für ihn der Hoffriseur der Kaiserin, der eine Weile mit ihm zusammen reiste. Gleich nach seiner Rückkehr veröffentlichte Gerstäcker seinen Reisebericht, und 1870 als einer der ersten deutschsprachigen Romanautoren sein damals vierbändiges Werk, das zu einem beliebten Roman der Zeit wurde. Hier liegt er nun in ungekürzter und unbearbeiteter Ausgabe wieder vor, so wie vom Autor für die Werkausgabe persönlich eingerichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Schriften
Friedrich Gerstäcker
In Mexiko
Ein Charakterbild
2. Band
Volks- und Familien-Ausgabe
2. Serie Band Zehn
der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Ungekürzte Ausgabe nach der von Friedrich Gerstäcker für die Gesammelten Schriften, H. Costenoble Verlag, Jena, eingerichteten Ausgabe „letzter Hand“. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Thomas Ostwald.
Unterstützt durch die Richard-Borek-Stiftung und
die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, beide Braunschweig
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. u. Edition Corsar
Braunschweig. Geschäftsstelle Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten. © 2020
1.
A los descontentos.
In der Calle Delago, ziemlich am äußern Ende der Stadt, lag eine der vornehmeren Pulquerien, die sich eigentlich erst seit der Zeit etablirt hatte, wo eine Masse von eingeborenen ,,Generalen" die Stadt überschwemmten und dann natürlich ihre gewohnte Pulque nicht missen, aber auch nicht gern mit den gemeinen Soldaten verkehren wollten. Die fremden Officiere hielten sich selbstverständlich von dieser Menschenrasse zurück, die vollkommen der untern Schicht der Mexikaner angehörte, aber doch einen höheren Rang, eine höhere Stellung beanspruchte, und so kam es denn, daß diese Pulqueria, die ein unternehmender Mexikaner gründete, entstand und von ihm, sei es durch Ahnungsvermögen, sei es dadurch, daß er seine Landsleute schon genau kannte, a los descontentos1 „zu den Unzufriedenen" getauft wurde.
Im Anfang nahm man allerdings diese Überschrift seines Hauses für Scherz und schrieb sie der Pulque zu, mit der seine Gäste nicht zufrieden sein sollten, aber nach gar nicht /2/ so langer Zeit sammelte sich dort allerdings eine Menschenklasse, die auf den Namen der „Unzufriedenen" mit dem größten Recht Anspruch machen konnte, denn sie glaubte alle Ursache dazu zu haben.
Die Militär-Organisation war nämlich, obgleich schon lange entworfen, doch erst jetzt wirklich in Kraft getreten, und so viel sich der Kaiser davon versprach und mit Recht davon versprechen durfte, hätte er es nämlich mit einem andern Volke als den Mischlingsracen Südamerikas zu thun gehabt, so stieß er hier damit doch in ein Wespennest.
In den „Descontentos" versammelten sich jetzt allabendlich besonders alle jene höheren Officiere, hauptsächlich Generale, die in den letzten Monaten von Juarez zu den Kaiserlichen übergegangen waren. Sie hatten sich nicht allein gegenseitig nichts vorzuwerfen, sondern auch ziemlich gleiche Interessen und - die Hauptsache: gleiche Ansichten über Kriegsführung, das heißt so lange kämpfen, als es bequem ging, und dann entweder davon-, oder zum Feind überlaufen. Jetzt bedrohte sie aber Alle zugleich ein und dasselbe Schicksal, oder war schon über sie hereingebrochen, das nämlich: bei der jetzigen militärischen Eintheilung als überflüssig angesehen und zur Disposition gestellt zu werden, wobei sie natürlich, wenn auch nicht ihren Titel - denn an dem hielten sie fest - doch jedenfalls ihren Gehalt einbüßen mußten. Das war zu viel für sie und die „Undankbarkeit des Kaiserreichs" ihr stehendes Gespräch geworden.
Anfangs freilich schimpften sie wohl darüber, hielten cs aber noch immer nur für eine Art von Schreckschuß, denn sie konnten sich nicht denken, daß man wagen würde, sie ganz und ohne Weiteres bei Seite zu schieben. Es verstand sich von selbst, daß sic dafür irgend einen andern fetten Posten, wo möglich an der Steuer, bekommen mußten, und was schadete es, wenn sie davon auch nicht das Geringste verstanden. War das nicht von jeher so gewesen und solche Posten nur als Belohnungen für geleistete Dienste gegeben worden? und konnte man es nicht mit der Zeit erlernen? - Aber auch das blieb aus, und die Entrüstung unter diesen Herren wurde natürlich allgemein. /3/
Die Pulqueria war ebenfalls, wie die anderen, ausgemalt, aber mit lauter Schlachtenbildern, die man jedoch vorsichtiger Weise dem Befreiungskriege entnommen hatte, um nicht etwa Jemandes Gefühle hier zu verletzen. Nur eine einzige Wand blieb dem Sturm des Forts Guadulupe bei Puebla durch die Franzosen gewidmet, wo diese von dem General Zaragoza so entschieden zurückgeworfen wurden. Die Franzosen haßten sie Alle, ob sie nun gerade unter dem Kaiser oder unter den Liberalen dienten, und auf jene „Waffenthat" der Mexikaner setzten sie Alle ihren Stolz.
Heute gerade waren verschiedene Decrete ausgegeben worden, und viele dieser durch Revolutionen gemachten, aber sonst ganz unfähigen Generale schienen gerade diesen Tag gewissermaßen als letzten Termin erhofft zu haben, um doch am Ende noch bedacht zu werden - sie sahen sich getäuscht, und besonders Einzelne, die früher im Heere des Feindes eine gewisse Rolle gespielt, fühlten sich, ihrer Meinung nach, auf das Unverzeihlichste zurückgesetzt.
An dem einen großen Tisch, der nahe zu dem, auf die Straße hinausführenden Fenster stand, saßen etwa acht oder neun solche „höhere" Officiere, die großen Pulquegläser vor sich, die Arme auf den Tisch gestemmt, und ein Carajo nach dem andern rang sich unter den nassen Schnurrbärten vor, die nur manchmal mit den Fingern abgestrichen wurden. Ein Taschentuch führte wohl keiner der Herren bei sich. Sie befanden sich auch in einer fatalen Lage, denn gelernt hatte Keiner von ihnen etwas, um sich der menschlichen Gesellschaft nützlich zu machen. Ohne Krieg oder Revolution konnten sie nicht bestehen, sie waren es von Jugend auf so gewohnt gewesen und darin aufgewachsen, und was sollte jetzt aus ihnen werden, wo sie den Liberalen den Rücken gekehrt und von diesem fremden übermüthigen Kaiser gar nicht gebraucht, ja nicht einmal anerkannt wurden?
Da trat eine nicht sehr hohe, aber sehnige Gestalt in die Thür, mit bronzefarbenem Haar aus dessen schwarzen Bart und ebensolchem gelockten Haar, aus dessen Antlitz ein Paar funkelnde Augen hervorblitzten und mit einem gewissen Hohn über die Gäste hinzuschweifen schienen. /4/
„Hallo, Cortina - komm hierher, Compaňero - wo bist Dn so lange geblieben?" riefen sie ihm zu - „seit einer Stunde warten wir schon auf Dich."
„Nun, Caballeros," lachte der Halbindianer ingrimmig in den Bart hinein - „ich dächte, Ihre Zeit erlaubte Ihnen das, denn zu thun haben Sie nichts - Carajo! ein ganzes Nest voll ausgenommener Generale und alle schon flügge."
„Hol' Dich der Teufel!" knurrte einer derselben - „einen Rath sollst Du uns geben, was wir thun können, nicht Dich über uns lustig machen - oder bist Dn etwa besser daran?"
„Einen Rath?" rief Cortina, indem er seinen Hut hinten auf den Kopf rückte und sich auf den ihm hingeschobenen Sessel warf - „seid Ihr wirklich rathlos und gefällt es Euch nicht mehr in Mexiko? - Zum Henker auch, es wird hübsch hier, denn die Sache fängt an drunter und drüber zu gehen!"
„Ist etwas vorgefallen?" riefen Drei, Vier zugleich.
„Vorgefallen? Bah, nichts - ein halb Dutzend gehangen, was ist das, aber Seine Majestät fängt an den Krieg bis an's Messer zu führen, und wir können froh sein, daß wir hier im Trocknen sitzen."
„Den Teufel auch - wer ist gehangen?" rief es jetzt durcheinander, denn Keiner fühlte sich so ganz sicher, ob nicht ein paar Bekannte oder Freunde unter den also Abgeurtheilten sein könnten.
„Ja, was weiß ich's!" sagte Cortina achselzuckend; „Kriegsgelder wurden auf der Diligence transportirt, und ein halb Dutzend Liberaler machte sich auf, um sie abzufangen; eine französische Escorte scheint ihnen aber in die Quere gekommen zu sein, und wenn die „Nachbarn" sie nicht beerdigt haben, hängen die wackeren Burschen noch draußen in den Bäumen der Peiiuelos."
„Carajo! die Franzosen waren das?"
„Nun gewiß - heißt ja jetzt Alles Straßenräuber und wird bald noch besser werden. Bazaine soll gesagt haben, daß nächstens ein Gesetz herauskommt, wonach die ganze Armee von Juarez als Straßenräuber betrachtet und behandelt wird."
„Dann hängen sie aber auch drüben Jeden, den sie von den Kaiserlichen erwischen." /5/
„Wird bald nicht mehr Bäume genug im Walde geben, für all' die Früchte," lachte Cortina. „Jungens, jetzt wird's hübsch in Mexiko, jetzt geht eigentlich unsere Zeit an, und dabei sollten wir hier ruhig sitzen und die Hände in den Schooß legen? Verbrannt will ich werden, wenn ich's thue - ich gehe wieder nach Norden."
„Zum Alten?" riefen Mehrere zugleich.
„Quien sabe?" sagte Cortina, die Achseln zuckend - „wer weiß. wo der steckt und ob er noch viel Soldaten hat - können's auch noch eine Weile abwarten, denn gestern hört' ich, daß Bazaine selber mit einer Armee hinauf will, um ihn zu fangen oder über die Grenze zu treiben."
„Dann ist die Geschichte aus."
„Noch lange nicht - dann geht sie erst an!" rief Cortina, sein Pulqueglas dabei bis auf den Grund leerend - „nachher kommt entweder Ortega oder ein Anderer, das bleibt sich gleich - aber da oben stehen bleiben können die Franzosen nicht - es liegt zu weit ab von der Hauptstadt, und sowie sie wieder anfangen sich zurückzuziehen, dann sind wir hinterher und - I'urisima! - nicht einen Augenblick Ruhe wollen wir ihnen gönnen."
„Was ist denn daran?" frug jetzt ein Anderer. „Die Amerikaner hier in der Stadt erzählen, daß der Kaiser Napoleon nächstens alle seine Soldaten nach Hause schicken werde, weil die im Norden es nicht länger leiden wollten."
„Das wäre recht," nickte Cortina, ingrimmig vor sich hinlachend - „nachher wollten wir hier bald unter den „feinen" Officieren aufräumen. In der Luft liegt übrigens 'was, denn die Pfaffen kommen wieder an's Tageslicht, wie die Maulwürfe vor einem Gewitter - haben mir auch schon Propositionen gemacht, mag aber mit den Schwarzröcken nichts zu thun haben. So lange sie uns brauchen, sind wir gut genug, aber kaum ist's vorüber, so zahlen sie mit Messen und Segen."
„Nach Vera-Cruz zu sollen sich auch wieder Schaaren von Juaristen zusammengezogen haben - ich hörte davon in der Stadt."
„Ja," nickte Cortina, „gehört hab' ich's auch, weiß aber nicht, ob 'was dran ist. Wenn sie nur nicht den Porfirio /6/ Diaz eingesperrt hätten - bei dem wäre gleich wieder anzukommen."
„Zu dem möcht' ich aber nicht," knurrte ein kleiner gelbbrauner Bursche mit einer riesigen Narbe über das ganze Gesicht hinüber - „fauler Kram das. Der hat seine eigenen Soldaten hängen lassen, wenn sie einmal geplündert hatten - mit dem ist's nichts!"
„Und weshalbsoll man seine Haut zu Markte tragen," rief ein Anderer,der eine einzige riesige Epaulette aufder linken Schulter trug, „wenn man nicht auch wenigstens etwas dafür hat. Soll mich nur wundern, wie lange diesmal das Kaiserreich dauert - hat ja schon beinahe anderthalb Jahr bestanden - hätt's ihm gar nicht zugetraut."
„Ich gehe morgen nach Queretaro hinauf," sagte Cortina - „wer geht mit?"
„Werden aber erst um Urlaub einkommen müssen," lachte der mit der Narbe.
„Hol' sie derTeufel!" knirschte Cortina zwischenden Zähnen durch - „ich binmit meinem Urlaub fertigund wieder ein freier Mann. Hinter Queretaro brauche ich keine acht Tage Zeit, um eine Truppe tüchtiger Kerle zusammen zu bringen."
„Und wär' es da doch nicht am Ende besser, die Franzosen erst ihren Zug nach Norden machen zu lassen? Jedenfalls rücken sie gegen Chihuahua und Monterey, und wir wissen dann eher, woran wir sind."
„Rechts und links davon haben wir Platz genug," lachte Cortina, „und wenn wir uns nach Guerrero hineinwerfen sollten. Ich gehe."
„Dann, denk' ich, gehe ich auch," sagte der mit der Narbe - „und Du, Carlos?"
„Zu versäumen hab' ich hier nichts - laßt uns Alle in's Land gehen. Vor der Hand machen wir nur eine Vergnügungsreise, und sind wir erst einmal drin, so sehen wir bald selber, wie die Sachen stehen."
„Ein Wort ein Mann!" rief Cortina. „Wann brechen wir auf?"
„Nicht zusammen," warnte ein Anderer - „wir dürfen /7/ keinen Verdacht erregen, sonst sitzen uns die Bestien auf dem Nacken. Laßt uns einzeln gehen, und in Queretaro treffen wir dann zusammen."
„Auch gut, und jetzt Adios, Caballeros - auf ein fröhliches Leben wieder in den Bergen!"
*
Im Hause Don Carlos Lucido's, in den prachtvollen und behäbigen Räumen herrschte eine furchtbare Aufregung, denn die Gerichte schienen diesmal wenig Umstände mit dem gefangenen Verbrecher machen zu wollen, wenn er auch der Sohn eines der reichsten Leute in Mexiko war. Mauricio, darauf gerade trotzend, hatte eingestanden, daß er bei dem Ueberfall der Diligence betheiligt gewesen, aber natürlich nur aus politischen Motiven. Er stehe entschieden auf Seiten der Liberalen, erklärte er ganz offen, und habe das Kaiserthum noch nie anerkannt. Ihre Absicht sei allein gewesen, die beiden französischen Ofstciere gefangen zu nehmen, um sie gegen gefangene Officiere der Liberalen auswechseln zu können, aber der hartnäckige Widerstand der Franzosen, von dem er selber noch die Narbe trug, habe seine Begleiter erbittert und den Tod der Beiden zur Folge gehabt.
Seine Aussagen halfen ihm nichts. - Ricarda San Blas, wie sie es van Leuwen versprochen, trat selber als Zeugin gegen ihn auf. - Es war nichts als ein ganz gemeiner Raubanfall gewesen, gerade wie der zweite, der durch den gefundenen Brief vereitelt wurde, und man hatte die Schüsse abgefeuert, che nur der Wagen ordentlich hielt, also konnte von einer bloßen Gefangennahme der Officiere gar keine Rede sein.
Mauricio Lucido, zum Tode verurtheilt, sollte am nächsten Morgen erschossen werden, denn es war nöthig geworden, dem liederlichen jungen Volk der Stadt ein Beispiel zu geben, daß sie keine bevorzugte Klasse bildeten, sondern sich den Gesetzen und der Ordnung ebenso fügen mußten, wie alle Anderen.
Der Kaiser selber unterschrieb das Todesurtheil und war so empört über diesen Fall, daß er, wie es hieß, nicht einmal Lucido's Mutter, die ihn um Gnade für den Sohn bitten /8/ wollte, vorließ. - Umsonst hatte sie sich wenigstens an Padre Fischer gewandt, der, als der Kaiser von Cuernavaca zurückkehrte, Hofkaplan geworden. Er versprach ihr allerdings, sein Möglichstes zu thun, aber sein Weg blieb, wie er ihr später sagte, erfolglos, denn der Kaiser wolle gerade in diesem Falle, wo schon so viele Verbrecher aus den unteren Klassen hingerichtet worden waren, keine Gnade walten lassen.
Arme Mutter! Padre Fischer hatte sich wohl gehütet, zu dem Kaiser zu Deinen Gunsten zu sprechen, denn was konnte der klerikalen Partei erwünschter sein, als daß gerade die Partei, die noch zum Kaiserreich hielt, gegen dasselbe erbittert wurde. Der Kaiser mußte nach und nach einsehen lernen, daß er Niemanden mehr hatte, auf den er sich stützen konnte, a l s eben die Geistlichkeit, und dahin erst einmal gelangt, und der Sieg konnte ihr nicht ausbleiben.
Die Frauen im Hause saßen und weinten; die Dienerschaft wehklagte, und der alte Lucido ging mit auf den Rücken gelegten Händen und finster zusammengezogenen Brauen in seinem Zimmer auf und ab. Boten waren nach den verschiedensten Richtungen ausgesandt, um die Freunde zu einer Berathung einzuladen, und nach und nach trafen sie jetzt ein. Aber es war kein fröhliches Zusammensein, wie es sonst so oft in diesen Räumen stattgefunden, sondern ernst und schweigend sammelten sich die Herren, die „Großen des Reiches", wie man sie recht gut hätte nennen können, in dem luftigen Gemach. Sie drückten dem Freund still und stumm die Hand, aber Jeder scheute sich, zuerst von dem zu beginnen, was ihnen Allen doch schwer und drückend genug auf dem Herzen lag. Aber es half nichts - einmal mußte doch das Eis gebrochen werden und Romero nahm zuerst das Wort.
„Compadre2", sagte er herzlich, indem er zu Lucido ging und ihm die Hand aus die Schulter legte - „Du weißt, ich nehme an dem Jungen fast so viel Theil als Du selber, denn ich habe ihn aus der Taufe gehoben und ihn mit unter meinen Augen aufwachsen sehen." /9/
„Ich weiß es, Compadre - ich weiß es," erwiderte Lucido bewegt, und der starke Mann mußte sich Mühe geben die Thränen zurück zu zwängen, „und daß er jetzt so enden sollte!"
„Wir sind hergekommen, um das mit Dir zu berathen," sagte Romero - „noch ist es doch vielleicht möglich, einen Ausweg zu finden."
Lucido schüttelte wehmüthig mit dem Kopf. - „Wir haben Alles versucht," sagte er, „meine Frau war selbst oben beim Kaiser, ist aber gar nicht vorgelassen worden. Es ist vorbei - der Junge hat schwer gefehlt, aber so zu büßen!"
„Mauricio war in der letzten Zeit verwildert," nickte Romero seufzend, „und wir selber konnten in den so bewegten Tagen nicht so auf ihn Acht geben, wie wir es wohl gesollt. Er ist in schlechte Gesellschaft gerathen - das viele fremde leichtfertige Volk, Abenteurer, die nur nach Mexiko kamen, um hier ein Vermögen zu sammeln, und als sie das nicht so leicht fanden, zu allen möglichen Kunstgriffen ihre Zuflucht nahmen. Was aber um der heiligen Jungfrau willen, Rodriguez, konnte Ihre Nichte bewegen, in so entschieden feindlicher Weise gegen den Jungen aufzutreten? Es ist unerhört, und ohne ihr Zeugniß wäre er nie zum Tode verurtheilt worden."
„Gott weiß es," sagte Rodriguez, mit den Achseln zuckend, „das sonst so bescheiden einfache, ja schüchterne Wesen war ganz wie umgewechselt. Den ersten Tag saß sie still und stumm, und verkehrte fast mit Niemandem, als aber am Abend spät die Nachricht kam, daß der Ueberfall gegen die Räuber an den Peňuelos geglückt und Alle, mit Ausnahme eines Einzigen, der entkommen war, ihre Strafe erhalten hatten, die Patrouille selber auch, mit nicht einmal einem Verwundeten zurückkehrte, nur ein belgischer Hauptmann sollte erschossen sein, - da trat sie bleich und erregt, wie ich sie nie gesehen, vor uns hin und schwur, daß Mauricio Lucido den Tod erleiden müßte. Wir haben Alles versucht, sie von ihrem Entschluß abzubringen - umsonst, es war nicht möglich; das sonst so scheue Mädchen schien wie verwandelt, und ernst und entschlossen verfolgte sie ihre Bahn."
„Welcher Partei gehört ihr Vater an?" frug Romero.
„So viel ich weiß, den Liberalen," sagte Rodriguez, „ob-/10/gleich er zu den besten Familien von San Blas gehört. Er war aber von je ein Schwärmer, hat alle seine Indianer frei und ihnen eigenes Land gegeben, um es zu bewirthschaften, und gerieth schon deshalb mit den Klerikalen in Streit. Sonst ist er aber einer der rechtschaffensten Leute, die ich kenne, und, wie ich oft und oft von meiner Schwester gehört habe, der beste Vater und Gatte."
„Es hat so sein sollen," stöhnte Lucido - ,,und den einzigen Sohn - den einzigen Sohn!"
„Ich begreife gar nicht," sagte jetzt Bastiani, der sich ebenfalls unter den Freunden befand, „daß der Kaiser gerade diesmal so hartnäckig auf dem Todesurtheil bestehen sollte. Es ist sonst gar seine Art nicht. Wissen Sie auch gewiß, Lucido, daß er von dem Besuch Ihrer Gattin in Kenntniß gesetzt war?"
Lucido nickte still mit dem Kopf. „Sein Hofkaplan hat es selber übernommen, ihr die Audienz zu erwirken, aber schon nach kurzer Zeit kehrte er zurück und sagte: der Kaiser wolle diesmal dem Gesetz seinen vollen Lauf lassen, denn: es gäbe in Mexiko keine bevorzugte Klasse."
„Und das Alles dafür, daß gerade diese bevorzugte Klasse ihn auf den Thron gesetzt!" rief Santiago, ein Schwager Lucido's, der bedeutende Besitzungen in Puebla hatte und sich gerade auf Besuch in Mexiko befand - „ohne diese „bevorzugte Klasse" säße er noch als armer Erzherzog auf seinem Felsenschloß von Miramare, während er jetzt der Herrscher des schönsten Landes der Welt ist -"
„Und ich weiß nicht," meinte Bastiani trocken, „ob er dort nicht besser und ruhiger säße als hier, denn mein Wort zum Pfande, ich möchte nicht an seiner Stelle sein."
„Wir können ihn wieder dorthin schicken," warf ein anderer Conservativer, Doblado Santa Cruz, ein, „denn für die Interessen unserer Partei hat er, so lange er sich hier befindet, noch nichts gethan."
„Ich halte ihn für einen ehrenwerthen Mann," sagte Bastiani.
„Aber den brauchen wir hier nicht!" rief Doblado heftig aus - „wir brauchen einen tüchtigen Mann, der das /11/ Land im Zaum hält und sich auf die Leute, die seine Freunde sind, oder sich wenigstens bis jetzt als seine Freunde gezeigt haben, stützt. Was wir hier brauchten, war ein Oberhaupt, das uns unser Eigenthum garantirte, und was hat Maximilian gethan? - es im Gegentheil gerade in Frage gestellt!"
„Caramba, no," rief Bastiani - „ich dächte gerade dadurch, daß er die Gesetze der todten Hand anerkannte und den Klerikalen, die sich feste Rechnung gemacht ihn auf ihre Seite zu bekommen, so fest entgegentrat, hat er mehr gethan, als wir von ihm und seinen Antecedentien3 nach erwarten durften."
„Dann hätte er auch diese Gesetze einfach anerkennen und jetzt nicht auf eine Revision der in unruhigen Zeiten geschlossenen Käufe dringen müssen," rief Santiago. „Damals sind allerdings Unregelmäßigkeiten vorgekommen, das gebe ich zu, aber es war in der Zeit nicht anders möglich, und konnte auch, da es todte Liegenschaften betraf, Niemandem zum Schaden gereichen. - Aber nein, das soll hier Alles nach europäischem Muster und in einer alten, gestempelten Form regiert werden, und das geht nun einmal nicht in Mexiko."
„Santiago hat Recht," nickte Romero, „ich bin gewiß ein Freund des Kaisers von Anfang an gewesen, und er hat sich mir und meiner Familie auch immer freundlich gezeigt, aber diese Revision der Verkäufe war ein Zankapfel, den er nicht in das Lager der Feinde, sondern in das seiner treuesten Freunde und Anhänger warf, und das nur den Advocaten nützen wird. Ich selber befinde mich mit all' meinen neuen Liegenschaften in der Stadt schon in einen höchst unangenehmen Proceß verwickelt, und wenn wir unsers Eigenthums nicht einmal gesichert sein sollen, so sehe ich eigentlich gar nicht ein, weshalb wir es nicht eben so gut der Kirche zurückgeben könnten. Dadurch bekämen wir wenigstens Frieden im eigenen Hans und mit unseren Familien."
„Der Kaiser ist ein Fremder," sagte finster Doblado, „und wird ewig ein Fremder bei uns bleiben, denn er versteht uns nicht. Vermitteln will er in einem fort, keinem Menschen Unrecht thun und sich Alle zu Freunden machen, und dadurch erwirkt er sich gerade das Gegentheil. Wer hier in Mexiko /12/ regieren will, der muß einer bestimmten Partei angehören und diese so mächtig zu machen suchen, daß sie allen anderen die Spitze bieten kann, sonst wird aus der ganzen Sache nichts und er setzt sich eben, wie das Sprüchwort sagt, sehr einfach zwischen ein paar Stühle hinein. Ja er thut gerade das Gegentheil - vom Papst erbittet er sich einen Nuntius und schickt eine Gesandtschaft nach Rom, wirft aber in derselben Zeit alle Verordnungen und Befehle des heiligen Vaters über den Haufen, - Juarez treibt er mit den Liberalen aus dem Lande, und bildet, während er das thut, sein ganzes Ministerium fast aus lauter Liberalen, - die Conservativen streichelt er mit der Hand durch Anerkennung der Reformgesetze, und zu gleicher Zeit stellt er durch die Revisionen ihr Besitzthum in Frage, giebt dabei die Indianer frei, oder entbindet sie vielmehr ihrer eingegangenen Verpflichtungen und erkennt selber unsere gesellschaftlichen Vorrechte nicht mehr an. Von wem verlangt er jetzt, daß sie zu ihm stehen sollen? welche Partei hat er wirklich für sich gewonnen? Das Volk? - das ist eine gedankenlose Masse, die kaum den Begriff eines wirklichen Kaisers kennt und die wir heute, die Klerikalen morgen für sich verwenden können, und was darf er von den Indianern hoffen? Nein, er mag ein ganz guter Mann sein, aber er spielt ein gefährliches Spiel, oder tappt blindlings in sein Unglück hinein, und findet sich einmal wieder eines schönen Tages auf der Rückreise nach seinem Felsenschloß. Unsere Parteien aber hier in Mexiko zu verschmelzen und eine einzige daraus zu machen, das bringt er nicht fertig, und - brächte kein Gott zu Wege."
„Mein Sohn! mein Sohn!" stöhnte Lucido, der sich auf einen Stuhl niedergelassen, und die krampfhaft gefalteten Hände dabei zwischen den Knieen hielt. Was kümmerte ihn jetzt die Politik des Landes, was Gewinn oder Verlust - was Kaiser und Reich - er jammerte um sein Kind, und Romero, der eine Zeit lang sinnend am Fenster gestanden und hinaus auf die Straße gesehen hatte, drehte sich endlich um und sagte:
„Es giebt nur noch einen Weg, um Mauricio zu retten, und das ist die Flucht. Vorhin sprach ich mit Deverreux über den /13/ Fall, der aber meint, daß Bazaine fest entschlossen sei, ihn erschießen zu lassen, um die beiden französischen Officiere zu rächen, und der ist nicht der Mann, der so leicht von einem einmal gefaßten Entschluß abzubringen wäre."
„Aber wie entfliehen? - wie ist es möglich?" rief Lucido, sich an diese letzte Hoffnung klammernd - „wenn es mit Geld abzumachen wäre, oh wie gern wollte ich das geben!"
„Ich glaube fast, es ist möglich," nickte Romero, „aber nicht mit einer kleinen Summe, denn der Gefängnißwärter muß mit ihm entfliehen und thut das nicht, wenn er nicht seine Zukunft gesichert bekommt."
„Und wie viel glaubst Du, daß er verlangen wird?"
„Ich denke, er wird mit fünftausend Pesos zufrieden sein."
„Gieb ihm das - gieb ihm mehr!" rief der Vater mit leuchtenden Blicken, „aber mach' mir den Sohn frei, und ich will es Dir auf meinen Knieen danken."
„Ja ich selber kann es nicht; dazu brauchen wir einen Pfaffen," nickte nachdenkend Romero, „aber ich glaube, ich kenne den richtigen Mann. Der höhere Klerus wird darüber jubeln, wenn der Kaiser unserer Partei durch solch ein Urtheil gewissermaßen einen Schlag versetzt, aber die niedere Geistlichkeit hat kein Interesse dabei, wird überhaupt von den Kirchenfürsten schlecht behandelt, und ist deshalb leicht zu gewinnen. Ueberlaß das mir - ich suche ihn augenblicklich auf, und wenn es noch möglich ist es durchzuführen, so bringt der es fertig."
„Und wer ist der?" frug Santiago - „kenne ich ihn?"
„Padre Sorra. Er gehört zu einem jener Convente, die allein auf ihren Privatverdienst, auf Messelesen und andere kirchliche Functionen, wie auch Sammlungen bei Festen angewiesen sind und schon dadurch dem überreichen Klerus neidisch entgegenstehen. Mit Geld ist bei denen Alles zu machen, und wenn ein zu einem solchen Zweck geeigneter Mensch existirt, so ist es mein Padre. - Aber gieb Dich deshalb noch nicht zu großer Hoffnung hin, Carlos. - Die uns gegönnte Zeit ist fast zu kurz. Vor allen Dingen werd' ich mit Sorra selber sprechen, und dann müssen wir Mauricio veranlassen, /14/ daß er einen Geistlichen verlangt, nach welchem er außerdem, wie ich fürchte, kein großes Bedürfniß spüren wird."
„Er hat sich von Gott und seinem ehrlichen Namen abgewandt," klagte Carlos Lucido - „oh, mein Sohn - mein Sohn - er wird elend zu Grunde gehen!"
„Veremos," sagte Romcro ruhig - „aber weiß Einer von Ihnen noch ein anderes Mittel, dem unglücklichen jungen Mann zu helfen?"
„Ich fürchte nein," sagte Rodriguez - „ich bin mit Bazaine, der durch seine Heirath ja auch mit mir verwandt wurde, ziemlich genau bekannt und war heute Morgen bei ihm, aber umsonst. Von der Seite ist nichts zu hoffen, und wenn der Kaiser selber Gnade versagt hat, so bleibt allerdings nichts übrig als Flucht - wenn er überhaupt noch zu retten ist."
„Gut, Caballeros," nickte Romero, „dann werde ich an meine Mission gehen, und morgen früh, compadre, sage ich Dir Antwort, ob ich Hoffnung habe. Den Kopf hoch, Mann, noch lebt Mauricio und es ist nicht Alles verloren!"
*
Zu dem Justizminister Escudero trat Marschall Bazaine in das Gemach und schien heute in ungewöhnlicher Aufregung.
Escudero, der feine, höfliche Mexikaner, empfing den Oberbefehlshaber der französischen „Hülfstruppen" auf das Artigste, aber der Franzose schien eben nicht in der Stimmung, langweilige Formen zu beobachten, und sich in einen der nächsten Stühle werfend, sagte er:
„Seňpr, das geht nicht länger so fort - wir müssen energisch gegen das Gesindel auftreten, oder wir erreichen nichts, als daß wir ein jedes Jahr von vorn den nämlichen Feldzug beginnen, wie wir ihn im vorigen hatten."
„Ich weiß nicht, was der Herr Marschall meinen," sagte Escudero freundlich, „aber ich sollte denken, Ihre Truppen wären energisch genug vorgegangen. Die letzten Nachrichten lauten außerordentlich günstig." /15/
„Der Teufel dank' es ihnen!" brummte Bazaine. „Sic wundern sich doch wohl nicht, daß unsere französischen Regimenter das mexikanische Gesindel werfen, wo sie mit ihm zusammentreffen, - aber was hilft das? Wir treiben sie aus jedem Platz hinaus, den wir angreifen, aber wir müßten eine halbe Million Soldaten hier haben, um jeden Hanptplatz nur befestigt zu halten. Sobald wir uns zurückziehen, rücken diese Raubbanden, die sich Soldaten des Präsidenten Juarez nennen, wieder vor, und das ist ein Spiel, das Menschen, die von trockenen Tortillas leben, wohl aushalten und eine unbestimmte Anzahl von Jahren fortsetzen können, an denen wir aber zuletzt mit dem Kaiserreich zu Grunde gehen."
„Aber so weit die Berichte reichen, die wir erhalten haben," sagte der Minister, „sind doch sämmtliche Kriegsoperationen auf das Glücklichste gelungen, und die heutige Nachricht bestätigt sogar, was schon vor ein paar Tagen gemeldet wurde, daß nämlich Juarez endlich nach dem Norden hinauf - man vermuthet sogar, über die Grenze getrieben sei. Die Liberalen behaupteten allerdings, er habe sich in Paso del Norte, einem kleinen erbärmlichen Grenzflccken, festgesetzt, aber das ist nicht wahrscheinlich, denn was wollte er dort? Ich kenne den Platz genau, er könnte sich dort kaum mit fünfzig Anhängern für kurze Zeit vielleicht am Leben erhalten."
„Und das ist es gerade, was ich Ihnen sagen wollte," rief Bazaine. - „Juarez ist jetzt thatsächlich über die Grenze getrieben und die Revolution vorbei - und, wenn er es nicht wäre, sein Präsidentschafts-Termin überhaupt in wenigen Wochen abgelaufen. Alle die, welche uns nach dieser Zeit mit den Waffen in der Hand gegenüberstehen, sind nichts als gemeine Straßenräuber - Banden, die herumziehen, einzig zu dem Zweck, Feind und Freund auszuplündern, und dem muß ein Ende gemacht werden, oder ich selber bitte Seine Majestät den Kaiser Napoleon, mich von hier abzuberufen. Ich bin mit Freuden willens, mich jedem geordneten Heer oder jeder berechtigten Macht entgegen zu stellen; ich erkenne selbst einzelne Guerillabanden an, sowie sie von einem bestimmten Oberhaupt dirigirt werden und irgend etwas - und wenn es selbst nur eine Idee wäre, verfechten, aber ich bin /16/ kein Polizei-Officiant, der genöthigt werden kann, sich das ganze Jahr mit Verbrechern herumzuschlagen, und dem man dann nicht einmal die Macht einräumt, die Schuldigen, wenn er sie wirklich gefaßt hat, zu züchtigen."
„Ich verstehe Sie nicht, Herr Marschall."
„Dann will ich ganz deutlich reden," sagte Bazaine. - „Der Kaiser muß, wenn er meine Unterstützung seiner Macht auch nur noch so viel für nöthig hält, ein Decret erlassen, das die jetzt noch umherstreifenden Banden für vogelfrei erklärt - Räuber und Mordbrenner, die es außerdem nur sind. Der eigentliche Krieg ist beendet und der Expräsident über die Grenze gejagt, wir haben es von diesem Augenblick an also mit keiner Kriegsmacht mehr zu thun, sondern allein mit übriggebliebenen und zurückgelassenen Banditen, die wir bei Gott nicht, wenn wir sie erwischen, als Kriegsgefangene behandeln können. Wir erklären den Krieg für beendet, denn wir haben ein volles Recht dazu, und wer von da ab mit den Waffen in der Hand gefangen wird, soll als gewöhnlicher Bandit behandelt, das heißt erschossen oder gehangen werden, wie es der Fall gerade mit sich bringt."
„Herr Marschall," sagte Escudero, „das ist ein Capitel, was wir schon verschiedene Male mit Seiner Majestät, aber ohne Erfolg verhandelt haben. Der Kaiser weigert sich auf das Entschiedenste, zu derartigen Maßregeln zu greifen, so lange Juarez auch nur einen Schatten von Recht auf seiner Seite hat. Er hofft immer noch durch strenge Gerechtigkeit den Feind zu überzeugen, daß er es mit keinem Eroberer, sondern mit einem Monarchen zu thun habe, der wirklich nur das Beste des Landes will und den Frieden desselben anstrebt. Und haben wir denn nicht auch in den zahlreichen Loyalitätserklärungen, die ihm in den letzten Wochen fast von allen nordischen Städten zugegangen sind, die Beweise, daß ihm die Mehrzahl, selbst der Liberalen zuneigt? Den Leuten dort mußte sich zuletzt die Ueberzeugung aufdrängen, daß Juarez nicht der Mann war, gegen einen Maximilian aufzutreten, und nicht allein Officiere der Liberalen, nein, zahlreiche Präfecten haben ebenfalls an uns geschrieben, ihren völligen Uebertritt zum Kaiserthum erklärt und uns selber gebeten, Truppen /17/ in ihre Ortschaften zu legen, um herumschwärmenden Banden der Liberalen die Spitze bieten zu können."
„Und da haben Sie den ewigen Refrain vom Lied!" brach Bazaine, der bis jetzt ungeduldig den Boden mit dem Fuß geklopft hatte, aus - „Truppen wollen sie haben, weil sie wissen, daß wir uns selbst beköstigen und für Alles, was wir brauchen, baar bezahlen - Truppen, nur um nicht selber in die Verlegenheit kommen zu müssen, ihr Eigenthum zu vertheidigen. Wir kosten sie nichts, sondern bringen ihnen noch Geld, aber kaum haben wir den Rücken gewandt und ein Juarez'sches Streifcorps rückt in den Ort ein, so jubeln sie dem auch wieder entgegen und erklären sich als die besten und treuesten Republikaner. Nicht eine Centime gebe ich Ihnen für all' die Loyalitätsadressen solcher Menschen, denn wie der Wind weht, so drehen sie sich, und das nämliche Concept, das sie heute in Abschrift an den Kaiser eingesandt haben, dient ihnen vielleicht acht Tage später, mit ein paar veränderten Worten, um es einem der liberalen Banden-Generale zu Füßen zu legen. Gehen Sie mir mit Ihren Adressen; ich halte mich an die wahre und nackte Wirklichkeit, an die Menschen, wie ich sie in den Jahren gefunden habe und wie sie sind, und demnach gebe ich Ihnen mein Wort, daß Sie sich auch nicht eine Stunde auf solche Versicherungen verlassen können. Nein, gespielt haben wir genug mit ihnen und jedem menschlichen Völkerrechte Genüge geleistet, das weiß Gott. Jetzt wird es Zeit, daß wir ihnen die Zähne zeigen, und i c h erkläre Ihnen hiermit, Seňor, daß ich in demselben Moment um meine Abberufung einkomme und meine Soldaten von dem sogenannten „Kriegsschauplatze" zurückziehe, wo mir der Kaiser jetzt noch, nach zahllosen Mahnungen, erklärt, daß er von seiner passiven Politik nicht abstehen will. Erläßt er ein Decret und giebt er mir die Vollmacht es auszuführen, dann stehe ich Ihnen dafür ein, daß ich Ihnen das ganze Land nicht allein erobere - denn das ist jetzt schon geschehen, - nein daß ich es auch unterwerfe und in Besitz halte, bis er seine eigene Armee (was, beiläufig gesagt, etwas lange dauert) auf den Füßen hat; erläßt er es aber nicht, dann mag er sich nuch die Folgen zuschreiben und mir nachher keine Vorwürfe /18/ machen, denn von dem Augenblick an trete ich zurück, und er mag das Kommando übergeben, wem er will. Mich bannt hier nicht allein der Befehl meines Kaisers, nein, auch meine eigene Ehre, und wahrlich, die will ich nicht dadurch auf's Spiel setzen, daß ich weiter nichts thue als Kriegsgefangene machen, sie höflich und mit jeder Rücksicht durch das Land cscortire und abliefere, und dann acht oder vierzehn Tage später den nämlichen Schuften wieder gegenüberstehe, die, à la caballero, auf Ehrenwort entlassen wurden und nicht einmal wissen oder beachten, was das zu bedeuten hat. Ich habe, das gestehe ich Ihnen aufrichtig, diese Art von Kriegführung bis zum Ueberdruß satt, und mit meinen Officieren ist das ebenso der Fall. Wir sind gewillt, unser Leben jeden Tag für den Kaiser in die Schanze zu schlagen - das ist unser Beruf - aber wir müssen auch dabei sehen, daß wir etwas erreichen. Mit den Danaiden wollen wir nicht schöpfen oder einen Sispphusstein den Berg hinaufrollen."
„Und wäre es nicht besser, Herr Marschall, daß Sie das Seiner Majestät in einer Denkschrift oder nur in einem Brief auseinandersetzten?" frug der Minister.
„Wozu die ewige Schreiberei?" sagte Bazaine barsch - „ich habe, seitdem ich in Mexiko bin, mehr Briefe geschrieben als früher in meinem ganzen Leben, und es jetzt satt bekommen. Sie sind der Hauptrathgeber des Kaisers und er hält viel auf Sie - in Ihren Verwaltungszweig fällt auch die ganze Angelegenheit, denn wir haben es jetzt nicht mehr mit Soldaten, sondern nur mit Räuberbanden zu thun, die den öffentlichen Frieden des Staates und die Sicherheit seiner Bewohner stören, und gegen diese müssen strenge - müssen die äußersten Maßregeln ergriffen werden, wenn wir irgend etwas erreichen wollen. Setzen Sie in Ihrem Ministerium ein solches Gesetz auf - ich bin gern bereit, es mit Ihnen privatim durchzuberathen - und ich stehe Ihnen nachher für den Erfolg."
„Und weshalb erlassen Sie nicht selber eine solche Ordre an Ihre Truppenkörper?" frug Escudero.
Bazaine zog seine Brauen finster zusammen. „Ich glaube," sagte er, „ich habe mit Ihnen oder Ramirez das nämliche /19/ Thema schon einmal verhandelt - aber die Antwort ist einfach genug: Ich habe zu befehlen, wo ich einem wirklichen Feind gegenüberstehe, und kenne die Kriegsgesetze civilisirter Völker gut genug, um Niemandes Rath oder Unterstützung zu verlangen. Hier aber hat der Krieg aufgehört - die Soldaten können nur noch zum Schutz der „Gensdarmen" dienen, und wo es Gesetze über die Unterthanen des Kaisers giebt, da steht mir, als französischem Feldherrn, keine Macht und keine Gewalt zu - und ich habe auch kein Interesse dabei," setzte er, kurz abbrechend, hinzu. „Will sich der Kaiser all' diese Räuberbanden conserviren und groß ziehen – eh bien - dann ist das seine Sache; dann kann und darf er aber auch keinen französischen Marschall dazu verwenden wollen, sie ihm einzufangen, und mein Dienst hier in Mexiko ist aus. - Leben Sie wohl, Seňor, das Thema ist jetzt genügend durchgesprochen, und verlangt der Kaiser mich in der Sache zu sprechen, so bin ich auch dazu erbötig, ihm meine Forderung noch einmal persönlich vorzutragen. - Doch ich muß fort, Seňor, und hoffe nur, daß Sie mir recht bald eine günstige Nachricht darüber mittheilen können."
Damit stand er auf, grüßte kurz und militärisch, und verließ ohne weiteren Aufenthalt Escudero's Haus.
2.
Der Flüchtige.
Der zur Hinrichtung Mauricio's bestimmte Morgen brach an, aber in dem Gefängniß selber herrschte die größte Verwirrung und Alles lief durcheinander. - Soldaten hatten sämmtliche Ausgänge um das Drei- und Vierfache wie gewöhnlich besetzt, und ein französischer Obrist wetterte in dem /20/ Raum auf französisch und spanisch umher - der Gefangene war entflohen.
Allerdings ging das Gerücht, er sei einer Patrouille begegnet, und diese jetzt unmittelbar auf seinen Fersen, so daß man hoffen dürfe ihn wieder zu bekommen, aber die Sache an und für sich blieb dieselbe, denn der Gefängnißwärter hatte sich mit ihm aus dem Staube gemacht, und der Franzose jetzt nicht einmal jemand Bestimmtes, an den er sich mit seinem Grimm wenden konnte. Es blieb ihm nichts übrig, als die ganze mexikanische Nation in Grund und Boden hinein zu verdammen und zu verfluchen - und das that er redlich.
Reiter sprengten jetzt durch die Straßen nach allen Richtungen hin - Patrouillen wurden ausgesandt, um sämmtliche Wege dicht um Mexiko, wo ein Ausweichen nicht gut möglich war, fest zu überwachen, und strenger Befehl gegeben, den Flüchtigen, wie es sei, todt oder lebendig wieder abzuliefern, während zu gleicher Zeit Lucido's Haus von einer Abtheilung Polizei bis in die letzten Räume durchsucht und, als man dort nichts fand, ein Doppelposten vor die Thür gestellt wurde, der strengen Befehl hatte, Niemanden weder aus noch ein zu lassen.
Seňor Lucido, über diese Beschränkung seiner Freiheit entrüstet, wollte dagegen protestiren, wurde aber mit der größten Strenge abgewiesen, und der Officier sagte es ihm auf den Kopf zu, daß nur er allein den Wächter mit Geld bestochen habe, um den Sohn zu retten - und wer hätte es dem Vater verdenken können!
Bazaine war außer sich, denn gerade die Conservativen, obgleich er eine Tochter aus ihrer Mitte zum Weib genommen, hatten ihn trotzdem in der letzten Zeit nur zu deutlich fühlen lassen, daß ihnen der französische Uebermnth doch mit der Zeit lästig wurde. Sie sprachen es offen aus, daß sie die französische Regierung zu Ende wünschten, und zogen sich mehr und mehr von den Franzosen zurück. - Und wie würden sie jetzt im Stillen jubeln, daß sie den lästigen Gästen eine schon sicher geglaubte Beute entrissen hatten!
Und doch schien ihr Triumph noch keineswegs gesichert, denn wenn es auch Mauricio gelungen war, aus dem Ge-/21/fängniß selber zu entkommen, so sah er sich dadurch doch noch immer nicht gerettet, denn ein ganz eigenthümlicher und unglücklicher Zufall brachte nämlich die Verfolger, ohne zu ahnen wer er wirklich sei, noch in den Straßen der Stadt auf seine Fährte.
Dicht vor dem Gefängniß hatte er sich von seinem Retter getrennt, weil er überzeugt war, seine Flucht allein viel ungefährdeter fortsetzen zu können. In den Straßen von Mexiko gab es allerdings sogenannte serenos oder Nachtwächter, die in unruhigen Zeiten auch wohl Vorbeipassirende anriefen, sie aber nie anhielten, und da noch Niemand um seine Flucht wissen konnte, war auch eine Entdeckung nicht zu fürchten. Er brauchte nur langsam seinen Weg zu verfolgen, um sich, erst einmal aus der Stadt, in die Berge zuwenden; ja er wußte selbst in den kleinen benachbarten Ortschaften überall Bekannte, die nie daran gedacht hätten, ihn an die Franzosen auszuliefern.
Unglücklicher Weise für ihn war aber gerade in dieser Nacht und in einer kleineren Straße, die hinter der Kirche San Augustin hin und mit der Straße Plateros parallel lief, ein Ermordeter von den Serenos gefunden worden - und derartige Fälle kamen allerdings nicht etwa selten vor.
Das aber brachte die Leute auf die Füße, denn man hoffte den Mörder noch unterwegs zu finden, und Patrouillen waren requirirt worden, um sie zu unterstützen. Da, als Mauricio gerade in die Straße einbog, kam diese Patrouille um die andere Ecke und rief ihn an, und davon erschreckt, trieb ihn sein böses Gewissen, sein Heil in der Flucht zu suchen.
Glücklich für ihn dämmerte gerade der Tag, und Indianer wie Milchverkäufer waren schon in die Stadt gekommen. Ein solcher Milchkarren hielt auch gerade vor dem Hause des Hof- friseurs Don Gaspard, und die Soldaten, denen schon der Befehl geworden, auf den Flüchtigen zu feuern, drückten nicht ab, weil sie dann bestimmt den armen unschuldigen Händler mit getroffen hätten. Außerdem konnte ihnen der Flüchtige auch gar nicht entgehen, denn unten von der Kirche herauf kamen ebenfalls Serenos, und ein in die Luft gefeuerter Schuß gab denen das Zeichen, bei der Hand zu sein, während sie /22/ jetzt zusprangen, um den zu verhaften, der sich ihnen nicht hatte stellen wollen.
Hinter dem Milchkarren kam er aber nicht wieder vor, und als sie diesen jetzt in vollem Ansturm umzingelten, erklärte der bestürzte Indianer, ein Mann sei allerdings hier eben in das Haus hineingesprungen und habe die Thür hinter sich zugeschlagen, das Hausmädchen aber nicht zurückgekehrt, um die Milch abzuholen, und er wisse nichts weiter. Da drin mußte er noch stecken.
Dort drinnen also, und die Patrouille machte auch gar keine Umstände, sich den Eingang zu erzwingen. Mit den Kolben donnerten sie gegen die von innen verschlossene Thür an, daß das ganze Haus davon erzitterte, und es dauerte auch gar nicht lange, so öffnete sich oben ein Fenster und Don Pedro selber, aus festem Schlaf aufgestört, eine weiße Nachtmütze über sein schwarzgelocktes Haar gebunden, auf die er in der Eile vergessen hatte, sah heraus und frug, was es in's Himmels Namen gäbe.
„Abra! policia!" (öffne, Polizei) war aber das Einzige, was ihm erwidert wurde, und daß sich die Leute da unten nicht auf eine Unterhandlung einlassen würden, bewiesen sie schon durch die unausgesetzten und ihre Ungeduld kennzeichnenden Kolbenstöße. Wenn er aber wirklich nicht gleich öffnete, wußte er gewiß, daß sie ihm die Thür einschlagen würden, womit sie außerdem schon beschäftigt schienen, und mit dem reinsten Gewissen von der Welt flog er mehr als er ging die Treppe hinab, um die Störenfriede einzulassen. Es war einmal kaiserliche Polizei, und der konnte er sich gerade als Hoffriseur nicht widersetzen.
Wenige Minuten später schob er den Riegel zurück und wollte aufschließen - aber es war schon aufgeschlossen, und die Patrouille drang, während natürlich der Ausgang scharf bewacht blieb, in das Haus hinein.
Daß nun der kleine Spanier nichts von dem Flüchtling wissen konnte, davon waren die Soldaten selber überzeugt, denn dieser hatte jedenfalls nur das erste beste offene Haus benutzt, um augenblicklichen Schutz darin zu finden. Der /23/ junge Officier, der die Patrouille führte, sagte deshalb auch nur ganz kurz:
„Seňor, eben hat sich ein Verbrecher in Ihr Haus geflüchtet."
„In mein Haus?" rief Don Pedro bestürzt, „aber wie ist das möglich, es war ja von innen zugeriegelt!“
„Das Haus stand gerade offen, weil das Mädchen Milch holte - er wird selber wieder zugeriegelt haben. Wir müssen Ihre Wohnung von oben bis unten durchsuchen."
„Alle Zimmer?" frug Don Pedro, der an seine noch nicht angekleidete Frau dachte.
„Alle, das heißt bis wir den Burschen haben - entgehen kann er uns nicht, Ihre Azotea4 ist doch zugeschlossen?"^
„Sicherlich und verriegelt dazu. Dahinaus kann er nicht, wenn er nicht weiß, wo der Schlüssel hängt."
„Nehmen Sie den Schlüssel gleich an sich, damit wir vollkommen sicher sind."
„Aber er hängt in meinem Schlafzimmer."
„Gut, dann fassen wir ihn auch. Hat Ihr Haus noch einen Ausgang nach hinten?"
„Nein - wir sind vollkommen abgeschlossen."
„Desto besser, und nun en avant! Jedes Zimmer, was durchsucht ist, wird fest verschlossen und der Schlüssel abgezogen."
„Das wird nachher eine schöne Konfusion mit den Schlüsseln geben," dachte Don Pedro, hütete sich aber wohl etwas zu sagen und äußerte nur - „bitte, Herr Hauptmann oder Obrist - entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Rang nicht kenne - das ganze Haus steht zu Ihrer Disposition - Seine Majestät der Kaiser hat keinen treueren Freund in Mexiko als mich."
„Sehr schön, monsieur," nickte der Officier, ohne von den Worten weiter Notiz zu nehmen, denn ein Theil der Soldaten stürmte schon die Treppe hinauf, während sich die anderen unten vertheilten, um ihre Nachforschungen gleich dort zu beginnen. /24/
Don Pedro eilte jetzt, so rasch er konnte, zu dem Schlafzimmer seiner Frau hinauf, um sie aufzufordern sich rasch anzuziehen, denn dem Besuch entging sie nicht - aber er fand die Thür von innen verriegelt und rief durch's Schlüsselloch:
„Oeffne, Cornelia - wir müssen uns rasch ankleiden - das Haus wird durchsucht - es hat sich ein Verbrecher hereingeflüchtet !"
Keine Antwort. Er legte sein Ohr an die Thür und glaubte, daß er Jemand flüstern höre. War das Mädchen darin? „Cornelia!" rief er nochmals - „öffne, liebes Kind - sie werden gleich auch zu Dir kommen, und wenn Du dann nicht aufmachst, schlagen sie die Thür ein - wahrhaftig, sie thun es!"
Wieder das Flüstern - aber weshalb antwortete seine Frau nicht?
„Zwei Mann auf die Azotea!" dröhnte da die Stimme des Officiers durch das Haus, und dieser wandte sich jetzt an den noch immer an seiner eigenen Thür Pochenden, um zu erfahren, wo der Aufgang dazu sei.
„Ja, ich will ja eben hinein," sagte der unglückliche Mann - „aber meine Frau zieht sich gerade an und macht nicht auf."
„Und führt keine andere Thür auf die Azotea, als durch Ihr Schlafzimmer?"
„Doch - diese hier gleich nebenan - aber die ist von innen doppelt verriegelt."
„Ersuchen Sie die Seňora, augenblicklich zu öffnen," rief der Officier - „es sollte mir leid thun, Gewalt brauchen zu müssen, aber ich habe meine Pflicht zu erfüllen."
„Cornelia – Herz - mach' auf!" bat ihr Gatte; „Du mußt aufmachen - die Polizei,der Kaiser verlangen es!"
Keine Antwort – es war, als ob da innen eine Thür ginge und wieder geschlossenwürde, aber weiter kein Laut, und jetzt wurde der Officier selber mißtrauisch.
„Abra la puerta!" rief er seinen Soldaten zu, und er brauchte keinen zweiten Befehl zu geben. Der erste Kolbenstoß, den der Soldat - ein breitschulteriger Bursche – gegen /25/ das Schloß that, sprengte die Thür auseinander, als ob sie von Glas gewesen wäre, und mit einem Aufschrei flüchtete Donna Cornelia, die unfern davon stand, in die entfernteste Ecke des Gemachs. Ein Blick umher überzeugte die Leute nun allerdings, daß sich Niemand weiter im Gemach selber befand, aber mögliche Verstecke gab es doch genug, die alle durchforscht werden mußten..
„Wo ist die Thür zur Azotea?" frug der Officier, ohne bis jetzt von der Dame die geringste Notiz zu nehmen.
„Durch diese Kammer hier, Seňor - es ist mein Ankleidezimmer - und dann über den kleinen Vorplatz," rief Don Pedro.
„Die Thüren sind auf -"
„Wohl der Kühle wegen aufgelassen Seňor," sagte Don Pedro, aber doch selber etwas erstannt, wenn er sich auch davon nichts merken ließ, denn vorher waren sic fest verschlossen gewesen, und was konnte seine Frau dort zu thun haben? Hatte sie sich vielleicht vor dem Lärm verstecken wollen? Der junge Officier aber, den blanken Degen in der Faust, schritt rasch hindurch, hatte aber kaum den sogenannten Vorsaal betreten, dessen Thür ebenfalls weit aufstand und von dem aus eine, aber wie Don Pedro versichert, doppelt verriegelte Pforte nach dem Entrée führte, als er seinen Leuten zurief: „Hierher, Kameraden - die Thür der Azotea ist geöffnet - der Vogel ist da hinaus; besetzt das Schlafzimmer - Keiner hinaus - und sechs von Euch hier hinauf!"
Wie ein Wetter stürmte er die etwas steile Stiege hinan und erreichte gleich darauf das offene flache Dach, das aber mit den übrigen Dächern so weit in Verbindung stand, daß sich ein Mensch leicht von einem zum andern schwingen konnte. Rasch sprang er dort auf eine der angebrachten Bänke, um einen besseren Ueberblick nach allen Richtungen hin gewinnen zu können, aber vergebens - nirgends ließ sich ein lebendes Wesen mehr erkennen - der obere Theil der Häuser, so weit er ihn von hier aus übersehen konnte, lag leer und öde, und wenn der Flüchtige hier hinausgestiegen, so hatte er auch einen Schlupfwinkel gefunden, um sich zu verstecken - und nach welcher Richtung sollte man ihn von hier aus verfolgen? /26/
Der Officier that das Einzige, was erunter diesen Umständen thun konnte, er ließ zweiMann Wacheoben und einen dritten an der Treppe, um augenblicklich den Alarm zu geben, wenn Jene etwas Verdächtiges bemerken sollten. Danach beendete er seine Untersuchung des ganzenHausesvon oben bis unten, ohne jedoch das Geringste zufinden,und das konnte natürlich seine Laune nicht verbessern. Er mußte seine Soldaten wieder abrufen - nur die Wachen auf der Azotea sollten noch bleiben, denn es war ja doch möglich, daß sich der Flüchtige wieder hervorwagte; ehe er aber Don Pedro's Haus verließ, sagte er mit strenger Miene zu dem kleinen Spanier, der aber so zerstreut schien, daß er die Worte kaum vernahm:
„Seňor, die Sache mit der Azotea ist sehr verdächtig," - (Don Pedro gab ihm darin in seinem Herzen Recht) ich fürchte, Ihre Frau Gemahlin hat sich verleiten lassen, einem Verbrecher zur Flucht zu verhelfen - ich werde jedenfalls die Anzeige meines Verdachts machen müssen und Sie haben das Weitere darüber zu gewärtigen."
,,Sehr schön," sagte Don Pedro - mit seinen Gedanken ganz wo anders, und der Boden brannte ihm unter den Füßen, daß nur das Militär erst das Haus verließe, denn er verlangte mit seiner Frau eine Privatbesprechung.
„Den Soldaten auf der Azotea," fuhr dann der Officier fort - „werden Sie nachher ein Frühstück besorgen, das sie einzeln einzunehmen haben, um ihren Posten nicht zu versäumen.- Vorwärts, marsch! - wir können hier vor der Hand nichts mehr nützen." Damit marschirte er mit seinen „Leuten" wieder auf die Straße hinaus, wo sich eine Menge Volk gesammelt hatte, um zu sehen, was es da gäbe, ließ sie dann in Reih' und Glied treten, und kehrte auf die Hauptwache zurück, um dort Bericht abzustatten.
Kaum war er fort, als Don Pedro in das Zimmer seiner Frau trat, dort mit einer furchtbaren Ruhe aus einer Schieblade seinen Revolver nahm, und dann mit finsteren Blicken auf dre Gattin zuging.
„Cornelia Weib! Wer war der Mann, mit dem Du /27/ hier geflüstert und dem Du dann den Schlüssel zur Azotea gegeben?“
Die Frau zögerte einen Moment mit der Antwort, ohne jedoch im Geringsten Furcht zu zeigen, denn sie wußte recht gut daß der Revolver gar nicht geladen war - überlegte sie erst' ob sie leugnen oder eingestehen sollte? - aber es dauerte nicht lange. Verächtlich die Lippen auswerfend, sagte sie: „Machen Sie sich nicht lächerlich, Don Pedro; was weiß ich, wer der Mann war. - Als das Mädchen, die Susa, unten auf der Straße die Milch nehmen wollte, sprang er an ihr vorüber in's Haus und die Treppe hinauf, und ehe ich nur schreien konnte, stand er mit einer großen Pistole vor mir und verlangte den Schlüssel zum Dach. Erst glaubte ich, es wäre ein Räuber und er wolle meinen Schmuck, als er aber nur den Schlüssel verlangte, gab ich ihn mit Vergnügen hin. Sollte ich mich des Schlüssels wegen todtschießen lassen? Dir wäre es am Ende recht gewesen."
„Und woher kannte der Fremde in solcher Weise Hausgelegenheit, daß er mir, der ich die große Treppe hinuntersprang, auf der kleinen auswich? - Was hattet Ihr denn zusammen zu flüstern, als ich vor der Thür stand und Einlaß begehrte, heh? weshalb öffnetest Du nicht, als Du hörtest daß ich es sei? - weshalb habt Ihr geflüstert? frag' ich."
„Er sprach leise," sagte Cornelia, sich stolz abwendend, „weil er wahrscheinlich fürchtete, draußen gehört zu werden. Glaubst Du, daß ich allein mit einem Menschen, der von der Straße hereinspringt und mir die Pistole auf die Brust setzt, schreien soll? Ich konnte vor Angst kaum einen Laut über die Lippen bringen."
„Und weshalb hast Du das nicht dem Officier gesagt, als er hier war - so daß ich jetzt noch gar in Verdacht komme, nicht loyal zu sein, und weshalb hat die Susa nicht geschrieen? Warum, frag' ich, habt Ihr Beide das Alles heimlich abgemacht?"
„Lege nur den Revolver fort und blamire Dich nicht," sagte seine Frau, ein wirklich reizendes junges Weib von kaum achtzehn Jahren - „ich habe Dir den Grund schon /28/ genannt, und gehe jetzt hinunter, denn ich muß mich anziehen. Du bist wohl am Ende gar eifersüchtig auf den Menschen und glaubst, er habe weiter nichts zu thun gehabt, als mir in den zwei Minuten eine Liebeserklärung zu machen? Es ist wahrhaftig zu absurd; Du wirst alle Tage unausstehlicher."
Don Pedro steckte den Revolver in die Tasche, drehte sich um, verließ das Zimmer und stieg langsam die Treppe hinab. Unten aber traf er die Susa, die eben im Begriff war, das Haus auszukehren, und sich ungemein eifrig dabei zeigte.
„Susa," sagte er mit finster zusammengezogenen Brauen, mit der Rechten in der Tasche noch immer den Revolver haltend, während er die Linke auf ihre Schulter legte - „wer war der Mensch, der heute Morgen in unser Haus flüchtete?"
„Pero, Seňor," sagte das Mädchen, ein braunes junges Ding, aber mit verschmitzten Augen, die sie jetzt freilich nicht zu dem Herrn aufschlug, sondern um so viel eifriger in ihrer Arbeit fortzufahren suchte, - „wie soll ich das wissen? Ich war selber erschrocken genug, und er sprang so rasch an mir vorüber, und der Gang war auch so dunkel - und sie wollten ihn fangen den armen jungen Menschen."
„Und woher weißt Du, Susa, daß es ein junger Mann war, wenn Du in dem dunkeln Gang nichts sehen konntest?"
Susa wurde blutroth und wußte nicht gleich, was sie antworten sollte; da nahm Don Pedro langsam die rechte Hand aus der Tasche hielt ihr den Revolver gegen den Kopf und sagte mit hohler Stimme:
„Susa, bereite Dich, vor Deinen Gott zu treten - Du hast keine zwei Minuten mehr zu leben. Wer war der Fremde?"
Die Indianerin warf einen scheuen Blick nach der Bewegung des Armes hin, erkannte aber kaum die drohend auf sie gerichtete furchtbare Waffe, als sie mit einem Aufschrei vor ihrem Herrn in die Kniee brach und mit vor Angst fast erstickter Stimme ausrief:
„Gnade, Gnade! Seňor, ich will ja Alles bekennen, oh, nur um Gottes willen, tödten Sie mich nicht!" /29/
„Sage mir dann - wer war der Fremde?" murmelte Don Pedro düster..^.
„Susa! Susa!" rief die Stimme der Herrin von oben nieder.
„Wer war der Fremde?" sagte Don Pedro, und seine Stimme klang geisterhaft - „ich zähle eins, zwei, drei. Wenn Du nicht antwortest, bist Du bei drei eine Leiche."
„Susa - Susa! so komm doch!" rief es wieder.
„Eins" - zählte Don Pedro - „zwei -"
„Don Mauricio Lucido," stöhnte das Mädchen.
„Ha!" rief Don Pedro - „er war schon öfter hier im Hause?"
„Ja –“
„Meine Frau kennt ihn?"
„Ja."
„Susa - Susa - kommst Du denn noch nicht, oder soll ich Dir Beine machen?"
Don Pedro stand vernichtet - er hätte in dem Augenblick das Mädchen noch viel mehr fragen können, aber der Kopf wirbelte ihm, und wie er nur die Hand von ihrer Schulter nahm, floh das scheue Ding wie ein Reh von ihm fort, die Treppe hinauf. Don Pedro achtete aber nicht mehr auf sie - er betrachtete die Waffe in seiner Hand, aber der Revolver war in der That nicht geladen; so ihn wieder in der Tasche bergend, schritt er hinüber in den Laden. Don Julio hatte diesen eben geöffnet und war gerade beschäftigt Seife zu schlagen und sich selber zu rasiren. So früh kamen selten Kunden und er behielt da genügende Zeit für sich - was im Hause vorging, kümmerte ihn außerdem nicht.
Don Pedro - sehr häufig etwas feierlich in seinem ganzen Wesen, schritt ruhig und ohne an einen Morgengruß zu denken, zu einem der Kundenstühle, die jeder vor einem Spiegel standen. Er wählte den, von dem aus er das Bild der Kaiserin am besten erkennen konnte, warf noch einen langen Blick darauf, seufzte tief und sagte dann, während er seinen Hals entblößte, mit vollkommen ruhiger Stimme:
„Don Julio, seien Sie so gut und schneiden Sie mir den Hals ab!" /30/
Don Julio, auf die Worte gar nicht achtend und am linken Daumen noch das Messing-Seifennäpfchen, ging ruhig auf den Principal oder Compagnon (man wußte eigentlich nicht recht, was er war) zu - Don Pedro rührte sich nicht - und strich ihm mit dem Pinsel in's Gesicht. Der Hoffrisseur aber, als er die Seife spürte, fuhr in aller Wuth in die Höhe und schrie:
„Esel! um mir den Hals abzuschneiden, brauchen Sie mich doch nicht vorher einzuseifen?"
„Um Ihnen was -?" rief Don Julio im höchsten Erstaunen aus.
„Den Hals sollen Sie mir abschneiden," wiederholte Don Pedro mit der größten Ruhe, indem er seinen Platz wieder einnahm. „Sie können nachher das ganze Geschäft übernehmen und meine Frau heirathen."
„Sind Sie verrückt geworden?" rief Don Julio, in der That mit einiger Berechtigung, aus. - „Was fällt Ihnen denn ein? - was ist denn geschehen? das war ja ein Heidenskandal heute Morgen im Haus."
Don Pedro antwortete nicht; er sah still und düster vor sich nieder, endlich stand er auf, wischte sich die Seife aus dem Gesicht - gewaschen hatte er sich noch nicht, und that das auch nie Morgens vor dem Frühstück - und sagte dann, indem er dem Barbier die Hand auf die Schulter legte:
„Julio - wissen Sie, was es ist zu lieben - und verrathen zu werden? Kennen Sie die Schlange, die ich an meinem Busen groß gezogen? - Sie heißt Cornelia. Ich gehe jetzt aus," setzte er dann ruhiger hinzu - „wenn Jemand nach mir fragen sollte; ich komme vor zehn Uhr nicht wieder nach Hause!" - Und damit setzte er seinen breitrandigen Hut auf und verließ den Laden.
*
Die Sonne neigte sich dem Horizont, und in der Calle Jesus stand, wie an jenem Abend, eine schlanke Frauengestalt in ihren Rebozo eingehüllt und schaute harrend bald die Straße hinab, bald hinauf - und hatte da viele, viele Abende so /31/ gestanden. Aber vergebens horchte sie den klappernden Hufen eines herbeitrabenden Pferdes. Wenn ja eins kam, so war es nie das rechte, und leise und verstohlen wischte sie dann die verräterische Thräne von den Wimpern.
Und die Sonne sank - der Himmel färbte sich in ein dunkles Blau, dem dann rasch jene blaugrauen Tinten folgten. Die Sterne funkelten nieder und die Nacht hatte ihr Reich begonnen.
„Er kommt wieder nicht," flüsterte das Mädchen mit einem recht tief aus der Brust hervorgeholten Seufzer - „arme Mercedes uud das sollte die Woche vor der Hochzeit sein, auf die ich mich nun die langen Monde so gefreut - hab' ich denn so harte Strafe verdient, Santisima?"
Noch einmal horchte sie hinaus - „Noch bis hundert will ich zählen, und wenn er dann nicht da ist, kommt er auch heut Abend nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs," immer langsamer zählte sie, um den Zeitraum recht hinaus zu dehnen - er kam nicht - „hundert" - sie horchte wieder - „hunderteins - hundertzwei, hundertdrei." - Die Straße lag todtenstill, und fest in ihre Mantille eingehüllt, schritt sie durch das Haus, über den Hof und in ihr dunkles Kämmerlein. - Aber die Nacht war so lang - schlafen konnte das arme Kind ja doch nicht, denn Angst und Ungewißheit peinigten sie, und sie zündete sich die Lampe an, um noch ein wenig ihre Kleider auszubessern, oder auch in einem Gebetbuche zu lesen, das ihr Gerónimo einst mitgebracht.
Die Oellampe verbreitete einen matten, düstern Schein in dem Gemach, und wenn sie den Kopf manchmal wandte, schauderte sie vor ihrem eigenen Schatten zusammen. So saß sie eine Stunde - saß sie zwei, und das Herz war ihr so voll, so schwer, daß sie manchmal sich aufrichten mußte, um nur wieder einmal frei und ordentlich Athem zu schöpfen.
Jetzt legte sie ihre Arbeit zusammen und wollte eben die Lampe auslöschen, als sie zusammenschrak, denn es schien ihr fast, als ob sie draußen die Hausthür hätte öffnen hören - es war nichts - sie hatte sich getäuscht - und doch trat sie hin und lauschte hinaus. - Da war richtig ein Schritt auf dem Pflaster des Hofes - doch wie viele /32/ Parteien wohnten dort gerade - noch fünf Familien außer ihr - es war jedenfalls Jemand, der zu einer von denen gehörte - wer sollte zu ihr kommen! Sie schloß den Laden wieder und wandte sich auf's Neue ihrer Lampe zu, als sie bis in die innersten Fasern ihres Herzens zusammenzuckte, denn mit leisem Finger pochte es an ihre Thür - deutlich konnte sie den Laut vernehmen, und nicht zu athmen wagte sie jetzt, denn sie fürchtete die Wirklichkeit und - fürchtete auch wieder, daß es in Nichts zerfließen könne.
Da noch einmal - jetzt hatte sie sich nicht getäuscht - das war ein Finger gewesen, der ihre Thür berührt - aber wenn Gerónimo, weshalb hätte er so schüchtern angepocht, und wer Anders hätte sie um diese Stunde der Nacht aufgesucht - aufsuchen dürfen?
Einen Moment stand sie unschlüssig - aber sie mußte Gewißheit haben, und nur mit ihrer rechten Hand an die Seite fühlend, ob noch das kleine, aber scharfe Messer in ihrem Gürtel stak, schritt sie entschlossen aus die Thür zu und schob den Riegel zurück.
„Wer ist da? was sucht Ihr hier so spät?"
„Ich bin es - Rodolfo, Seňorita," flüsterte die Stimme zurück. „Seid ruhig - ich habe Euch eine Kunde zu bringen."
„Eine Kunde von ihm, von Gerónimo?"





























