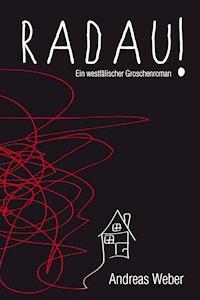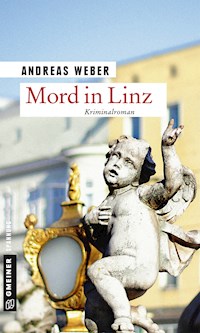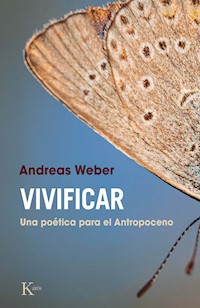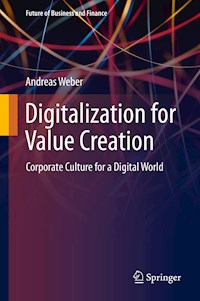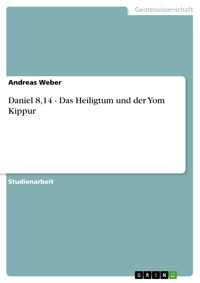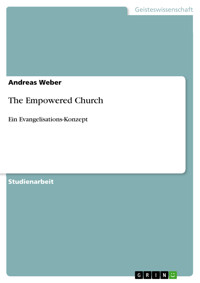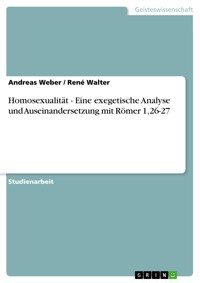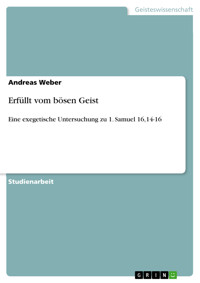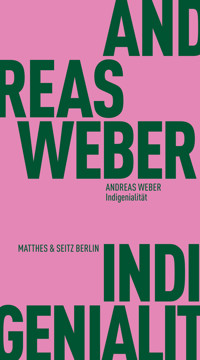
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Wir sind alle Wilde«, sagt Andreas Weber und verdeutlicht, dass unsere Zivilisation nicht nur die Indigenen kolonisiert hat, sondern auch unser eigenes Denken. Wenn wir die Welt wieder zu einem lebensspendenden Ort machen wollen, sollten wir das Indigene in uns selbst entdecken. »Radikale Demokratie«, »Ethik und Moral der Gemeinsamkeit«, »Gerechtigkeit«, »Ökologie der Gabe« und »Nachhaltigkeit« – um diese Begriffe kreist Webers philosophisches Plädoyer für einen offenen Austausch in einer Welt der Gegenseitigkeit, die gerade erst wieder entdeckt wird: Physiker, Biologen und Geisteswissenschaftler beginnen den ganzheitlichen Kosmos angesichts der ökologischen und gesellschaftlichen Krisen neu zu begreifen und alte Gewissheiten abzustreifen. Sich auf diese neue Weltsicht einzulassen, bietet die Chance, lebendiger Teil einer ganzheitlichen Wirklichkeit zu werden und eine ökologische Lebenskunst zu verwirklichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Indigenialität
Fröhliche Wissenschaft 231
Andreas Weber
Indigenialität
»Die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Natur ist wahrscheinlich die wichtigste des gegenwärtigen Jahrhunderts.«
Philippe Descola1
Inhalt
Einleitung: Wir sind alle Wilde
Erster Teil
Jenseits des Narzissmus
Das Denken dekolonialisieren
Anthropologie der Befreiung
Zweiter Teil
Ein lebendiger Kosmos
Alles fühlt
Bedingungsloses Grundwillkommen
Das Ökosystem als Liebesgeschichte
Dritter Teil
Eine ökologische Lebenskunst
Selbstsein als Glück
Eine neue Klassik
Anmerkungen
Einleitung: Wir sind alle Wilde
»Disziplin und Freiheit sind einander nicht entgegengesetzt.«
Gary Snyder2
Wie schon lange nicht mehr – zuletzt wohl in den kurzen Jahrzehnten zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg – stehen unsere Weltbilder infrage. Viele nennen unsere Gegenwart »Anthropozän«. In diesem Begriff klingt an, dass der Mensch sich zu einem gestaltenden Teil der Natur gemacht hat, aber auch, dass die Regeln des Natürlichen, des Stoffes und der Materie, alles Menschliche durchziehen. Die Trennung in »Kultur« hier und »Natur« dort, welche Neuzeit und Moderne geprägt hat, ist an ihr Ende gekommen. Leib und Seele sind nicht mehr geschieden. Handelnde bestehen aus Materie, Materie hat ihre eigene Handlungslogik. Das abendländische Denken, das zweitausend Jahre Geistesgeschichte geprägt hat, ist plötzlich überholt.
Dass die lange Epoche der Trennung zu Ende geht, hat handfeste Gründe. Der Begriff »Anthropozän« wurde ihretwegen geboren. Heute sind die Spuren menschlicher Verwüstungen noch in den entlegensten Winkeln des Planeten zu finden. Die ökologische Krise ist zum Dauerzustand geworden. Unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, produziert immer mehr Abfall und immer mehr Abstand zwischen den Reichen und dem Rest, der mühsam mitzuhalten versucht. Dem sozialen Klima werden Diagnosen wie Sinnentleerung oder »Müdigkeitsgesellschaft« gestellt.3 Unter dem alten Blickwinkel – menschliche Gestaltung hier, Natur als Ressource dort – scheinen all diese Probleme unüberwindbar.
Der Abschied vom Dualismus, von der Opposition zwischen Kultur und Natur, bedeutet somit weit mehr als eine philosophische Revolution. Er verschiebt die Grundannahmen und die Handlungsmöglichkeiten in den wichtigsten Feldern der Praxis. Dazu gehören die Prinzipien der Wirtschaft, die Lehrsätze der Ökologie und sogar die Parameter des Politischen und des Ethischen. Denn sobald die Trennung zwischen Akteur und dem Bereich, in dem er handelt, aufgehoben ist, lässt sich nicht mehr von einem »Markt« sprechen, auf dem »Ressourcen« gehandelt werden, nicht mehr von einem »Ökosystem«, in das wir zerstörerisch oder schützend eingreifen, und auch nicht von moralischen Regeln, die unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation gelten.
Heute stehen die Axiome der abendländischen Kultur zur Verhandlung. Und die Zeit, sie durch etwas grundlegend Neues zu ersetzen, das bei der Lösung der massiven drohenden Probleme hilft, ist knapp.
Was aber kommt dann?
Wir spüren, dass unser Weltbild an sein Ende gekommen ist. Aber ein neues ist nicht zur Hand. Oder etwa doch? Hier setzt »Indigenialität« ein. Seit Hunderttausenden, ja vielleicht sogar Millionen von Jahren haben die »Indigenen«, die Menschen der Stammeskulturen, in dem Kosmos gelebt, den wir gerade wieder zu entdecken beginnen. Die »Indigenen«, das sind solche Kulturen, wie sie seit der Tiefenzeit der Menschheit und bis zum Beginn des Ackerbaus auf der Erde existiert haben, heute jedoch nur noch an wenigen Stellen des Planeten vorkommen, wie etwa die australischen Aborigines oder die Indios des Amazonas.
Die Indigenen haben eine Welt der Nicht-Trennung immer schon gedacht und immer schon gelebt. Sie haben diese auf eine Weise gestaltet, die ihnen über Jahrmillionen das ökologische Überleben gesichert hat. Anders als die moderne Zivilisation, der es in den letzten hundert Jahren gelungen ist, die eigenen Lebensgrundlagen so zu ruinieren, dass sie sich in einer galoppierenden Klimaerwärmung gefangen sieht und einen planetarischen Artenschwund losgetreten hat.
Selbst das Ganze sein
Indigenialität heißt, sich als aktiven Teil eines sinnvollen Ganzen zu verstehen und so zu handeln, dass die eigene Lebensqualität die dieses Ganzen steigert. Indigenialität heißt, die Welt nicht länger in unauflösbaren Gegensätzen zu denken und an deren Widersprüchen zu verzweifeln (Leib – Seele, Körper – Geist, Markt – Soziales, Materie – Spiritualität, Teilhabe – Verantwortung). Sie erlaubt die gleichzeitige Beteiligung an verschiedenen Dimensionen der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist kein totes Objekt, sondern zeigt sich gebend und fürsorglich. Im Gegenzug benötigt sie kontinuierliche Hingabe und Pflege, um fruchtbar zu bleiben.
Auf den folgenden Seiten will ich beleuchten, inwieweit »Indigenialität« den Horizont einer anderen Kultur bieten kann. Dabei wird es nicht darum gehen, nostalgisch-romantisch die Vorzüge des Steinzeitlebens zu beschwören. Vielmehr soll »Indigenialität« prägnant jene Bereiche eines Wirklichkeitsverständnisses herausarbeiten, die uns in der heutigen Paradigmenwende nützlich sein könnten. Ich will prüfen, inwieweit diese sich mit Kernelementen einer Weltsicht, wie sie gerade das Anthropozän entwirft, treffen. Aus dieser Begegnung, so die Erwartung, könnten sich kosmologische und lebenspraktische Auffassungen ergeben, die uns zukunftsweisende Lösungen bieten.
Anthropologen wie der Franzose Philippe Descola, der den Lehrstuhl am Pariser Collège de France in der Nachfolge seines berühmten Vorgängers Claude Lévi-Strauss innehat, erfassen heute, wie tief eine ursprüngliche Kosmologie des Gemeinsam-mit-der-Welt-lebendig-Seins die Menschheitsgeschichte geprägt hat. Sie ist in Stammeskulturen rund um den Globus und quer durch die Geschichte zu finden, bis hinein in jene Tiefenzeit, in der Homo erectus das Feuer hütete und seine Verwandten rituell bestattete und – wie seine Nachfolger mancherorts noch heute – seine Teilnahme im System universeller Verwandlungen durch Felsbilder und -ritzungen immer wieder neu inszenierte.
Die Kosmologie von Völkern, die eng mit Tieren und Pflanzen, Steinen und Wasser zusammenleben, ohne wie unsere moderne Zivilisation beständig in deren Beziehungen einzugreifen, erscheint erstaunlich konstant. Fast könnte man sagen, dass es eine menschheitsalte Praxis der gegenseitigen Verwandlung gibt, des Austauschs und der Feier des Geschenks, von einer fruchtbaren Biosphäre genährt zu werden.
Diese Kultur der gegenseitigen Bedingtheit und des Einander-Erschaffens hat überall andere Namen, die bis heute nachklingen: »Ubuntu« heißt sie in der afrikanischen Zulu-Sprache, übersetzt etwa mit »Ich bin, weil du bist«. »Traumzeit« nennen die Europäer sie in einer ziemlich verunglückten Übertragung des australischen Schöpfungsverständnisses. Ähnliche Sichtweisen herrschen im indianischen Südamerika – und herrschten auch auf dem Gebiet der USA und Kanadas, bevor die Kolonialisatoren die Mitglieder der »First Nations« und ihre Anschauung der Gegenseitigkeit fast vollständig vernichteten.
Auch das vorgermanische Europa überspannte dieser Kosmos: Er war es, der die Gemäldegalerien der Grotten von Lascaux, Chauvet und Altamira hervorbrachte. Während der letzten Eiszeit war die Nordhalbkugel von Westspanien über die damals komplett begehbare Beringstraße bis zur heutigen US-Ostküste von einer Kultur der Eiszeitsavanne geprägt. In deren Zentrum stand, die Fruchtbarkeit ökologischer Verwandlung zu erhalten. Die Welt war Fülle, und die Fülle war Beziehung, und auf der Welt sein hieß, diese Fülle durch die Kunst der eigenen Beziehungen zu nähren und zu bewahren.
All das ging zu Ende, als die Menschen von der Landwirtschaft abhängig wurden. Wie der US-Ökophilosoph Paul Shepard schon in den 1970er Jahren erörterte und wie heute in dessen Gefolge sein britischer Kollege Timothy Morton betont, zerstörte die »Agrilogistik« der Bauern und Viehzüchter einen Kosmos der Gegenseitigkeit und errichtete stattdessen Enklaven der Kontrolle.4 Der Bauer muss andere Wesen beherrschen, um zu überleben. Landwirtschaft akzeptiert nicht, dass Fruchtbarkeit nur dadurch zu erzeugen ist, dass man sich als Teil des Ökosystems versteht, und dass diese Teilhabe zugleich eine intensive emotionale Erfahrung von Glück und Eingebundenheit darstellt.
Die bäuerliche Mentalität setzt auf Kontrolle, Pflege und Bemeisterung der anderen, die so zum reinen Konsumprodukt werden. Sie erwirkt Kolonisation, wo vorher der Tausch von Geschenken stand. Und dieser Wandel hinterlässt seine Spuren in der Seele. Er ist auch eine emotionale Katastrophe. Die frühen Bauern machten die Erfahrung, dass ihre Existenz nur »im Schweiße ihres Angesichts« möglich war, wie es die Bibel, das archetypische Manual eines Bauern- und Hirtenvolkes, beschreibt.
In der »Agrilogistik« heißt existieren gegen die Verbundenheit kämpfen, denn Verbundenheit will Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit aber kann nicht zugelassen werden, denn Landwirtschaft muss den Mangel bezwingen und darf sich nicht auf den glücklichen Fund im Überfluss verlassen. Überspitzt könnte man sagen: Zähne zusammenbeißen kommt vor dem Genuss des reines Daseins. Das dürfen nur die anderen, die »Vögel auf dem Felde, sie säen nicht, sie ernten nicht«, wie es in der Bibel heißt.5 Der Mensch aber, der die anderen Wesen hinter einen Zaun verbannt hat, muss sich quälen.
Sich heil fühlen als Naturzustand
Die vor-ackerbaulichen Völker kennen diese Qual nicht, denn es gibt bei ihnen keine Gegenüberstellung von »Natur« und »Kultur«. Diese ist eine Erfindung unserer Zivilisation. Sie ist eine Fiktion, die tief durch unsere Existenz schneidet, weil sie unseren Körper von seiner Seele trennt. Morton nennt diesen Abschied die »Abtrennung«, wie der Verlust eines Körpergliedes. Sie war der Abschied davon, wache Empfindung und tief verankerte Innerlichkeit als fundamentale Ebene der Welt stets aufs Neue finden zu können. Natur dort und Kultur hier – das ist der Archetyp des ausschließenden, des kolonialisierenden Denkens.
Der Anthropologe Descola stellte in seinen Arbeiten staunend fest: Natur und Kultur, Materie und Mensch zu trennen ist ein westliches Konzept. Ursprünglich wird die Welt als ein Ganzes gedacht, in dem sich Schöpfung beständig verwirklicht und dabei sowohl Dinge als auch Erfahrungen hervorbringt, sowohl Materie als auch Beziehungen und ihre Regeln. Die Tiefenkultur der Menschheit gestaltet aus, dass wir an einem Ökosystem teilnehmen. Sie organisiert diese Teilnahme bewusst so, dass einerseits das Ökosystem geschützt wird und dass sich andererseits das eigene Handeln als sowohl persönlicher wie auch kosmischer Erfahrungsprozess darstellt.
Dieser emotionale Erfahrungscharakter der menschlichen Tiefenkultur wird selbst von solchen Anthropologen oft übersehen, die wie Descola davon fasziniert sind, dass menschliche Kultur nicht automatisch der Natur gegenüberstehend gedacht werden muss, sondern auch wie ein Ökosystem verstanden werden kann: dessen süße Früchte einen ernähren, dessen klares Wasser einen tränkt, dessen warme Sonne einem Leben spendet – das glücklich macht. Nicht von der Natur getrennt zu sein bedeutet somit automatisch, dass die eigenen Gefühle ebenfalls Teil des Ökosystems sind. »Indigenialität« ist die Grundlage einer ökologischen Lebenskunst. Diese hebt sich an zentralen Stellen von unserer westlichen Weltsicht ab.
Verbundenheit
Für die Indigenen existiert kein Dualismus. Es gibt nicht »Natur« dort und »Kultur« hier. Die menschliche Welt ist Teil eines Systems von Beziehungen, zu denen auch die Steine, die Gewässer, die Tiere und Pflanzen und die Gestirne gehören. Elemente der menschlichen Realität und soziale Regeln (etwa wer wen heiraten darf) werden durch Elemente der Natur ausgedrückt. Das heißt, dass diese Natur nicht als Sinnbild für das Menschliche steht, sondern auf einer tieferen Ebene ebenfalls sozial ist – und ihre Mitglieder machen Erfahrungen wie wir.
Ökologische Erfahrung in der Ersten Person
Ökologie ist für die Indigenen nicht die Wissenschaft der Nahrungsketten »da draußen«, sondern eine persönliche Erfahrung. Menschen und umgebende Natur sind real eins: »Ich bin das Land – und das Land ist ich«, sagt die Aborigine-Autorin Margaret Kemarre Turner.6 Der Körper ist nicht metaphorisch, sondern wahrhaftig ein Teil des umgebenden Landes. Das Land ist der Körper. Wenn den Menschen das Land genommen wird, wird ihnen nicht nur ihre physische Grundlage entzogen, sondern ihr Körper genommen.
Radikale Demokratie
»Indigene« leben in »akephalen« (»führerlosen«) Gesellschaften, also in einer radikalen Basisdemokratie: Die Menschen sind ursprünglich in Familiengruppen oder »Communitys« organisiert, die nicht von einem »Häuptling« beherrscht werden, sondern von einem Ältesten angewiesen, der wiederum von der Unterstützung eines Komitees anderer erfahrener Mitglieder der Gemeinschaft unterstützt wird (und der jederzeit ausgetauscht werden kann).
Ethik als Moral der Gemeinsamkeit
Die Ethik der Indigenen ist nicht abstrakt auf eine Idee vom Menschen zentriert, sondern bezieht sich immer auf das adäquate Handeln für eine Gemeinschaft, das allen zugutekommt. Die Menschen sind dabei Teil des Ökosystems. Die ökologischen Beziehungen verkörpern zugleich die moralischen Normen. Sie bestimmen die Regeln des Austauschs und des entsprechenden Verhaltens. Die Ökologie ist kosmologisch, die Kosmologie verpflichtet auf ein bestimmtes Verhalten, um die lebensspendenden Bezüge zu erneuern und zu nähren. Das Wissen über die Wirklichkeit beinhaltet also immer schon deren Ethik.
Gerechtigkeit
Die Menschen leben mit dem Ökosystem in einer Allmende. Sie nutzen nicht Ressourcen, sondern sie werden vom Land ernährt und ernähren es gleichzeitig durch Pflege und durch die rituelle Bestärkung ihrer Verbundenheit. In einer Allmende leben heißt nicht Objekte nutzen und Ressourcen kontrollieren, sondern Teil einer Familie sein, zu der auch Tiere, Pflanzen, Steine, Wasser und Luft gehören. »Allmende« als System eines ökonomischen Austauschs wird in der aktuellen Wirtschaft und Politik diskutiert, etwa im Rahmen des Grundeinkommens.
Ökonomie der Gabe
Im Kosmos der Indigenen gibt es keine Objekte, über die allein menschliche Akteure disponieren. Ökologie ist ein Beziehungsprozess der Gegenseitigkeit. Sie bricht zusammen, wenn ihre Teilnehmer zum Objekt gemacht werden. Eine Allmende bedeutet, dass das eigene Selbst nur dadurch gedeiht, dass alles andere auch gedeiht. Jede Beziehung ist somit eine Allmende. Eine fruchtbare Beziehung ist ein Verhältnis, in dem das Selbst dadurch wächst, dass auch der andere gedeihen darf. Kurz: Jede Allmende, die gelingt, ist eine Liebesbeziehung.
Nachhaltigkeit
Der indigene Kosmos funktioniert nach festen Regeln, die sich nicht ändern. Die Regeln beschreiben, wie durch wechselseitiges Geben der Einzelnen untereinander die Fruchtbarkeit des Ökosystems und die Prosperität der Gemeinschaft immer neu erzeugt werden. Diese Sicht ist einerseits statisch, andererseits bilden die festen Prinzipien den Rahmen für dauernde dynamische Veränderungen. Diese sind allerdings nicht auf Fortschritt und Wachstum ausgelegt, sondern darauf, das Prinzip der Fruchtbarkeit der Welt immer neu zu bekräftigen.
Auf den folgenden Seiten versuche ich, ein Weltbild zu umreißen, das die Leerstellen unserer Weltsicht mit dem füllt, was dem Menschen seit Hunderttausenden von Jahren seinen Platz in der Wirklichkeit gegeben hat. Es ist das Bild einer Welt, die wir immer schon selbst in uns tragen. Gerade diese innere Welt ist aber vom Aussterben bedroht. Ihre äußerliche Erscheinung ist längst zu einer exotischen Seltenheit geworden: An den meisten Orten der Erde sind die Gesellschaften, die der ursprünglichen menschlichen Kosmologie folgten, heute vernichtet – auch wenn es noch einzelne Völker im Amazonas-Wald gibt, die noch keinen Kontakt mit der sogenannten Zivilisation hatten, und ein paar zurückgezogene Stämme etwa in Papua-Neuguinea.
Praktisch in ganz Afrika ist die ursprüngliche Kultur der Teilhabe durch Sklavenhandel und koloniales Erbe zerstört und, was vielleicht noch tragischer ist, von der Bevölkerung weitgehend verdrängt worden. Dieser Identitätsverlust ist in seiner traumatischen Wirkung mit dem Zustand eines Menschen zu vergleichen, der seine seelische Identität verloren hat.
Das gilt auch für die australische Aborigine-Kultur. Obwohl diese auf der ganzen Welt immer wieder als romantisches Beispiel für einen noch funktionierenden Naturkosmos herhalten muss, befindet sie sich in einem immer schlechteren Zustand. Mehr als zwei Jahrhunderte haben die britischen Kolonialisatoren und später der australische Staat viel darangesetzt, eine Weltsicht auszulöschen, in der Besitz nicht existiert, weil er die Gegenseitigkeit stört, mit der die Teilnehmer im Ökosystem einander Leben und Energie schenken.