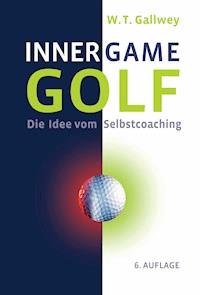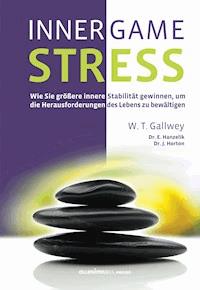Inner Game Golf
Die Idee vom Selbstcoaching
W. Timothy Gallwey
alles im fluss Verlag
© für die deutsche Ausgabe, 2003:
alles im fluss Verlag, Am Rebberg 11, D – 79219 Staufen
Telefon +49-7633-933480 / Fax +49-7633-9334811www.alles-im-fluss-verlag.de /
[email protected]
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der schriftlichen Einwilligung des Verlags.
5. Auflage September 2011
Autor: W. Timothy Gallwey
Übersetzung: Jörg Savelsberg
Projektleitung: Frank Pyko
Umschlaggestaltung: Piotr Iwicki
Layout: bookwise GmbH
Druck und Bindung: fgb - freiburger graphische betriebe
Printed in Germany
Veröffentlicht in den USA von Random House Inc., New York, und gleichzeitig in Kanada von Random House of Canada Limited, Toronto, unter dem Titel "The Inner Game of Golf"
ISBN 978-3-9809167-0-7
Vorwort
Die Welt ist wie eine riesige mechanische Uhr: Unendlich viele Zahnräder greifen ineinander und treiben schließlich den Uhrzeiger voran. Dieses mechanistische Verständnis von Ursache und Wirkung haben wir spätestens seit Isaac Newton. Und auf viele Erscheinungen trifft dieses Verständnis auch zu. Davon leben zum Beispiel die Naturwissenschaften.
Das Golfspiel leidet eher unter diesem Verständnis. Immer schon wurden die einzelnen Abschnitte und Sequenzen des Golfschwungs analysiert und wie die Zahnräder einer Uhr ständig präziser aufeinander abgestimmt. Heute stehen wir vor einem Wust technischer Anweisungen, der uns schier zusammenbrechen lassen könnte.
Das Golfspiel – genauer gesagt die Mechanik des Golfschwungs – war von jeher ein Lieblingsthema für den Forscherdrang der Systematiker. Das Resultat war nicht nur eine unglaublich tief schürfende Analyse der Komponenten und Abfolgen des Schwungs, sondern auch ein stetes Anwachsen der Golflehre. Trotz der unvermeidlichen Frustration, die sich ergibt, wenn man versucht, sämtliche Instruktionen zu verstehen, zu verinnerlichen und anzuwenden, will die Gier nach dieser Art von Wissen nicht enden. Auch der Glaube an die allein selig machende Kraft der Technik ist ungebrochen. Diese Gier kommt aus dem gleichen Verlangen nach Wissen, das auch die technologische Revolution Newtons angefeuert hatte: aus dem Verlangen nach Kontrolle. Ich wusste, dass es im Golfspielen um Kontrolle ging. Auch ich war dem menschlichen Drang nach mehr Kontrolle erlegen. Wird dieser Drang nicht beobachtet, wird er erst zu einem Zwang und dann obsessiv. Die meisten Golfer sehnen sich nach einer Abkürzung auf dem Weg zur Meisterschaft, die darin besteht, jeden Ball zum gewünschten Ziel zu befördern, und das mit Grazie, Leichtigkeit, Präzision und Perfektion.
So sah auch mein Traum aus. Die Realität war von hohen Erwartungen geprägt, denen immer wieder Verzweiflung folgte. Zum Schluss resignierte ich und glaubte, Golf sei nur von denjenigen zu meistern, die über eine große athletische Fähigkeit verfügen und Zeít haben, täglich zu üben. Ständig setzte ich mich mit Instruktionen auseinander, die mein Körper nicht befolgen konnte. Ich war sauer, wenn die erhofften Resultate ausblieben. Glücklicherweise machte mir meine Erfahrung mit dem Buch »Tennis und Psyche« es schließlich möglich, diesem Strom von Anweisungen zu entkommen, bevor ich in ihm ertrank.
Ich wollte sehen, wie weit ich kommen könnte, wenn ich auf die Vorzüge technischer Expertise verzichtete. Meine Lektoren und Herausgeber setzten mir das Ziel, die 80 zu unterspielen. Während ich das Buch schrieb, durfte ich aber nur einmal in der Woche spielen. Die Originalausgabe des Buches schilderte daher meine Entdeckungen, die vielleicht in dieser Erkenntnis gipfelten: Natürliches Lernen wird nur dann möglich, wenn man die inneren Hindernisse überwindet, den Zweifel, die Angst, die mangelnde Konzentration. Das Buch stellte auch die grundlegenden inneren Fähigkeiten vor, die Lernen und Höchstleistungen ermöglichen.
Mittlerweile ist der Glaube an das menschliche Potenzial weiter verbreitet als früher. Doch unverändert stehen sich die meisten von uns tendenziell immer noch im Weg. Und wir gehen nach Fehlern so hart mit uns ins Gericht, dass jegliche Besserung fast ausgeschlossen ist. Nur wenn wir mutig und ehrlich zugeben, dass wir uns selbst stören, und wenn wir aufmerksamer werden, können wir die zahlreichen technischen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, effektiv nutzen.
Kürzlich kam eine sehr beunruhigende Tatsache ans Licht. Die Masse der Golfer wird im Allgemeinen nicht besser! Bei einer Konferenz der PTA of America über »Lehren und Coaching« stellte das Golf Tips Magazine diese Frage: Wie kommt es, dass trotz der vielen Golfschulen, trotz talentierter Pros, trotz aller Trainingshilfen, trotz renommierter Trainingshandbücher und Zeitschriften, trotz High-Tech-Ausrüstung das Handicap des durchschnittlichen amerikanischen Golfers allenfalls stagniert oder – was laut Studien des amerikanischen Golfverbandes wahrscheinlicher ist – sogar steigt? Für mich ist die Antwort klar: Es gibt eine große Lücke zwischen unserem Wissen über den Golfschwung und unserer Fähigkeit, Menschen beim Lernen zu helfen.
Dieses Problem lässt sich weder durch Weiterentwicklung des technischen noch des erfahrungsorientierten Unterrichts allein lösen. Genauso wenig hilft es, beide Felder so zu untersuchen, als seien sie voneinander unabhängig. Wir brauchen eine eheähnliche Symbiose beider Sparten, in der jede die ihr angemessene, aber von der anderen unterschiedene Rolle spielt. Es kann ja auch keine glückliche Ehe geben, wenn jeder Partner dogmatisch auf seiner eigenen Perspektive besteht und den anderen dominieren will. Als ich das Buch neu bearbeitete, kam es mir vor allem darauf an, den nächsten Entwicklungsschritt des Inner Game zu formulieren. Die letzten vier Kapitel gehen über das Grundbedürfnis nach mehr Bewusstsein für Bewegung beim Golflernen und Golfspielen hinaus. In ihnen werden vor allem folgende Fragen behandelt: Welches Motiv habe ich, Golf zu spielen? Wie wirkt sich dieses Motiv auf mein Spiel aus?
Inner Game eröffnet Möglichkeiten des Selbst-Coachings, die man auf dem Golfplatz und außerhalb nützen kann. Es setzt Potenziale frei, die uns angeboren sind. Wir müssen sie nur wieder entdecken, um jene Brücke zwischen Mechanik und Gefühl zu schlagen, die heute wichtiger ist denn je.
Diese Brücke zwischen dem Inneren und dem Äußeren kann uns die Erfüllung bringen bei jedem Spiel, das wir spielen. Sie kann uns gewiss zu größerem und vergnüglicherem Respekt vor dem uralten und wundervollen Spiel Golf verhelfen.
W. Timothy Gallwey
Kapitel I
Die innere und äussere
Herausforderung
Als ich meinen Tennisschläger an den Nagel hängte und meine 25 Jahre lang nur selten benutzten Golfschläger putzte, fühlte ich zweierlei: Einerseits war ich begierig, die Methoden und Prinzipien des »Inner Game«, die ich auf dem Tennisplatz und auf der Skipiste entwickelt hatte, auf ihre Brauchbarkeit für das altehrwürdige Golfspiel zu überprüfen. Andererseits fühlte ich mich nicht ganz wohl bei dem Gedanken, die ständigen mentalen Schwierigkeiten anzugehen, die das Golfspiel provoziert.
Die Zweifel rührten nicht von mangelndem Selbstvertrauen im Hinblick auf das »Inner Game« her. Ich wusste, was es zu leisten im Stande ist, wusste, dass seine Prinzipien grundsätzlich richtig sind. Die Methoden und Techniken hatten für erstaunliche Resultate nicht nur im Tennis und im Skifahren, sondern in ganz verschiedenen Welten gesorgt: in der Musik, im Geschäftsleben, in der Erziehung, im Gesundheitswesen und in der Familie. Außerdem hatte ich Briefe von vielen Golfern bekommen, die »The Inner Game of Tennis« gelesen hatten. Sie teilten mir mit, dass sie nicht nur ihr Handicap wesentlich verbessert hatten, sondern auch mit viel mehr Freude dem Golfspiel nachgingen. Ich hatte das sichere Gefühl, das Inner Game könne dem Golfspiel und den Golfern grundsätzlich helfen, auch denen, die gelegentlich den Wunschtraum hegen, das Spiel auf einen Schlag meisterhaft zu beherrschen. Aber Golf ist anders als Tennis. Im Tennis war ich ziemlich stark. Ich habe es mein ganzes Leben lang gespielt. Jetzt wollte ich mich dem Golfspiel zuwenden und mein Hacker-Niveau möglichst schnell hinter mir lassen. Immer war es mir leicht gefallen, anderen bei der Überwindung ihrer Zweifel, Ängste und Enttäuschungen zu helfen. Beim Erlernen des Golfspiels war jedoch ich der Schüler. Manchmal beschlich mich auch die Furcht zu versagen. Aber ich beruhigte mich mit dem Wissen, dass ich bei konsequenter Anwendung des Inner Game unausweichlich mehr lernen würde als Golf zu spielen. Dem Lernen würden mit Sicherheit Resultate folgen.
»ES IST DAS EINZIGE SPIEL, ÜBER DAS ICH KEINE GEWALT HABE.«
Eine meiner ersten Runden spielte ich im Hillcrest Club von Los Angeles. Zu meiner Gruppe gehörte auch Dr. F., einer der renommiertesten Chirurgen von Kalifornien. Auf ihn war ich schon einmal bei einem Prominenten-Tennisturnier gestoßen. Irgendwie schaffte er es, dreimal in der Woche Golf zu spielen. Am ersten Abschlag war ich noch etwas nervös angesichts der ungewohnten Atmosphäre und ich bewunderte Dr. F. ob seiner scheinbaren Selbstsicherheit. Am ersten Loch spielt Dr. F. Par. Auf dem zweiten Abschlag drosch er zwei Bälle hintereinander ins Aus. Er war sauer, hämmerte seinen Driver auf den Boden und rief angewidert aus: »Das ist das frustrierendste Spiel, das sich je ein Mensch ausgedacht hat.« Da er offensichtlich kein Neuling auf dem Golfplatz war, fragte ich ihn naiv: »Warum spielen Sie dann so viel?« Dr. F. machte eine Pause und sagte schließlich: »Weil ich das Spiel nicht besiegen kann.« Er schien selbst über seine Antwort erstaunt zu sein. Er dachte über sie nach und sagte dann entschieden: »Ja, es ist das einzige Spiel, über das ich keine Gewalt habe.«
Es wurde bald offenbar, dass Dr. F. sich nicht nur von seinen Abschlägen frustrieren ließ. Er stand so angespannt über seinen 1 Meter-Putts, dass ich mir sagte: Wenn der sein Skalpell mit
ebenso dunklen Vorahnungen anfasst wie seinen Putter, dann möchte ich bei ihm nie auf dem Operationstisch liegen. Dabei fordern delikate chirurgische Eingriffe eine wesentlich größere Fingerfertigkeit als ein Putt von einem Meter – mal abgesehen davon, dass es auch noch um das Leben eines Menschen geht. Doch Golf nervte Dr. F. eindeutig stärker. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass Dr. F. sein Skalpell verärgert auf den Boden des Operationssaales werfen und sich einen Tollpatsch schimpfen würde. Aber genau das passierte bei mehr als einem Drei-Putt. Diese Beobachtung minderte meinen Respekt vor der Herausforderung des Golfspiels keineswegs.
Nicht nur Dr. F. empfand Frust. Obwohl ich es vom Tennis her besser wusste, unterzog ich nach jedem Fehlschlag meinen Golfschwung einer kritischen Analyse. Ich wusste sehr wenig von den mechanischen Abläufen des Schwungs. Trotzdem versuchte ich herauszufinden, was falsch gewesen war. Hatte ich das Gleichgewicht verloren? Schwang ich zu eilig? War ich zu früh oder zu spät mit meinen Handgelenken? Beim nächsten Schlag bemühte ich mich immer, den vermeintlichen Fehler zu korrigieren. Wenn ich dann den Eindruck hatte, ein Fehler sei behoben, dann tauchten umgehend zwei neue auf. Je mehr ich versuchte, meinen Schwung zu kontrollieren, desto mechanischer und weniger rhythmisch wurde er. Daraus resultierten noch furchtbarere Schläge. Die wiederum veranlassten mich zu einer noch stärkeren Selbstkorrektur. Es dauerte nicht lange, bevor aus diesem Kreislauf eher eine Selbstzerstörung denn eine Selbstkorrektur geworden war.
Abseits des Platzes dachte ich gründlich über Golf nach. Worum ging es dabei überhaupt? Ein Begriff setzte sich in meinem Kopf fest: Kontrolle. Grundsätzlich scheint es bei Kontrolle darum zu gehen, dass man den Körper zu einer gewünschten Handlung veranlasst – dadurch verhält sich der Golfball wie gewünscht. Ich betrachtete Golf allein als Herausforderung für die Fähigkeit eines Spielers, seinen Körper zu kontrollieren. Ich hatte einige Erfahrung in Sachen Kontrollprobleme beim Tennis gesammelt und ich beschloss, sie auf das Golfspiel zu übertragen.
Auf dem Tennisplatz hatte ich gelernt, dass die Methode zur Kontrolle des Körpers, wie sie die meisten von uns gelehrt wird, nicht funktioniert. Dem Körper vorzuschreiben, was er zu tun hat, ist nicht der effektivste Weg zur Leistungssteigerung. Unsere Muskeln verstehen Sprache nicht. Unser Verstand begreift nicht die Koordination von Hand und Auge. Versuchen Tennisspieler ihren Körper zu veranlassen, sich nach den Instruktionen der letzten Tennisstunde zu verhalten, dann schränken sie dessen ungehinderte Beweglichkeit ein. Sie stören die Koordination, anstatt sie zu unterstützen. »Nehmen Sie den Schläger früh zurück ... Treffen Sie den Ball vorne ... Machen Sie den Schläger nicht im Durchschwung zu«, sagen sich diese Spieler während eines Matches. Selbst wenn diese Instruktionen mit der Steifheit und dem Selbstbewusstsein eines rebellischen Rekruten beherzigt werden, führt das nur zu moderaten Erfolgen.
Die Qualität meines Trainings und die Leistungsfähigkeit meiner Schüler verbesserten sich eines Tages wesentlich, als ich die zerstörerische Wirkung von Anweisungsfluten erkannte. War der Kopf des Schülers frei von äußeren und inneren Anweisungen, dann konnte er besser auf den Ball achten und er hatte ein wesentlich besseres Gefühl für den Schläger. So kamen natürlich auch bessere Resultate zustande. In jenen frühen Tagen der Erforschung des Inner Game, also dessen, was sich im Kopf abspielt, war ich erstaunt über die Verbesserungen, die allein daraus resultierten, dass ich dem Schüler sagte: »Vergiss alles, was Du über das Schlagen eines Tennisballes zu wissen glaubst.« Außerstande zu vergessen, was er wirklich wusste, konnte er nur vergessen, was er zu wissen glaubte. Eine natürliche Leichtigkeit kam in sein Spiel. Aber das Inner Game ist nicht schon mit einer einzelnen Anweisung gewonnen. Die innere Opposition ist viel zu listig und viel zu fest verankert in unserer Psyche, als dass sie sich so leicht ausschalten ließe.
Nach einigen Jahren hatten die Voraussetzungen für das Inner Game beim Tennis Konturen angenommen. Die Hauptursache für Fehler beim Tennis liegt im Kopf des Spielers. Zweifel, Verkrampfung und Konzentrationsdefizite sind problematischer als technische Mängel. Aus diesem Grund fand ich es als Trainer viel wirkungsvoller, von innen nach außen zu arbeiten, die mentalen Ursachen von Fehlern zu beheben, anstatt an äußerlichen Symptomen herumzukurieren. Immer wieder beobachtete ich, dass die Ausschaltung eines einzigen Selbstzweifels umgehend in zahlreiche technische Verbesserungen im Schwung und im gesamten Spiel mündete. Diese Veränderungen ereigneten sich spontan und ungezwungen. Sie erforderten weder technische Anweisungen noch die ständige Forderung, Selbstanalyse zu betreiben, wie sie mein Training zu Beginn ausgezeichnet hatten. Auf dem Tennisplatz waren damit Methoden zur Bekämpfung der meisten mentalen Probleme, unter denen Spieler leiden, gefunden. Und sie hatten sich als wirkungsvoll erwiesen. Jetzt war ich herausgefordert, praktische Wege zu erarbeiten, die Gleiches im Bezug auf die physischen Erfordernisse und den mentalen Druck beim Golfspiel leisteten.
GOLF IST EIN INNER GAME
Als ich Golf regelmäßig zu spielen begann, erkannte ich, dass es die Effektivität des Inner Game in besonderem Maße herausforderte. Welches andere Spiel führt zu solcher Verkrampfung und Angst? Wie das eigene Kind weiß es uns auf unglaubliche Weise für sich zu gewinnen – und zugleich enthüllt es jede Schwäche unseres Geistes und Charakters, gleich wie gut diese verborgen ist. An uns liegt es, ob wir diese Schwäche überwinden oder uns von ihr überwältigen lassen. Nur wenige Spiele bieten eine so ideale Arena, um uns mit Hindernissen zu konfrontieren, die unsere Lernfähigkeit beeinträchtigen, unsere Leistung und unsere Freude am Leben – auf dem Golfplatz und außerhalb. Um damit fertig zu werden, muss der Golfer die Herausforderung des Spiels sowohl im Kopf wie mit dem Körper annehmen. Er muss nicht nur Bunker und Ausgrenzen wahrnehmen, sondern auch die mentalen Hindernisse.
Erste Aufgabe ist beim Inner Game Golf das Erkennen der mentalen Anforderungen, die das Golfspiel provoziert. Es gibt deren viele in ganz unterschiedlichen Facetten. Aber im Wesentlichen handelt es sich dabei um fünf Kategorien: die Verlockungen des Spiels für das Ego, die notwendige Präzision, den Druck bei Turnieren, die ganz spezielle Geschwindigkeit des Spiels und die Zwangsvorstellung von der idealen Technik.
DIE VERLOCKUNG DES GOLFSPIELS
Früh entdeckte ich die verführerische Qualität des Golfspiels, über die kaum eine andere Sportart verfügt. Im Augenblick der Frustration schwört mancher Golfer, sein Bag an den Nagel zu hängen. Doch kaum einer tut das. Aus irgendeinem Grund erinnert man sich der zwei oder drei »Triumphe« auf einer Runde, während die ärgerlichen Fehlschläge und das dumpfe Mittelmaß längst vergessen sind.
Ich sah, dass die Anziehungskraft des Spiels teilweise auf den Resultaten beruhte, die oft nichts anderes als pures Glück waren. Golf ist eine der wenigen Sportarten, in denen ein Anfänger für eine Sekunde mit einem Champion gleichziehen kann. Ein Nichtsportler, der erstmals Golf spielt, kann einen 15-Meter-Putt auf dem ersten Grün einlochen und zu dem Schluss gelangen: Golf ist ein einfaches Spiel. Selbstüberschätzung kann sich breit machen. So kann ein Zwanzigjähriger mit ziemlich guter Koordination seinen ersten Abschlag 230 Meter weit mitten aufs Fairway hämmern und auf dem Weg zu seinem Ball zu der Ansicht gelangen, dass er in kurzer Zeit reif für die Tour ist. An irgendeinem Tag könnte mein 75-jähriger Vater ein Resultat erzielen, das besser ist als das von Jack Nicklaus bei einer Katastrophenrunde. Selbst als Anfänger konnte ich an irgendeinem Loch mit zwei Schlägen auf dem Grün sein, den Ball mit einem Putt versenken und ein Birdie machen – ein Resultat, wie es sich selbst Spitzenspieler wünschen. Das Problem bestand natürlich darin, dass mir das nur selten gelang. Und in meiner Naivität verführten mich meine guten Löcher zu dem Glauben, ich könnte mit den Besten mithalten. Und die schlechten Löcher, die unausweichlich folgten, konnten meine eitlen Hoffnungen in Verzweiflung wandeln. Das kommt bei den meisten anderen Sportarten nicht vor. Ich bin ein besserer Tennis- als Golfspieler. Wenn ich jedoch gegen Pete Sampras an meinem besten Tag spielen würde, während er seinen schlechtesten hätte, würde ich nicht viele Punkte holen, noch viel weniger Spiele oder Sätze. Eine realistische Einschätzung meiner golferischen Qualitäten fiel mir am Anfang gar nicht leicht.
Nach nur wenigen Stunden auf der Driving Range erkannte ich, dass die unglaubliche Anziehungskraft des Spiels mir auch seine wesentliche Frustration bescherte. Obwohl ich seit meinem dreizehnten Lebensjahr nur wenig Golf gespielt hatte, gelang es mir ab und zu, den Ball 210 Meter geradeaus zu schlagen. Der Anblick des Balls, der hoch und zielsicher durch die Luft schoss, war begeisternd; er vermittelte mir ein Gefühl von Meisterschaft und Kraft. Der Frust rührte daraus, dass ich diesen Ballflug nicht nach Belieben reproduzieren konnte. Angestachelt von unendlicher Hoffnung unterdrückte ich meinen Ärger über Fehlschläge und schlug Ball um Ball. Ich wollte jene Begeisterung
noch einmal fühlen, wollte beweisen, dass mein Körper zu dem im Stande war, was er bereits gezeigt hatte. Ich hatte angebissen. Wenn ich mich auf der Driving Range umsah, stellte ich fest, dass es anderen genauso ging. Da standen wir nun, brachten viel Zeit und Geld auf, um jenen flüchtigen und zugleich quälenden perfekten Schwung zu erhaschen, der voraussagbare Resultate verhieß. Und immer wieder wurden wir mit der bedrückenden Wahrheit konfrontiert, dass wir einfach die gewünschte Selbstkontrolle nicht hatten, von der wir glauben, dass wir sie haben sollten. Das Ganze hätte nicht so wehgetan, wenn wir nicht ein paar ausgezeichnete Schläge gemacht hätten. Sie hatten uns das grausame Wissen vermittelt: Wir haben die Fähigkeit in uns, irgendwo, irgendwie.
Ich begann, die Faszination des Dr. F. zu verstehen und zu teilen. Golf schien meine Hoffnungen nur zu heben, um sie dann zu zerschmettern. Golf schmeichelte meinem Ego nur, um es dann zu zerquetschen. Wo lag hier der Spaß? War das Spiel zu bezwingen? Und was würde das bedeuten? Könnte ich zumindest lernen, mich an Golf zu erfreuen und ohne Enttäuschungen zu spielen? Ich fühlte: Wenn ich das schaffe, habe ich einen bedeutenden Sieg errungen.
PRÄZISION
Der quälendste Aspekt meines Spiels war zweifellos die mangelnde Konstanz. Ich konnte einen Ball 35 Meter links vom gedachten Ziel hooken und beim nächsten Schlag, scheinbar mit demselben Schwung, um 35 Meter nach rechts slicen. Noch beunruhigender war es, wenn ich einen Ball vom Abschlag weit und mitten auf das Fairway abschlug und beim nächsten Abschlag den Ball derart toppte, dass er nur ein paar Meter weit über das Gras hoppelte. An mangelnde Konstanz war ich im Tennis gewöhnt. Aber sie hatte bei weitem nicht diese Bandbreite. Ich konnte ein As schlagen, auf das ein Aufschlag folgte, der einen Meter zu lang war. Aber ich schlug nicht den ersten Ball ganz unten ins Netz und den nächsten hoch in den Zaun der Umrandung. Aber genau das passierte mir vergleichsweise damals auf dem Golfplatz. Es hatte den Anschein, als erfordere gutes Golfspiel eine viel größere Selbstdisziplin als gutes Tennis. Der Grund für die enge Bandbreite, innerhalb derer Fehler gestattet sind, liegt auf der Hand: das Tempo des Schlägerkopfes, das nötig ist, um den Ball weit zu schlagen. Die Geschwindigkeit des Arms beim Durchschwung ist nicht viel größer als die des Arms eines Tennisspielers beim Aufschlag. Aber wegen der größeren Länge und Flexibilität des Golfschlägers ist das Tempo des Schlägerkopfes wesentlich höher. Wenn ein Schlägerkopf bei einem Tempo von über 160 km/h ein oder zwei Grad offen steht, kann es sein, dass der Ball sein Ziel um einige zehn Meter verfehlt. Angesichts dieser Tatsache überrascht es schon, dass der Ball überhaupt einmal dorthin fliegt, wohin er soll.
Beim Tennis ist der Aufschlag der einzige Schlag, der vom Spieler initiiert wird. Der Golfer ist dagegen für jeden Schlag allein verantwortlich. Interessanterweise hat man beim Tennis einen zweiten Aufschlag. Golf verzeiht keinen Fehler! Außerdem bearbeitet man beim Tennis einen viel größeren Ball mit einer viel größeren Schlagfläche, um ihn viel weniger weit zu schlagen. Die Hinwendung zum Golf verlangte deutlich einige Feineinstellung hinsichtlich der Konzentration.
Die im Golf notwendige größere Präzision wird auch durch die Weise gekennzeichnet, in der der Ball angesprochen wird. Der Tennisspieler kann sich ziemlich lässig oder großspurig an der Aufschlaglinie aufbauen, den Ball ein paar Mal aufspringen lassen und dann servieren. Die meisten Golfprofis zeigen viel mehr Selbstdisziplin. Sie treten jedesmal in derselben, fast schon ritualisierten Weise an den Ball heran. Auch in ihrer Kleidung scheinen sie pedantischer zu sein. (Mich beschleicht oft das Gefühl, ich könne bei einer Cocktailparty Golf- von Tennisspielern unterscheiden.)
Pedanterie war niemals meine starke Seite. Es gibt kein Foto von mir als kleiner Junge, bei dem nicht mindestens ein Schuh offen ist. Ich konnte meist alle Probleme bei einer Mathematikarbeit lösen, hatte jedoch selten eine Eins, weil ich oft nachlässig bei der Berechnung war. Ich fragte mich daher, ob ich jenen Grad an Disziplin erreichen würde, der für Golf anscheinend nötig ist. Zu Beginn betrachtete ich Golf daher als Herausforderung an meine Fähigkeit, mich in Sachen Disziplin zu verbessern. So recht begeistern konnte mich diese Aufgabe nicht.
Die fürs Golfspiel notwendige Präzision erlaubt nicht, aufgestauten Ärger und Frust derart zu entlassen, wie das aggressivere Sportarten tun. Golf produziert Frust. Aber damit
muss man auf irgendeine Weise vor dem nächsten Schlag fertig werden. Das bedeutet eine faszinierende Herausforderung für das Inner Game.
DRUCK
Ich habe einen mäßigen Tag auf dem Tennisplatz und verliere 6:3, 6:3. Diese Erniedrigung kann ich für mich lindern, indem ich mir sage, dass mein Gegner an diesem Tag besonders stark gespielt hat. Der Golfer kann das nicht. Für Blamage oder Triumph ist allein er selbst zuständig. Und zumeist hat er noch drei Leute bei sich, die ihm die jeweilige Leistung attestieren können. Das Ego blüht oder verwelkt in dieser Situation.
Jeder Schlag beim Golf zählt. Im Tennis kann ich drei Punkte hintereinander verlieren und trotzdem das Spiel gewinnen. Im Endresultat werden viele verlorene Punkte gar nicht erst auftauchen. Tennis vergibt ein paar Fehler. Golf verzeiht keinen einzigen. So steht man scheinbar immer unter Druck.
Golf ist von Natur aus ein Spiel des Golfers gegen sich selbst. Dadurch wird das Inner Game intensiviert. Das Ego wird sowohl mehr herausgefordert als auch bedroht. Die Laune des Spielers steigt oder sinkt in direkter Abhängigkeit von seinem Resultat, das allein ein Produkt seiner eigenen Anstrengungen ist. Wenn ich auch schon viele Golfer erlebt habe, die den Druck abbauten, indem sie dem Wetter oder dem Platz die Schuld gaben, den Schlägern, den Bällen, anderen Spielern, Familien- oder Arbeitsproblemen, so glaube ich doch nicht, dass sie sich dauerhaft selbst täuschen konnten. Irgendwann erkannten sie, dass Golf ein Spiel gegen den Platz und gegen sich selbst ist und dass der Score ziemlich genau die tatsächlichen Fähigkeiten widerspiegelt.
Während ich viele Golfer gesehen habe, die unter diesem Druck leiden, habe ich oft auch festgestellt, dass es genau dieser Druck ist, der Golfer auf den Platz zieht. Es ist so etwas wie eine Regel, dass Golfer die schwereren Kurse den leichteren gegenüber bevorzugen. Manche erhöhen den bereits vorhandenen Druck, indem sie Wetten abschließen, »nur um das Spiel interessanter zu machen«.
Lernen, wie man unter Druck Leistung bringt, ist ein erklärtes Ziel von Inner Game. Die Herausforderung, einen 1,50-Meter-Putt
am 18. Loch zu versenken, um das Par zu retten und das Match zu gewinnen, ist viel mehr mentaler denn physischer Natur. Ein Spieler, der lernt, präzise und kraftvoll auch unter solchem Druck zu handeln, erwirbt eine innere Fähigkeit, die es ihm erlaubt, auch mit anderen Situationen in seinem Leben fertig zu werden.
GESCHWINDIGKEIT
Das Tempo beim Golfspiel ist einmalig und ein offensichtlicher Kontrast zu der Geschwindigkeit der meisten anderen Sportarten. Im Tennis beispielsweise mögen selbstkritische oder negative Gedanken kurz aufkommen – aber man muss sich umgehend von ihnen verabschieden, weil man auf den nächsten Ball zu reagieren hat.
Auf dem Golfplatzhaben wir zu viel Zeit zum Nachdenken. Zwischen den Schlägen können sich ganze Gedankenwolken breit machen: Was ging beim letzten Schlag schief? Wie korrigiere ich meinen Slice? Was passiert mit meinem Score, wenn ich mit dem nächsten Schlag im Aus lande? Es gibt endlos viel Zeit zur Überanalyse. Man wird verwirrt, entmutigt oder sauer.
Der Tennisspieler wird ständig auf Trab gehalten. Er bewegt sich, schlägt den Ball. In vier Stunden auf dem Platz absolviere ich um die 64 Spiele. Bei rund 100 Punkten komme ich vielleicht auf 1200 bis 1500 Schläge. Wenn jeder Golfschlag zwei Sekunden dauert, dann schwinge ich den Schläger insgesamt nur drei Minuten bei einer Runde von vier Stunden. Die Konzentration beim Golf bedarf darum einer ganz speziellen Art der Anstrengung. Der Ball liegt einfach nur da, und der Golfer muss sich völlig auf den Schwung konzentrieren. Keinesfalls darf er sich durch die großen Abstände zwischen zwei Schlägen ablenken lassen. Beim Tennis baute sich meine Konzentration während des Ballwechsels auf. Sie erreichte ihren Höhepunkt, wenn ich ganz in der Aktion aufging. In den großen Pausen zwischen zwei Schlägen beim Golf geschieht es viel leichter, dass die Gedanken abschweifen. Ich kam zu dem Schluss, dass der Weg zum nächsten Schlag zu den kritischsten Faktoren beim Golfspiel gehört. Während dieser Zeitraum von manchen Profis sowohl als mentales Hindernis wie auch als Vorteil verstanden wird, habe ich das Gefühl, dass die meisten Golfer seine Bedeutung unterschätzen. Gerade in diesem Zeitraum werden die meisten Spiele verloren – in der Wirklichkeit
wie im Kopf. In dieser Zeitspanne kann das mentale Gleichgewicht des Golfers durch eine Flut negativer Gedanken gestört werden oder damit beschäftigt sein, die Verkrampfung vom letzten Schlag abzulegen und sich auf den nächsten vorzubereiten. Der Golfer mit einem guten Inner Game nutzt die Zeit zwischen zwei Schlägen, um sich mental zu entspannen und die totale Konzentration aufzubauen, die er für die zwei Sekunden des nächsten Schwungs braucht. (Dieses Thema wird in Kapitel 8 weiter behandelt.)
TECHNIK
Lange Zeit hatte ich die Ansicht vertreten, dass die mechanischen Abläufe des Tennisschwungs übermäßig analysiert werden. Dann schaute ich in die vorhandenen Golflehrbücher. Es würde mich nicht überraschen, wenn man feststellte, dass mehr über die Technik des Golfschwungs geschrieben worden ist als über irgendeine andere Bewegung des Menschen. Der Schwung wird in seine kleinsten Bestandteile zerlegt und die anfallenden Informationen werden in die ohnehin schon übervollen Köpfe der Golfschüler gepfropft. Als ein Freund hörte, dass ich mit dem Golfspiel anfangen wollte, präsentierte er mir drei Wälzer: 295 Golfstunden von Bill Casper, 385 Golfstunden von Gary Player, 495 Golfstunden von Arnold Palmer. Es ist nicht zu übersehen, welche Blüten der Aberglaube im modernen Golf treibt. Viele Golfer sind beständig auf der Suche nach dem »Geheimnis«. Endlose magische Formeln werden von den wahren Gläubigen propagiert. Der Golfer ist bereit, jeden Tipp auszuprobieren, um seinen Frust loszuwerden, und er macht sich die schönsten Hoffnungen, wenn ein paar Schläge dann klappen. »Es funktioniert!«, denkt er bei sich. »Ich weiß jetzt, was ich machen muss«, ruft er aus. Mein Vater kann als Zeuge dafür herhalten. Aber wie lange funktioniert eine magische Formel? Das »Geheimnis« wird bereits nach ein paar schlechten Schlägen verworfen, und die Hoffnungen schwinden. Jetzt ist der Golfer offen für den nächsten Tipp. Gewiss, ein kleiner Tipp kann schon einmal ganz hilfreich sein. Aber die alles umfassenden Rezepte machen nur Hoffnung darauf, dass man ein Spiel in den Griff bekommt, das niemals dank einer einzelnen Anweisung zu meistern ist. Ich bin überzeugt, dass die glücklichsten und besten Golfer jene sind, die erkannt haben, dass einzelne Rezepte nicht funktionieren. Sie wissen, dass gutes Golf Geduld und Demut sowie ständiges Training der Technik und des Inner Game voraussetzt.
Dies ist also die Situation, der sich die arglose Seele gegenübersieht, wenn sie sich dem Golfspiel zuwendet. Das Ego des Neulings wird angezogen von den reichlichen psychischen Belohnungen, die Erfolg in diesem Sport verheißen, und es fürchtet die Schande, falls ein akzeptables Spielniveau nicht erreicht wird. Bei seinen ersten Runden wird der Neuling genügend gute Schläge gemacht haben, um künftiges Heldentum bereits spüren zu können: Nur noch etwas Beständigkeit braucht es, um die gelegentlich guten Schläge zu einem wirklich ordentlichen Score zu addieren. Leider weiß der Neuling nicht, dass die mechanischen Abläufe dieses Spiels die Wahrscheinlichkeit, die guten Schläge beständig zu wiederholen, gegen Null tendieren lassen. Zudem wird er umgeben sein von Propheten, die über die mentalen und technischen Rezepte verfügen, um ihn von seinen üblen Schlägen zu erlösen, um ihm das Tor weit zu öffnen, hinter dem der Himmel guten Golfspiels liegt. Verwirrt von der langen Liste der »So macht man's« und »So macht man's nicht«, die von seriösen Grundlagen bis zu abergläubischer Magie reicht, wird er dazu neigen, jeden Schlag zu analysieren und jeden Fehler zu korrigieren. Dann wird er an der Korrektur herumkorrigieren. Zwischen zwei Fehlschlägen hat er alle Zeit der Welt, nachzudenken und seine Verkrampfung sowie seinen Zweifel zu verstärken. Nach einem guten Schlag versucht er zu analysieren, wie er ihn wiederholen kann. Dies alles im Kopf eines einzelnen Menschen in Kombination mit den Anspannungen des heutigen Lebens führt letztlich dazu, dass Golf ein zugleich faszinierendes und gefährliches Spiel ist.
DAS INNER GAME BEIM GOLF
Dieses Buch geht davon aus, dass man einige Kontrolle über seinen Kopf gewinnen muss, um Kontrolle über den Körper zu erlangen. Ein grundsätzliches Verständnis der Technik kann hilfreich sein und gewiss ist ein bestimmtes Maß an physischer Koordination erforderlich, um gutes Golf zu spielen. Aber die Unterschiede in Sachen Talent sind noch kein Grund dafür, dass wir auf der Driving Range so viel besser schlagen als in der Hitze eines Wettkampfs. Sie sind auch kein Grund für unsere so unterschiedlichen Scores. Ziel des Inner Game ist es, die unnötig große Lücke zwischen unserem Potenzial und unseren tatsächlichen Leistungen zu schließen, um beständiger Freude am Spiel zu empfinden.
Derart liegt die Herausforderung des Golfspiels mehr in den ungeklärten Aspekten des Inner Game als in den praktischen Abläufen. Das Interesse an der mentalen Seite des Golfspiels nimmt zu, wie sich in Büchern und Artikeln zu diesem Thema zeigt. Ein regionaler PGA-Bildungsdirektor, der mich bat, bei einem PGA-Treffen eine Rede zu halten, erklärte mir, die Golflehrer hätten inzwischen den Punkt erreicht, dass sie ihre technischen Analysen eindämmten und ihre Aufmerksamkeit mehr der mentalen Seite des Sports zuwendeten. »Wir wissen eine Menge über den Schwung«, sagte ein Golflehrer zu mir, »aber nicht viel über die Methode, wie man Golfern beim Erlernen dieses Schwungs hilft.«
Das war nicht einfach so dahingesagt. Die Frage, wie man Selbstzweifel, Konzentrationsfehler, Ärger und geringes Selbstwertgefühl überwindet, stellt sich sehr real. Solche Begleiter sind ein sehr unangenehmes Handicap. Am liebsten würden wir sie vergessen.
Aber wir können nicht so ohne weiteres ein gutes Inner Game spielen. Es handelt sich dabei um einen Prozess, der fortdauernd auf dem Golfplatz abläuft. Es geht nur darum, ob wir dieses Spiel bewusst spielen, nicht darum, ob wir es gewinnen oder verlieren. Wer das Gefühl hat, seine Leistung entspräche immer seinem Potenzial, wer sich seiner Golferfahrung erfreut und aus ihr lernt, dem möchte ich herzlich gratulieren: Er hat das Inner Game gewonnen. Alle anderen, mich eingeschlossen, die sehr unterschiedliche Runden unter sehr unterschiedlichen Umständen absolvieren, haben noch den Feind in sich und müssen das Inner Game spielen lernen.
Die fundamentale Herausforderung für den Golfer besteht darin, das Vorhandensein von Störquellen zu erkennen. So ist eher der Sieg im Inner Game das Ziel als die Herrschaft über den Golfplatz.
Dieses Buch beschreibt auf praktische Weise, wie man Prinzipien und Techniken des Inner Game ins Golfspiel integriert. Die Übungen sind weder Tricks noch Tipps. Vielmehr sollen sie helfen, die drei wesentlichen inneren Fertigkeiten zu entwickeln: Aufmerksamkeit, Entscheidungskraft und Vertrauen. Weil viele dieser Übungen entwickelt wurden, während ich versuchte, das Golfspiel zu lernen, enthält dieses Buch an manchen Stellen kurze Beschreibungen meiner inneren und äußeren Kämpfe sowie der Entwicklung meines Golfspiels.
Das nächste Kapitel beginnt mit meinen Bemühungen, Beständigkeit in meinem Schwung zu erlangen, um mein durchschnittliches Ergebnis von 100 und mehr um zehn Schläge zu reduzieren. Ich erreichte das mit Hilfe einer Konzentrationstechnik aus »The Inner Game of Tennis«, die ich in angepasster Form übernahm. Deren Formel lautet: »Hinten, Unten, Oben.«
Kapitel II
Unter 90 mit Hinten, Unten, Oben
In »The Inner Game of Tennis« (Tennis und Psyche) schrieb ich: »Entspannte Konzentration ist der Schlüssel zu Vortrefflichkeit bei allem.« Ich erkannte, dass Golf für das Aufrechterhalten dieser Konzentration eine weit schwierigere Herausforderung als Tennis darstellt. Als ich begann, das Inner Game beim Golf zu erforschen, wusste ich nicht, dass es sich dabei um eine nicht ganz neue Thematik handelte. Da sich fast die gesamte Golflehre zu jener Zeit offenbar auf die Technik konzentrierte, war ich überrascht, als ich auf einen Artikel mit der Überschrift »Die mentalen Hindernisse des Golfspiels« stieß. Er war 1929 vom legendären Bobby Jones für Vanity Fair verfasst worden. Der Artikel trug den Untertitel: »Einige Gedanken über Ängste, Nerven, Temperament und Konzentrationsmangel beim Golfspiel.« Hier ein paar Auszüge:
Golf ist sicherlich ein verwirrendes Spiel. Sogar die besten Golfer können nicht auf den ersten Abschlag treten, ohne sich zu vergewissern, was sie tun werden ... Man sollte meinen, dass ein Mensch, der schon tausende Golfbälle korrekt geschlagen hat, in der Lage ist, diese Leistung beliebig zu wiederholen. Aber das ist sicher nicht der Fall.
Der Golfschwung ist eine höchst komplizierte Kombination von muskulären Aktionen – zu komplex, um durch objektive, bewusste Bemühung gesteuert zu werden. Darum müssen wir uns zu einem guten Teil auf instinktive Reaktionen verlassen, die wir bei ausgiebigem Training erworben haben. Nach meiner Erfahrung können wir uns desto mehr auf unseren Instinkt verlassen und auf desto bessere Resultate hoffen, je stärker wir uns den Gedanken von der bewussten Kontrolle aus dem Kopf schlagen.
Diese intensive Konzentration auf das Resultat und den absoluten Ausschluss alles Denkens sind methodisch das Geheimnis eines guten Schlags. Nur wenige großartige Schläge kommen zu Stande, wenn der Kopf auf die Stellung der Füße, das Verhalten des linken Arms etc. fixiert ist.
Beim Schlagen eines Golfballs hilft es immer, wenn der Spieler in der Lage ist, alle Sorgen im Hinblick auf das Ergebnis seiner Bemühung auszuschalten – zumindest während des gesamten Schwungs ... Nach Einnahme des Standes ist es zu spät, sich Sorgen zu machen. Dann geht es nur noch darum, durch den Ball zu schlagen.
Selbst mit Hilfe eines erstklassigen Golflehrers ist es nicht leicht, einen zuverlässigen Golfschwung zu entwickeln. Aber es ist möglich und machbar, eine mentale Einstellung zum Golfspiel zu kultivieren, dank deren man die eigenen Fähigkeiten voll ausschöpfen kann.
Diese Feststellungen deckten sich mit meinen Erfahrungen, die ich beim Lehren von Konzentration im Tennis gewonnen hatte. Ich erkannte, dass meine vermeintlichen Entdeckungen gar nicht so neu waren und auch schon von vielen anderen gemacht worden waren – vielleicht von jedem, der in seinem Bereich wirklich Überragendes geleistet hatte. Letztlich handelt es sich um das simple Problem der Kontrolle. Aber die meisten Dinge, die etwas ganz Besonderes verlangen, sind zu komplex, wie Bobby Jones beobachtete, um »durch objektive, bewusste mentale Bemühung gesteuert zu werden«.
SELBST 1 UND SELBST 2
Einen wesentlichen Durchbruch für mein Verständnis vom Problem der Kontrolle über Geist und Körper erzielte ich als Tennislehrer, als mir bewusst wurde, dass mein Kopf während des Spiels beständig Kommentare abgibt. Ich bemerkte, dass meine Schüler einem ähnlichen Fluss selbst belehrender Gedanken beim Unterricht ausgesetzt waren: Jetzt aber, führe den Schläger früher zurück ... Den letzten Ball hast du schon wieder zu spät getroffen ... Geh etwas in die Knie bei solchen Volleys ... Oh, oh, da kommt wieder ein Ball so hoch auf meine Rückhand, wie ich ihn eben schon nicht richtig getroffen habe ... Diesmal muss ich ihn treffen ... Mist! Wieder nicht richtig ... Wann treffe ich so einen Ball endlich einmal richtig? ... Schau auf den Ball, schau auf den Ball ... Was erzähle ich meinem Doppelpartner, wenn ich dieses Match verliere?
Als ich mich eingehender mit den Gedanken beschäftigte, die mir bei einem Tennismatch durch den Kopf gingen, stellten sich mir die Fragen: »Zu wem spreche ich? Wer spricht da eigentlich?« Überrascht konstatierte ich, dass ich offenbar zumindest über zwei Identitäten verfügte. Die eine spielte Tennis. Die andere analysierte. Ich beobachtete, dass ein Teil von mir, eine Art Kommentar-Identität, die ich Selbst 1 nannte, alles über das Spiel wusste und Selbst 2, die Spiel-Identität, überwachte. Selbst 1 gab nicht nur Selbst 2 Anweisungen, sondern kritisierte es auch für gemachte Fehler, warnte vor zukünftigen Problemen und hielt Strafpredigten nach Fehlschlägen. Das Verhältnis zwischen Selbst 1 und Selbst 2 war in erster Linie von Misstrauen geprägt. Selbst 1 traute Selbst 2 den korrekten Schlag nicht zu; entsprechend dem Grad an Misstrauen versuchte Selbst 1 Selbst 2 dazu zu zwingen, den verbalen Anweisungen zu folgen. Ich stellte fest, dass bei zunehmendem Vertrauen auf meine Fähigkeit, den Ball gut zu schlagen, die Instruktionen von Selbst 1 an Selbst 2 abnahmen und Selbst 2 ganz gut ohne Selbst 1 zurecht kam.
Als ich mir des Selbst 1 bewusst geworden war, wurde es immer deutlicher, dass diese kritische Stimme, die in meinem Kopf wie ein Feldwebel herumbrüllte, meinem Tennis gar nicht zuträglich war. Selbst 1 war mir eher Hindernis denn Hilfe. Ich suchte nach Wegen, um die Störungen durch Selbst 1 zu vermindern; ferner wollte ich herausfinden, was passierte, wenn ich mich auf das Potenzial von Selbst 2 verließ. Ich fand heraus: Wenn ich Selbst 1 zum Schweigen brachte und Selbst 2 ungestört spielen ließ, verbesserten sich meine Leistung und mein Lernfortschritt wesentlich. Mein Selbst 2 war wesentlich kompetenter, als mein Selbst 1 annahm. Ich stellte ferner fest, dass ich als Lehrer das anweisungshungrige Selbst 1 eines Schülers nicht mit allzu vielen technischen Instruktionen füttern durfte, sondern Vertrauen in die Fähigkeiten seines Selbst 2 setzen musste. Der Fortschritt meiner Schüler steigerte sich dadurch um das Drei- bis Vierfache und sie lernten mit viel weniger Frust.
Kurz: Ich fand heraus, dass Selbst 1 – das sprechende, Gedanken produzierende Selbst – ein schlechter Chef ist, wenn es um die Kontrolle über das Muskelsystem geht. Wenn das Selbst 2 – der Körper selbst – die Kontrolle übernimmt, verbessern sich die Qualität der Leistung, der Grad der Freude an der Betätigung und der Lernfortschritt.
Obwohl ich im Laufe der Zeit erkannte, dass Selbst 1 in Wirklichkeit eine Zusammensetzung verschiedener Ich-Identitäten ist, die zu verschiedenen Zeiten auftreten, erwies es sich als nützlich, all diese Elemente unter der Bezeichnung Selbst 1 als Störquelle in unserem Inneren zusammenzufassen. Um die Störung zu verkleinern und die Leistung anzuheben, war es nach meinem Empfinden nicht nötig zu analysieren, weshalb Zweifel, Furcht, Kritik oder Konzentrationsmängel auftraten. Es reichte aus, sie als Einmischung zu erkennen und das Denken auf etwas Reales in der unmittelbaren Umgebung zu konzentrieren. Aus dieser Erkenntnis wurde eine Reihe von Konzentrationsübungen für das Inner Game des Tennisspielers entwickelt.
Einige Leser von »The Inner Game of Tennis« haben Selbst 1 und Selbst 2 mit der populären Theorie, das Gehirn bestünde aus zwei Bereichen, verknüpft. Sie setzen Selbst 1 mit der rationalen, analytischen linken Gehirnhälfte und Selbst 2 mit der intuitiven rechten Gehirnhälfte gleich. Diese Verknüpfung mache ich mir nicht zu Eigen, denn beide Hälften sind Teile des menschlichen Körpers. Ich betrachte Selbst 2 als den gesamten menschlichen Organismus, als natürliche Ganzheit. Selbst 1 hat andererseits nicht wirklich eine physiologische Existenz. Es ist ein Phänomen mentaler Selbststörung, das in der Lage ist, über beide Hirnhälften zu stören – und das auch tut. Selbstzweifel beispielsweise können sich bei einer Mathematikarbeit wie in einem Tennismatch
einschleichen, auf dem Golfplatz wie beim Singen. Aber wenn sich der Kopf konzentriert und in der aktuellen Beschäftigung ganz aufgeht, wird die Störung minimiert und das Gehirn funktioniert (fast) so gut, wie es in unserer Macht liegt.
Ziel des Inner Game ist es also nicht so sehr, Selbst 2 zu seiner maximalen Entfaltung zu bringen, als vielmehr Selbst 1 zu veranlassen, dass es Selbst 2 an seiner maximalen Entfaltung nicht hindert.
Wie die meisten Tyrannen würde es Selbst 1 gar nicht gefallen, die Kontrolle zu verlieren. Es würde sich den Versuchen, seinen Einfluss zu minimieren, widersetzen. Der Prozess, die Kontrolle von Selbst 1 zugunsten von Selbst 2 zu verkleinern, erwies sich als Herausforderung. Er erforderte die Entwicklung von Konzentrationstechniken, die Selbst 1 mit nicht störenden Tätigkeiten beschäftigten und Selbst 2 bewusst erlaubten, den Ball zu schlagen. Sobald Selbst 1 auf eine Konzentrationsübung fokussiert war, verminderte sich sein Einfluss auf Selbst 2 wesentlich und die Leistung verbesserte sich umgehend.
ZAUBER DER ÜBUNG AUFPRALL-SCHLAG
Auf dem Tennisplatz war mir klar geworden: Es war nicht einfach, die Ermahnung von Bobby Jones, sich »den Gedanken von der bewussten Kontrolle aus dem Kopf schlagen«, zu beherzigen. Auch war es nicht leicht, sich auf »den absoluten Ausschluss alles Denkens« zu konzentrieren.
Im Tennis konzentriert man sich vor allem auf den Tennisball in Bewegung. Aber es reichte nicht, die Schüler aufzufordern, auf den Ball zu schauen. Wenn ich sie anwies, auf die sich drehenden Nähte des Tennisballes zu gucken, war der Grad der Konzentration höher. Die Schläge wurden geschmeidiger. Noch mehr brachte eine simple Konzentrationsübung ein, die ich »Aufprall, Schlag« nannte. Sie wirkte bei Spielern aller Leistungsklassen.
Bevor ich den Schülern Anweisungen gab, machte ich sie gewöhnlich mit der Übung bekannt, indem ich sagte, ihr Zweck sei es nicht, das Resultat, sondern die Wahrnehmung zu verbessern. Diese wichtige Fertigkeit im Rahmen des Inner Game ist hilfreich bei allen Betätigungen. Die Übung bestand darin, laut »Aufprall« zu rufen, wenn der Ball den Boden berührte, und »Schlag« in dem Moment, in dem der Schläger den Ball berührte. Sobald sich der Spieler dieser Übung befleißigte, waren sowohl sein Schwung verbessert als auch die Bewegung seiner Beine und seines Körpers. Entspannung und Fluss der Bewegung nahmen gewöhnlich merkbar zu. Die Spieler schlugen sogar schwierigere Bälle mit ziemlicher Mühelosigkeit, während ihr Bewusstsein ganz von der Kadenz der Aufprall-Schlag-Konzentration gefesselt war. Ich erkannte, dass es zwei grundsätzliche Kriterien für den Erfolg jeglicher Aufmerksamkeitsübung gibt. Zum Ersten musste sie interessant genug sein, um das Bewusstsein ganz auf sich zu ziehen und es von seinem normalen Muster der übertriebenen Kontrolle und Störung abzuhalten. Zweitens musste es eine nützliche Rückmeldung über Ball und Körper vermitteln, um eine besser koordinierte Bewegung zu ermöglichen.
Beim Golf hielt ich Ausschau nach einem simplen Ziel der Konzentration, das auf gleiche Weise mein Denken daran hinderte, den natürlichen Schwung und natürlichen Lernprozess zu stören. Golfspieler, die mit dem Buch »The Inner Game of Tennis« vertraut waren, fragten mich dasselbe, was auch ich mich fragte: »Was ist ‚Aufprall, Schlag' beim Golf?«
SUCHE NACH DER PASSENDEN ÜBUNG BEIM GOLF
Ich habe mit einer Reihe von Übungen für die Konzentration auf den Golfball herumexperimentiert: auf ein Dimple schauen, auf den Namensschriftzug, auf einen kleinen Schmutzfleck. All dies reichte nicht, mich für längere Zeit zu beschäftigen. Das Problem war: Der verflixte Ball lag einfach nur da. Auf ihn zu schauen langweilte schnell. Forcierte ich die Übung, strapazierte ich mein Gehirn und mein Schwung wurde steif. Der Zauber des »Aufprall, Schlag« hatte offensichtlich etwas zu tun mit der mentalen Faszination, die von der Bewegung und dem Rhythmus des Tennisballs ausgeübt wird. Auf einen Golfball war das nicht anzuwenden. Um einen Golfball zu schlagen, brauchte das Selbst 2 auch keine ständigen visuellen Rückmeldungen. Der Golfball bleibt liegen, bis man ihn schlägt. Die vollständige Bewegungslosigkeit des Golfballs, die so viel Zeit zum Nachdenken und Verkrampfen gibt, war genau das Merkmal, das Konzentration verhinderte.
Dann fand ich ein Konzentrationsziel, das hilfreicher war als alle anderen und darum hier erwähnt werden soll. Anstatt auf den Ball zu schauen, betrachtete ich die Rückseite des Balles in räumlicher Beziehung zu einem Grashalm gerade darunter. Indem ich beide im Auge behielt, konnte ich feststellen, wie sich mein Kopf während des Schwungs bewegt hatte. Wenn die relative Position von Ball und Grashintergrund sich zu stark veränderte, lag das daran, dass ich meinen Kopf zu stark bewegt hatte. Das half, bot aber noch nicht die gewünschte Antwort.
Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass beim Golf das wesentliche Konzentrationsziel nicht der Ball sein sollte, sondern der Schlägerkopf, das entscheidende, sich bewegende Objekt. Da war die Bewegung, da war Rückmeldung erforderlich, da war der Rhythmus, der das Bewusstsein faszinierte – und nicht beim Ball. Aber ich konnte dem Schlägerkopf nicht mit meinen Augen folgen. Wenn ich ihm meine Konzentration zuwenden wollte, musste ich meinen Gefühlssinn einsetzen. Ich wusste da noch nicht, wie schwierig das sein würde. In welchem Maß konnte ich tatsächlich fühlen, wie sich der Schlägerkopf beim Schwung bewegte? Ich entschied mich, auf die Driving Range zu gehen und dieses Schlägerkopf-Training auszuprobieren.
Anfangs hatte ich ziemlich wenig Ahnung davon, wo mein Schlägerkopf war. Ich stellte fest, dass ich seine Position besser fühlen konnte, wenn ich mich wenig sorgte, ob ich den Ball traf oder nicht. Ich versuchte, meine Augen zu schließen und zu schwingen; dadurch verstärkte sich mein Gefühl für den Schlägerkopf noch weiter. Die Bewegung des Schlägerkopfes wurde interessant genug, um meine Aufmerksamkeit während des gesamten Schwungbogens zu fesseln. Wenn ich nur einfach versuchte, den Schlägerkopf zu fühlen, und nicht, ihn zu kontrollieren, schien sich der Schläger von selbst zu bewegen – und die Resultate waren ausgezeichnet. Genauso war es beim Tennis gewesen, als sich meine Psyche stärker bemühte. Aber wenn ich meine Aufmerksamkeit teilte – sie zur Hälfte auf das Gefühl vom Schlägerkopf und zur anderen Hälfte auf die Kontrolle des Schwungs richtete –, waren die Ergebnisse nicht so gut.
HINTEN-UNTEN-OBEN
Um mein Gehirn auf den Schläger zu konzentrieren und nicht länger auf dessen Kontrolle, entwickelte ich die folgende Übung. Während ich meine Aufmerksamkeit auf das Gefühl richte, das der Schlägerkopf vermittelt, sage ich »Hinten«, sobald ich merke, dass der Schläger bei Vollendung des Rückschwungs den äußersten Punkt erreicht hat. Ich fühle dann einfach nur seine Position, ohne dass ich mich weiter darum kümmere, ob sie auch »korrekt« ist. Wenn die Schlagfläche auf den Ball trifft, sage ich sofort »Unten«. Schließlich sage ich »Oben«, wenn der Schläger nach Vollendung des Durchschwungs zur Ruhe kommt.
Diese Übung verschaffte mir eine Verbindung zum Schlägerkopf während des gesamten Schwungbogens und forderte mir so viel Konzentration ab, dass meine Aufmerksamkeit nicht unter irgendwelchen Selbst-1-Kommandos leiden konnte. Das Verweilen beim Schläger bis zum »Oben« erwies sich als besonders wirkungsvoll, um mein Selbst 1 davon abzuhalten, meinen Kopf vorzeitig zu bewegen und hinter dem Ball herzuschauen. Die Übung erforderte sogar noch mehr Konzentration als das visuelle »Aufprall, Schlag« beim Tennis. Eben weil sie mehr verlangte, war sie auch wirkungsvoller.