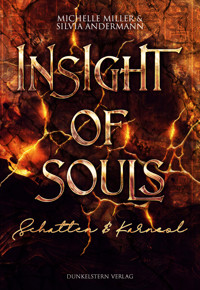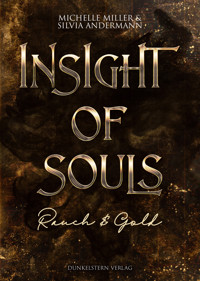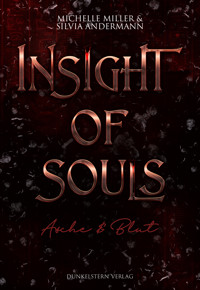
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dunkelstern Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Insight of Souls
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Auf wessen Seite stehst du, wenn die Apokalypse zum Greifen nahe ist? Von Alexander fehlt jede Spur und Nicolas hätte um ein Haar sein Leben verloren. Als die Gezeichneten plötzlich weltweit auftauchen, um die Nesweru auszulöschen, reist die Familie Krylow aus Russland zur Unterstützung an – und deckt ein dunkles Geheimnis auf, das Cassey und Natalie den Boden unter den Füßen wegreißt. Inmitten dieses Chaos' versuchen Cassey und Nicolas ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Doch Alastors Pläne sind tödlich und unaufhaltsam ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright 2024 by
Dunkelstern Verlag GbR
Lindenhof 1
76698 Ubstadt-Weiher
http://www.dunkelstern-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Covergestaltung: Fabula Coverdesign
Lektorat: Lektorat Mitternachtsfunke
Korrektorat: Nicole Gratzfeld
Satz: Bleeding Colors Coverdesign und Satz
ISBN: 978-3-98947-030-9
Alle Rechte vorbehalten
Für die Ewigen und die Endlichen. Für diejenigen unter euch, die in der Liebe ihren Halt gefunden haben. Auf dass ihr Casseys Tapferkeit, Nicolas’ Sanftmut, Natalies Fürsorglichkeit und Graysons Entschlossenheit immer in euren Herzen tragen werdet.
Inhalt
Content Notes
1 - Cassey
2 - Cassey
3 - Nicolas
4 - Nicolas
5 - Cassey
6 - Nicolas
7 - Cassey
8 - Nicolas
9 - Cassey
10 - Nicolas
11 - Nicolas
12 – Nicolas
13 – Cassey
14 - Cassey
15 – Nicolas
16 – Cassey
17 – Nicolas
18 – Nicolas
19– Grayson – 7 Tage zuvor
20 – Cassey
21 – Cassey
22 – Cassey
23 – Grayson
24 – Nicolas
25 – Nicolas
26 – Cassey
27 – Cassey
28 – Cassey
29 - Nicolas
30 – Nicolas
31 – Nicolas
32 – Nicolas
33 – Cassey
34 – Cassey
Epilog
DANKSAGUNG
Content Notes
Content Notes
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr am Ende des Buchs eine ausführliche Liste. Wir wünschen euch ein angenehmes Leseerlebnis.
Michelle, Silvia & der Dunkelstern Verlag
1 - Cassey
Hier im Krankenhaus existiert keine Nacht, keine Dunkelheit. Diese Flure kennen keine Zeit. Es ist immer taghell, immer geräuschvoll, immer etwas los. Als wolle man so jegliches Böse verdrängen, das aus den Schatten der Nacht hervortritt und an die Türen klopft.
Doch ich lasse die Finsternis herein, heiße sie in meinem Inneren willkommen. Eine Galaxie aus dunklem Nichts. Ein schwarzes Loch, das immer größer und betäubender wird, umso länger ich hier sitze; umso mehr Erinnerungen diese Finsternis hervorgräbt.
Erinnerungen an Nicolas’ Lachen, seine liebevollen Blicke, seine wohltuenden Worte. An seine Zärtlichkeit, seine Fürsorge, seine Sturheit. Das gemeinsame Tanzen, zusammen Musik hören, miteinander reden, einander necken. Seine blöden Zitate aus Klassikern oder Musicals.
Dann sind da aber auch noch andere Erinnerungen, die sich hineinschleichen. Momente, in denen ich ihn an den Rand der Verzweiflung gebracht und verletzt habe, in denen die Hoffnung aus seinen Augen schwand. Trauer, die sein Gesicht zeichnete – ein müdes Gesicht. Schmerzerstickte Schreie. Erniedrigung. Blut … so viel Blut.
Nicolas wollte mir nie wehtun und dieses Versprechen konnte er bis zum letzten Atemzug einhalten, doch ich …
Ich kneife die Augen zu, weil der Kloß in meinem Hals schmerzt. Sogleich schmiegt sich eine zarte, warme Hand in meine linke Ellenbeuge und ich sehe auf. Meine Schwester schenkt mir ein aufbauendes Lächeln. Dunkle Schatten liegen unter ihren Augen. Die Müdigkeit tut der Nervosität in ihrem Gesicht jedoch keinen Abbruch. Eigentlich müssten wir schon auf dem Weg nach Long Beach sein. Dennoch stand für sie außer Frage, nach Nicolas zu sehen.
Mein Versuch, ihr Lächeln zu erwidern, geht mächtig schief. Ich würde ihr gerne versichern, dass alles gut ist, aber meine Lippen fühlen sich seit Stunden zu schwer an, um auch nur einen Ton zu sagen.
Ihre himmelblauen Augen fokussieren etwas in meinem Schoß und sofort erstarren meine Finger. Ich folge ihrem Blick auf die Tafel Bitterschokolade. Die Lasche der Folie ist in gleichmäßigen Abständen eingerissen. Ich ziehe meine Hände zurück und lege sie anschließend flach darüber. Es kostet mich Kraft, ruhig sitzen zu bleiben, während sich die Welt um mich herum ungerührt weiterdreht.
Urplötzlich erhebt sich Charles Greenwood rechts von mir. Er war die ganze Zeit über so schweigsam, dass ich ihn völlig ausgeblendet hatte. Dabei ist er seit Verlassen von Greenwood Tech stets in unserer Nähe. Er hat uns nach Hause gefahren, damit wir unsere Taschen packen konnten. Und während wir hier auf Neuigkeiten warten, behält er alles im Auge.
Papa hat in ihm einen wirklich guten Freund; das war mir bis zum heutigen Tag nicht bewusst. Charles sorgt sich in seiner Abwesenheit um uns, als wären wir seine eigenen Kinder. Obwohl wir erwachsen sind und auf uns selbst achten können.
»Und?«, fragt er mit gedämpfter Stimme, als seine Schwester Dr. Cheyenne an uns herantritt und uns mit ihren stechend grünen Augen nacheinander betrachtet.
Auch sie scheint seit unserer letzten Begegnung einen Friseurbesuch hinter sich zu haben, denn ihr blondes Haar ist nun sogar kürzer als meines. Dadurch sieht sie ihrem Bruder noch ähnlicher und ohne Cheyennes weißen Arztkittel könnte man sie von hinten vielleicht sogar verwechseln.
Als würde ich dadurch erst realisieren, wo wir uns befinden, beißt wieder dieser Geruch von Putz- und Desinfektionsmittel in meiner Nase. Darunter mischt sich hin und wieder ein Hauch von Blut oder dem, was sie hier als Essen bezeichnen. Die Schuhe einiger Fachkräfte quietschen auf dem grauen Gummiboden und Rollcontainer klappern. Eine Neonröhre über uns flackert, was der bestechenden Helligkeit hier drinnen jedoch keinen Abbruch tut. Ich hasse es hier. Kliniken lösen in mir ein beengendes Gefühl aus. Sie verleiten mich dazu, mir immer wieder selbst zu sagen: Ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt.
»Also«, setzt Cheyenne an und atmet angehaltene Luft aus, »eurem Freund geht es soweit gut. Er hat sehr viel Blut verloren, aber wir konnten ihn stabilisieren.«
All meine Muskeln entspannen, nur mein Herz beginnt zu hüpfen. Mit einem Schlag verstummt mein Kopf. Nur ein Gedanke bleibt zurück: Nicolas muss beschützt werden, er muss verschont bleiben. Ich habe die Chance bekommen, etwas wiedergutzumachen, und das werde ich tun – egal wie.
»Das ist gut, oder?«, höre ich Natalie fragen. Ihre Stimme klingt nach einem Lächeln. Ich sehe es nicht, weil sich mein Blick in Cheyennes Kittel brennt.
»Sicher«, antwortet sie nickend. »Natürlich müssen wir ihn erst einmal noch unter Beobachtung halten, aber aktuell bereitet mir sein Zustand keine Sorgen. Er hatte Glück.«
Glück im Unglück.
»Danke für diese erfreuliche Nachricht«, bemerkt Charles erleichtert und legt seiner Schwester eine Hand auf die Schulter.
Sie winkt ab. »Nichts zu danken.«
Gerade als ich mich aufrichten will, um sie auf Nicolas’ Schutz anzusprechen, kommt Charles mir zuvor: »Wir sollten jemanden vor seinem Zimmer postieren. Zum Beispiel Ron. Könntest du das einrichten?«
Erneut setze ich dazu an, etwas zu sagen, doch ehe ein Laut über meine Lippen gelangen kann, übernehmen die Anderen.
»Das wäre wichtig«, fügt Natalie hinzu. »Solange Alastor ihn als Druckmittel nutzen könnte, wird Nicolas hier nicht sicher sein.«
Die Lüge verknotet mir den Magen, auch wenn ich sie nicht selbst ausgesprochen habe. Wir missbrauchen ihr Vertrauen. Um einen Shemayu zu schützen, der mehr verdient hat als meine kaputte Liebe. Der sofort tot wäre, wenn wir ihnen die Wahrheit über Nicolas sagen würden.
Es erstaunt mich, wie überraschend leicht Natalie diese Lüge über die Lippen kommt. Wo man ihr noch vor wenigen Monaten jede Schwindelei an der Nasenspitze ansehen konnte, hat sie sich inzwischen ein unschuldiges Pokerface antrainiert. Dennoch weiß ich, dass es ihr im Herzen wehtut.
»Dieser Mistkerl scheint es auf Alex und seine Töchter abgesehen zu haben«, grummelt Charles.
»Will er nicht …« Cheyenne verstummt, als ein Kollege vorübergeht, und nickt ihm lächelnd zu. Dann tritt sie etwas näher heran und dämpft ihre Stimme. »Will er nicht alle Nesweru aus dem Weg räumen?«
»Ja schon, aber er arbeitet mit jemandem zusammen, dessen Priorität es ist, mit unserem Vater eine Rechnung zu begleichen«, erklärt Natalie. »Also sind wir wohl zuerst an der Reihe.«
In Cheyennes abgeschlagenes Gesicht tritt ein mitfühlender Ausdruck. Am liebsten würde ich schreien: Hört auf, über Alastor zu reden, das kann ich jetzt nicht auch noch!
Und als hätte sie die sensibelsten Antennen der Welt, lenkt sie wieder auf den Grund zurück, weswegen wir noch nicht in den Betten von Greenwoods Ferienhaus auf Long Beach liegen.
»Um euren Freund braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich kümmere mich persönlich um seinen Schutz.«
»Bist du sicher?« Charles blickt skeptisch drein.
»Klar, kein Problem. Ich kann mir die Zeit freischaufeln.«
»Aber wenn du mal nicht …«
»Melde ich mich«, unterbricht sie ihn, als hätten sie diese Unterhaltung schon tausend Mal geführt, und lächelt sanft. »Versprochen, Bruderherz.«
Plötzlich steht Natalie auf und ich bleibe als Einzige sitzen, bin wie festgewachsen. »Vielen Dank, Cheyenne«, lässt sie verlauten, was vor zwei Tagen noch undenkbar gewesen wäre. Also nicht das Dankeschön, sondern die Tatsache, dass Nicolas’ Wohl ihr am Herzen liegt und sie sich aufrichtig über den Einsatz zu freuen scheint. Oder erkenne ich gerade nicht einmal mehr, wenn meine eigene Schwester lügt? Nein, mir scheint als würde sie sich mit Nicolas arrangieren wollen – einzig und allein Grayson bremst sie aus.
Dass Nicolas so … anders ist als andere Shemayu, kommt ihr eigentlich sogar gelegen. Es bestätigt sie in ihrer tief verankerten Überzeugung, dass in allem und jedem etwas Gutes steckt. Aber ob sie es immer noch so sieht?
Cheyennes Lächeln wird breiter. »Euer Freund ist auch mein Freund.«
Ihre Worte sind wie Fausthiebe.
»Gut«, seufzt Charles und blickt in die Runde. »Wir sollten uns dann auf den Weg machen.«
Meine Muskeln verkrampfen.
Ich spüre Natalies Blick, ehe sie zögerlich antwortet: »Wäre vermutlich das Beste.«
Erst als sie sich dem Ausgang zuwenden, finde ich meine Stimme wieder. Sie hört sich befremdlich an, als ich sage: »Ich würde gerne … noch warten.«
Alle Augenpaare sehen zurück zu mir und mustern mich abwartend.
Nach einem Räuspern umschließe ich Nicolas’ Portemonnaie sowie die Tafel Schokolade und erhebe mich. »Ich würde gerne warten, bis er wach ist.«
»Das … kann aber noch ein Weilchen dauern, Cassey«, entgegnet Cheyenne und sieht mich mitleidig an. Instinktiv verspüre ich den Drang, die Schultern zu straffen und das Kinn zu recken, aber dazu fehlt mir die Energie.
»Das ist schon okay«, übernimmt Natalie wieder und sieht zu Charles. »Oder? Du musst auch nicht …«
»Unsinn, natürlich bleibe ich«, unterbricht er sie und legt seine schwere Hand auf meine Schulter. »Die Zeit haben wir.«
Ich ringe mir zum Dank ein knappes Lächeln ab.
Cheyenne nickt. »Ich gebe euch Bescheid.«
»Yenn, hast du kurz …?« Charles heftet sich an die Fersen seiner Schwester und sie gehen ein paar Schritte.
Natalie und ich nehmen wieder Platz – das Plastik ist abgekühlt. Wir schweigen, aber ich spüre eine gewisse Unruhe von ihr ausgehen. Mit einem Brummen fordere ich sie zum Sprechen auf.
»Was wirst du ihm sagen, wenn du bei ihm bist?«, rückt sie mit ihrer Frage raus.
Mein Blick haftet an der Schokolade. Plötzlich schwillt der Kloß in meinem Hals wieder an und aus dem Nichts verschwimmt meine Sicht. Keine Bitterschokolade der Welt wäre lecker oder ausreichend genug, um alles wiedergutzumachen. Sie kann nicht alles heilen, auch wenn Nicolas das behauptet hat – schon gar nicht uns.
Ich räuspere mich. »Ich … werde ihn bitten, New York zu verlassen. So weit weg wie möglich von hier zu verschwinden.«
»Die beiden sind nicht einmal unseretwegen abgehauen«, gibt sie zu bedenken.
Flüchtig presse ich meine Lippen aufeinander. »Sie hatten es vor. Und sie können ja auch wieder zurückkommen, wenn das mit Alastor vorbei ist. Nur … werden wir dann nicht mehr da sein.« Zögerlich hebe ich die Lider, um meine Schwester anzuschauen. »Insofern du das noch willst. Also … von hier wegziehen – mit mir.«
Auf einmal runzelt sie irritiert die Stirn. »Natürlich, aber ich dachte … Das war doch noch bevor …«
Der Knoten in meinem Hals erschwert mir jedes Wort. »Ich muss das tun«, beschließe ich und senke meinen Blick. »Er ist ohne mich besser dran.«
Kurzes Schweigen.
»Wi- … wieso tust du dir das an, Cass? Wieso verbaust du dir erneut die Chance auf ein bisschen Glück?«
»Chance?«, frage ich verwirrt und schraube meine Lautstärke etwas runter. »Es gibt keine Chance. Ich bin eine Nesweru und er ist ein Shemayu. Das funktioniert nicht.«
»Aber er …«
»Ist und bleibt ein Shemayu, Nat. Und ich kann nicht einfach von jetzt auf gleich meiner Bestimmung den Rücken kehren. Würde ich das machen, dann …«
»Was?«
»Dann wären all die Torturen der letzten Jahre … alles, was ich für die Menschheit, die Götter und mein Überleben geopfert habe … sinnlos gewesen. Dann wären die Schäden, die ich in den vergangenen Wochen angerichtet habe, keine … positiven Schäden mehr.«
Ich kann doch nicht guten Gewissens mit einem Shemayu zusammen sein und derweil andere jagen. Noch weniger kann ich so egoistisch sein und riskieren, dass Nicolas weiterhin unglücklich ist, während er selbstlos nur auf meine Entscheidung wartet – ewig warten würde. Diese innere Zerrissenheit bereitet mir Übelkeit.
Natalies Ausdruck wird sanfter und zugleich umspielt ein schmerzhafter Zug ihre Lippen, während sie über meine Worte nachdenkt. Dann legt sie ihre Hand über meine und murmelt: »Ich verstehe deine Zweifel, aber … Du musst wissen, was für dich am besten ist, Cass. Wenn du es nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dann … ist das so. Ich kann dir nur sagen, dass – obwohl Nic ein Shemayu ist – er vor dem Ball derjenige war, der dich in die Normalität entführen konnte. Es kann also funktionieren. Solange du auf dein Herz und nicht auf deinen Kopf hörst.«
2 - Cassey
215. Ich betrachte die Zahl und versuche, in ihr eine Bedeutung zu erkennen. Vielleicht eine Lösung für mein Dilemma, vielleicht aber auch eine Bestätigung dafür, das Richtige zu tun. Dabei kann es sich eigentlich nur falsch anfühlen, den Mann gehen zu lassen, der womöglich mein Seelenverwandter ist – anders kann ich mir die ausbleibende Reaktion meines Amuletts auf ihn nicht erklären.
Aber wieder einmal muss ich meine Sehnsüchte und Wünsche hinter meine Bestimmung als Nesweru stellen, denn diese würde Nicolas auf kurz oder lang nur Leid oder gar den Tod bringen.
Meine Hand auf der Türklinke ist warm und schwitzig. Das verräterische Organ in meiner Brust pocht so wild, dass mir fast die Luft wegbleibt. Ich schlucke schwer, denn ja … ich habe Angst. Angst vor seiner Reaktion. Angst vor seinen Blicken, seinen Berührungen, seinen Worten. Scheiße, ich habe Angst davor, dass er meinen Entschluss zunichtemacht und wir letztlich beide enttäuscht werden – erneut.
Komm schon, Cass, sei keine Memme! Geh da rein, gib ihm sein Zeug, bitte ihn, New York zu verlassen, und mach dich vom Acker. Ganz einfach.
Ich atme tief ein, beiße die Zähne dabei fest zusammen, und gebe mir einen Ruck. Die Tür öffnet sich leise nach innen. Plötzlich herrscht Nacht. Bis auf ein kleines, rotes Blinken ist keine Lampe in diesem Zimmer eingeschaltet. Lediglich durch das Fenster an der gegenüberliegenden Wand dringt Licht – vom Verkehr zehn Stockwerke unter uns und einem Hochhaus nebenan. Nach einigem Blinzeln nehme ich Umrisse wahr. Links ein Tisch mit zwei Stühlen, rechts das Bett flankiert von Rollwagen und Infusionsständer. Darin ein ruhig atmender Nicolas – ist er wieder eingenickt?
Behutsam schließe ich die Tür hinter mir und mein in den Raum geworfener Schatten verschmilzt mit der Dunkelheit. Bis auf ein paar gedämpfte Geräusche wird es so still, dass ich mir ein erleichtertes Seufzen verkneifen muss. Schritte huschen am Zimmer vorbei. Ein Gerät piepst. Und obwohl es Nacht ist, rauschen Autos auf der Straße und ein Hupen ertönt. Diese Stadt schläft wirklich nie.
Plötzlich zuckt es im Bett und ich fokussiere wieder Nicolas. Sein Kopf ist zu mir herumgewirbelt und seine Augenhöhlen liegen komplett im Dunkeln – nicht nur wegen der Schatten. Sie sind tiefschwarz. Im selben Moment läuft mir ein Schauer über den Rücken und ich bin dabei ruhiger, als es vermutlich gesund für mich ist.
Beschwichtigend hebe ich die Hände.
»Ich bin’s nur«, murmle ich und erkenne im nächsten Moment die Ironie meiner Worte. Ja genau, ich bin’s. Eine Nesweru, die ihn auslöschen wollte.
»Cass?« Seine Stimme klingt belegt. Er streckt sich nach etwas an der Wand hinter sich aus, wobei er den Infusionsständer mitreißt und beinahe zu Fall bringt. Ein Fluchen dringt über Nicolas’ Lippen.
Schnell wende ich mich den Lichtschaltern am Eingang zu und treffe mit Glück den für eine eher dämmrige Abendbeleuchtung statt des hellen Hauptlichts. Trotzdem zu hell für jemanden, der eben noch geschlafen hat. Seine Augen sind fest zugekniffen, ehe er langsam gegen die Helligkeit anblinzelt.
»Ist das diese Duat, von der du gesprochen hast? Bin ich tot?«, fragt er unerwartet und tastet mit den Fingern seiner linken Hand über die Bettdecke, die ihm bis unter die Achseln gezogen wurde. Ein intravenöser Zugang steckt in seinem linken Arm und versorgt ihn noch mit Blut.
Seine Frage ist fast schon zu komisch, um ernst zu bleiben. Meine Mundwinkel zucken kurz unkontrolliert.
Fuck, das wird schwer.
»Ich glaube nicht, dass die Unterwelt ein Krankenhaus ist«, entgegne ich und gehe auf ihn zu. Dabei betrachte ich ihn genauer. Selbst in diesem Licht wirkt er noch kreidebleich. Die von der Blutarmut verursachte Müdigkeit ist ihm auf Anhieb anzusehen. Das Haar ist etwas zerzaust. Er steckt in einem dieser sexy halboffenen Kittel und sein rechter Arm ...
Ein Stein bildet sich in meinem Magen.
»Was ist passiert?«, fragt Nicolas und rettet mich somit vor dem Strudel aus Erinnerungen. »Hat Alastor … Bist du okay?«
Ich presse die Lippen aufeinander und nicke, obwohl ich gerade nicht wirklich okay bin – zumindest nicht seelisch.
»Wie ... fühlst du dich?«, frage ich, statt ihm zu erzählen, was zwischenzeitlich los war. Weil es nicht mehr war als Tränen, Zweifel, Autofahrten, Taschen packen und Warterei.
»Wie auf meinem ersten und einzigen Drogentrip 1836«, entgegnet er scherzhaft und lächelt knapp. »Verwirrt, desorientiert … und mit dem Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe.«
»Nicolas Wandsworth hat Drogen genommen«, bemerke ich gespielt erstaunt und lächle zurückhaltend. An seinem Zustand bin ich schuld.
»Nur einmal«, gibt er zurück und korrigiert sich sogleich: »Na ja, kommt drauf an, was man unter Droge versteht. Und ob es auch zählt, wenn man es sich damals zu offiziell medizinischen Zwecken eingeflößt hat.«
Ich schaue auf meine Hände herab und strecke ihm dann die Tafel Bitterschokolade und sein Portemonnaie entgegen. Der Tag, an dem er mir von der Schokoladen-Theorie seiner Mutter erzählt hat, kommt mir so weit weg vor. Als wären es nicht bloß Monate gewesen.
Ein Grinsen erhellt sein blasses Gesicht. »Das hast du nicht gemacht«, flüstert er erstaunt und nimmt beides entgegen.
»Hatte ich zufällig da«, lüge ich achselzuckend, denn in Wahrheit fand ich sie beim Packen in einer meiner Schubladen. Sie hat darauf gewartet, an ihn übergeben zu werden. Doch dann kam der Ball …
Ich versuche, nicht in seine Augen zu schauen, nur leider fällt mein Blick dadurch erneut auf seinen verbundenen Unterarm. Bilder und Empfindungen drängen sich mir auf und erschüttern die Grundfeste meiner mentalen Mauern.
Plötzlich rutscht Nicolas höher und streckt seinen linken Arm nach mir aus. »Hey. Es tut mir leid«, murmelt er mitfühlend.
Ich betrachte unentwegt seine ausgestreckte Hand und rege mich nicht. Mein Körper vibriert fast unter der Anspannung.
»Dir muss nichts leidtun.«
»Doch. Das muss hart für dich gewesen sein«, entgegnet er und lässt seine Hand widerwillig sinken.
Ja, war es. Es war hart zu sehen, wie er drohte, mit jedem Liter mehr und mehr seinen Körper zu verlassen.
»Ich … komme klar«, versichere ich ihm und ziehe meine Schulterblätter zusammen. In der Hoffnung, dass ich mir so vortäuschen kann, dass es der Wahrheit entspricht.
Mein Körper fühlt sich an, als würde er sich selbst in zwei Teile reißen wollen. Einer will standhaft bleiben, um den Schaden gering zu halten, der andere will um jeden Preis zu ihm. Ich spüre mittlerweile wirklich körperliche Schmerzen.
»Tust du nicht«, widerspricht er. »Wir hatten mal einen Deal, erinnerst du dich? Dass du mich nicht anlügst. Wir haben zwar beide das Versprechen gebrochen, aber vielleicht können wir einen Neustart wagen?«
Um von mir und dem Thema abzulenken, deute ich auf sein Portemonnaie und sage: »Ich habe alles drin gelassen.« Dann neige ich den Kopf nach links und rechts. »Okay, ich habe alles wieder an seinen Platz getan.«
Nicolas schmunzelt. »Wie löblich, dass du den mittellosen Highschool-Lehrer nicht um seine … was ist drin? Vielleicht zehn, zwölf Dollar? … betrogen hast.«
»Zehn«, bemerke ich und verschränke die Arme vor der Brust. »Und die ... deine Kette ist auch drin.«
Er sieht überrascht auf und ein Funkeln tritt in seine Augen. Ein stummer Jubel. »Danke, Cass«, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen und öffnet den Geldbeutel, als würde er mir keinen Glauben schenken. »Wieso warst du zu Hause? Sicher nicht wegen meiner Sachen.«
Mein Herz sackt ein Stück herab. Ich räuspere mich, ehe ich mit ruhelos umherwanderndem Blick erkläre: »Wir ... Natalie und ich, wir werden woanders unterkommen. Wo es zumindest ein wenig sicherer ist. Also haben wir ein paar Sachen gepackt.«
Er nickt verständnisvoll. »Ich will nicht wissen wohin, weil ich keine Gefahr für euch sein will. Aber sag mir bitte, dass euer Versteck nicht nur ein wenig sicherer, sondern verdammt sicher ist«, bittet er mich besorgt und legt das Portemonnaie beiseite. Anschließend streckt er seine Hand erneut nach mir aus. »Und setz dich bitte hin, du machst mich total nervös.«
Es juckt mich in den Fingern, auf seine Aufforderung einzugehen. Mein Herz trommelt mit seinen verlangenden Fäusten wild gegen meinen Brustkorb.
Du weißt, warum es dich zu ihm zieht. Gib nach, wispert eine Stimme in mir verlockend. Ich bilde mir sogar ein, dass da mein Amulett zu mir spricht.
Mit einem Kopfschütteln versuche ich, sie zu vertreiben. Der Tag war definitiv zu lang. »I-ich wollte nicht bleiben.«
Trauer zeichnet sogleich sein Gesicht. »Wieso nicht?«
Damit es nicht noch schwerer wird.
»Du musst dich ausruhen und ... wir haben noch eine lange Fahrt vor uns.«
Er blinzelt ein paar Mal. »Soll das heißen … warte, verabschiedest du dich gerade von mir?«, fragt er irritiert und zieht seine Augenbrauen zusammen, die linke von einer Narbe geziert – verursacht von meinem Vater. »Im Sinne von … dauerhaft?«
Ich beiße mir auf die Unterlippe und schlendere zu der kleinen Tisch-Stuhl-Gruppe, wobei ich meine unruhigen Hände in die Jackentaschen schiebe. »Egal, wohin du mit Grayson und Tess wolltest ... ihr müsst den Plan umsetzen. Du musst raus aus dieser Stadt, am besten ganz weit weg. Zumindest bis wir Alastor aus dem Weg geräumt haben.«
»Verarschst du mich gerade?«, kommt es überraschend schroff über Nicolas’ Lippen. »Glaubst du ernsthaft, ich lasse dich mit Alastor hier allein zurück?«
Ich verharre, ihm schräg den Rücken gekehrt, und schließe kurz die Augen. »Ich ... ich bitte dich darum, Nic«, sage ich mit Nachdruck, klinge dabei jedoch kraftloser als gedacht. »Du musst dich in Sicherheit bringen. Ich ... bin nicht allein.«
»Und du denkst, dass ich irgendwo in Sicherheit bin, wenn Gray …«
Meine Augen verengen sich. »Wenn Gray?«, wiederhole ich, damit er den Satz beendet.
»Als … ich sagte, dass Grayson alles dafür tun würde, um mich freizukriegen, meinte ich wirklich alles. Er hat einen Deal mit den Minions ausgehandelt, der uns ziemlich um die Ohren fliegen wird. Verstehst du nicht? Wir müssen endlich anfangen, uns gegen sie zu verbünden.«
Verdammt, das hätte mir klar sein müssen. Natürlich war deren Not gefundenes Fressen für Alastor.
»Er ist aber noch nicht ...«
Sein »Nein« schießt wie aus einer Pistole. »Das würde er nie tun. Es war nur Strategie.« Er schnauft. »Ziemlich miese Strategie, wenn du mich fragst. Aber er wusste sich nicht anders zu helfen. Was ich damit sagen will: Meine Sicherheit ist so oder so am Arsch. Also tu das nicht meinetwegen. Ich will dir helfen, Cass.«
Ich schüttle den Kopf. »Für deine Sicherheit ist gesorgt, solange du hier bist. Aber je schneller du verschwindest ...«
»Hör auf, das zu sagen«, unterbricht er mich mit gequälter Stimme und ächzt im nächsten Moment. Ich sehe über die Schulter und bemerke, wie er aufsteht und vom Schwindel erfasst wird.
Ich bin schneller bei ihm, als ich denken kann. Mit den Händen unterhalb seiner Achseln halte ich ihn aufrecht und beäuge wachsam sein Gesicht. Kippt er jetzt um?
»Mir geht’s gut«, murmelt er noch leicht benommen.
»Klar doch«, kontere ich sarkastisch und begegne seinen Augen.
Scheiße, ich hätte einfach nur eine Nachricht hinterlassen sollen.
Damit er sich wieder setzt, übe ich sanft Druck aus. »Falls du’s vergessen hast: Du hast eine Menge Blut verloren und lauter Zeug intus. Bedeutet: Liegenbleiben.«
Seine Mundwinkel zucken und ich befürchte, dass er protestiert. Doch dann gibt er nach und setzt sich wieder, greift aber nach meiner Hand, ehe ich sie zurückziehen kann. Von unserer Berührung ausgehend wandert eine Gänsehaut – eine der guten Sorte – meine Arme hinauf. Anschließend sieht er mir tief in die Augen und ein Kribbeln meldet sich in meinem Magen. »Ich dachte, wir versuchen das mit dieser Freundschaft, Cass. Schließ mich nicht aus deinem Leben aus, bitte. Ich mache mir scheißviele Sorgen um dich.«
»Ich schließe dich nicht aus meinem Leben aus«, wispere ich und schlucke schwer. »Sondern mich aus deinem.«
»Das will ich genauso wenig«, betont er eindringlich und drückt sanft meine Finger. »Ich verstehe, wenn das zwischen uns … für dich nicht mehr funktioniert. Ich kann das akzeptieren. Also wovor hast du Angst?«
Meine Augenbrauen ziehen sich zusammen. »Akzeptanz bedeutet nicht, damit klarzukommen«, weiche ich seiner Frage aus. Doch Nicolas lässt es mir nicht durchgehen. Also knabbere ich auf meinem Lippenpiercing, während ich zig Sätze in meinem Kopf bilde, davon aber keinen einzigen rausbringe. Schließlich kapituliere ich und entziehe ihm eine Hand. Ich bin schon viel zu lange hier. Es ist gesagt, was ich mir vorgenommen habe.
Seine Finger legen sich unter mein Kinn und heben es an, doch ich drehe sogleich den Kopf weg. »Cassey, lass uns das mit Alastor gemeinsam erledigen. Wir sind viel stärker, wenn wir zusammenarbeiten.«
»Das kannst du nicht wissen.«
»Nein, kann ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es so ist. Sag mir, was dagegenspricht.«
Ich schnaube, weil er schon wieder bohrt und bohrt, aber ich kann mich auch nicht von der Stelle lösen. Wieso um der Götter Willen kann ich mich nicht einfach umdrehen und gehen?
»I-ich ...«, setze ich an und muss wieder eine Atempause machen, weil mir mein Herz bis zum Hals schlägt.
»Wovor hast du Angst?«, hakt Nicolas nach.
»Argh! Davor, dich weiterhin zu verletzen, okay?«, platzt es aus mir heraus und ich wende mich ihm abrupt zu, blicke direkt in seine Augen. Ich weiß, was ich für ihn empfinde, und das schnürt mir die Kehle zu. »Egal in welcher Form, ich will das nicht. Es war schon genug. Und wenn wir zusammenbleiben, dann kann ich nicht garantieren, dass es besser wird. Aber wenn wir getrennte Wege gehen ...«
»Warte«, unterbricht er mich und erwidert forschend meinen Blick. »Du … mich verletzen?« Irritiert schüttelt er den Kopf. »Das ist nicht fair. Du triffst diese Entscheidung über meinen Kopf hinweg. Ich kann selbst entscheiden, was mich verletzt und was nicht. Du bist nicht schuld, wenn ich das Risiko eingehen will.«
Mit aller Kraft versuche ich, die Tränen zurückzuhalten.
Vielleicht möchte ich mich aber auch selbst beschützen.
»Wenn du Angst haben solltest«, setzt er vorsichtig an, »dass du noch einmal Gefühle für mich entwickeln könntest … Ich kann versprechen, der unausstehlichste Freund auf der Welt für dich zu sein. Ich habe durch Grayson eine Menge Übung, weißt du?«
»Verstehst du denn nicht?«, frage ich etwas heiser und setze einen Schritt zurück. Dann lege ich eine Hand auf meine Brust. »Meine Gefühle sind der Grund dafür, dass ich dich darum bitte zu gehen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas passiert. Und noch weniger könnte ich es ertragen, dich zu enttäuschen. Oder mich selbst. Weil ich ... weil ich mir etwas erhoffe, das vermutlich nicht möglich ist. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn wir ... und ich dann nicht ...«
»Atme, Cass«, weist er mich sanft an und kommt erneut auf die Beine, wirkt diesmal aber sicherer. Seine Hände berühren zögerlich meine Schultern.
Doch statt entspannter zu atmen, entfährt mir ein Schluchzen und ich wende mich schnell ab. Das läuft ganz anders als geplant und doch irgendwie genauso, wie ich es geahnt hatte.
Plötzlich legen sich seine Arme von hinten um mich und ich spüre seinen warmen Atem im Nacken. Ich hatte seit viel zu langer Zeit keine Umarmung mehr, wie ich in dem Moment feststellen muss.
»Mir wird schon nichts passieren«, flüstert er. »Und du kannst mich nicht enttäuschen, denn ich erwarte nichts von dir.«
»Dir ist schon was passiert«, kontere ich kurzatmig und kneife die Augen zu.
Die Umarmung wird fester, sein Kopf schmiegt sich an meinen. »Gelb ist meine absolute Hassfarbe, ich träume manchmal in Musicals und würde wahnsinnig gerne Musik schreiben können, aber ich kann’s einfach nicht.«
Wie so oft, wenn er das tut, entfährt mir unbeabsichtigt ein Prusten. Dann verpasse ich ihm einen sanften Schlag gegen den gesunden Arm, wobei ich Rücksicht auf den Schlauch nehme. »Ich meine es ernst.«
»Ich auch«, beteuert er. »Weißt du, wie frustrierend es ist, dass ich jedes Lied auf der Welt spielen, aber keines erfinden könnte?« Leise lachend löst er sich etwas von mir und streicht über meine Oberarme. »Nein, im Ernst, Cass. Morgen könnte ich von einem Auto überfahren oder von Alastors Minions umgebracht werden. Das Leben ist nun mal nicht sicher. Ich weiß aber, dass ich dich in meinem haben will. Egal was kommt.«
Langsam drehe ich mich zu ihm um. »Scheiße, wieso machst du es mir so schwer?« Mit diesen Worten bahnen sich die Tränen ihren Weg.
Nicolas betrachtet die salzigen Spuren und verzieht mitleidig das Gesicht. »Ich will es dir nicht schwermachen, ich will dir helfen.«
»Lässt dir aber selbst nicht helfen«, bemerke ich und verfrachte ihn dann wieder aufs Bett. Abermals hält er mich an der Hand bei sich.
»Bitte«, fleht er fast tonlos.
Meine Arme und Beine fühlen sich immer schwerer an.
»Wie soll das funktionieren?«, frage ich ihn ratlos.
Nach kurzer Überlegung heben sich seine Mundwinkel. »Indem wir ehrlich zueinander sind?«
Ich seufze. »Na gut, soll ich ehrlich sein? Ich … möchte das, was wir hatten ... so sehr. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Instinktiv wirst du immer mein Feind sein, ob ich will oder nicht. Könntest du etwa damit leben?«
Endlich erreiche ich, dass er nachdenkt. Dass er nicht vor Überzeugung sprudelt. Dass er von sich aus den Rückzug antritt.
Er senkt den Blick und lässt meine Hand los. »Vielleicht. Ich weiß es nicht«, antwortet er mit Bedacht. »Aber ich würde es gern versuchen.« Langsam hebt er wieder das Kinn und sieht hoffnungsvoll in meine Augen. »Und ich kann warten. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Aber ich will für dich da sein dürfen – ob nun auf die eine oder andere Weise. Und ich verstehe, dass das nicht einfach wird. Weder für dich noch für mich. Aber … einfach war noch nie unser Ding, oder?«
»Nein, war es nicht«, murmle ich und füge mehr für mich hinzu: »Aber es wäre mal eine nette Abwechslung.«
Das sanfte Lächeln kehrt auf seine Lippen zurück. »Ich dachte, du liebst Herausforderungen.«
Meine Mundwinkel zucken unkontrolliert.
»Wie wäre es, wenn du in Ruhe darüber nachdenkst? Schließlich haben wir noch ein paar mehr Probleme am Hals als unsere … komplizierte … emotionale Situation.«
Ich lache spöttisch auf und schlinge meine Arme um mich; tröste mich darüber hinweg, dass ich zu schwach war, um ihm zu widerstehen. »Ich hatte den ganzen Abend, um nachzudenken, meinte, eine geeignete Lösung gefunden zu haben, und was hat es gebracht?«
»Manchmal hilft es, gemeinsam nachzudenken. Es gefällt mir im Übrigen nicht, dass du und Natalie allein irgendwo in ein Versteck fahrt. Könnt ihr Greenwood mitnehmen?«
»Wir kommen klar«, wiederhole ich und blicke kurz über die Schulter, als könne ich meine Schwester durch die Wand sehen.
»Ihr seid zu zweit. Das ist gegen jemanden wie Alastor nicht gerade beruhigend.«
Ich verdrehe die Augen. »Was ist mit dir? Hier drinnen haben wir dir Schutz organisiert, aber wenn dein trotteliger Kumpel einen Deal mit ihm eingegangen ist ... Ich bin immer noch der Überzeugung, dass ihr verschwinden solltet. So wie geplant.«
Dann müsste ich mir auch nicht ständig Gedanken um ihn machen.
Plötzlich werden seine Augen groß. Schnell sucht er das Zimmer ab, ehe er sich zum Rollwagen vorbeugt und sein Smartphone zur Hand nimmt. »Shit«, flucht er kurz darauf und fährt sich unruhig durchs Haar. »Er und Tess sind auf dem Weg hierher.«
Das ist endlich der Antrieb, den ich brauchte, um von hier zu verschwinden.
»Gut«, sage ich also und streiche unter meinen Augen entlang, wobei ich mich halb zum Gehen abwende. »Ihr müsst dringend besprechen, was ihr macht.«
»Warte!«
Ich halte inne. Mit flehendem Ausdruck erhebt er sich.
»Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Und dass du dich meldest, wenn ihr gut im Versteck angekommen seid.«
»Mhm. Und Dr. Cheyenne Greenwood wird ein Auge auf dich haben, also ... nimm ihr bitte nicht übel, wenn sie sich viel in deiner Nähe aufhält. Und wenn sie dir gesundheitliche Anweisungen gibt ... hör bitte wenigstens auf sie.«
»Cheyenne Greenwood«, wiederholt er den Namen nachdenklich und hebt dann die Augenbrauen. »Hast du mich in ein Nesweru-Krankenhaus einliefern lassen?«
»Nein«, antworte ich schlicht. »Und sie weiß auch nicht, was du bist.«
»Okay«, sagt er gedehnt und presst anschließend die Lippen aufeinander.
Jetzt ist es soweit. Geh, Cass.
Doch ich nehme mir noch einen Augenblick, um ihn zu betrachten. Zögerlich hebe ich eine Hand und streiche – obwohl wir in den vergangenen Tagen so viel Zeit miteinander verbracht haben – erstmals über seinen Bart. Ein befremdliches Gefühl. Ich mochte es immer, über seine babyweiche, glattrasierte Haut zu fahren.
»Triff bitte keine dummen Entscheidungen wegen mir«, flüstere ich dabei. »Besonders nicht nach allem, was ich getan habe.«
»Das Leben ist zu kurz, um immer die rational klügere Entscheidung zu treffen. Manchmal muss man die dummen Entscheidungen treffen, wenn man damit glücklicher ist.«
»Wo sind deine grauen Haare?«, scherze ich trocken, um die Situation aufzulockern. In seinen Worten steckt so viel Wahrheit, aber meine Angst, dass dieses Glück erneut nur von kurzer Dauer sein könnte, ist größer.
Schmunzelnd greift er nach meinem Handgelenk und senkt sachte meinen Arm. »Ich bin Jahrhunderte alt, Cass. So oft, wie ich schon graue Haare hatte, kann ich dir gar nicht mehr sagen.«
Es fühlt sich erstaunlich gut an, ungefiltert mit ihm reden zu können, ohne dass sich durch Lügen oder Ausflüchte alles in mir verknotet. Es hat sich nicht einmal merkwürdig angefühlt, als er mir im Keller von seinen früheren Leben erzählt hat.
»Ich sollte gehen, bevor Natalie eine böse Überraschung erlebt.«
»Schreib mir«, erinnert er mich schnell. »Ruf mich an. Egal was. Wenn dir etwas passiert, kannst du was erleben.«
»Mir passiert schon nichts«, versichere ich ihm, auch wenn ich schon viel zu oft eines Besseren belehrt wurde. Aber vielleicht würde es ihm so leichter fallen, mit seinen Freunden von hier wegzugehen. Sie müssen ihn davon überzeugen.
»Klar. Du bist schließlich Wonder Woman.«
Ich schnaube und verdrehe erneut die Augen. »Gute Nacht, Nicolas.«
Ein merkwürdiges Gefühl stellt sich ein, als die Tür hinter mir ins Schloss fällt. Irgendwie war es ein Abschied, obwohl es kein Abschied war. Zumindest nicht auf ewig. Und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll.
3 - Nicolas
Nicolas«, weckt mich eine sanfte Stimme. Ich bin so unfassbar müde und würde am liebsten sagen: Geh weg, lass mich schlafen. Doch als die Person noch einmal meinen Namen sagt und über meine Stirn streichelt, heben sich meine Lider wie von selbst.
Ich kann nicht lange geschlafen haben. Vielleicht eine Stunde. Cassey ist nicht mehr da. Stattdessen atmet Tess erleichtert aus, als ich in ihre warmen, braunen Augen sehe. Sie hat sich über mich gebeugt und lächelt, doch hinter ihrer Stirn tobt ein Orkan. Ihre Gedanken fluten meinen Kopf und ich kann kaum einen davon greifen, weil sie so schnell, unkontrolliert und hektisch kommen und gehen.
»Wie spät ist es?«, frage ich und versuche, mich aufzusetzen.
»Fast zwei«, murmelt sie und zieht die Augenbrauen zusammen. Ihr rotes Haar schaut unter einer dunklen Kapuze hervor, als hätte sie sich wie eine Einbrecherin Zutritt zum Krankenhauszimmer verschafft. »Gibst du mir eigentlich keine Auszeit? Muss ich mir ständig Sorgen um dich machen?«
»Sorry«, gebe ich grinsend zurück und kneife die Lider zusammen. Bin ich immer noch oder schon wieder auf Schmerzmitteln? Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass im Halbschlaf eine blonde Frau an meinem Bett stand und irgendetwas in den Zugang in meiner Hand gestochen hat. Aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht war das Cheyenne?
»Nichts da, sorry«, wehrt Tess ab und steht auf. Ich sehe ihr an, dass sie gerne einige Fragen stellen würde, aber sie hält sich zurück. »Grayson ist unfassbar sauer auf dich. Und ich bin es im Übrigen auch.«
»Kann ich mir vorstellen«, entgegne ich und greife nach meinem Handy.
Sind in Sicherheit, Mrs. Doubtfire.
Ich schmunzle und tippe: Gute Nacht, Cass.
»Wandsworth«, stöhnt Tess und nimmt mir das Handy ab.
In diesem Moment öffnet sich die Tür und Grayson betritt mit einer Miene den Raum, die seine Wut nicht verbergen kann. Aber in seinen Augen leuchtet ein klein wenig Erleichterung. Eine blonde Frau im Kittel folgt ihm und stellt sich als Dr. Cheyenne Greenwood vor. Sie diskutiert, dass die Besuchszeiten lange vorbei sind und die beiden morgen wiederkommen sollen, doch ich kann sie dazu überreden, uns zehn Minuten zu geben. Ihre grünen Augen und die Grübchen sind denen von Charles so ähnlich, dass auch kein Zweifel an ihrer Identität besteht. Sie mustert mich wachsam, nickt dann aber widerwillig und weist mich auf den Notfallknopf hin, der ausschließlich zu ihrem Pieper führt.
»Es gibt kein dümmeres Wesen auf diesem Planeten als dich«, knurrt Grayson und stapft auf mein Bett zu, als Cheyenne die Tür hinter sich geschlossen hat.
»Komm runter«, bitte ich ihn und will mich auf meinen Armen hochstützen, als ein stechender Schmerz durch meinen rechten fährt. Ich beiße die Zähne zusammen und atme fluchend aus. Unter dem Verband pocht die Naht und erinnert mich an Cassey, Alastor und ein zu scharfes Küchenmesser.
»Du willst uns tatsächlich umbringen, oder?«, fährt er fort und verschränkt die Arme vor der Brust.
Ich verdrehe die Augen. »Willst du wissen, was passiert ist, bevor du mir Vorwürfe machst?«
»Weiß ich nicht. Will ich das? Wenn der Name Cassey darin vorkommt, kannst du dir deine Erklärungen sparen.«
»Okay, beruhigt euch. Beide«, befiehlt Tess und sieht streng zwischen uns hin und her. »Erzähl«, verlangt sie anschließend von mir und ich fasse den vergangenen Abend in wenigen Sätzen zusammen. Dabei werde ich immer wieder von genervten, wütenden oder patzigen Ausrufen von Grayson unterbrochen, während Tess sich sehr zusammenreißt, aber ähnliche Gedanken hat.
»Was passiert ist, war nicht Casseys Schuld«, beende ich meinen Monolog.
»Das hast du verdammt richtig erkannt, Wandsworth. Es ist deine beschissene Schuld. Du fährst gerade einen Mords-Ego-Trip und wegen wem? Der Frau, die dich wochenlang gefoltert und in ihrem Keller eingesperrt hat. Sag mal, geht’s noch? Scheiße, Nicolas! Was hat sie mit deinem Gehirn gemacht?«
»Cass hat mich nicht gefoltert, okay?«, entgegne ich und presse die Lippen aufeinander.
»Ich glaub’s nicht«, zischt er wütend und wendet den Blick von mir ab.
»Nic«, setzt Tess sanfter, aber bestimmt an. »Du musst doch merken, dass sie dir nicht guttut. Du bringst dich für sie immer nur selbst in Gefahr.«
»Sie bedeutet mir eben viel. Ich würde für dich oder für Gray genau das gleiche Risiko eingehen«, argumentiere ich.
»Oh, welch Gnade. Der heilige Märtyrer, Nicolas«, spuckt Grayson mir entgegen. »Als hättest du jemals in diesem Leben auch nur einmal an mich gedacht, wenn du irgendeine Entscheidung getroffen hast! In diesem Leben? Nein, überhaupt.«
»Das ist nicht dein Ernst«, stöhne ich genervt. »Es geht hier nicht nur um Cassey. Oder dich und mich. Es geht um uns alle. Um die Welt, wenn man es so dramatisch formulieren will. Alastor hat einen an der Waffel. Er könnte uns in diesem Moment belauschen und dich dazu bringen, irgendetwas zu tun, was du nicht tun willst. Das ist scheiße gefährlich für uns.«
»Nein, nicht für uns, Nic! Für Cassey und Natalie! Wir, das sind Tess, du und ich, wir haben nichts mehr mit den beiden oder Alastor zu tun«, beharrt er. »Wir fahren nach Arizona. Keine Diskussion mehr.«
»Das sehe ich anders«, widerspreche ich. »Immerhin hat er mich gesteuert. Er wollte mich benutzen, um Cassey zu verletzen.«
»Dafür hätte er mich nicht steuern müssen«, grummelt Grayson.
»Ich muss sagen, dass ich das alles ebenfalls beunruhigend finde«, bemerkt Tess, setzt ihre Kapuze ab und dreht ihre Haare in einen Dutt, nur um sie dann wieder offen fallen zu lassen.
»Nicht du auch noch«, grollt Grayson und fährt sich mit beiden Händen übers Gesicht.
»Wir können uns da nicht mehr raushalten«, wiederhole ich mich aufgebracht. »Wir stecken schon viel zu tief drin. Alastor wird uns nicht fahren lassen. Er wird anderen Leuten wehtun, um an uns ranzukommen. Denk an Taylor, Tess.« Sofort presst sie ihre Lippen aufeinander. »Dieser Abend beweist doch, dass er zu allem fähig ist. Er kannte Rebecca. Er hat mehrere Jahrzehnte Rache gefordert, weil er nicht bekommen hat, was er wollte – obwohl das Ganze wahrscheinlich mehr ein Spiel für ihn war. Jetzt will er an Gray und mich ran. Dass wir mit Cassey und Natalie zu tun haben, ist für ihn doch nur das Sahnehäubchen.«
»Hatten«, korrigiert Grayson.
»Haben«, beharre ich. »Ob du es gut findest oder nicht – Cassey ist ein Teil meines Lebens und ich werde für sie da sein.«
»Wie erbärmlich bist du bitte? Lässt du dich auch an einer Leine ums Haus führen, wenn sie das wollen würde?«
»Grayson, genug jetzt«, geht Tess dazwischen. »Objektiv betrachtet muss ich Nicolas Recht geben. Dieser Apokalypsen-Plan geht uns alle etwas an. Es werden so viele Leute sterben, wenn Alastor nicht gestoppt wird. Wir können nicht einfach wegsehen.« Ich nicke bestätigend und Grayson verdreht die Augen. »Aber ich bin nicht dafür, mit den Nesweru zusammen zu arbeiten. Besonders nicht mit den Krylowi.« Ich will etwas erwidern, doch Tess hebt die Hand. »Ich bin noch nicht fertig, Nicolas. Ich vertraue Cassey nicht. Kein bisschen. Ich weiß nicht, wie du ihr verzeihen kannst, was sie dir angetan hat – doch das ist deine Sache. Aber ich werde auf keinen Fall mit dieser Frau an einem Plan arbeiten.«
»Tess ...«
»Nichts da, du kannst mich mal, Wandsworth«, gibt sie zurück und ihre Stimme bricht. Plötzlich stehen Tränen in ihren Augen, die mein Gewissen an den Grund des Meeresbodens sinken lassen. »Weißt du eigentlich, wie viele Sorgen wir uns um dich machen müssen? Wie scheiße deine Aktion für Gray und mich war?«
Ich schlucke und nicke. »Es tut mir leid. Ich ...«
»Ja, genau! Ich«, zischt Grayson. »Du denkst nur an dich selbst!«
»Das ist nicht wahr«, presse ich hervor.
»Ach? Wer stirbt mit dir, wenn du verreckst?«
»Du«, gebe ich zu.
»Wer hat dir gesagt, dass er nicht noch ein Leben haben will?«
»Du.«
»Und wer hat dir gesagt, dass wir beide zusammenhalten müssen, was auch immer geschieht?«
»Rebecca.«
Er atmet für eine Sekunde aus und flüstert dann: »Das alles wäre nicht passiert, wenn sie noch leben würde. Ohne sie hast du dich zu so einem Arschloch entwickelt, Nic! Und jetzt willst du der Frau helfen, deren Vater sie ermordet hat. Wenn Rebecca wüsste, was du für ein scheiß Heuchler geworden bist, würde sie sich für dich schämen.«
Ich wende den Blick ab. Es stimmt, dass ich anders bin ohne sie. Dass ich früher mehr darüber nachgedacht hätte, was meine Handlungen für Grayson bedeuten. Aber gerade hat er eine Grenze überschritten, die er nicht mehr zurücknehmen und die ich nicht verzeihen kann.
Schweigen breitet sich in dem kleinen Raum aus. Nur die Gedanken rasen durcheinander. Ich lausche auf eine Entschuldigung von Grayson. Ein schlechtes Gewissen. Irgendetwas, das mir sagt, dass er seine Worte bereut. Aber da ist nichts als seine unbändige Wut auf Natalie und Cassey, auf mich und diese Welt.
Tess räuspert sich. »Es ist vollkommen verständlich, dass du wütend auf Nic bist. Das bin ich auch. Aber das war richtig scheiße von dir, Grayson. Rebecca ins Spiel zu bringen, war unter der Gürtellinie.«
»Weißt du was? Es wäre vermutlich das Beste, wenn wir ab jetzt getrennte Wege gehen«, murmle ich ohne ihn anzusehen. »Wir verabreden uns nur noch, wenn einer von uns keine Energie mehr hat. Und ansonsten macht jeder, was er will.«
Vielleicht ist das hier genau der Punkt, an dem es für Grayson und mich einfach nicht mehr weitergeht. Unsere Verbindung – nicht die Shemayu-Bindung – ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr intakt.
»Hört auf zu streiten! Ihr entschuldigt euch jetzt beieinander«, zischt Tess und ihre Finger knistern leise vor elektrischer Spannung, »oder ihr bekommt den Stromstoß eures Lebens.«
»Wenn du Nic jetzt schockst, dann wird er vielleicht wieder wie früher«, brummelt Grayson trotzig und bringt sicherheitshalber ein bisschen Abstand zwischen Tess und sich. Die danach eintretende Stille ist so unangenehm, dass ich es kaum wage zu atmen. Tess sieht zwischen uns hin und her und wartet, dass einer von uns nachgibt.
»Es tut mir leid«, gebe ich zu und sehe Grayson an. »Wirklich. Ich war ein egoistischer Arsch und das tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht, was meine Handlungen für dich bedeuten könnten, und ja, ich hätte dir erzählen müssen, dass ich mich mit Cassey treffen will.«
Überrascht dreht er sich zu mir herum. »Ach ja?«
»Aber …«
»Natürlich«, stöhnt er und schüttelt den Kopf.
»Aber ich werde mir von dir nicht sagen lassen, mit wem ich Kontakt haben darf«, fahre ich fort. »Ich weiß, du verstehst nicht, warum mir Cassey wichtig ist …«
»Bist du blöd?«, fragt Grayson. »Natürlich verstehe ich das. Sie hat dir den Kopf verdreht.«
»Hat sie nicht! Ich liebe sie«, rufe ich aus und beiße mir auf die Unterlippe, als mir bewusst wird, was ich da gerade gesagt habe.
Graysons Augenbrauen heben sich.
Tess hält die Luft an.
Ich schließe die Augen und fahre mir durchs Haar. »Das müsst ihr nicht nachvollziehen können. Ihr müsst es nicht einmal akzeptieren, denn das ist ganz allein meine Sache. Ich brauche eure Erlaubnis nicht. Aber es geht mir beschissen ohne Cassey. Ich will sie in meinem Leben. Ganz egal, was zwischen uns steht. Und so schlimm die letzten Wochen auch waren, haben sie mir genau das gezeigt.«
Ich starre meinen besten Freund an und warte. Er starrt zurück und wartet ebenfalls. Auf eine Entscheidung. Schließlich bestätigen seine Gedanken meine Vermutung: \\Hier gibt es keinen Kompromiss, Nicolas. Ich werde nicht mit Cassey zusammenarbeiten. Tess auch nicht. Entweder sie oder wir.//
Der letzte Satz lässt etwas in mir erfrieren.
»Du stellst mir ein Ultimatum?«, frage ich tonlos.
»Was? Hey, keine Geheimkommunikation«, verlangt Tess.
\\Zu allem und jedem bist du so nervtötend selbstlos. Nur zu mir nicht. Du hast für alles und jeden Verständnis, nur für mich nicht. Du willst Cassey um jeden Preis in deinem Leben, aber was ich will, ist dir egal. Was bist du für ein beschissener Freund, wenn du verdammt nochmal nie Rücksicht auf mich nimmst?//
Ich beiße die Zähne aufeinander, weil alles in mir vibriert. Als würde man mich in zwei Hälften reißen wollen. Ich weiß, dass Tess nichts damit zu tun hat. Sie wird weiterhin meine beste Freundin sein, egal welche Entscheidung ich treffe. Aber Grayson hat mich mit seinem Ultimatum genau in die aus seiner Sicht falsche Richtung gedrängt. Denn das würde ich nie von ihm verlangen. In seiner Situation hätte ich nicht einmal darüber nachgedacht, mich zwischen Natalie und ihn zu stellen. Und während Cassey mich loswerden wollte, damit ich in Sicherheit bin, will Grayson nur seinen Sturkopf durchsetzen. Weil er voller Hass und Wut ist. Weil er nicht damit leben kann, dass Nesweru nicht unsere Feinde sein müssen.
Langsam wende ich den Blick ab. Grayson weiß, was das bedeutet.
\\Dein letztes Wort?//
Seine Gedanken sind so eisig, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe.
»Ich schreibe dir dann in sechs Wochen«, gebe ich mit fester Stimme zurück.
Die Luft in dem kleinen Krankenhauszimmer wird schwer. Ich kann kaum atmen, als Grayson sich von mir entfernt und mit wenigen Schritten das Zimmer verlässt. Tess starrt ihm hinterher, dann sieht sie zu mir.
»Wieso müsst ihr beide alles kaputt machen?«, flüstert sie und verzieht das Gesicht. Sie steht zwischen den Stühlen, kann uns beide verstehen und hasst uns doch dafür, dass wir uns eben nicht verstehen.
»Vielleicht kriegt er sich wieder ein«, murmle ich und spüre erst jetzt das Brennen in meinem rechten Arm. Es ist kaum auszuhalten und ich bin kurz davor, den Rufknopf für die Schwester zu drücken.
»Mach das nicht. Tu nicht so, als wärst du nicht mindestens genauso schuld daran.«
Ich senke den Blick. »Wenn er dich zur Wahl gezwungen hätte, wie hättest du entschieden?«
\\Freunde stellen einander kein Ultimatum.//
Es ist ein unbewusster Gedanke, aber als ihr klar wird, dass ich sie gehört habe, nickt sie bedächtig. »Ich verstehe dich. Was nicht heißt, dass ich das gut finde.« Langsam kommt sie auf mich zu und setzt sich auf das Bett. Dann legt sie vorsichtig ihren Kopf auf meine Brust und atmet tief durch. »Du kannst Cassey ausrichten, wenn ich dich noch ein einziges Mal ramponiert vorfinde, wenn sie vorher mit dir zusammen war, dann kann sie was erleben.«
»Ey«, mache ich und zwicke in Tess’ Nase. Ihre Anwesenheit lenkt mich von dem stechenden Schmerz in meinem Arm ab.
»Ich weiß, du liebst sie. Aber Nic ... ich liebe dich auch. Du musst echt besser auf dich aufpassen, hörst du?«
»Ich dich auch«, murmle ich sanft und Tess streicht vorsichtig über meine Brust. »Und ja, ich versuche es. Falls das hilft: Ich begebe mich nie absichtlich in diese Situationen.«
»Das wäre ja noch schöner«, gibt sie zurück und spielt mit dem Stoff meines Krankenhauskittels. »Ich bringe dir ein paar Klamotten und Zeug. Weißt du, wie lange du noch bleiben sollst?«
»Keine Ahnung. Aber ich habe strengste Anweisung, auf Dr. Greenwood zu hören.«
Tess’ Augenbrauen heben sich. »Immerhin ist sie streng mit dir.«
»Ich kenne sie doch bisher kaum.«
»Ich spreche von Cassey.«
Meine Mundwinkel zucken.
»Es ist unglaublich. Man muss nur ihren Namen sagen und schon guckst du, als hätte man dir deinen Lieblingskuchen vor die Nase gestellt«, witzelt sie und richtet sich wieder auf. \\Auch, wenn ich ihn dafür umbringen könnte, dass er sie liebt. Er sieht so viel glücklicher aus, als noch vor ein paar Wochen. Ist wirklich Cassey daran schuld? Wehe sie bricht ihm das Herz. Dann breche ich ihr ...//
Ich sehe Tess vielsagend an.
\\Den kleinen Finger?//
Kopfschüttelnd unterdrücke ich ein Grinsen.
4 - Nicolas
Am nächsten Morgen – oder besser gesagt Mittag – werde ich von Stimmen auf dem Flur geweckt. Dr. Cheyenne Greenwood ist freundlich und zuvorkommend, aber eben auch typisch Ärztin. Wenn es nach ihr ginge, würde ich noch ein paar Tage bleiben, aber sie versteht mein Drängen, aufgrund der aktuellen Situation zügig nach Hause zu kommen. Nur ... wo ist zu Hause? Bei Tess? Zusammen mit Grayson? Wohl kaum.
Ich scrolle gelangweilt durch ein paar Wohnungsanzeigen, doch ohne Grays mentale Unterstützung kann ich mir das erstens nicht leisten und zweitens hätte ich keine Chance, so schnell und unkompliziert eine Wohnung zu finden. Bleibt also nur noch ein Hotel, bis ich etwas Besseres habe.
Nachmittags bringt Tess mir eine große Tasche mit Klamotten und allem möglichen Kram von mir. Sie hat einfach alles eingepackt, was sie greifen konnte, sagt sie, als ich zwei etwas schickere Hemden herausziehe, die ich mir eigentlich für den Schulalltag gekauft hatte. Dennoch bin ich froh, ein Shirt und eine Jogginghose gegen dieses demütigende Krankenhaushemd tauschen zu können. Immer wieder sehe ich in der Zwischenzeit aufs Handy und versuche mir einzureden, dass es Cassey gut geht, auch wenn sie sich nicht meldet.
Später taucht auch noch Taylor auf – offiziell, um Tess abzuholen und mit ihr zum Pavel’s zu fahren, inoffiziell, weil Tess uns beide noch einmal richtig bekanntmachen wollte. Scheinbar läuft da inzwischen mehr, auch wenn sie vor einer festen Bindung zurückschrecken. Taylor bietet mir an, dass ich eine Weile bei ihr unterkommen kann, weil ihre Mitbewohnerin im Ausland ist, aber ich lehne dankend ab. Es wäre keine gute Idee, nun auch noch Tess’ Freundin in Alastors Fokus zu ziehen.
Am frühen Abend schlafe ich immer wieder ein, weil die Schmerzmittel wahre Wunder wirken. Ich fühle mich dauerhaft benommen und passe nur halb so gut auf, wie ich sollte, als Dr. Cheyenne noch einmal meinen Verband wechselt und mir dabei erklärt, worauf ich achten muss, wenn ich es zu Hause selbst mache. Mittlerweile höre ich allerdings ihre Gedanken deutlicher, weil sie Vertrauen gefasst hat. Immer wenn ich auf mein Handy spähe, taucht ein sanftes Lächeln auf ihren Lippen auf und sie denkt so etwas wie: \\Ich hätte nie gedacht, dass sich die kleine Krylowa mal verliebt.//
Schließlich ziehe ich meine Jeans und das neue hellblaue Hemd an. Meine Entlassungspapiere sind unterschrieben, die Tür steht halb offen und ich packe die letzten Sachen zusammen, als in meinem Kopf eine Stimme laut wird.
\\Fuck, was, wenn er nicht mitkommt?//
Ich richte mich auf. Das ist Connor.
\\Aber ich habe keine Wahl. Sonst reißt Hardy mir meine Innereien raus. So wie er es gestern bei Joanne gemacht hat. Warum ist der Boss nur so versessen auf ihn?//
Mit zwei Schritten bin ich bei der Tür und spähe durch den Spalt. Connor und eine mir unbekannte Frau gehen geradewegs auf den Tresen zu, der schräg gegenüber von meinem Zimmer ist. Sie fragen nach James White und das ist mein einziger Vorteil. Scheinbar wissen sie nicht, dass Cassey mich unter meinem richtigen Namen angemeldet hat.
Die Frau am Empfang klickt langsam und gelangweilt durch ihre Liste. Ich warte keine Sekunde länger und schnappe mir meine Tasche – bin immer noch dumm genug, den rechten Arm zu benutzen, und lasse sie vor Schmerzen fallen. Einen Atemzug später habe ich sie über meine linke Schulter gelegt und greife mein Handy vom Nachttisch. Gerade als ich mir die Kapuze der schwarzen Hoodie-Jacke überziehe, um nicht anhand meiner Haare erkannt zu werden, öffnet sich die Tür in meinem Rücken.
In der Spiegelung der Fensterscheibe erkenne ich Connor und die Frau. Sie versperren den Eingang.
Fuck.
Aus dem Fenster springen wird nichts, wir befinden uns im zehnten Stockwerk.
»Nicolas Wandsworth«, bemerkt die Unbekannte und spielt mit ihrer mausbraunen Haarsträhne, die aus dem Zopf gefallen ist. Ihre Absätze klacken auf dem beschichteten Boden, als sie sich auf mich zu bewegt. »Wie schön, dich endlich persönlich kennenzulernen.«
Ich gehe um das Bett herum, lasse meine Hand dabei wie zufällig auf den roten Notfallknopf für Cheyennes Pieper fallen.
»Mit wem habe ich die Ehre?«, frage ich und versuche, trotz der Schmerzmittel aufmerksam und hellwach zu sein.
»Ich bin Kaitlyn. Connor kennst du ja bereits. Wir sind hier, um dich abzuholen.«
Ihre Gedanken sind ziemlich verschlossen, aber ihr entweichen immer wieder Fetzen, die zwischen Angst und Überzeugung schwanken.
»Euch sollte klar sein, dass ich nicht mit euch komme«, gebe ich zurück und scanne den Raum ab, doch ich wüsste nicht, was ich hier zur Verteidigung benutzen könnte.
»Schade. Hardy hält Grayson und dir aktuell noch die Luxus-Suite frei«, entgegnet sie und legt den Kopf schief. Dann wandert sie mir hinterher um das Bett herum. »Und wie ich sehe, bist du schon abreisebereit.«
»Connor«, sage ich und sehe zu meinem ehemaligen Schüler. »Du weißt, dass das falsch ist.«
Ich höre in seinen Gedanken, dass er zweifelt. Er würde sich aus der Ruhe bringen lassen, wenn ich nur genug Zeit hätte, auf ihn einzureden. So wie er sich eben auch von Alastors Leuten bequatschen ließ. Aber diese Zeit habe ich nicht.
Cheyenne stürmt ins Zimmer, braucht eine Sekunde, um die Situation zu analysieren, und hält im nächsten Moment einen zu beiden Seiten ausfahrbaren Stock in den Händen, der gefährlich orange schimmert. Kaitlyns und Connors Augen werden für eine Millisekunde schwarz, das Symbol leuchtet auf ihren Stirnen. Cheyenne erwischt Connor volle Breitseite mit dem Stock an der Schläfe und er geht zu Boden. Kaitlyn prescht auf Cheyenne zu und ich stehe da wie angewurzelt, während die beiden sich einen Kampf liefern, der für mein benommenes Gehirn viel zu schnell geht.
»Nicolas, runter!«, ruft Cheyenne und ich reagiere instinktiv. Es knallt. Fuck, hat sie etwa auch eine dieser speziellen Schusswaffen?
Kaitlyn schreit auf. Als ich den Kopf wieder hebe, schiebt Cheyenne gerade die kleine Pistole zurück in ihre Kitteltasche und zieht eine Spritze auf der anderen Seite heraus. Zwei Sekunden später steckt die Nadel in Kaitlyns Seite und Cheyenne drückt den Kolben herunter. Kaitlyn windet sich kurz, dann hängt ihr Körper schlaff über dem Bettgestell und rührt sich nicht mehr. Der Schuss hat ihren Oberarm gestreift.
»Scheiße, was haben die Gezeichneten nur mit dir?«, zischt Cheyenne wütend und sieht mich irritiert an. Sie holt die Karneolkette aus ihrem Kittel und ich weiche einen Millimeter zurück.
»Was?«, fragt sie und missversteht meine Reaktion völlig. Sie wirft einen Blick über ihre Schulter und sieht gerade noch, wie Connor plötzlich aufspringt und die Flucht ergreift.
»Fuck!«, ruft sie und blickt zwischen Kaitlyn, mir und der Tür hin und her. »So eine Scheiße, verflucht! Argh!«
Ich taste nach einer Wand, weil mir das lange Stehen unter Schmerzmitteln doch noch Probleme bereitet. Cheyenne ist mit zwei Schritten bei mir.
»Schon okay, dir passiert nichts«, verspricht sie mir, weil sie erneut meine Bewegung fehlinterpretiert. Sie drückt mir eine Visitenkarte in die Hand. »Ruf Charles an. Sag ihm, dass er dich zu Cassey bringen soll. Dort bist du in Sicherheit.«
»Nein, ich kann nicht ...«
»Nicolas«, unterbricht sie mich. »Ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Ich muss diesen Typen wiederfinden. Geh in die Liegendaufnahme. Charles wird dich dort abholen, wenn du ihn darum bittest. Sag ihm, dass er auch Ron verständigen soll. Er muss sich um diese hier kümmern. Wir haben keine Zeit. Geh!«
***
»Steig ein«, verlangt Charles, als er den großen, schwarzen Geländewagen in der eigentlich nur für Notfälle gedachten Haltebucht stoppt. Ich rutsche auf den Beifahrersitz und ziehe die schwarze Kapuze herunter.
»Hey. Sorry für die Umstände.« Da ich von Charles’ Karneolbesessenheit weiß, gebe ich mir Mühe, nichts zu berühren. Mit den Ärmeln über meinen Fingern schnalle ich mich an und ignoriere das immer schlimmer werdende Brennen in meinem Arm.
»Gar kein Thema. Dass diese Ratten jetzt auch noch hinter dir her sind, tut mir so leid. Aber du bist bei Cassey sicher, das verspreche ich. Also sicherer als in der kleinen Firmenwohnung oder im Krankenhaus«, bemerkt Charles und gibt Gas. Er fährt viel zu schnell, nimmt jede dunkelorange Ampel mit. »Was macht dein Arm?«
»Es geht«, gebe ich zu und blinzle gegen den Schwindel an, der mich erfasst, als Charles über eine Kreuzung brettert.
Sein wachsamer Blick streift erst mich, fällt dann in den Rückspiegel und wird zu einem sanften Lächeln. Ich sehe über die Schulter und entdecke eine Babyschale. Mit einem Baby darin. Meine Augen werden groß.
»D-du ...«, setze ich an und komme nicht weiter.
»Valentine schläft im Auto besser ein als irgendwo sonst«, erklärt Charles mit einem Schulterzucken.
»Ist das nicht zu gefährlich? Was, wenn die ... Gezeichneten uns gerade verfolgen?«, frage ich und bin froh, im letzten Moment nicht Minions gesagt zu haben.
»Bei mir ist er sicherer als bei irgendjemand anderem«, beharrt er und steuert plötzlich das Auto weg von der Stadt, Richtung Long Beach. Hoffentlich ist das Versteck von Cassey und Natalie nicht zu weit entfernt für Graysons und meine Verbindung. Nach einigen Kilometern spüre ich zwar ein dumpfes Pochen hinter meinen Schläfen, doch es ist aushaltbar.
Charles und ich unterhalten uns über alles Mögliche. Ich versuche, viele Fragen zu stellen und ihn erzählen zu lassen, damit ich nicht lügen muss. Valentine ist tatsächlich am Valentinstag geboren worden und damit nur elf Wochen alt. Zuerst quietscht und brabbelt er noch fröhlich vor sich hin, doch kurz vor unserem Ziel schläft der Kleine wirklich ein.
An Charles’ Stelle würde ich vor Sorge sterben. Doch er betont immer wieder, wie froh er sei, dass Valentine ein Einzelkind und damit kein Nesweru ist. Er erklärt mir ein paar Details zu Nesweru und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Wenn er wüsste, dass er das alles gerade einem Shemayu erzählt … einen Shemayu in Sicherheit bringt und das Wohlergehen seines Sohnes für das eines Shemayu aufs Spiel setzt.
Wir halten schließlich vor einem riesigen Anwesen mit Sicherheitsschranke und Videoüberwachung. Greenwood. Klar. Der Name steht scheinbar für Geld und viel zu viel Großzügigkeit. Charles gibt den Code ein und das Tor öffnet sich. Halluziniere ich oder schimmert es leicht orange?
Hinter dem Tor liegt eine viel zu große Auffahrt und ein viel zu großes hell gestrichenes Haus mit riesigen Fenstern. Man sieht zwar, dass im Innenraum Licht brennt, doch das Glas scheint mit einem Sichtschutz ausgestattet zu sein. Kleine Lampen säumen den Weg und führen an der Außenwand vorbei in Richtung Strand.
Charles sieht zu mir. »Schaffst du es allein bis zur Tür?«
»Natürlich«, antworte ich und schnalle mich ab. »Danke. Für alles. Das ist ...«
»Das, was Alex auch für dich getan hätte«, entgegnet Charles sanft. \\Ich muss wenigstens versuchen, die Mädels in dieser Hinsicht zu unterstützen. Alex würde das Gleiche für Valentine tun, wenn ich nicht da wäre.//
Wenn er wüsste …