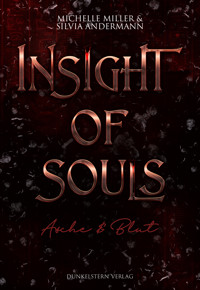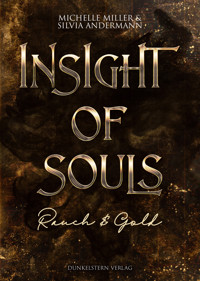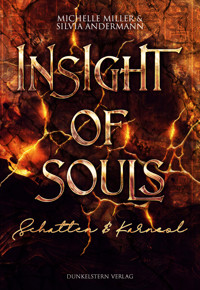
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dunkelstern Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Insight of Souls
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Er wird Dunkelheit und Chaos über diese Welt bringen. Er ist derjenige, der das Licht der Götter auslöschen wird.« Mit der Wahrheit bricht das wackelige Gerüst von Casseys und Nicolas' Beziehung in sich zusammen. Der Schock, sich in den Feind verliebt zu haben, sitzt tief – die Wut noch tiefer. Doch den beiden bleibt nicht viel Zeit, um sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Eine Gruppe Shemayu und ihr mysteriöser Anführer bedrohen das Leben aller Nesweru – und derer, die sich ihm in den Weg stellen ….
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright 2024 by
Dunkelstern Verlag GbR
Lindenhof 1
76698 Ubstadt-Weiher
http://www.dunkelstern-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Covergestaltung: Fabula Design
ISBN: 978-3-98947-001-9
Alle Rechte vorbehalten
Für die Verlorenen und die Wiedergefundenen.
Für diejenigen unter euch,
die sich auf ihrem Weg verirrt haben.
Auf dass ihr erkennt, was wirklich zählt.
Inhalt
TRIGGERWARNUNG
Kapitel 1 - Cassey
Kapitel 2 - Nicolas
Kapitel 3 - Cassey
Kapitel 4 - Nicolas
Kapitel 5 - Cassey
Kapitel 6 - Cassey
Kapitel 7 - Nicolas
Kapitel 8 - Cassey
Kapitel 9 - Cassey
Kapitel 10 - Cassey
Kapitel 11 - Cassey
Kapitel 12 - Nicolas
Kapitel 13 - Nicolas
Kapitel 14 - Cassey
Kapitel 15 - Cassey
Kapitel 16 - Nicolas
Kapitel 17 - Nicolas
Kapitel 18 - Nicolas
Kapitel 19 - Cassey
Kapitel 20 - Nicolas
Kapitel 21 - Cassey
Kapitel 22 - Nicolas
Kapitel 23 - Cassey
Kapitel 24 - Nicolas
Kapitel 25 - Cassey
Kapitel 26 - Cassey
Kapitel 27 - Nicolas
Kapitel 28 - Nicolas
Kapitel 29 - Cassey
Kapitel 30 - Nicolas
Kapitel 31 - Cassey
Kapitel 32 - Cassey
Kapitel 33- Nicolas
Kapitel 34 - Cassey
Kapitel 35- Nicolas
Kapitel 36- Cassey
Kapitel 37- Cassey
DANKSAGUNG
Triggerwarnung:
TRIGGERWARNUNG
Liebe Leser:innen, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr am Ende des Buchs eine ausführliche Liste. Wir wünschen uns für euch ein angenehmes Leseerlebnis.
Michelle, Silvia & der Dunkelstern Verlag
Kapitel 1 - Cassey
Scheinwerfer und Blaulicht durchbrechen die dunkelste Nacht, die ich je in New York City erlebt habe. Die Pfützen unter meinen Füßen glitzern blau-rot und spiegeln den Rettungswagen, auf dessen Tritt ich sitze, wider. Ein schwarzer Schatten inmitten dieses Farbenspiels – meine Silhouette.
Hinter mir im Wageninneren wird Natalie behandelt. Die Sanitäterin spricht leise mit ihr, gibt Anweisungen und fragt sie nach ihrem Befinden, während Natalie nur wenige Worte über ihre Lippen zwingt. Immer wieder kommt ein Sanitäter oder ein Polizist vorbei, um irgendwelche Dinge zu klären, denen ich keine Beachtung schenke. Schnelle Schritte stampfen und knirschen über den nassen Asphalt. Tragen werden gerollt, Anweisungen hallen über die abgesperrte Straße, Stimmen wandern wie ein Summen zwischen den Wagen und Menschen hindurch.
Ich starre auf die knisternde Rettungsdecke, die mir aufgezwungen wurde. Sie bedeckt größtenteils die blauen Flecken, Schürfwunden, Schnitte, Stiche und Brandwunden. Alles darüber hinaus kann die Sanitäterin nicht versorgen. Die angegriffenen Organe, die Vergiftung, welche sich schleichend bemerkbar macht. Die gepeinigte Seele – von den psychischen Angriffen der Shemayu, nachdem die Offenbarung von Nicolas und Grayson unsere mentalen Mauern erschüttert hat.
In mir wohnt eine Leere, die nahezu alle Geräusche an mir abperlen lässt.
Plötzlich tauchen nackte Füße neben mir auf. Einem Automatismus folgend springe ich auf, die Schmerzen meines Körpers ignorierend, und drehe mich zu Natalie um. Ich biete ihr meine Hand an, um ihr aus dem Wagen zu helfen.
»Lassen Sie mich das machen«, ertönt neben mir die Stimme der Polizistin, die wir im Auditorium bereits kennengelernt haben. Sie streckt Natalie ihre Hände entgegen und stützt sie, sodass ich meine wieder zurückziehen und mich setzen kann.
Ächzend lässt sich meine Schwester neben mir nieder. Im nächsten Moment wird auch ihr eine Rettungsdecke um die Schultern gelegt. Das Gold lässt ihre Haut nicht mehr ganz so blass wirken, hebt ihre Verletzungen im Gesicht aber umso mehr hervor. Ein Nahtpflaster am Haaransatz, eines an der Wange, ein blau unterlaufenes Auge, eine geplatzte Lippe. Die Nase hat aufgehört zu bluten.
Ich frage gar nicht erst, wie es ihr geht, denn ich kenne die Antwort bereits. Die Polizistin hingegen zögert nicht und wendet sich mit einem mitfühlenden Blick an uns beide: »Geht … geht es Ihnen soweit gut?«
»Gut genug, um Fragen zu beantworten«, murmle ich und löse meinen Blick von Natalie, die ausdruckslos in die Ferne starrt. »Das ist es doch, was Sie wollen. Wir lassen uns verarzten, fahren mit aufs Revier und sagen Ihnen, was Sie wissen möchten.«
»Es würde uns selbstverständlich sehr helfen, da Sie beide bis zum Schluss mitten im Geschehen waren«, erklärt sie und strafft die Schultern. »Aber uns ist natürlich auch wichtig, dass Sie in der Verfassung dazu sind.«
Nein, sind wir nicht. Natürlich nicht! Wie blöd kann man sein?
»Wir bringen es lieber jetzt hinter uns«, entgegne ich, denn in den nächsten Tagen werden unsere Verletzungen doppelt so schnell abheilen, wie es für einen Menschen normal wäre. Also beuge ich mich zu unseren Schuhen herab und nehme sie in die Hand. Meine Füße schmerzen zu sehr, sind zu geschwollen, um jetzt wieder in High Heels gezwängt zu werden.
Die Polizistin mustert unsere vom Kampf gezeichneten Kleider. »Auf dem Revier gibt es Wechselkleidung, wenn Sie …«
»Nicht nötig«, würge ich sie ab. »Können wir dann?«
Nach kurzem Zögern nickt sie. Ich wende mich Natalie zu. Sie ist wie zur Statue erstarrt, das Gesicht glatt und ausdruckslos. Das Einzige, was sich bewegt, sind ihre losen Haarsträhnen in der leichten Brise.
»Nat?«, frage ich eine Spur sanfter. »Natalie?«
Sie blinzelt. Dann dreht sie den Kopf. Nur kurz begegnen ihre Augen meinen, dann sehen sie durch mich hindurch. Ich nehme ihre Hand und führe sie bis zum Einsatzwagen, wo wir auf der Rückbank Platz nehmen. Die Rettungsdecke knistert, das Lederpolster knarrt, die Tür knallt zu. Und mit einem Schlag kehrt Stille ein. Eine Stille, die mich unruhig macht, weil sie mir verdeutlicht, wie laut es in meinem Inneren ist. Das Chaos in mir schreit, aber ich verschließe es in einer Kapsel, die ich erst zu gegebener Zeit wieder öffne.
***
Die Rettungsdecke gegen eine fremde Fleecejacke getauscht, sitze ich – immer noch barfuß – mitten im Getümmel der Polizeiwache. Die vielen Geräusche verschwimmen zu einem einzigen Rauschen und Surren. Mein Kopf glüht und zugleich erbeben meine Gliedmaßen vor Kälte.
Zitternd sitze ich auf einem unbequemen Stuhl – vielleicht wäre gerade aber auch einfach alles unbequem wegen meiner Verletzungen – neben einem der Schreibtische und warte auf den Detective, der meine Aussage aufnehmen soll. In meinem Schoß halte ich einen Plastikbecher fest. Mein Blick haftet an den vielen kleinen Luftbläschen in meiner Cola.
In Gedanken gehe ich das Gespräch von Natalie und mir im Wagen durch – natürlich auf Russisch, damit die Polizistin nichts verstehen konnte. Wir überlegten uns, was wir zu möglichen Beobachtungen sagen sollten, wie zum Beispiel, dass Menschen ohne Berührung zu Boden befördert wurden oder in einem goldenen Licht, das von uns ausging, verbrannten. Das Licht könnte eine Reflexion der Saalbeleuchtung im Schmuck gewesen sein, die Verletzungen ohne Berührung lediglich Einbildung unter Stress, weil alles viel zu schnell ging. Die Verbrennungen der Wirte sind etwas schwieriger zu beantworten. Man könnte auf elektrische Gerätschaften spekulieren, die von den Tätern benutzt wurden. Dass sie von innen heraus verbrannt sind, wird die Polizei erst nach einer Autopsie wissen können.
»Cassey. Seren. Alexandrowna. Krylowa«, vernehme ich eine männliche Stimme, die meinen Namen sagt, als wäre ich eine alte Freundin – oder Erzfeindin.
Im nächsten Moment schlendert ein junger Mann an mir vorbei und lässt eine Akte auf seinen Schreibtisch fallen. »Wie passend, dass Sie hier sitzen.«
Sein gekünsteltes Grinsen wird von einem dunklen, gepflegten Bart und groben, aber schönen Gesichtszügen umspielt. Das weiße Hemd spannt unter seinem muskulösen Oberkörper. Darüber trägt er ein Waffenholster aus braunem Leder. Dem Schild auf seiner Brust kann ich den Namen Mubarak entnehmen.
Ich runzle die Stirn und beobachte, wie er sich in seinen Stuhl sinken lässt. »Wie soll ich das bitte verstehen?«, frage ich und muss mich räuspern, weil meine Stimme so kläglich klingt.
Er schlägt die Akte auf. Anschließend faltet er die Hände gemütlich vor sich und sieht mich mit einem schadenfrohen Funkeln in den grünen Augen an. »Wie geht es Ihnen?«, übergeht er meine Frage, als wäre ich nicht wegen meiner Aussage zum Attentat hier, sondern zu einem Plausch. Wie ... geschmacklos in Anbetracht der aktuellen Situation. Er bleibt mir jedenfalls eine Antwort schuldig.
»Wie würde es Ihnen denn an meiner Stelle gehen?«, entgegne ich in der Hoffnung, dass er mir mit solch dämlichen Fragen fernbleibt. Andererseits ... woher soll er schon wissen, wie es mir geht? Er kann diese Last gar nicht erahnen, die auf meinen Schultern liegt. Ich war verantwortlich für all diese Menschen. So viele von ihnen sind gestorben und ich kenne wahrscheinlich bloß die Dunkelziffer.
Auch ein Nesweru hat heute sein Leben gelassen. Hunter Greenwood, der Zwillingsbruder von Ron. Er konnte gerade noch einen Hilferuf aussenden, ehe er Blut spuckte und zusammenbrach. Dank ihm traf Charles Greenwood nahezu gleichzeitig mit der Polizei ein, um bei der Verfolgung der flüchtigen Shemayu zu helfen. Ron kam an, als wir bereits im Einsatzfahrzeug saßen. Ich möchte mir sein Leid nicht vorstellen.
Ich sollte Wut spüren. Brodelnden Hass, der die Dunkelheit in mir weckt und mich diese Arschlöcher jagen lässt.
Aber gerade bin ich einfach zu erschöpft. Müde, ausgelaugt, und allmählich macht sich auch die kleine Dosis Gift bemerkbar, die mir ein Samu’shemayu per Hautkontakt verpasst hat. Ich friere, mein Ruhepuls ist viel zu hoch und mir ist leicht schwummrig. Noch ein Grund, weshalb ich keine Geduld für derlei Fragen habe.
Insgeheim hoffe ich, dass Papa endlich aufkreuzt und uns hier rausbugsieren kann. Wir haben ihn vor gut einer halben Stunde kontaktiert, also müsste er bald da sein – hoffentlich mit Gegengift in der Tasche.
Detective Mubarak tut meine Gegenfrage lediglich mit einem gebrummten »Hm« ab und fordert mich anschließend auf: »Erzählen Sie mir vom heutigen Abend.« Seine Augen begegnen meinen – ich habe bei ihm kein gutes Gefühl. Aber nicht das Shemayu-Gefühl, sondern das Ertappt-Gefühl. »Wieso waren Sie am Ort des Attentats?«
Ich blicke an meinem Kleid herab, und als ich wieder zu ihm aufsehe, kontere ich: »Na, gekellnert habe ich nicht. Ich war auf dem Maskenball der NYU, der Uni, an der ich studiere. Als Gast.«
»Waren Sie in Begleitung?«
Ein Bild von Nicolas blitzt vor meinem inneren Auge auf. Zum ersten Mal seit dem Moment, in dem ich seine schwarzen Augen gesehen habe, regt sich etwas in meiner Brust. Mein Herz krampft sich zusammen. Und es verhärtet, ehe es Blut spucken kann.
Noch immer will ich mir einreden, dass die schwarzen Augen nur Einbildung waren; eine Fantasie meiner gestressten Gedanken in einer unüberschaubaren Situation.
Wenn das hier vorbei ist, wartet er bereits vor dem Präsidium auf mich. Ein besorgter Ausdruck in den grün-blauen Augen und ein erleichtertes Lächeln auf den Lippen. Ich werde in seine Arme fallen und diesen Abend für nur einen Moment vergessen.
Aber mein Unterbewusstsein kennt die Wahrheit. Und es verschließt sich vor den Gefühlen, die von dieser Erkenntnis ausgelöst werden. Es verschließt sich davor zuzugeben, dass es jemals ein Wir mit Nicolas gab.
Mein Blick huscht prüfend zu Natalie, die ein paar Tische weiter ebenfalls befragt wird. »Ich war mit meiner Schwester dort.«
»Sie studiert auch an der NYU?«
»Ja.«
Er fragt mich nach unserer Ankunftszeit, meinen Eindrücken und Gefühlen gegenüber anderen Gästen, ob ich getanzt habe, mit wem ich getanzt habe, ob ich Alkohol getrunken habe, bis er zu der entscheidenden Frage kommt, die er vermutlich von Beginn an stellen wollte: »Ist Ihnen im Laufe des Abends irgendetwas aufgefallen? Etwas, das Ihnen merkwürdig erschien?«
Abgesehen davon, dass ich scheinbar einen normalen Abend hatte? »Da war ein Typ, der mich gestalkt hat, aber sonst ...«
Endlich eine Regung. Er runzelt die Stirn. »Ein Stalker?«
»Er schien mir ständig zu folgen und hat mich ununterbrochen angestarrt.«
»Haben Sie etwas unternommen?«
»Nein.« Leider.
»Wieso nicht?«, hakt er nach und betrachtet mich dabei wachsam. »Ich halte Sie nicht für ... besonders zurückhaltend.«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Ach ja? Was lässt Sie das vermuten?«
»Ich habe meine Gründe.«
Der lässt sich auch echt alles aus der Nase ziehen.
»Und klären Sie mich auch noch über diese Gründe auf, Detective?«
»Alles zu seiner Zeit. Beantworten Sie meine Frage.«
»Es war nicht einfach, etwas zu unternehmen, wenn er immer direkt in der Menschenmenge untergetaucht ist.«
»Oder«, setzt er an und legt eine dramatische Pause ein, wobei er sich vorbeugt. »Sie wollten gar nichts unternehmen.«
Ich runzle die Stirn und warte darauf, dass er weiterspricht.
Statt mir seine Unterstellung zu erklären, fragt er: »Wo waren Sie, als das Attentat startete?«
Wieder erwischt mich ein Flashback.
»Du bist ein Blödmann«, murmle ich leise und schluchze.
»Kann ich mit leben«, grinst Nicolas und kommt meinem Gesicht näher. Er zieht mich enger an sich. Ich schlinge die Arme um seinen Nacken und wir sehen einander tief in die Augen.
Die Gäste im Ballsaal beginnen, von zehn abwärtszuzählen. Ich hole Luft, um etwas zu sagen, da beugt Nicolas sich vor, um mich zu küssen.
Ich räuspere mich und schüttle die Erinnerung von mir.
»Wo soll ich schon gewesen sein? Auf dem Ball eben.«
Seine Augen verengen sich flüchtig. »Eine Quelle hat behauptet, Sie seien im Technikraum neben dem Podium gewesen.«
Welche Quelle? Nicolas? Ist er hier irgendwo?
Ich halte mich zurück, nach ihm Ausschau zu halten. Aber er wird nicht hier sein. Grayson hat ihn gepackt und sie sind geflohen, während ich wie paralysiert war.
»Tja, dann steht wohl Aussage gegen Aussage«, kontere ich so ruhig wie möglich und nehme einen Schluck Cola. Es befeuchtet die Wüste in meiner Kehle.
»Hm. Man könnte denken, dass Sie sich dort versteckt haben, weil Sie ganz genau wussten, was passieren würde. Dass Sie nichts gegen den Stalker unternommen haben, weil Sie wussten, dass er Teil davon ist.«
Meine Augenbrauen wandern gen Haaransatz und ich blinzle. »Wie bitte?«
Er neigt den Kopf leicht zur Seite wie eine Schlange. »Die Frage ist bloß, ob aus Angst oder um nicht mit reingezogen zu werden.«
Ich brauche einen Augenblick, um zu realisieren, was hier vor sich geht. »Versuchen Sie etwa gerade allen Ernstes, mich in die Täterrolle zu stecken?«, frage ich eine Oktave höher. »Das sind reine Spekulationen. Sie haben keine Beweise.«
Gleich darauf spüre ich, wie sich mein Puls beschleunigt und mir das Atmen schwer macht. Stress verteilt das Gift schneller.
Beruhig dich, Cass. Du kriegst das gewuppt, auch in diesem Zustand.
Mubarak mustert mein Gesicht wie durch ein Allsehendes Auge. »Ich habe Gründe zu meiner Annahme.«
»Welche denn? Ich habe gegen die Angreifenden gekämpft, falls Ihnen das entgangen ist. Sie haben mich übel zugerichtet und trotzdem sitze ich hier und mache meine Aussage – gegen diese Gruppe Arschlöcher.«
»Ein Wolf im Schafspelz«, entgegnet er schlicht.
»Bodenlose Unterstellung«, spucke ich.
»Bodenlos?«, wiederholt er unberührt und lehnt sich zurück. »Keineswegs, Miss Krylowa.«
Der Detective eröffnet seine sogenannte Beweislage gegen mich:
1. Fälle von Menschenverbrennungen und Vermissten folgen mir wie eine Ameisenspur in jeden Bundesstaat, in dem ich mich aufhalte.
2. Kalifornien, Arizona, Oklahoma, Georgia … Ein Umzug nach dem anderen in den letzten zehn Jahren. Meine ständigen Umzüge wirken wie eine Flucht vor der Polizei.
3. Es wurden Zeugenaussagen aufgenommen, in denen ich als eine auffallend laute und zur Gewalt neigende Frau beschrieben werde, und zudem angeblich im Umkreis einer Straftat gesichtet wurde.
4. Eine Kameraaufnahme von einer Straße und einem gegenüberliegenden Gebäude in Manhattan. Natalie und ich sind darauf zu sehen, wie wir Violet Jones ins Wohngebäude folgen – das war kurz nach unserem Umzug hierher. Seitdem gilt sie als vermisst. Ab hier wird auch Natalie verdächtigt.
5. Hinzu kommt der Fall mit Terrence, als ich ihn in der Bar scheinbar grundlos angefallen habe. Zwar hat dieser seine Anzeige wegen Körperverletzung zurückgezogen, sie wurde jedoch trotzdem in den Akten vermerkt. Kurz nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, ist er in der Nähe tot aufgefunden worden – von innen verbrannt. Als hätte ich meine Tat so vollendet.
Der Detective legt mir Fotos von verbrannten Leichen vor und beobachtet meine Reaktion. Jeder normale Mensch wäre von diesem Anblick vermutlich abgeschreckt, würde sich abwenden oder gar übergeben. Aber ich habe leider schon so viele verbrannte Körper gesehen, dass sie mich nicht schocken – und das macht mich auffällig.
Es wäre jedoch ein Leichtes für mich, das auf die heutigen Ereignisse und ein Trauma zu schieben. Selbst an einem Abend habe ich zu viel Gewalt und Tod gesehen.
Im Endeffekt könnte ich all diese Beweise mit einer guten Mischung aus Wahrheit und Lügen zunichtemachen.
1. Diese Fälle gab es auch schon zuvor und sie gibt es überall auf der Welt – ich kann mich wohl kaum teleportieren.
2. Ich war ein Problemkind. Schule war ein schwieriges Thema. Und unser Vater bekam immer wieder neue Jobangebote. Alles zusammen hat dazu geführt, dass wir weitergezogen sind, in der Hoffnung, dass es sich im nächsten Städtchen bessert. Ich wollte eigentlich nur zurück in meine Heimat.
3. Die Beschreibungen passen auch zu anderen Frauen. Solange keine handfesten Beweise vorliegen, die auf meine Identität schließen lassen, gilt dieser Vorwurf als haltlos.
4. Bei Violet könnte ich einfach vorgeben, dass sie mir das Portemonnaie geklaut hat, und als ich es mir zurückholen wollte, ist mir meine Schwester lediglich gefolgt. Dass Violet seitdem vermisst wird, hat nichts mit mir zu tun. Immerhin wurde sie – wie man auf den Aufnahmen höchstwahrscheinlich auch sehen wird – eine ganze Weile später von Sanitätern abgeholt. Sie hatte vielleicht einen Kreislaufzusammenbruch.
5. Als Detective wird er wissen, dass ich einen guten Grund hatte, Terrence anzugreifen. Er wird wissen, dass ich wegen ihm vor ein paar Jahren fast gestorben wäre. Dass Terrence danach tot aufgefunden wurde, würde ich als Karma bezeichnen, denn es gibt keine Beweise, die auf uns zurückzuführen sind.
Abgesehen davon könnte ich all das auch auf Terrence schieben. Behaupten, dass er mir alles anhängen wollte, aber selbst dafür verantwortlich war. Dass er mich deswegen nicht anzeigen wollte. Dass die Morde und Vermisstenanzeigen auch nach seinem Tod kein Ende nehmen, weil er einer Sekte oder so angehört hat.
Aber ich erkenne den Ernst der Lage und nehme daher von meinem Recht zu Schweigen und einer Anwältin – natürlich eine unseres Vertrauens – Gebrauch, auch wenn es Mubarak in seinen Anschuldigungen bestärkt. Denn ich weiß nicht, ob mir in dem Zustand etwas über die Lippen rutschen könnte. Es bräuchte nur ein einziges falsches Wort und das ganze Kartenhaus würde in sich zusammenfallen.
»Wenn Sie also nicht weiter mit meinem Schweigen vorliebnehmen wollen, stellen Sie mir nur noch Fragen zum Attentat auf den Ball, oder ich gehe«, schließe ich mit gerecktem Kinn.
Widerwillig kehrt er zum eigentlichen Thema zurück und arbeitet missmutig eine Frage nach der anderen ab. Wie vermutet sind Fragen dabei wie: Könnten Sie die Angreifer identifizieren? Was war das für ein Licht, das ein paar Gäste gesehen haben? Was sagen Sie zu den Behauptungen, die Angreifenden hätten Menschen teilweise ohne Berührung verletzt?
Gerade als die letzte Frage beantwortet ist, taucht eine Hand auf meiner Schulter auf. Ich drehe ruckartig den Kopf, wobei es schmerzhaft in meinem Nacken zieht.
»Haben Sie dann all Ihre Antworten, Detective?«, fragt mein Vater mit dieser Stimme, die keine Widerrede duldet. »Ich denke, meine Töchter haben nach den ganzen Strapazen endlich Ruhe verdient.«
Detective Mubarak räuspert sich, steht auf und strafft die Schultern – was für ein lächerlicher Versuch, meinem Vater gegenüber Autorität auszudrücken. »Es tut mir leid, aber ich denke, wir müssen sie noch etwas hierbehalten.«
Papa würdigt mich keines Blickes. »Haben Sie denn noch nicht genug?«
»Es liegt ... ein Verdacht gegen sie vor, den ...«
»Den Sie nicht beweisen können, wenn wir mal ehrlich sind«, unterbreche ich ihn und erhebe mich.
Mir schießt das Blut wie bei Ring the Bell rasant in den Kopf. Meine Sicht verschwimmt. Plötzlich ist es für den Bruchteil einer Sekunde schwarz um mich herum. Ich spüre, wie sich ein Arm um meine Taille legt und etwas Nasses meine Zehen berührt.
Blinzelnd sehe ich zu meinem Becher am Boden hinab. Dann zum Detective, der mich skeptisch beäugt, und letztlich zu meinem Vater. Sein Gesichtsausdruck ist mir schleierhaft.
»Sie bleibt definitiv nicht hier«, bestimmt Papa. »Sprechen Sie mit ihrer Anwältin.«
»In Ordnung«, entgegnet der Detective und verschränkt die Arme vor der Brust. »Bis die Sache geklärt ist, dürfen Sie den Staat New York nicht verlassen, Miss Krylowa. Sollten Sie das tun, machen Sie sich eines Verbrechens strafbar.«
»Werden wir ja sehen«, kontere ich und löse mich aus Papas überraschend sanftem Griff, um aufzustehen.
»Unsere Anwältin wird sich bei Ihnen melden«, sagt Papa, ehe auch er sich abwendet.
Seite an Seite gehen wir zwischen den Schreibtischen hindurch auf ein gläsernes Bürozimmer zu, biegen rechts ab und steuern den Flur an. »Natalie wartet vorne«, lässt er mich wissen, die Stimme hart und klar wie ein Diamant.
»Hast du das Gegengift dabei?«
»Noch besser: Cheyenne Greenwood ist da. Sie wartet draußen mit dem Mittel auf euch.«
Ich nicke und betrete schweigend den Gang. Als ich aus der Jacke schlüpfe, erblicke ich Natalie auf einem der Stühle an der Wand. Ihr Blick ist auf ihre Hände gerichtet, die ruhig in ihrem Schoß liegen, statt gedankenverloren mit den Haarspitzen zu zwirbeln. Sie ist wie in einer Schockstarre gefangen. Tränen hat sie noch nicht vergossen. Das kommt erst später. Und dann werde ich da sein, um sie aufzufangen.
Kapitel 2 - Nicolas
Ich fühle mich elend, als ich aus dem Mustang steige und mich strecke. Wir sind zu alt, um die Nacht im Auto zu verbringen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Sekunde geschlafen. Casseys entsetzter Ausdruck hängt mir immer noch nach.
Als wir ein Diner in der Nähe der Brooklyn Bridge betreten, spiele ich mit dem Gedanken, einen Irish Coffee zu bestellen. Ich will vergessen, was vor wenigen Stunden passiert ist. Dass Cassey und Natalie Nesweru sind und Grayson und ich nichts – rein gar nichts – gemerkt haben. Ich fühle mich so unendlich dumm.
Das Diner ist komplett leer, weil es viel zu früh ist, um wach zu sein. Aber selbst Grayson konnte gegen vier Uhr nicht mehr schlafen. Seine Gedanken schmerzen in meiner Brust, weil ich ihn noch nie so sehr habe leiden hören. Natalies Name fällt häufig und immer wieder werde ich mit Erinnerungen an ihr Lachen und ihre gemeinsame Zeit beschallt. Ich hätte versucht, ihn aufzumuntern oder zu trösten, wenn ich nicht dasselbe empfinden würde wie er.
Wir setzen uns an einen Tisch in der Ecke und sprechen kein Wort. Das haben wir nicht mehr getan, seit wir beschlossen haben, dass es sicherer ist, die Nacht im Auto zu verbringen und nur Bargeld zu benutzen. Auch wenn wir bisher überaus selten persönlich mit Nesweru Kontakt hatten – zumindest, soweit wir uns zurückerinnern können –, wissen wir, dass sie gerissen und skrupellos sein können. Mein Inneres weigert sich, zu glauben, dass Cassey zu ihnen gehört. Dass sie mich höchstwahrscheinlich umbringen will.
»Hey, was kann ich euch bringen?«, fragt eine angenehm volle Stimme und als ich den Kopf Richtung Bedienung hebe, fällt ihr das Lächeln aus dem Gesicht.
Ich erkenne sie sofort wieder. Es ist Tess, die Kellnerin vom Ball. Ihre roten Haare sind noch wie vor ein paar Stunden zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre schicken Klamotten hat sie gegen eine ausgewaschene Jeans mit Löchern an den Knien, ein graues langärmliges Oberteil und eine kurze hellbraune Lederschürze getauscht. Ihr Namensschild Teresa Johnson gibt mir die Bestätigung, die ich gar nicht gebraucht hätte.
Unter ihren braunen Augen liegen dunkle Schatten – logisch, wenn man in der Nacht Cocktails zubereitet und dann ab vier Uhr im Diner steht. Verdattert schauen wir uns eine Weile an. Sie ist die Erste von uns, die ihre Sprache wiederfindet: »Na, ihr habt vielleicht Mut, hier aufzukreuzen.«
»Wowowow«, raunt Grayson, als wir es in ihren Fingerspitzen knistern hören wie bei einem elektrischen Wackelkontakt – ihre Fähigkeit, die sie mir auch schon auf dem Ball demonstriert hat.
Ich versuche, über ihre Gedanken herauszufinden, wie Tess einzuordnen ist. Eigentlich war sie mir ganz sympathisch, aber wer weiß, ob sie zu den Angreifenden auf dem Ball gehört hat. Ihre Gedanken stolpern, sind durcheinander und geben nichts darüber preis, wie sie eingestellt ist. Also trete ich unauffällig gegen Graysons Fuß und frage ihn stumm, ob er sie einschätzen kann.
\\Keine Ahnung. Ich habe sie in dem Gewirr nicht gesehen.//
»Okay, Karten auf den Tisch. Was war das denn bitte für eine Aktion gestern Abend?«, fährt sie uns verurteilend an. Noch immer knistert es verdächtig um sie herum, weshalb wir ihr nichts anhaben können. Zumindest nicht körperlich.
»Das fragen wir uns auch«, entgegne ich. Meine Stimme klingt abgeschlagen, obwohl ich gerade ein bisschen Konzentration gebrauchen könnte.
»Klar«, betont Tess spöttisch und verschränkt die Arme vor der Brust. »Was zieht ihr beide für eine kranke Scheiße ab? Auf wessen Seite steht ihr?«
»Auf gar keiner«, mischt sich Grayson ein und betrachtet Tess prüfend.
Plötzlich schnellt ihre Hand vor, packt ihn im Nacken und drückt seine linke Gesichtshälfte auf den Tisch. Er verzieht den Mund und kann einen Schmerzenslaut nicht unterdrücken.
»Hört auf, zu lügen«, zischt sie und gibt ihm eine Stromladung mit.
»Fuck, was willst du?«, ruft Grayson wütend, nachdem er sich erholt hat. Seine Augen werden urplötzlich schwarz und meine tun es ihnen gleich. Wenn Tess ihre Fähigkeit uns gegenüber anwendet, dann ist es unser gutes Recht, ebenfalls unsere Waffen auszupacken.
»Nicht euer Ernst«, stöhnt sie und schockt Grayson so sehr, dass er sich nicht auf ihre Gedanken fokussieren kann. Das Schwarz zieht sich wieder in seine Pupillen zurück, aber er blinzelt angestrengt. Dafür höre ich umso besser, was Tess durch den Kopf geht. Nämlich Angst. Ihre fast panischen Überlegungen, ob sie nicht lieber fliehen sollte, weil wir entweder von den Attentätern oder den Nesweru geschickt wurden. Wir waren schließlich gestern Abend noch ganz offensichtlich mit Cassey und Natalie zusammen. Aber das bedeutet für mich, dass Tess selbst nicht zu den Angreifenden gehören kann – dann würde sie nicht an unserer Positionierung zweifeln müssen.
»Hey, lass ihn los! Wir sagen dir alles, was du wissen willst, okay?«, versuche ich zu deeskalieren.
Kann dieser Tag eigentlich noch beschissener anfangen?
»Habt ihr diesen Angriff geplant? Gehört ihr dazu?«, hakt sie nach und hält Graysons Gesicht immer noch auf die Tischplatte gedrückt.
»Nein und nein«, nuschelt dieser und versucht, ihren Arm wegzuschlagen, wofür sie ihm noch einen Stromstoß versetzt.
»Dann gehört ihr zu den Nesweru?«
»Ganz sicher nicht«, knurrt Grayson.
»Was ist mit dir?«, frage ich und ihr Blick schießt zurück zu mir.
»Ich gehöre zu niemandem«, bestätigt sie meine Vermutung. Ihr Tonfall ist bissig, wenn auch nicht so eiskalt, wie es Casseys Stimme manchmal sein kann. »Ich habe da einfach nur gekellnert und auf einmal sind alle ausgerastet.«
»Ach, das glaubst du doch selbst nicht«, wendet Grayson ein und versucht, nach ihr zu treten. Wieder zuckt er von ihren Stromschlägen zusammen und ich hoffe, dass sie ihm keinen Herzstillstand verpasst.
»Wieso sollten wir dir das glauben?«, hake ich nach.
»Mir doch scheißegal, was du glaubst. Auffällig war, dass ich gerade dich nicht entdecken konnte, als es losging«, faucht Tess und greift flink mit der anderen Hand in mein Genick, um mich in dieselbe Lage wie Grayson zu befördern. Dieser stöhnt: »Er hat mit seiner Ex, die gestern noch seine Freundin war, im Materialraum rumgemacht. Jetzt lass mich los, du …«
»Vorsicht. Ich bin nur einen Stromstoß von eurem Tod entfernt«, flüstert Tess bedrohlich. »Es ist schon schlimm genug, dass ihr ernsthaft zwei Nesweru benutzt habt, um euren kranken Plan durchzuführen – was auch immer euch dieses Attentat gebracht hat.«
Grayson und ich reden zeitgleich auf sie ein, dass wir nichts mit dem Attentat zu tun hatten und Cassey und Natalie auch nicht benutzt haben. Allein der Gedanke daran schmerzt in meiner Brust. Und dass Cassey diese Annahme auch haben könnte, kommt mir erst jetzt.
»Sicher. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr ernsthaft mit Nesweru zusammen wart. Das war doch alles nur Show, um …«
»Um was?«, unterbreche ich sie. »Tess, ich schwöre, wir wussten nicht, was da abgehen sollte. Und wir wussten nicht, dass die beiden …«
»Nesweru sind«, beendet Grayson den Satz, den ich nicht aussprechen kann.
»Sicher«, wiederholt sie und lacht gehässig. Als wir beide nicht darauf eingehen, hält sie inne. »Ihr meint das ernst?«
»Ja«, stöhnen Grayson und ich wie aus einem Mund.
»Ihr verarscht mich nicht?«
»Nein«, entgegnen wir einstimmig.
»Oh«, macht Tess erneut und scheint kurz zu überlegen. »Das ist … Shit, ihr seht echt voll fertig aus.«
»Danke«, grummelt Grayson und richtet sich auf, nachdem sie ihren Griff gelockert hat. Ich hingegen bleibe mit dem Kopf auf dem Tisch liegen. Ich kann nicht mehr. Es ergibt alles keinen Sinn.
Aber Grayson hat noch genug Energie für uns beide. Er steht blitzschnell auf, packt Tess’ Handgelenke über dem Stoff ihrer Ärmel, sodass ihn der Strom nicht erreichen kann, und dreht sie ihr auf den Rücken. »So. Und was hattest du damit zu tun?«
»Hey, ich habe dir gerade vertraut, du Bastard«, ruft sie wütend.
»Jeder macht mal Fehler. Jetzt spuck’s aus! Wer hat dieses Attentat geplant? Für wen arbeitest du?«
»Ich wusste nichts davon!« Sie tritt gegen sein Schienbein. Grayson stöhnt vor Schmerz auf und lässt seine Augen erneut schwarz werden.
»Gray, warte«, bitte ich kraftlos, ohne mich von der Tischplatte zu erheben. »Sie weiß wirklich nichts. Ihre Gedanken hätten sie doch längst verraten, wenn es so wäre.«
»Bist du sicher?«
»Nimm deine Hände von mir«, fordert sie und windet sich aus seinem Griff. Dann bringt sie erst einmal einen Sicherheitsabstand zwischen uns.
Alle atmen tief durch.
»Okay. Vielleicht beruhigen wir uns jetzt erst mal wieder«, bemerkt Tess leise nach einigen Sekunden Stille. »Wenn ihr damit nichts zu tun hattet und ich auch nicht, dann sitzen wir schließlich irgendwie im selben Boot. Richtig?«
Kapitel 3 - Cassey
Nachdem ich im Keller eine Extrarunde am Boxsack hinter mich gebracht und meine Kondition ausgereizt habe, gehe ich nach oben. Vollgeschwitzt und noch leicht außer Atem trete ich vor die Badezimmertür.
Gerade als ich anklopfen will, klickt es im Schloss und die Tür öffnet sich. Warme, feuchte Luft schlägt mir entgegen und dreht mir den Magen um.
Natalie zuckt vor Schreck zusammen und greift instinktiv nach dem weißen Turban auf ihrem Kopf, damit er nicht verrutscht. »Musst du mich immer so erschrecken?«, beschwert sie sich leise und atmet tief durch.
Sie sieht auf einmal viel frischer aus. Nicht nur wegen des Trainings und der anschließenden Dusche, sondern so, als würde es ihr tatsächlich wieder etwas besser gehen. Die dunklen Schatten unter ihren Augen und die Müdigkeit sind aus ihrem Gesicht verschwunden. Es ist nicht mehr von den vielen Tränen aufgedunsen, die sie in den vergangenen Nächten vergossen hat.
Ihr herzzerreißendes Weinen hat meine eigenen Schmerzen auf ein Minimum schrumpfen lassen. Mir war es wichtiger, sie zu trösten, als mich selbst wieder aufzubauen. Also war ich stillschweigend für sie da, habe sie mit Essen versorgt und ihr zugehört. War ihre starke Schulter – wie immer.
An nur zwei Tagen durchlief sie verschiedenste Emotionen in ihrer Trauerbewältigung und in gewisser Weise litt ich im Stillen mit ihr. Verstand erst nicht, wieso es mich treffen musste, verfluchte dann die Götter und war schließlich nur noch sauer auf mich.
»Was kann ich dafür, dass du so schreckhaft bist, Schwesterherz?«, entgegne ich und deute an ihr vorbei ins Badezimmer. »Fertig?«
»Ja, du kannst«, antwortet sie und zupft ihren roséfarbenen Kimono aus Seide zurecht, ehe sie sich an mir vorbeizwängt. »Vergiss nicht, danach das Fenster aufzumachen.«
Ich verdrehe die Augen. Ohne zu antworten schließe ich die Tür hinter mir. Dann trete ich ans Waschbecken und blicke in den beschlagenen Spiegel. Erkenne nur Umrisse. Frage mich, was Natalie in meinem Gesicht sieht.
Also wische ich das Kondenswasser fort und stütze mich am Beckenrand ab. Ich sehe ein verzerrtes Gesicht. Gerötet vom Sport. Babyhärchen, die sich aus dem strengen Zopf gelöst haben. Aber vor allem sehe ich Ernsthaftigkeit. Das Lachen ist mir seit dem Ball vergangen – uns beiden.
Noch immer könnte ich mich selbst dafür ohrfeigen, mich nur auf das Amulett verlassen zu haben. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass es einmal nicht funktionieren würde; dass Ra mich derart im Stich lassen würde. Aber abgesehen davon frage ich mich auch immer wieder aufs Neue, wie ich nicht merken konnte, dass sie Shemayu sind. Bei den Göttern, ich habe so viel Zeit mit Nicolas verbracht. Ich war ihm so nah und doch so blind. Blind vor … Liebe.
Aber ist es nicht so, dass wir die Löcher in unseren Herzen mit Lügen füllen, damit sie aufhören zu bluten? Mein Herz war zerschunden und daher habe ich die Lüge nicht erkannt, als sie direkt vor mir stand. Als sie mich berührte, mich küsste und mir sagte, dass sie mir nie wehtun würde.
Ich habe mich noch nie so dumm gefühlt, war aber auch noch nie so rasend vor Wut. Das alles war nur ein Spiel. Er hat mich entblößt, mich ausspioniert, mir Honig ums Maul geschmiert und mir Lügen verkauft, um mich zu schwächen. Keine Ahnung, welchen Zweck er damit verfolgte, wenn er mir nie etwas getan hat. Aber vielleicht hat sich sein Plan auch einfach geändert, als der Angriff auf dem Ball dazwischenkam.
Nur dem Boxsack vertraue ich meine Emotionen an, ehe ich sie wieder dorthin verfrachte, wo sie eigentlich hingehören – in die verstaubte Abstellkammer meiner Seele. Mag sein, dass es für Leute wie Natalie funktioniert, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Aber für mich nicht.
Wenn ich jetzt daran denke, mich in Nicolas verliebt zu haben, fliegen mir nicht mehr allerlei schöne Erinnerungen durch den Kopf. Dann sind die einzigen Gefühle, die mich ausfüllen, nicht mehr Trauer und Schmerz, sondern Ekel und Wut.
***
Gerade als ich meine schwarze Lederjacke überziehe, kommt meine Schwester aus der Küche und dreht einen angeknabberten Apfel zwischen ihren Fingern. »Hast du die Nachricht von Charlotte gesehen?«
Ich halte mitten in der Bewegung inne. Beim Verlassen der Polizeistation hat Papa bereits Charles’ Schwester Charlotte Greenwood angerufen, damit sie sich um meinen Fall kümmert. Alle uns bekannten Greenwoods haben durch IT, Medizin und Jura Berufe erlernt, die ihnen als Nesweru nützlich sind. Vielleicht sollte ich mein Studium schmeißen und zur Polizeischule gehen.
Aber nein, von einer Nachricht weiß ich nichts.
Natalie lehnt sich seufzend gegen den Türrahmen. »Das Verfahren wurde eingestellt. Detective Mubarak soll ziemlich … sauer gewesen sein. Vielleicht solltest du also in nächster Zeit weniger … auffällig sein, Cass.«
Augenrollend wende ich mich ab und schlüpfe in meine Bikerstiefel. »Ich bin so unauffällig wie es die Shemayu zulassen, Nat.«
»Leider wahr«, murmelt sie.
Kurzes Schweigen. Dann nehme ich meine Schlüssel aus der Schublade der Kommode und bitte sie: »Sag Papa, er soll uns die Liste aller Studierenden, Dozierenden und Angestellten, die auf dem Ball anwesend waren, schicken, wenn sie fertig ist.«
Natalie folgt mir zum Hauseingang. »Und was, wenn die Shemayu nicht von der Uni sind? Wie Begleitungen zum Beispiel. Oder Aushilfen.«
Ich öffne die Tür. »Dann … checken wir eben die Begleitpersonen und alle Aushilfen, Natty. Und danach gilt es, die Überwachungskameras der Umgebung zu durchforsten. Ansonsten suchen wir aktiv nach Shemayu, sei es vom Ball oder nicht – völlig egal –, statt das Schicksal entscheiden zu lassen.« Ich drehe mich zu ihr um und lege meine Hände auf ihre Schultern. »Wir werden uns jeden Einzelnen von ihnen vorknöpfen. Und nachdem wir einen Shemayu nach dem anderen vernichtet haben, werden wir uns um sie kümmern, okay?«
Einen kurzen Moment verkrampft sie und ihr Blick füllt sich mit Schmerz. Ich wusste von Tag eins, dass Grayson sie irgendwann verletzen würde, und dafür wird er bitter büßen. Aber erst, nachdem wir uns die mit dem Symbol gezeichneten Shemayu vorgeknöpft haben. Wir müssen den Ameisen bis zu ihrer Königin folgen, um diese samt Nest zu verbrennen – dieses Mal lassen wir uns aber nicht so einfach abspeisen wie vor einem Monat.
Bei Grayson und Nicolas konnte ich auf dem Ball kein Stirnsymbol ausmachen. Sie haben also keine Priorität. Aber wer weiß, wie lange noch, und ob sie nicht dennoch etwas damit zu tun hatten.
Natalies Ausdruck glättet sich und sie nickt. Dann legt sie ihre Hände ebenfalls auf meine Schultern und zieht mich an sich heran, um ihre Stirn an meine zu legen. Sie öffnet die Lippen, um etwas zu sagen, lässt es aber dann doch sein. Also löse ich mich von ihr und betrete die Veranda.
Mit großen Schritten gehe ich zur Garage. »Was hast du vor?«, ruft Natalie mir hinterher. Das weiße Tor öffnet sich mit einem lauten Knarren. Zwischen eingestaubten Kartons und einer Werkbank entdecke ich mein Schmuckstück, das sich unter einem weißen Stofftuch abzeichnet.
Mein Herz macht vor Vorfreude einen Sprung und ich ziehe das Tuch herunter, um mit den Fingerspitzen über den schwarzen Lack und das schwarze Leder zu fahren. »Hallo, mein Baby«, begrüße ich meine Honda CBR sehnsüchtig. Ich bekam das gute Stück zu meinem zwanzigsten Geburtstag – unter der Bedingung, dass ich mich ganz allein um alles kümmere, jegliche Kosten eingeschlossen.
»Oh, du holst dein Kleines Schwarzes raus?«, fragt Natalie hinter mir, obwohl es eine Feststellung ist. Sie nennt mein Motorrad immer das Kleine Schwarze, trotz seiner wuchtigen Größe.
Ohne etwas zu erwidern, schiebe ich es an meiner Schwester vorbei und schließe das Tor wieder. »Ich habe zwei Termine in Midtown, bin bald zurück«, verkünde ich, während ich mir meine schwarzen Lederhandschuhe überziehe.
»Was für Termine?«, hakt sie misstrauisch nach und folgt jeder meiner Bewegungen.
»Wirst du sehen, wenn ich zurück bin.«
Ich nehme den Helm vom Lenker, zwirble ein letztes Mal mein langes Haar ein und ziehe ihn anschließend über. Dann schwinge ich mich auf das Gefährt und schließe meine Hände um die Griffe. Ein tolles und vertrautes Gefühl, das mir im Winter stets fehlt.
Als ich den Motor starte, lassen das laute Brummen und die Vibration mein Herz schneller schlagen. Adrenalin pur.
***
Es ist bereits dunkel, als ich mein Motorrad in die Garage schiebe und durch die Hintertür in den Garten gehe. Vorsichtig spähe ich um die Ecke durch die große Scheibenfront ins Haus. Natalie sitzt auf der Couch am Laptop und wirkt vertieft.
Um sie zu erschrecken, trete ich hervor und klopfe einmal heftig gegen die Scheibe. Tatsächlich war sie so in ihre Recherche versunken, dass sie heftig zusammenzuckt. Im nächsten Augenblick schießt sie vom Polster hoch und hält den Laptop über ihren Kopf – bereit, damit zuzuschlagen. Sehr gut.
Als sie mich erkennt, senkt sie die Arme, atmet tief durch und funkelt mich bissig an. Ich kann nicht anders, als schief zu grinsen. Sie stellt den Laptop ab und kommt auf das Schiebefenster zu, wobei ihr Blick dieses Mal voll gemischter Gefühle ist. Vermutlich wegen meiner neuen Frisur.
Boxie nannte die Friseurin sie. Eine Kombination aus Bob und Pixie, was auch immer das sein soll. Jedenfalls ist sie genau richtig. Nicht zu kurz, aber auch nicht störend lang. Nacken und Ohren sind frei, aber mit genug Haar zum Stylen.
Die Fenstertür öffnet sich und Natalie starrt mich perplex an, während ich an ihr vorbeigehe, um die Schlüssel auf die Kommode im Flur zu legen. Ihre Reaktion folgt in drei, zwei, eins: »Was um der Götter Willen hast du getan?«
Sie kommt auf mich zu und begutachtet ungläubig meinen neuen Look.
»Wa-wa… Aber deine schönen Haare! Cass«, klagt sie und fährt mit ihren Fingerkuppen durch meine kurzen Haare. »Warum? Warum hast du sie schneiden lassen?«
Ich zucke mit den Achseln. »Gefällt’s dir nicht?«
»D-doch«, antwortet sie, verzieht dabei aber leicht das Gesicht. »Aber ich … Es ist eben gewöhnungsbedürftig. Wir hatten beide bisher immer nur lange Haare.«
»Irgendwann ist immer das erste Mal.« Gelassen schlüpfe ich aus den Stiefeln.
»Hm. Na ja, immerhin sind sie leichter zu pflegen.«
»Alles durchdacht«, kontere ich und zwinkere, dabei war die Pflege das Letzte, an das ich dabei gedacht habe. Immer wieder taste ich nach der ungewohnten Frisur, als wollte ich mich daran erinnern, dass mit den abgeschnittenen Haaren auch ein anderer Teil von mir der Vergangenheit angehört.
»Weißt du eigentlich, dass du gerade voll das Klischee erfüllst?«, fragt Natalie schief lächelnd und geht zurück in den Wohnbereich.
Ich runzle die Stirn. »Wie bitte?«
»Na ja, dieses Neues Ich, neues Aussehen-Ding. Die Frau, die einen Schlussstrich ziehen will und dafür eine Typveränderung vornimmt. Total das Klischee, Cass.«
»Purer Zufall«, grummle ich mit gerümpfter Nase.
»Ja ja«, winkt Natalie ab, setzt sich wieder auf ihren Platz und stellt den Laptop auf ihren Schoß.
Ich lasse mich neben sie fallen und stöhne.
»Wie viele Shemayu waren es noch gleich? Dreiundzwanzig?«, fragt sie unvermittelt und öffnet ein Excel-Dokument. Es sieht aus wie die Liste, die Papa erstellen sollte. Also lehne ich mich zu ihr hinüber.
»Irgendwas über zwanzig, ja«, murmle ich. »Jedenfalls zu viele.« Deshalb sind uns auch einige entkommen. Drei Nesweru gegen diese Anzahl Shemayu ist unmöglich machbar. Wir konnten gerade einmal drei von ihnen vernichten, wovon wiederum zwei verbrannt sind. Eine einzige Wirtin kam ins Krankenhaus und wurde schließlich von SERKET verlegt. Die Einsatzkräfte, die eine Verfolgung flüchtiger Angreifenden aufgenommen haben, konnten mithilfe von Charles nur einen Shemayu fassen. Dabei wurde ein Polizist jedoch schwer verletzt und letztlich brachte sich der Gefangene – oh, Wunder – selbst um.
Siebenundfünfzig Menschen wurden von diesen Schweinen ermordet.
»Ist das die Liste von Papa?«
»Mhm«, brummt Natalie zustimmend und scrollt herunter. Die ausgefüllten Zeilen wollen gar nicht enden. Es müssten mindestens fünfhundert an der Zahl sein. Darin stehen jeweils der Name der Person und die zugehörige Anschrift. Dahinter ist vermerkt, ob diejenige Lehrperson, Studierende oder Servicekraft ist. Farbenfrohe Markierungen weisen sie zudem entweder als tot oder kein Shemayu aus.
Sofort sitze ich aufrecht. »Moment, was ist denn das? Wi-wieso …«
»Woher kann er das wissen?«, fragt Natalie irritiert. Wir kannten bisher lediglich die Zahlen. Von Papa.
»Wann soll er das denn überprüft haben?«
Es ist immer wieder erstaunlich, wie er arbeitet. Er denkt bereits B, bevor wir A gesagt haben. Jedes Mal, wenn wir glauben, allein auf uns und unser Können gestellt zu sein, da er viel in der Firma ist, merken wir, wie wenig wir doch von seinen Aktivitäten außer Haus wissen.
»Manchmal frage ich mich echt, ob er überhaupt auf die Arbeit fährt«, bemerke ich und überlege dabei, wie wir vorgehen. Zunächst sollten wir alle Personen aussortieren, die laut ihm entweder tot oder keine Shemayu sind. Der Rest ließe sich nach den Adressen gruppieren, damit wir nicht kreuz und quer durch New York fahren müssen.
»Ja klar, und wie finanziert er unser Leben?«, fragt Natalie.
Ich ziehe die Schultern hoch. »Diebstahl? Geldwäsche? Drogenhandel? Wie man eben in einer Großstadt so an Geld kommt«, scherze ich trocken.
Sie verdreht die Augen, schmunzelt und wendet sich wieder dem Bildschirm zu. »Du bist der schlimmste Mensch auf diesem Planeten.«
»Oh, das ist das Schönste, was du je zu mir gesagt hast«, piepse ich und lege berührt eine Hand auf mein Herz. Dafür bekomme ich von ihr einen Klaps gegen den Schenkel und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit höre ich sie lachen. Dieses Geräusch und dieser Anblick sind beseelender als ein Orgasmus.
Natalie beginnt die Personen aus der Liste zu archivieren, die laut Papa nicht in Frage kommen, ohne dass ich ihr meinen Plan dargelegt habe.
»Dir scheint es besser zu gehen«, stelle ich fest und füge stichelnd hinzu: »Hast wohl bloß Abstand von mir gebraucht.«
»Sehr witzig, Cass«, grummelt sie.
»Ich weiß.«
»Den brauche ich nämlich immer«, schiebt sie trocken hinterher und ich ziehe die Augenbrauen hoch. Langsam dreht sie den Kopf. Das Funkeln in ihren Augen straft sie Lügen.
»Touché.«
Ihre Mundwinkel heben sich zu einem Grinsen, dann schüttelt sie den Kopf und arbeitet weiter am Dokument. Dabei fällt mir gegen Ende der alphabetisch geordneten Liste Nicolas’ Name ins Auge und sofort presse ich die Zähne fest aufeinander. Ich sehe ihn vor mir, wie er mir im Licht der Straßenlaterne gegenübersteht und mich mit diesem Blick ansieht – als wäre ich sein Ein und Alles. Scheiße, es tut immer noch weh. Das sollte es nicht.
Das Klappern von Schlüsseln am Eingang reißt mich aus meinen Gedanken und ich blicke über die Schulter zum Flur. Unser Vater tritt ein und zieht seinen schwarzen Mantel aus, den er nur zu besonderen Anlässen trägt.
»Hi«, begrüßt Natalie ihn und stellt den Laptop vor sich ab. Mitfühlend beobachtet sie, wie er sich entkleidet. »Wie war’s?«
Er zuckt mit den Schultern. »Ich werde nie verstehen, wieso man es als Trauerfeier bezeichnet«, brummt er. »Eine Beerdigung ist kein feierlicher Anlass.«
Eine Beerdigung, bei der wir nicht anwesend waren, weil wir Hunter nicht wirklich kannten. Aber wir kennen Charles und Ron und andere Greenwoods. Im Nachhinein hätten wir vielleicht doch aus Solidarität mitkommen sollen. Andererseits … würde das jeder und jede Nesweru so sehen, wäre jede einzelne Trauerfeier größer als eine russische Hochzeit.
Stattdessen haben wir uns lieber um die Liste gekümmert, die ja letztlich auch dieses Leid beenden soll.
»Natürlich nicht«, pflichtet Natalie ihm bei. »Setz dich, Papa. Ruh dich etwas aus. Wir … haben dir ohnehin etwas zu sagen.«
Bitte, was?
Ruckartig drehe ich mich zu ihr herum. »Ach ja?«
Ihr Blick huscht kurz zu mir und sie nickt entschlossen.
»Aha, okay«, sagt Papa gedehnt, schlüpft aus seinen Schuhen und stützt anschließend seine Arme auf der Sessellehne rechts von mir ab. »Was habt ihr angestellt?«
Auf mein neues Aussehen reagiert er kein bisschen, als wäre es ganz normal.
»Das ist eine interessante Frage und ich möchte sie deshalb auch nicht durch eine Antwort verderben«, kontere ich und ernte dafür erneut einen Klaps von Natalie.
»Jetzt hör schon auf, Cass«, tadelt sie mich. »Papa, wir müssen dir etwas beichten, das dir nicht gefallen wird. So gar nicht.«
Mit dem Kiefer mahlend wende ich mich von ihr ab.
»Ich bin ganz Ohr«, sagt Papa ausdruckslos und wartet geduldig. Er ist wie eine Büste aus Marmor, die keine Mimik verzieht. Ein perfektes Pokerface.
»Puh, okay. Also, ähm… wie fange ich an?«, beginnt meine Schwester und so wie ich sie kenne, wird sie lange damit hadern.
Also erlöse ich sie – und mich – und rücke frei Schnauze mit der Sprache raus: »Nicolas und Grayson sind Shemayu.«
Stille.
Keine Reaktion.
Papa mustert uns unberührt.
»Es tut uns wirklich leid«, meldet Natalie sich – hörbar von seinem Schweigen gequält – zu Wort. »Wir waren so dumm.«
Erneute Stille.
Irritiert runzle ich die Stirn. »Du willst nichts dazu sagen? Nicht abfällig den Kopf schütteln, herumschreien, Vorwürfe machen … Nicht einmal Empörung?«
Wieder schweigt er uns sekundenlang an. Dann schüttelt er den Kopf. »Nein. Es überrascht mich nicht.«
»Wie jetzt?«, fragen Natalie und ich unisono.
Er wendet sich ab und schlendert in die Küche. Dabei erklärt er: »Ich bin vielleicht nicht der Vater des Jahres, aber auch nicht dämlich. Seit dem Ball weint Natalie fast ununterbrochen und Cassey hat sich die Haare abgeschnitten.«
»Vielleicht hatte ich auch nur einen Kampf mit dem Rasenmäher«, rechtfertige ich mich und verschränke die Arme vor der Brust.
Natalie zieht eine Augenbraue hoch. Ihr Blick sagt: Als würdest du jemals den Rasen mähen.
»Oh, bitte«, seufzt unser Vater abfällig und stellt die Kaffeemaschine an. Hinter seinem Rücken schneide ich eine Grimasse.
»Wir haben es einfach nicht gemerkt«, erklärt Natalie kleinlaut. »Und unsere Amulette haben uns keinen Grund gegeben, skeptisch zu sein.«
Er wirft einen grüblerischen, beinahe besorgten Blick über seine Schulter. »Habt ihr sie auch richtig überprüft?«
Meine linke Augenbraue hebt sich. »Was kann man da schon falsch machen?«
»Na, irgendetwas werdet ihr wohl falsch gemacht haben.«
»Klar. Mal wieder sind wir selbst daran schuld.«
»Eure Amulette funktionieren doch bei anderen Shemayu einwandfrei, oder?«, hakt er nach und erneut schimmert Besorgnis durch seine eiserne Maske.
»Wäre ja schlimm, wenn nicht.«
»Ein Ja oder Nein würde ausreichen«, ermahnt er mich und kehrt uns wieder den Rücken zu. »Irgendetwas müsst ihr ja falsch gemacht haben. Denn selbst wenn die Amulette nicht angeschlagen hätten – was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann –, gab es bestimmt noch andere Indizien, die sie als Shemayu entlarvt hätten und die ihr hättet erkennen müssen.«
Nicolas’ Empathie.
Seine Worte und Handlungen, passend zu meinen Gedanken.
Grayson immer in seiner Nähe.
Meine unerklärliche Entlassung nach der Terrence-Geschichte – die Ninjas, die in Wahrheit Shemayu sind.
Altawam’shemayu.
So muss es sein.
Eine wütende Hitze kocht in meinem Magen hoch, sodass ich die Zähne fest aufeinanderpresse. Aber nicht nur, weil Papa uns zurechtweist, sondern vor allem, weil es berechtigt ist und ich nichts einwenden kann. Denn jedes Gegenargument, das mir auf der Zunge liegt, weiß mein Kopf zu widerlegen.
»Aber gut, nächstes Mal wisst ihr es besser«, schließt er.
»Nächstes Mal?«, frage ich irritiert. »Wie jetzt? Keine Predigt? Keine Strafe? Kein Haltet euch in Zukunft zurück, was eure Gefühle betrifft?«
Wieder schüttelt er den Kopf, woraufhin Natalie und ich einen völlig perplexen Blick austauschen. Während das schreiende Mahlgeräusch der Kaffeemaschine den Raum ausfüllt, sagen wir nichts. Aus unerklärlichen Gründen pocht mein Herz wie wild. Dass er so ruhig ist, macht mich nervös. Oder war seine Strafe, dass er Natalie nicht getröstet hat? Aber was ist dann meine gewesen? Ich bin verwirrt.
Sobald der Kaffee fertig ist, dreht er sich mit der Tasse um. »Ihr habt euch in die beiden verliebt. Dass ihr verletzt wurdet und leidet, ist Strafe genug und ich hoffe, dass ihr es euch endlich hinter die Ohren geschrieben habt«, erklärt er seelenruhig und kühl.
Verblüffung und Empörung kämpfen in mir um die Oberhand, doch dann fällt meine Kinnlade herunter und ich setze zur Verteidigung an. »Hey, das war jetzt ein einziges Mal, ja?«
»Und schon einmal zu viel«, entgegnet er und setzt sich an den Küchentisch, sodass nur sein Schopf zu sehen ist. »Immerhin hättet ihr tot sein können.«
Schnaubend drehe ich mich zu Natalie um, die mich mit einer gehobenen Augenbraue mustert. Keiner sagt etwas. Also wenden wir uns wieder der Arbeit zu. Stundenlang gruppieren und sortieren wir die Personen und erstellen einen Plan, genauer gesagt eine Route. Um die Arbeit aufzuteilen, beziehen wir auch den Greenwood-Clan ein. New York und Umgebung sind heutzutage eigentlich ihr Territorium.
Jetzt beginnt eine harte Zeit. Konsequentes Training und möglichst jeden Tag Shemayu-Jagd, um die ellenlange Liste abzuhaken. Außerdem steht eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte der Götter und der Nesweru an, um hoffentlich mehr über das Symbol herauszufinden, das auf den Stirnen der Shemayu auftaucht. Vielleicht bereichert die Recherche auch ein wenig unser Wissen über Altawam’shemayu. Zudem würde mich brennend interessieren, ob es schon Situationen gab, in denen ein Karneol nicht auf Shemayu reagiert hat, und was der Grund dafür war.
Ich hatte ohnehin nicht vor, den Spring Break mit Partys zu genießen.
Kapitel 4 - Nicolas
»Noch einen«, grummle ich und schiebe mein Glas über den klebrigen Tresen.
Tess schüttelt ihren Kopf und knallt eine Schale mit Erdnüssen vor meine Nase. »Du hattest schon genug. Lass es gut sein, Nicolas.«
»Isch bin Kunne. Kunne is’ Könich. Noch ein’n«, fordere ich und lege meine Wange neben den Erdnüssen ab. Der heftige Bass lässt den Tresen unter mir vibrieren. Aber das stört mich nicht. Es kommt dem Schwindelgefühl, das ich herzlich willkommen heiße, sogar noch entgegen. Die sich anbahnende Übelkeit eher weniger.
»Na schön«, seufzt sie und füllt das Glas erneut. Ihre Gedanken vermischen sich in meinem betrunkenen Gehirn zu Brei.
»Best’n Dank«, murmle ich, setze mich auf und kippe den Whiskey in einem Zug herunter. Dann verziehe ich das Gesicht. Jedoch nicht aufgrund des herben Geschmacks von Bourbon, sondern weil es überhaupt kein Whiskey ist. Irgendwie süßlich und … »Wuah! Was’n das?«
»Apfelsaft«, kontert sie trocken. »Ich dachte nicht, dass deine Geschmacksknospen noch aktiv sind.«
»Du bis’ doch …«, setze ich an und bekomme einen kleinen Stromstoß. »Aua!«, beschwere ich mich einige Sekunden später, weil erst in meinem Kopf ankommen muss, dass es ihre volle Absicht war.
»Nicolas! Geh nach Hause. Leg dich ins Bett. Schlaf deinen Rausch aus. Musst du nicht morgen arbeiten?«
»Na und?«, gröle ich und lehne mich schwungvoll zurück. In diesem Moment fällt mir auf, dass der Stuhl nie eine Lehne hatte, und falle rückwärts auf den versifften Boden dieser Dreckskneipe. Zuerst bekomme ich keine Luft mehr, doch dann verspüre ich ein Pochen am Hinterkopf und atme tief röchelnd ein.
»Aua«, wiederhole ich krächzend.
Plötzlich werde ich von zwei Personen zeitgleich gepackt und wieder hochgezogen, was das Schwindelgefühl noch schlimmer macht. Mir ist schlecht. Ich schwanke und werde zurück auf dem Hocker platziert. Gleich darauf verspüre ich einen Klaps gegen den Oberarm.
»Hast du ihm etwa schon wieder Bourbon gegeben?«, fragt eine vertraute Stimme vorwurfsvoll.
»Gray … er war so …«
»Mann, Tess! Ich habe nichts dagegen, sich mal zu betrinken und so weiter … aber das ist jetzt der wievielte Abend in Folge?«
\\Er wird sich noch umbringen, wenn er in dem Tempo weitermacht.//
Ich rümpfe die Nase, weil Graysons Gedanken so klugscheißerisch klar in meinem Kopf widerhallen, während die Masse um mich herum ein nuschelndes, unklares Gemurmel von sich gibt.
»Ich hatte ihm die ersten zwei gegeben und als ich wiederkam, hatte Henry ihm schon die nächsten …«
»Henry!«
»Hallihallo, ich bin auch noch da«, gebe ich zu verstehen und knabbere an einer Erdnuss. Ich konzentriere mich darauf, sie genau in der Mitte zu spalten. Mit den Zähnen versuche ich, die Nuss zu knacken, aber sie zerbricht an der falschen Stelle. So ein Mist. Noch eine!
»Was?«, ruft eine tiefe Stimme, die nicht Grayson gehört.
»Hör auf, ihm Alkohol zu geben! Und du auch, Tess! Ab sofort gibt ihm keiner von euch auch nur einen Tropfen, ist das klar?«
Die dritte Nuss bricht in der Mitte und ich stoße ein triumphierendes »Haha« aus. Im selben Moment verschlucke ich mich daran und huste röchelnd.
»Muss er kotzen?«, fragt Tess.
»Nicolas! Lass den Scheiß.« Grayson klopft mir fest auf den Rücken und ich zucke zusammen.
»Ey, Mann! Nicht so aggressiv.«
Die Tränen, die sich beim Verschlucken in meinen Augen gesammelt hatten, beginnen zu fließen. Völlig unkontrollierbar. Aber nicht etwa wegen der zerbrochenen Nuss oder des Alkoholverbots von Grayson. Sondern weil ich sie verloren habe. Für immer. Ich sehe ihre huskyblauen Augen vor mir. Fühle, wie ihre Piercings meine Lippen berühren. Rieche diesen unbeschreiblichen Duft ihrer Haut.
Sie ist weg.
Nein. Ich bin weg. Geflohen vor ihr.
Weil sie mich umgebracht hätte, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen hätte.
Ich verziehe das Gesicht und vergrabe es in meinen Händen. Wieso muss mir immer alles genommen werden? Ist das meine Strafe? Dafür, dass ich Rebecca verraten habe? Ist es das?
»Nic … komm schon. Du weißt, ich kann sowas nicht gut«, jammert Grayson und hört auf zu klopfen. Stattdessen legt er eine Hand auf meine Schulter und drückt sie aufmunternd.
»Ich hole Wasser für ihn«, verkündet Henry.
Ich vermisse ihre Anwesenheit überall. Ihre ganze Präsenz. Es fühlt sich an, als würde ein Teil von mir fehlen. Denn obwohl wir uns noch gar nicht lange kannten, haben wir einander so viel gegeben. So viel anvertraut. So verdammt viel Chaos angerichtet. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich muss mich entschuldigen und ihr sagen, dass ich jedes Wort ernst gemeint habe, auch wenn diese riesige Lüge zwischen uns steht.
»Ich bringe dich nach Hause«, murmelt Gray und hievt mich vom Hocker.
»Ich will zu Cass.«
»Vergiss diesen Namen.«
»Kann nicht. Ich muss ihr erklär’n ...«
»Was? Was willst du einer Nesweru bitte erklären, Nicolas?«
»Ich wollte nie ...«
»Das wird ihr egal sein. Es wird ihnen beiden egal sein, dass wir das nicht wollten, okay? Sie würde dir nicht zuhören. Sie würde dich umbringen. Und deswegen vergisst du jetzt ihren Namen, verstanden?«
***
Am nächsten Morgen wache ich mit höllischen Kopfschmerzen auf, die sowohl vom Alkohol als auch von dem Sturz kommen dürften. Ich verfluche meinen Wecker, während ich aus dem Bett krieche und mit halb geschlossenen Augen nach der Tür suche. Bis mir auffällt, dass wir uns nicht mehr in der alten Wohnung in Manhattan befinden. Sondern in Brooklyn. In der 331 Flatbush Avenue. Circa eine halbe Stunde Autofahrt von unserer alten Wohnung und doch eine ganze Welt entfernt.
Ich hasse Brooklyn. Ich hasse diese friedliche Hier-sind-alle-lieb-zueinander-Stimmung. Ich hasse es, dass wir uns hier verstecken müssen. Und ich hasse es, dass wir jetzt wahrscheinlich öfter umziehen müssen. Vielleicht würde ich Brooklyn weniger hassen, wenn es mich nicht so an Queens und meine Kindheit dort erinnern würde.
Von meinem Zimmer aus muss ich mich erst kurz orientieren. Links Bad. Offene Wohnküche direkt vor mir. Graysons Zimmer rechts um die Ecke. Küche klingt gut, ich brauche dringend Kaffee.
Da Grayson gestern bis fünf Uhr gearbeitet hat, schläft er sicher noch. Jetzt haben wir kurz nach sieben. Das bedeutet, dass auch ich bestimmt nur vier Stunden Schlaf hatte, und so fühle ich mich auch.
Während der Kaffee kocht, gehe ich duschen. Dann befülle ich einen Thermobecher und nehme ihn mit in die Schule. Mein zweiter Tag an der Brooklyn Memorial High School. Das war die einzige Schule in der Nähe, die einen Lehrer für Chemie und für die Musical-Gruppe gesucht hat. Und dank Grayson hat es nicht lange gedauert, bis ich einen Abschluss und die Lizenz zum Unterrichten hatte. Er meinte, sich mehr als zwei Wochen in Selbstmitleid zu suhlen, würde auch nichts bringen.
Also lasse ich mich im Klassenraum auf meinen Stuhl am Pult fallen und klappe meine Notizen auf. Die Buchstaben tanzen vor meinen Augen und ich blinzle angestrengt. Wahrscheinlich bin ich ein grauenvoller Lehrer. Ich habe keine Ahnung von Pädagogik. Schlimmer noch: Ich kenne jetzt schon die intimsten Geheimnisse meiner Schüler, weil sich die meisten nicht auf den Unterricht konzentrieren. Ich kenne all ihre Gedanken und heutige Teenager haben scheinbar unglaublich viele davon.
Die erste Hälfte des Tages vergeht schleppend. Zur Mittagspause verkrieche ich mich im Musical-Raum und lasse mich dort auf den Klavierhocker sinken. Denn ich habe echt keinen Nerv für Gespräche im Lehrerzimmer, obwohl die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen ganz okay wirken. Ich versuche, mich ihnen anzupassen, indem ich aufgehört habe, mich zu rasieren, meine Haare im Nacken zusammenbinde und vornehmlich Hemden trage – es lässt mich älter wirken und wir dürfen schließlich um keinen Preis auffallen. Cassey und Natalie könnten bereits nach uns suchen.
Eigentlich dachten Grayson und ich deswegen, dass Brooklyn nur eine Zwischenstation auf unserer Flucht ans andere Ende der Welt ist. Aber Tess ist inzwischen ein guter Grund zu bleiben geworden. In ihrer Theorie ist es für uns hier sogar am sichersten, weil die Nesweru uns niemals für so dumm halten würden, direkt vor ihrer Nase zu kampieren. Grayson und ich zweifeln an dieser Theorie, aber wir lieben New York zu sehr, um diese Stadt hinter uns zu lassen. Oder um es mit Graysons Worten zu sagen: »Wir waren zuerst hier. Und das schon seit Jahrhunderten. Wenn sie uns umbringen wollen, müssen sie es in New York tun.«
Abgesehen davon ist Tess in kürzester Zeit eine wirklich gute Freundin geworden. Sie überlebt wie wir ohne das Töten ihrer Opfer und hat schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu anderen Shemayu. Tess hat Grayson den Job im Pavel’s verschafft und lehrt ihn die Kunst des Cocktailschwenkens. Wenn er es nicht hört, nennt sie ihn kleiner Padawan und bringt mich damit zum Lachen – was in letzter Zeit selten genug vorkommt. Jede Erinnerung an Cassey quält mich und ich denke unverhältnismäßig oft an sie.
Ich zucke zusammen, als die schrille Klingel losplärrt. Super, der Horror geht weiter. Mein Kopf hämmert immer noch und selbst fünf Tassen starker Kaffee haben mich nicht wirklich wach bekommen.
»Hallo, Mr. White«, grüßt mich eine meiner Schülerinnen, die gerade die Tür geöffnet hat. Corey, meine Sophie.
Ja, ganz richtig. Mein Leben hasst mich. Mir wurde gestern mitgeteilt, dass für dieses Jahr die Aufführung von Mamma Mia geplant ist. Wenn das hier die Truman Show ist: Nicht witzig.
Ich habe meine zwölf Schülerinnen und Schüler gestern erst einmal kategorisch eingeteilt. Corey würde in die Rolle der Sophie passen. Daniel ist zumindest optisch ein Sky – mal sehen, was er heute zeigen kann. Freya wäre eine gute Donna. Jay ist Freyas Freund und allein deswegen denke ich, dass er in Sams Rolle passen würde. Wenn die beiden sich allerdings trennen, während wir proben, habe ich ein Problem. Und in diesem Alter sind diese hormongesteuerten, testosterongeladenen Sportler nicht gerade … treu. Zumindest habe ich gestern via Gedanken etwas mitbekommen, was ich lieber nicht gewusst hätte: Jay hat zeitgleich etwas mit der nur wenig talentierten Angela.
Mila, Marie-Lou, Nora-Shaneel, Gunther und Timothy kann ich noch immer nicht richtig einschätzen. Ich weiß nur, dass manche ihrer Eltern echt einen an der Waffel haben. Nora-Shaneel? Was ist das bitte für ein Name? Und Gunther? Wirklich? Da hat wohl jemand zu viel Friends geschaut, aber trotzdem muss man doch sein Kind nicht mit so einem Namen strafen.
Und seit wann hasse ich eigentlich Teenies? War das schon immer so oder sind die in den letzten Jahrzehnten einfach alle beschränkter geworden?
»Mr. White?«
Ich zucke zusammen, weil ich so in Gedanken versunken war. Außerdem habe ich mich immer noch nicht an meinen neuen Namen gewöhnt. White. James White.
Sehr einfallsreich, Grayson.
Er und ich sind jetzt offiziell Brüder, aufgrund seiner offensichtlich lateinamerikanischen Wurzeln wohl eher Halbbrüder. Und er selbst hat sich natürlich wieder den Sexiest-Man-Alive-Namen verpasst. Liam White. Weil er ein Buzz-Feed-Quiz gemacht hat, um herauszufinden, was der heißeste Name in diesem Jahr ist.
***