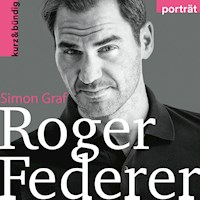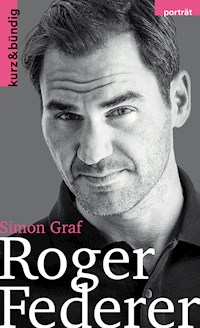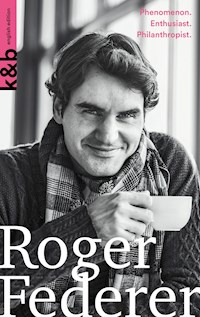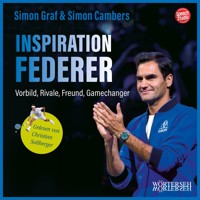
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Speech Studio Schweiz
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Roger Federer ist der wohl populärste Sportler unserer Zeit. Mit seinem scheinbar mühelosen Spiel prägte er das Tennis über Jahrzehnte und hob es in neue Sphären. Er gewann über hundert Turniere, darunter zwanzig Grand-Slam-Titel – acht davon allein in Wimbledon. Der Maestro begeisterte aber nicht nur mit seinem Tennis, sondern vor allem auch mit seinem Charisma und seinem großen Herzen. Was macht ihn so einzigartig, dass er Menschen auf dem ganzen Globus in seinen Bann zieht? Die beiden Sportjournalisten Simon Graf und Simon Cambers wollten dieses Geheimnis lüften. Dazu führten der Schweizer und der Brite in den letzten zwei Jahren über vierzig exklusive Interviews mit Persönlichkeiten wie Anne-Sophie Mutter, Toni Nadal, Marco Chiudinelli, Arno Camenisch, Michelle Gisin, Marc Rosset, Paul Annacone, Coco Gauff, Ons Jabeur, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Heinz Günthardt, John Bercow, Mats Wilander oder Stan Smith – mit Freunden, Rivalen, Coaches, Fans und Kulturschaffenden. Sie alle erzählen von sehr persönlichen Erlebnissen, teilen mit uns bis anhin unveröffentlichte Anekdoten und gewähren uns Einblicke in das, was Roger Federers unvergleichliche Strahlkraft ausmacht. So ist eine Hommage an einen Menschen entstanden, der unvergessen bleiben wird.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2022 Wörterseh, Lachen
Lektorat: Brigitte MaternKorrektorat: Andrea LeutholdUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaFoto Cover: Foto-net, Roger Federer bei seiner Verabschiedung am Laver Cup 2022Foto »Über das Buch«: Foto-net, Roger Federer in Wimbledon 2018Foto »Über die Autoren«: Die beiden Autoren Simon Graf und Simon Cambers im Centre Court von WimbledonFotos Bildteil: Zur Verfügung gestellt, alle anderen Fotos sind gekennzeichnetBildbearbeitung: Michael C. ThummLayout, Satz und Herstellung: Beate SimsonDruck und Bindung: CPI Books GmbH
Print ISBN 978-3-03763-143-0 E-Book ISBN 978-3-03763-833-0
www.woerterseh.ch
»Es ist nett, wichtig zu sein. Aber noch wichtiger ist es, nett zu sein.«
ROGER FEDERER
Inhalt
Über das Buch
Über die Autoren
Vorwort des Co-Autors Simon GrafZwanzig Jahre mit Roger Federer – wie er mein Leben bereichert hat
Roger, der Freund
Marco Chiudinelli, Jugendfreund »Und der Sieger sagte: ›Klar, spielen wir noch mal!‹«
Danny Schnyder, erster Rivale Er schaffte, was Nadal und Djokovic gegen Federer nie gelang
Marc Rosset, Ex-Tennisprofi und »großer Bruder« »Ich mochte diesen Jungen einfach«
Wayne Ferreira, südafrikanischer Mentor »Ich werde nie wieder einen Ball mit Roger schlagen«
Urs Bürgler, Ringer, Schwinger und Verkuppler »Jetzt, Roger! Das ist deine Chance!«
Roger, der Schüler
Annemarie Rüegg, Schulkoordinatorin und Sprachlehrerin »Er hatte den Kopf auf den Arm gelegt und war eingeschlafen«
Sven Groeneveld, Ex-Verbandscoach »Er war und ist auch heute immer noch der Clown«
Paul Annacone, Federers Ex-Trainer »Gib dein Bestes, aber, Junge, hab Spaß dabei!«
Darren Cahill, Ex-Coach von Lleyton Hewitt und Andre Agassi »Es sind die kleinen Dinge, die dich ausmachen«
Roger, der Rivale
Toni Nadal, Onkel und langjähriger Coach von Rafael Nadal »Sie zeigten, dass man trotz einer starken Rivalität befreundet sein kann«
Marian Vajda, langjähriger Coach von Novak Djokovic Mittendrin in der großartigsten Ära des Tennis
Mark Petchey, Ex-Trainer von Andy Murray »Andy suchte einen Grund, Roger nicht zu mögen«
Craig O’Shannessy, Strategieanalyst »Severin sagte: ›Ich würde gern mit dir über das Finale sprechen‹«
Roger, die Inspiration
Stefanos Tsitsipas, griechischer Tennispionier »Er ließ den Sport viel eleganter, sauberer und stilvoller aussehen«
Matteo Berrettini, italienischer Topspieler »Danke für die Tennisstunde. Wie viel schulde ich dir?«
Coco Gauff, aufstrebender US-Tennisstar »Ich dachte mir: ›Weißt du was? Roger hat recht‹«
Ons Jabeur, Tunesiens Wegbereiterin Sie nannten sie Roger Federer
Marc Krajekian, Krebs-Überlebender »Roger war der Ansporn, schnell wieder gesund zu werden«
Michelle Gisin, Olympiasiegerin Dank Federer entdeckte sie ihre Liebe fürs Tennis
Andri Ragettli, Freeskier »Jetzt mach es wie Roger!«
Anne-Sophie Mutter, Stargeigerin »Er wurde zu einer Art spirituellem Familienmitglied«
Arno Camenisch, Schriftsteller »Ihn umgibt ein Zauber«
Roger, der Konkurrent
Pat Rafter, zweimaliger US-Open-Sieger »Er war ein pickelgesichtiger Junge, der mit uns abhängen wollte«
James Blake, frühere Nummer 1 der USA »Und dann wurde Roger zu Roger«
Jarkko Nieminen, Freund und »Opfer« Ein unvergesslicher Abend dank Roger
Grigor Dimitrov, bulgarischer Topspieler »Come on, Baby Fed!« – »Sehe ich etwa aus wie ein Baby?«
Sergej Stachowski, ukrainischer Federer-Bezwinger »Mit Roger geht eine Ära zu Ende«
Nicolas Mahut, französischer Doppel-Star »Ich glaube, er wurde geboren, um Wimbledon zu gewinnen«
Mike Bryan und Bob Bryan, Seriensieger im Doppel »Es war eine Ehre, dass uns Roger um einen Gefallen bat«
Roger, der Held
Scarlett Li, Weltreisende und Datenanalystin »Roger sucht immer den Augenkontakt«
Sunita Sigtia, Geschäftsfrau und Wohltäterin Für Roger ertrug sie Kälte und Regen
John Bercow, Ex-Sprecher des britischen Unterhauses »Er dachte wahrscheinlich, ich sei ein Stalker«
Vittoria Oliveri und Carola Pessina, italienische Tennis-Juniorinnen »Für Roger ist hier immer ein Tisch reserviert«
Roger, der Gamechanger
Mats Wilander, Tennis-Champion und TV-Experte »Roger ist der Einzige, in dessen Schuhen ich gern stecken würde«
Stan Smith, Ikone »Wenn du Roger das nächste Mal siehst, trage diese Schuhe«
Roy Emerson, Tennislegende »Er drehte sich zu mir um und fragte: ›Wie kriege ich da Milch raus?‹«
Mike Nakajima, früherer Nike-Tennisdirektor »Geld und Ruhm verändern Menschen – nicht aber Roger«
Janine Händel, CEO der Roger Federer Foundation »Bei Roger verlieren die Kinder ihre Hemmungen«
Heinz Günthardt, Schweizer Tennispionier »Er ist zum Tennisspielen geboren«
Roger, der Profi
Mary Carillo, US-Fernsehlegende »Roger weiß, welche Wirkung er auf die Menschen hat«
Ella Ling, britische Fotografin Das Foto der weinenden Helden hat sie berühmt gemacht
Michael Gradon, Ex-Mitglied des Wimbledon-Komitees »Roger überstimmte mich – das war ein peinlicher Moment«
Eric Butorac, Ex-Spieler und Federers rechte Hand »Er verarbeitet Informationen unglaublich schnell«
Luki Frieden, Filmemacher und Regisseur »Roger kreiert eine familiäre Stimmung«
Nachwort des Co-Autors Simon CambersPerfektion, Ehrlichkeit, Großzügigkeit: Federer ist ein Vorbild für alle
Über das Buch
Roger Federer ist der wohl populärste Sportler unserer Zeit. Mit seinem scheinbar mühelosen Spiel prägte er das Tennis über Jahrzehnte und hob es in neue Sphären. Er gewann über hundert Turniere, darunter zwanzig Grand-Slam-Titel – acht davon allein in Wimbledon. Der Maestro begeisterte aber nicht nur mit seinem Tennis, sondern vor allem auch mit seinem Charisma und seinem großen Herzen.
Was macht ihn so einzigartig, dass er Menschen auf dem ganzen Globus in seinen Bann zieht? Die beiden Sportjournalisten Simon Graf und Simon Cambers wollten dieses Geheimnis lüften. Dazu führten der Schweizer und der Brite in den letzten zwei Jahren über vierzig exklusive Interviews mit Persönlichkeiten wie Anne-Sophie Mutter, Toni Nadal, Marco Chiudinelli, Arno Camenisch, Michelle Gisin, Marc Rosset, Paul Annacone, Coco Gauff, Ons Jabeur, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Heinz Günthardt, John Bercow, Mats Wilander oder Stan Smith – mit Freunden, Rivalen, Coaches, Fans und Kulturschaffenden. Sie alle erzählen von sehr persönlichen Erlebnissen, teilen mit uns bis anhin unveröffentlichte Anekdoten und gewähren uns Einblicke in das, was Roger Federers unvergleichliche Strahlkraft ausmacht. So ist eine Hommage an einen Menschen entstanden, der unvergessen bleiben wird.
»Ich fand immer bemerkenswert, mit welchem Anstand Roger Federer gewinnt. Verlieren tut er sowieso mit Anstand. Aber das Gewinnen, ohne über den anderen zu triumphieren, sich einfach nur an der eigenen Leistung zu freuen, das ist ein großes Zeichen von menschlicher Stärke und Klasse.«
Anne-Sophie Mutter, Stargeigerin
»Roger spielte mit einer unglaublich guten Technik und sehr elegant, Rafael mit einer riesigen Leidenschaft – es waren unterschiedliche Stile. Aber der gegenseitige Respekt war groß. Meiner Meinung nach ist es eine der größten Rivalitäten in der Geschichte des Sports.«
Toni Nadal, Onkel und Coach von Rafael Nadal
»Das finde ich bei Roger absolut unglaublich: Wie er sich über all die Jahre die Freude bewahrt hat an diesem Sport, in dem die Abnutzung so groß ist, der so frustrierend und ein ewiger Kampf sein kann. Trotzdem hatte man bei ihm immer das Gefühl: Es geht ihm ums Spiel, um den Sport an sich, alles andere ist nebensächlich.«
Michelle Gisin, Olympiasiegerin
»Roger hatte das Glück, dass er auf seinem Weg sehr viele gute Menschen traf. Die wichtigste Begegnung war die mit Mirka, seiner Frau. Ich sage immer: Fünfzig Prozent seines Erfolgs verdankt er ihr.«
Marc Rosset, Ex-Tennisprofi und Mentor
Über die Autoren
© Peter Klaunzer
Simon Graf (links), geb. 1971 in Zürich, wandte sich nach dem Masterabschluss in Geschichte, deutscher Literaturwissenschaft und Linguistik seinen Steckenpferden Journalismus und Sport zu. Für den »Tages-Anzeiger« und die »SonntagsZeitung« berichtet er seit mehr als zwanzig Jahren über Roger Federer. 2018 erschien sein Bestseller »Roger Federer« (kurz & bündig). Er lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Kilchberg am Zürichsee, wo er Roger gelegentlich auf den nahe gelegenen Tennisplätzen trifft.
Simon Cambers (rechts), geb. 1973 in Wimbledon, hat als freiberuflicher Journalist alle Stars des Tennissports interviewt und berichtet seit zwei Jahrzehnten über ATP- und WTA-Tour. Er schreibt unter anderem für »The Guardian«, »The New York Times«, den Glasgower »Herald«, die Nachrichtenagentur Reuters oder für die Website des Sportsenders ESPN. Zudem kommentiert er für Radio Roland Garros und Australian Open Radio. Er lebt mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in Bournemouth an der Südküste Englands.
VORWORTSimon Graf, Co-Autor
Zwanzig Jahre mit Roger Federer – wie er mein Leben bereichert hat
Jeder hat seine Federer-Geschichte. Das wurde mir erst so richtig bewusst, als ich 2015 mit Terry, einem amerikanischen Freund, achtundzwanzig Stunden lang im Wimbledon Park für Tickets anstand. Es war die erste Woche der All England Championships, und ich schrieb eine Reportage darüber für unsere Sonntagsausgabe. Wir übernachteten im Zelt und kamen dadurch mit Tennisfans aus der ganzen Welt ins Gespräch. Die meisten konnten ganz genau erzählen, wann und wieso ihre Liebe für Roger Federer begonnen und wie er ihr Leben über all die Jahre geprägt hatte. Die Zeit verging darob im Nu. Damals, in einer fast schlaflosen Nacht, derweil der Regen auf unser kleines Zelt prasselte und ich mir eine weiche Matte wünschte, entstand in meinem Kopf die Idee für dieses Buch: Es wurde zwar oft darüber geschrieben, was der Maestro alles erreicht hat, aber noch nie darüber, was er in so vielen Menschen ausgelöst, wie er sie inspiriert hat.
Allmählich reifte die Idee. Da Federers Wirkung keine Landesgrenzen kennt, wollte ich dieses Buch nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch veröffentlichen. Und spannte deshalb mit meinem britischen Journalistenkollegen Simon Cambers zusammen, was es uns auch ermöglichte, all unser Know-how und unsere Connections zusammenzulegen. Cambers ist – kein Witz! – in Wimbledon zur Welt gekommen. An dem Ort, der für Roger Federers Karriere so wichtig war wie kein anderer. Über zwei Jahre lang schrieben wir zwei Autoren uns daraufhin Tausende von Whatsapp-Nachrichten und Mails, führten Hunderte von Zoom-Calls, in denen wir uns über den Stand unserer Interviews austauschten und neue Ideen entwickelten.
Es sind vierundvierzig ganz persönliche Geschichten darüber entstanden, wie Roger Federer Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen berührt hat – und welchen Einfluss viele von ihnen auch auf ihn hatten. Wir redeten unter anderem mit Freunden, Mentoren, Coaches, Rivalen und weiteren Konkurrenten, mit Kulturschaffenden, Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Bereichen, einem Politiker und mit weit gereisten Fans. Indem sie alle ihre Erlebnisse mit uns teilen, bringen sie uns nicht nur das Faszinosum, sondern auch den Menschen Roger Federer näher.
Ich selbst war als Tennisreporter genau zu der Zeit in die Berichterstattung eingestiegen, als er zu den Profis wechselte. Am ersten Montag der All England Championships 2002 schritt ich erstmals stolz vom Pressezentrum zum Centre Court Wimbledons. Im Jahr zuvor hatte Federer den großen Pete Sampras entthront, nun schickte er sich an, dessen Erbe anzutreten. Und ich würde das nun journalistisch begleiten. Dachte ich. Zwei Stunden und drei verlorene Sätze gegen den Kroaten Mario Ancic später ging ich konsterniert zurück an meinen Platz im Pressezentrum und sortierte meine Gedanken und Sätze.
Ich sollte dann aber doch noch etliche Triumphe Federers erleben und mehr als die Hälfte seiner zwanzig gewonnenen Grand-Slam-Finals live im Stadion. Natürlich war der erste Wimbledon-Titel 2003 ein besonderer, auch wenn das Endspiel gegen Mark Philippoussis nicht gerade denkwürdig war. Mit anderen Schweizer Journalistinnen und Journalisten feierten wir danach im Londoner Stadtteil Hammersmith den großen Tag der Schweizer Tennishistorie. Der Wirt des italienischen Restaurants erkannte die Gunst der Stunde und stellte uns eine Flasche Grappa auf den Tisch, deren Inhalt wir umgehend seiner Bestimmung zuführten. Dann noch eine. Die Rechnung fiel üppig aus.
Als wir uns um zwei oder drei Uhr morgens auf den Weg zurück ins Hotel machten, sah René Stauffer, mein Kollege beim Zürcher »Tages-Anzeiger« und bei der »SonntagsZeitung«, auf seinem Handy eine Message von Mirka, Rogers Freundin. Sie schrieb, dass wir das gewünschte Exklusivinterview mit ihm an diesem Morgen führen könnten, noch vor dem offiziellen Pressetermin. Nach seinem Debakel an den French Open sechs Wochen zuvor hatte er keine ausführlichen Interviews mehr gegeben. Nun, da er es allen gezeigt hatte, war er wieder bereit, zu reden. Wir duschten kurz, steckten danach in der Lobby des schmucklosen Novotel Hammersmith unsere Köpfe zusammen und dachten uns einige kluge Fragen aus. Dann gönnten wir uns noch ein, zwei Stunden Schlaf. Doch der machte es auch nicht besser. Federer musste lachen, als er uns frühmorgens im Garten seines gemieteten Hauses an der Lake Road 10 empfing. Wir sahen noch übernächtigter aus als er.
In jenem Interview sagte er: »Die Gewinner bleiben, die Verlierer gehen. Gewinner und Verlierer sind so nahe beieinander und doch so weit entfernt. Wahre Champions macht einfach aus, dass sie gewinnen.« Was überheblich klang, war schlicht die Wahrheit. Und Federer spürte damals, dass er so bald nicht aufhören würde mit dem Gewinnen. Für uns Schweizer Tennisreporter war das ein Segen. Er spielte so regelmäßig wie ein Schweizer Uhrwerk und verschaffte uns Planungssicherheit. Von Wimbledon 2004 bis zu den Australian Open 2010 spielte er sich dreiundzwanzigmal in Serie mindestens ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. So mussten wir während Wimbledon nicht mehr in Hammersmith nächtigen, sondern konnten – wie die Spielerinnen und Spieler – für zwei Wochen ein Haus unweit des All England Club mieten.
Ein Glücksfall war Roger Federer nicht nur wegen seiner Erfolge und seines wunderschönen Spiels, sondern auch wegen seiner Nahbarkeit. Er wurde der am meisten interviewte Athlet auf dem Planeten und gab uns Journalisten immer genug Nahrung für Storys – auch wenn seine Matches manchmal nicht so viel hergaben. Er versuchte, sich in uns hineinzuversetzen, überlegte, was unsere Geschichte sein könnte. Und so abstrus unsere Fragen auch manchmal waren, wir erhielten immer eine reflektierte Antwort. Selbst als er im Herbst seiner Karriere der Fragerei der internationalen Medien müde geworden war, die sich stets auf den Dreikampf mit Rafael Nadal und Novak Djokovic fokussierten, blieb er gegenüber den Schweizer Journalistinnen und Journalisten stets zugänglich.
So viel er von sich preisgab und so virtuos er spielte, es gab auch eine Phase, in der es nicht mehr so einfach war, das Phänomen Federer in Worte zu fassen. Weil es schon fast normal geworden war, dass er von Sieg zu Sieg eilte. Wir Journalisten klammerten uns an Statistiken, Zahlen, Rekorde und Vergleiche mit Größen aus früheren Zeiten, um zu erklären, wieso seine Erfolge nicht selbstverständlich waren. Und wenn er verlor, war das in der Schweiz eine halbe Staatsaffäre. Außer es war auf den Sandplätzen von Roland Garros gegen Rafael Nadal, denn daran gewöhnte man sich auch. Seine Grand-Slam-Titel nach den Zeiten seiner großen Dominanz fühlten sich für viele noch süßer an als jene zuvor. Viele Federer-Fans nennen seine wundersame Rückkehr in Melbourne 2017 nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause mit dem epischen Finale gegen Nadal als ihren prägendsten Federer-Moment.
Der Zufall und unsere geografische Nähe am Zürichsee wollten es, dass ich ihm auch abseits der Turniere immer mal wieder über den Weg lief. Wie 2019, vier Tage nach seinem verlorenen Halbfinale in Roland Garros, als er seine beiden Töchter zum Schwimmunterricht ins Hallenbad meiner Wohngemeinde Kilchberg gebracht hatte. Er erblickte mich in der Cafeteria, und wir plauderten eine Stunde, wobei ich mir große Mühe gab, keine Tennisfragen zu stellen. Ich war selbst gerade mit meiner damals siebenjährigen Tochter Lavinia vom Schwimmen gekommen, und eigentlich hatten wir vorgehabt, noch etwas Tennis zu spielen. Aber natürlich ließ ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, abseits der Tour einmal länger mit Roger zu reden. Als er merkte, dass es für meine Tochter langweilig wurde, bezog er sie in das Gespräch mit ein. Er fragte sie, was sie gern mache und welchen Sport sie treibe, und als sie nicht allein ans Buffet gehen wollte, um ein Stück Kuchen zu kaufen, nahm er sie an der Hand und begleitete sie.
Ab und zu ertappe ich mich im Familienalltag bei dem Gedanken: »Wie würde wohl Federer reagieren?« Beispielsweise wenn ich mich über meine Töchter ärgere. Ich stelle mir dann vor, wie er ganz ruhig bleiben und lächeln würde. Wahrscheinlich nervt es ihn genauso, wenn seine Kinder morgens nicht aus dem Bett wollen oder am Abend nicht ins Bett, oder wenn sie den Teller nur halb leer essen und dann die Schränke nach Süßem durchsuchen. Aber nur schon meine idealisierte Vorstellung des Familienmenschen Federer verhilft mir in solchen Situationen zu mehr Gelassenheit.
Der Einfluss Federers war bei mir sehr groß. Während über zwanzig Jahren hat er mein Berufsleben bereichert und meine Weiterentwicklung als Journalist befördert. Weil ich dank ihm viel erlebt habe und um die Welt gekommen bin, weil ich immer wieder neue Ansätze für meine Geschichten suchen musste und ein internationales Netzwerk aufbauen konnte. Und zu guter Letzt inspirierte er mich dank seiner fabelhaften Karriere zu diesem Buch und damit in Zeiten des Brexits zu einer schweizerisch-britischen Kooperation mit meinem Namensvetter und hochgeschätzten Kollegen Simon Cambers. Es war mir ein großes Vergnügen!
Simon Graf, im September 2022
Roger, DER FREUND
◀ Wimbledon 2015(Foto: Foto-net)
Am Ursprung jeder großen Sportlerkarriere steht das Spiel. Wer als Kind gern und oft spielt, wird sich auch später kreativ ausleben wollen – auf ganz unterschiedliche Weise. Zu spielen ist von unschätzbarem Wert. Man darf es auch tun, wenn man erwachsen ist. Roger war von klein auf vernarrt in Bälle. Als sein Kopf kaum über die Tischplatte ragte, spielte er Pingpong, dann Tennis, Fußball, Squash, Basketball. Zu seinem bevorzugten Spielkameraden wurde MARCO CHIUDINELLI, den er im Tennistraining kennen lernte. Mit ihm teilte er die Spielfreude, den Bewegungsdrang und die Lust am Wettkampf. Sie spielten noch, wenn alle anderen längst nach Hause gegangen waren. Auch auf der Playstation oder am PC duellierten sie sich stundenlang. Roger Federer träumte schon in jungen Jahren von Wimbledon, auch wenn er zunächst in DANNY SCHNYDER seinen Meister fand. Dieser erste Rivale bereitete ihn auf die späteren Herausforderer Rafael Nadal und Novak Djokovic vor. Schnyder wurde nie Profi, aber er schaffte etwas, das Nadal und Djokovic nie gelingen sollte.
MARC ROSSET und WAYNE FERREIRA führten Federer als Teenager in die harte Welt des Profidaseins ein. Rosset war froh, einen anderen Schweizer auf der ATP-Tour begrüßen zu dürfen. Der aus Johannesburg stammende Ferreira fühlte sich ebenfalls als dessen Mentor, nicht nur, weil Südafrika Federers zweite Heimat ist. Die beiden waren auch für ihn da, als er erstmals mit dem Tod konfrontiert wurde. Und der Ringer URS BÜRGLER half an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney nach, als der schüchterne Roger nicht wusste, ob und wie er bei Mirka den ersten Schritt machen sollte. Auch dazu sind Freunde da.
MARCO CHIUDINELLIJugendfreund
»Und der Sieger sagte: ›Klar, spielen wir noch mal!‹«
Als Jugendfreunde waren Marco Chiudinelli und Roger Federer unzertrennlich. Ihre Freundschaft hält bis heute an, und Marco kann sich noch an vieles aus jener unbeschwerten Zeit erinnern. Die beiden waren acht oder neun, als sie sich zum ersten Mal trafen. Die »Vereinigung der Tennisclubs von Basel und Umgebung« organisierte einmal pro Woche ein Training für die talentiertesten Junioren der Region. »Wir waren bunt gemischt, zehn, zwölf Kids. Erinnern kann ich mich aber nur noch an Roger«, sagt Marco. »Wir verstanden uns auf Anhieb gut.«
Die Trainings fanden im Van der Merwe Center statt, einem großen Fitnesszentrum in Allschwil. Danach tobten sich Marco und Roger im Squashcourt weiter aus. »Zuerst spielten wir mit unseren Tennisrackets und Tennisbällen«, erinnert sich Marco Chiudinelli schmunzelnd. »Die Bälle spickten in dem engen Raum aber wild herum wie in einem Flipperkasten. Irgendwann bekamen wir von der Reception einen Squashball. Perfekt war das aber auch nicht. Wir stießen mit den großen Tennisrackets immer wieder gegen die Wände. Zu Weihnachten bekamen wir von unseren Eltern dann Squashschläger geschenkt. Damit ging es besser.«
Der Bewegungs- und Spieldrang und ihr sportlicher Ehrgeiz einte die beiden, die sich, obwohl ihre Geburtstage nur dreiunddreißig Tage auseinanderliegen – Roger ist der Ältere –, sonst nicht so früh begegnet wären. Die Chiudinellis wohnten damals mitten in Basel in der Nähe des Zoos, die Federers ein paar Kilometer außerhalb in Münchenstein. Marco und Roger bewiesen so viel Balltalent, dass ihre gemeinsamen Trainings bald häufiger wurden. In einer nun exklusiveren Fördergruppe durften sie dreimal pro Woche trainieren, zusammen mit Frank Frey, dem Sohn des Präsidenten der Vereinigung. »Diese Trainings schweißten Roger und mich noch mehr zusammen. Und unsere Eltern waren froh, dass wir gemeinsam unterwegs waren und Spaß hatten.«
1990 bestritten sie am Bambino-Bären-Cup in Arlesheim ihr erstes offizielles Spiel gegeneinander. »Es wurde auf neun Games gespielt, ich gewann 9:7«, weiß Chiudinelli noch ganz genau. Anfangs sei er 2:5 zurückgefallen und von Roger getröstet worden, dann aber übernahm er die Führung und musste nun seinen Freund moralisch aufbauen. Dieser Sieg sollte für Chiudinelli der einzige in einer offiziellen Partie gegen Roger bleiben. »Im Finale habe ich dann aber gegen Enzo Aresta verloren«, erzählt Chiudinelli und fügt schmunzelnd an: »Diese Niederlage fuchst mich heute noch.«
Irgendwann wurde das gemeinsame Fördertraining sistiert, Chiudinelli kann nicht mehr sagen, wieso. Die Eltern hatten sich inzwischen angefreundet, und die Federers ermutigten die Chiudinellis, ihren Sohn auch zum TC Old Boys zu schicken, wo Roger trainierte. Eine gute Entscheidung. »Dort herrschte ein ganz anderes Klima als beim Basler Lawn Tennis Club, wo ich zuvor gewesen war«, sagt Chiudinelli. »Wir hatten bei den Old Boys viele Kids auf ähnlichem Niveau, du fandest immer jemanden zum Spielen.«
Der Zufall wollte es, dass die Familie Chiudinelli zu jener Zeit ganz in die Nähe der Familie Federer nach Münchenstein zog. So fuhren Marco und Roger jeweils zusammen ins Training. Auf dem Rückweg deckten sie sich an einem Kiosk mit sauren Zungen, Schlangen und Colafröschen ein. »Wir setzten uns wieder auf die Fahrräder, stopften den Mund mit den Süßigkeiten voll und füllten so unsere Zuckerspeicher wieder auf«, sagt Chiudinelli und lacht.
Trainiert wurden sie beim TC Old Boys vom Australier Peter Carter, der später zu Swiss Tennis wechselte, um Federer dort persönlich weiterzubetreuen. Chiudinelli erinnert sich: »Wir waren vom Niveau her ähnlich gut, gleich alt und ambitioniert. Wir hatten beide dieses Wettkampf-Gen. Wir wollten immer Games und Sätze spielen. Die anderen hatten diese intrinsische Motivation weniger. Bei uns wollte der Verlierer immer eine Revanche, und der Sieger sagte: ›Klar, spielen wir noch mal!‹ Wir konnten stundenlang spielen.«
Im Sommer 1995, mit vierzehn Jahren, trennten sich ihre Wege, als Federer ins nationale Trainingszentrum in Ecublens eintrat und bei einer Gastfamilie wohnte. »Für mich war das kein Thema«, sagt Chiudinelli. »Ich qualifizierte mich ja nicht einmal jedes Jahr für die Schweizer Juniorenmeisterschaften. Roger spielte schon damals immer um den Titel mit. Ich vermisste ihn bei den Old Boys. Ich war schon besser als diejenigen, die nur regional spielten, aber nicht so gut, dass ich davon träumte, mit Tennis einmal mein Geld zu verdienen. In die Freundschaftsbücher schrieb ich als Traumjob ›Informatiker‹, den Beruf meiner Eltern. Im Tennis war mein Ziel eine N-Klassierung.« N steht für »national«, was bei den Aktiven den Top 150 des Landes entspricht.
Als Federer an den Genfersee zog, befürchtete Chiudinelli, dass die Freundschaft durch die Distanz zerbrechen könnte. Doch das Gegenteil war der Fall. Wenn Roger an den Wochenenden von Ecublens heimkam, verbrachten sie viel Zeit miteinander, fuhren mit zwanzig oder dreißig Franken in der Tasche mit der Straßenbahn zur Basler Steinenvorstadt, wo immer viel los war, flanierten durch die Gassen, aßen bei »McDonald’s«, verspielten ihr Geld im Spielsalon und schauten, wenn alles aufgebraucht war, anderen beim Gamen zu.
Wenn der Spielsalon um ein Uhr morgens schloss und keine Straßenbahnen mehr fuhren, gingen sie die vier Kilometer zu Fuß nach Hause und redeten dabei über Gott und die Welt. Dann gamten sie zu Hause bei Chiudinelli auf dessen PC weiter bis drei oder vier Uhr morgens. »Wir spielten meistens ›NBA‹ oder ›FIFA‹. Im Basketball spielte Roger mit den Phoenix Suns, ich mit den Chicago Bulls.« Weil Chiudinelli in seinem Kinderzimmer einen Basketballkorb hatte, duellierten sie sich auch mit einem richtigen Ball – allerdings nicht nachts. »Es war eine intensive, schöne Zeit«, blickt Marco zurück. Für Partys, Alkohol oder Mädchen interessierten sie sich damals noch nicht groß. Die beiden ausgeprägten Spielernaturen wollten nur spielen: ob auf dem Court mit Racket und Ball, auf der Playstation, am PC oder im Spielsalon. Über Ecublens redeten sie kaum. Jedenfalls nicht übers Tennis. »Mir kam es gar nicht in den Sinn, dass ich auch einmal da hingehen könnte. Deshalb war es mir ziemlich egal, was da tennismäßig so ging«, sagt Chiudinelli.
Doch dann, Anfang 1997, Marco war fünfzehn, erhielt er von Swiss Tennis eine Einladung nach Ecublens, um im nationalen Trainingszentrum vorzuspielen. Wahrscheinlich hatte Peter Carter, der ihn bei den Old Boys trainiert hatte und inzwischen in Ecublens unterrichtete, ein gutes Wort für ihn eingelegt. »Ich reiste ehrfürchtig an den Genfersee. Ecublens war damals der heilige Gral des Schweizer Tennis, auch wenn die Halle alt war und fast zusammenkrachte. An jenem Tag spielte ich groß auf, alles klappte. Nur im Zwölfminutenlauf am Schluss versagte ich. Danach teilten sie mir mit, ich sei für den Kader nominiert.« In jenem Jahr zog Swiss Tennis von Ecublens nach Biel um ins topmoderne neue nationale Leistungszentrum, und ab diesem Zeitpunkt verfolgte auch Marco eine Tenniskarriere. »Hätte mich Swiss Tennis nicht in den Kader aufgenommen, ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, mehr zu trainieren«, sagt er schulterzuckend. Manchmal findet das Glück einen, ohne dass man es sucht.
In Biel sahen sich Marco und Roger aber nicht mehr so oft, denn sie waren in unterschiedlichen Trainingsgruppen und spielten deshalb kaum miteinander. Zudem war Roger, inzwischen sechzehn, schon oft an Turnieren unterwegs. Am 22. September 1997 tauchte er nach seinen ersten Siegen bei einer Serie von Satellite-Turnieren (das ist die dritthöchste Profistufe) im freiburgischen Bossonnens erstmals in der ATP-Weltrangliste auf: als Nummer 803 fünf Ränge vor Lleyton Hewitt, der später bei den Profis sein erster großer Rivale wurde. »Damals war für mich klar, dass Roger Tennisprofi werden und Erfolg haben wird«, sagt Chiudinelli. »Aber dass er eines Tages Grand Slams gewinnen würde, dachte ich noch nicht.«
Derweil Federer 1998 in Wimbledon das Juniorenturnier gewann und in Gstaad mit siebzehn auf der ATP-Tour debütierte, war Chiudinelli davon noch weit entfernt. Aber auch er setzte inzwischen ganz auf Tennis, wurde im August 1999 mit achtzehn Profi, gewann schon bald ein Satellite-Turnier und kletterte in den ersten Monaten in die Top 500 der Weltrangliste. Trotzdem waren die beiden in komplett anderen Welten unterwegs – Roger Federer hatte sich da schon in die Top 100 gespielt.
Chiudinelli kann sich noch gut erinnern, wo er war, als sein Freund am 3. Juli 2001 seinen bis dahin größten Erfolg feierte. Mit neunzehn Jahren, also noch als Teenager, zerstörte Roger in Wimbledon im Achtelfinale den Traum seines Idols Pete Sampras, Wimbledon ein achtes Mal zu gewinnen. Marco war derweil im französischen Montauban, wo er in der Qualifikation für ein Challenger-Turnier keinen Ball traf und vom Argentinier Walter Larrea, einem örtlichen Clubspieler, deklassiert wurde. »Nachdem ich den ersten Satz 1:6 verloren hatte, ging ich in die Garderobe, zertrümmerte einen Schläger und sagte zu mir: ›Das ist Walter Larrea, der hat vielleicht einen ATP-Punkt geholt in seinem Leben. Jetzt gehst du raus und kämpfst!‹ Ich ging also raus, kämpfte wie verrückt und verlor den zweiten Satz 0:6.«
Natürlich habe er sich für Roger gefreut, sagt Chiudinelli. »Aber ich war damals vor allem mit mir selbst beschäftigt. Ich überlegte mir, von Montauban nach Tiflis zu fliegen und dort zwei Future-Turniere zu spielen, um wieder einmal ein Match zu gewinnen. Ich war völlig am Boden, hatte keinen Support mehr von Swiss Tennis, und Roger schlug in Wimbledon Sampras.« War Chiudinelli nie neidisch auf seinen Jugendfreund und dessen Karriere? Er schmunzelt: »Diese Frage höre ich oft. Nein, ich empfand nie eine Spur von Neid. Denn ich sah mich nie auf dem gleichen Level wie Roger, schon zu Juniorenzeiten nicht. Du findest in allen Berufen welche, die erfolgreicher sind als du. Aber du vergleichst dich nicht ständig mit ihnen. Sonst müssten fast alle in ihrem Job unglücklich sein.«
Chiudinelli versuchte, auf der Profitour Fuß zu fassen, derweil Federer von Erfolg zu Erfolg eilte. An dessen ersten Wimbledon-Sieg am 6. Juli 2003 kann Marco sich nicht mehr erinnern. Oder genauer: Er verschlief ihn. Und das kam so: In jenem Jahr war er anfänglich auch im All England Club dabei, qualifizierte sich im Doppel mit dem Kroaten Lovro Zovko fürs Hauptfeld, verlor aber bereits in Runde eins. Er hatte sich danach fürs Challenger-Turnier in Granby in der Nähe von Montreal eingeschrieben, das er eigentlich wegen Problemen mit seinem linken Handgelenk hätte absagen müssen. Doch dann entdeckte er beim Surfen im Internet, dass zwei seiner Lieblingsbands in Montreal nacheinander am gleichen Konzert auftreten würden: die Progressive-Rock-Bands Dream Theater und Queensrÿche. Obwohl also eine Pause angesagt gewesen wäre, entschied er sich, trotzdem zu fliegen und vor dem Turnier das Konzert zu besuchen, um auf andere Gedanken zu kommen. Im Flugzeug traf er den Deutschen Maximilian Abel, der ebenfalls in Granby antrat. Zusammen besuchten sie am 5. Juli das Konzert in Montreal und zogen danach bis frühmorgens um die Häuser. Als Chiudinelli gegen Mittag aufwachte, war Federer fünftausend Kilometer und fünf Zeitzonen entfernt Wimbledon-Champion geworden.
Dass Roger und Marco beide Tennisprofis wurden, half, ihre Freundschaft wachzuhalten, auch wenn sie in unterschiedlichen Sphären spielten. »Wenn ich eine Frage zu einem Gegner hatte, wusste ich, ich kann Roger immer anrufen. Wir sahen uns an mehreren ATP-Turnieren und an den vier Grand Slams. In Basel trainierten wir jeweils vor dem Turnier zusammen.« Und wenn es sich ergab, gingen sie zusammen essen. War es nicht stets hektisch um Federer herum? Chiudinelli verneint. »Roger konnte sich gut abschirmen. Er hatte in den Restaurants meist seine Ecke, so konnten wir uns ungestört unterhalten.« Verändert habe sich Federer durch all den Rummel um ihn nicht. »Ich habe keinen Vergleich. Ich kenne sonst niemanden, der ein Superstar wurde. Aber ich würde sagen: Er ist ein Vorbild darin, wie er mit alldem umgegangen ist.«
Wie erklärt sich Chiudinelli die Dauerhaftigkeit und Professionalität seines Freunds? Er überlegt kurz und sagt: »Er hatte gute Voraussetzungen mit seinen Eltern, die sich ein bisschen im Tennis auskannten und ihn unterstützten, sich aber trotzdem zurückhielten. Und er hatte ein goldenes Händchen in der Wahl der Leute, die ihn umgeben. Zuallererst seine Frau Mirka, die sein Leben managt und das ganze Drumherum. Es gibt andere Partnerinnen auf der Tour, die mehr für Chaos als für Ruhe sorgen. Sie ist für ihn enorm wertvoll. Fitnesstrainer Pierre Paganini war für ihn von Anfang an ebenfalls sehr wichtig, auch wenn es darum ging, wie man Ziele festlegt und im Blick behält. Auch in Coach Severin Lüthi fand er eine Konstante und in Manager Tony Godsick ebenso.«
Federer habe es verstanden, Menschen um sich aufzubauen, die ihn schützten, aber auch förderten, die ihre Inputs einbrachten, damit er immer besser wurde. »Viele wissen gar nicht, wie viel Teamwork es im Tennis braucht, damit du als Einzelsportler auf dem Court performen kannst. Du brauchst eine gute Crew, damit du auf dem Platz hundert Prozent liefern kannst und nicht bei dreiundneunzig Prozent hängen bleibst. Roger lebte dieses Teamwork stets sehr ausgeprägt und bewies bei der Auswahl seiner Leute gute Menschenkenntnis.« Chiudinelli hingegen war oft allein rund um den Globus unterwegs und wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Doch er blieb stets dran und schaffte mit siebenundzwanzig nach einer achtzehnmonatigen Pause, die einer komplizierten Knieoperation geschuldet war, ein bemerkenswertes Comeback, das ihm von der ATP sogar die Auszeichnung »Comeback Player of the Year« eintragen sollte.
Im Oktober 2009 stieß Chiudinelli erstmals in die Top 100 vor, kurz danach, Anfang November, spielte er an den Swiss Indoors groß auf und forderte im Halbfinale Federer im Duell der ehemaligen Ballboys. Erstmals spielten sie, die in jungen Jahren so viel miteinander erlebt hatten, als Profis gegeneinander. Ihr Aufeinandertreffen hielt, was es versprach. Chiudinelli spielte keck auf, verpasste im ersten Satz drei Breakbälle zum 5:3, führte im Tiebreak 4:1 und hatte bei 7:6 einen Satzball, den Federer mit einem brillanten Rückhandpassierball abwehrte. So setzte sich der Favorit dann doch noch standesgemäß 7:6, 6:3 durch.
»Es war ein schöner und bitterer Moment für mich zugleich«, sagt Chiudinelli. »Ich hatte meine Chancen, deshalb war meine Niederlage doppelt enttäuschend. Aber es war für mich wunderschön, in ein volles Stadion einzulaufen und zu erleben, dass die Sympathien der Zuschauer ähnlich verteilt waren. In der St. Jakobshalle fieberte die eine Hälfte mit Roger, die andere mit mir.« Am liebsten hätte Marco den Court nach dem Handshake gleich Richtung Garderobe verlassen, so enttäuscht war er. Aber er musste noch zum gemeinsamen Platzinterview bleiben. »Das war gut für mich, weil ich mich so schneller wieder fassen konnte.«
Fünf Jahre später, im November 2014, feierten die beiden gemeinsam den Davis-Cup-Titel in Lille mit einem 3:1 gegen Frankreich. Roger Federer und Stan Wawrinka holten im Finale die nötigen drei Punkte, die langjährigen Davis-Cup-Spieler Marco Chiudinelli und Michael Lammer waren mit im Team. »Es war ein extrem schöner Moment für mich«, sagt Chiudinelli. »Als wir uns nach dem Sieg unterhielten, gab mir Roger das Gefühl, dass er auch für uns gespielt hatte. Er wusste: Das war für Michi und mich die einzige Chance, etwas in dieser Größenordnung zu gewinnen. Allein hätten wir das nicht geschafft. Dafür sind wir Roger und Stan ewig dankbar. Das gehört zu den Top-3-Highlights meiner Karriere.« Er habe damals gespürt, dass von Federer eine große Last abgefallen sei, weil er den Schweizer Fans und auch Swiss Tennis endlich den Davis-Cup-Titel beschert hatte – nach all den Jahren, in denen er für den Davis Cup immer mal wieder abgesagt hatte, wofür er auch kritisiert worden war. »Das konnte er nun abhaken.«
Während Roger Federer 2017 nach einer sechsmonatigen Verletzungspause sein grandioses Comeback feierte, das ihm drei weitere Grand-Slam-Titel eintragen sollte, neigte sich für Chiudinelli in jenem Jahr die Karriere dem Ende zu. Der Körper spielte nicht mehr mit, ständig plagten ihn Knie- und Achillessehnenprobleme. Er ging auf eine Art Abschiedstournee, spielte nochmals an denjenigen Orten, an denen es ihm besonders gefallen hatte, bevor er im Oktober 2017 an den Swiss Indoors in Basel offiziell abtreten wollte. Zwei Wochen zuvor weihte er seinen Freund Roger in diesen Plan ein, als sie am Rande des ATP-Turniers in Schanghai essen gingen. »Wir hatten ein gutes Gespräch, diskutierten bis spät in die Nacht hinein. Roger riet mir, die wichtigsten Schweizer Journalisten vorab zu informieren und ihnen Interviews zu geben. Vielleicht, so meinte er, würde mir einer dieser Artikel eine Tür öffnen für mein Leben nach der Karriere. So machte ich es.«
An einem Montagabend Ende Oktober 2017 spielte Chiudinelli an den Swiss Indoors gegen den Niederländer Robin Haase sein letztes Match. Federer saß in der ersten Reihe, vergoss bei Marcos Ehrenrunde Tränen, umarmte danach seinen Freund und flüsterte ihm zu: »Ich bin ein Fan von dir.« Rückblickend sagt Marco Chiudinelli: »Dass Roger an jenem Abend da war, bedeutete mir sehr viel. Er war von meinen Anfängen bis zu meinem letzten Match dabei.« Und natürlich saß auch Marco Ende September 2022 in der Londoner O2-Arena, als Roger am Laver Cup seinen tränenreichen Abschied vom Tennis feierte.
DANNY SCHNYDERErster Rivale
Er schaffte, was Nadal und Djokovic gegen Federer nie gelang
Niemand schlägt Roger Federer achtmal in Folge. Nicht einmal Rafael Nadal oder Novak Djokovic. Niemand? Doch, einer hat es geschafft: Danny Schnyder. An seinem Baselbieter Tenniskollegen verzweifelte der junge Roger. Die beiden waren schweizweit die Besten des Jahrgangs 1981, duellierten sich als Acht- bis Vierzehnjährige regelmäßig an Juniorenturnieren und freundeten sich an. Danny, der jüngere Bruder der späteren Profispielerin Patty Schnyder, wuchs in Bottmingen auf, Roger im Nachbardorf Münchenstein. Manchmal besuchten sie zusammen ein Spiel des FC Basel oder schauten zu Hause einen Film; an freien Wochenenden trafen sie sich oft auf dem Tenniscourt und trieben allerlei Unfug. Doch in offiziellen Matches galt es ernst. »Da kannten wir keine Freundschaft mehr«, sagt Schnyder. »Wir waren beide sehr ehrgeizig, deshalb wurde es immer sehr emotional.« Wobei es in den ersten Duellen primär Federer war, der laut wurde und dem ab und zu ein Schläger aus der Hand rutschte.
Der gut sechs Monate ältere Schnyder war für Federer anfangs ein ähnlich unangenehmer Gegner, wie es später Novak Djokovic werden sollte. Danny beging kaum Fehler, hatte eine stabile doppelhändige Rückhand und traktierte die verwundbare einhändige Backhand Federers. »Ich war sehr solide an der Grundlinie, machte wenig Fehler«, sagt Schnyder. »Rogi war immer der risikofreudigere Spieler, probierte sogar schon damals, Aufschlag-Volley zu spielen, was sich in so jungen Jahren noch nicht auszahlt. Mit der Vorhand versuchte er zu powern. Aber er machte noch zu viele Fehler, und seine Rückhand war eine Riesenschwäche. Da nagelte ich ihn fest.«
Die ersten fünf, sechs Mal habe er klar gesiegt, glaubt sich Schnyder zu erinnern. »Rogi war frustriert, er hasste es, zu verlieren.« Die ersten acht offiziellen Matches gewann Schnyder. Doch dann war der Bann gebrochen, und Federer überließ seinem Jugendrivalen nur noch einmal den Sieg. »Die Bilanz war am Schluss knapp positiv für Rogi«, sagt Schnyder. An den Junioren-Schweizermeisterschaften 1993 in Bellinzona durften sich beide freuen, weil sie im Doppel zusammen gewannen. Im Einzel siegte Federer im Endspiel gegen Schnyder. Auf einem Foto halten sie beide strahlend ihre je zwei Medaillen in die Kamera: dreimal Gold und einmal Silber.
»Wenn ich all die Erfolge von Rogi sehe, kommt es mir wie ein Traum vor, dass ich einmal sechs Jahre lang mit ihm mithalten konnte«, sinniert Danny Schnyder. Durch ihre gemeinsame Zeit als ambitionierte Junioren fühlen sie sich bis heute miteinander verbunden, auch wenn sie sich kaum mehr sehen. Im März 2015 besuchte Schnyder, damals in San Diego wohnhaft, seinen Jugendfreund am Turnier in Indian Wells in der kalifornischen Wüste. »Ich glaubte, er hätte bei seinem gedrängten Programm nur eine Viertelstunde Zeit. Aber wir saßen im Player’s Garden über eine Stunde zusammen und plauderten über alte Zeiten, unser aktuelles Leben und unsere Familien. Klar bin ich stolz auf ihn, dass er eine solch großartige Karriere gemacht hat. Aber mehr als all die Titel freut mich, dass er noch immer der gleiche lockere Typ ist wie vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren.«
In Indian Wells frischten sie Erinnerungen auf, wie etwa daran, dass sie an einem Juniorenturnier im französischen Annecy nur Blödsinn im Kopf gehabt hatten. »Wir schossen Bälle herum, und wer den anderen traf, bekam einen Lollipop. Wir mussten herzhaft lachen, als wir daran zurückdachten. Was ich wahnsinnig finde: Rogi kramte jedes Detail unserer Matches hervor. Er kannte teilweise sogar noch die Resultate.« Später chauffierte Federer seinen Jugendfreund noch mit dem Auto ins Hotel.
Aber wieso wurde aus Roger Federer ein Tennis-Superstar und aus seinem ersten Angstgegner keiner? »Das werde ich oft gefragt«, sagt Schnyder, der statt einer sportlichen eine akademische Laufbahn einschlug. »Ich glaube, selbst wenn ich voll auf Tennis gesetzt hätte, wäre ich nicht weitergekommen als in die Top 600 oder 700 der Welt. Ich hatte nicht die Physis und das Talent, um weiter nach vorn zu kommen. Und was noch wichtiger ist: Mir fehlte die absolute Leidenschaft. Ich wollte nicht mehr als sechs, sieben Stunden pro Woche dem Tennis widmen. Das Händchen war da, aber den riesengroßen Mangel an Leidenschaft kannst du nicht wettmachen.« Eine Leidenschaft, die Schnyder bei Federer spürte. »Er liebte das Spiel, mehr als ich. Und noch mehr liebte er es, zu siegen. Sein Siegeswille war riesig.«
Schnyder sah bei seiner gut zwei Jahre älteren Schwester Patty, die auf der WTA-Tour bis auf Rang 7 vorstoßen und elf Profititel gewinnen sollte, wie viel man investieren muss für eine Profikarriere. »Als ich fünfzehn, sechzehn war, wollte ich lieber mit Freunden etwas unternehmen. Ich war ein großer Fan des FC Basel, besuchte alle Spiele. Dann kam mit siebzehn, achtzehn der Ausgang dazu, und das Tennis rückte definitiv in den Hintergrund.« Danny Schnyder schaffte es bis auf Rang 67 der nationalen Rangliste. Immerhin.
Was ihn bei Federer am meisten verblüfft: mit welcher Gradlinigkeit dieser seine Karriere vorantrieb. »Wir waren als Jugendliche ähnlich, hatten viele Flausen im Kopf und waren nicht sehr beflissen im Training. Wenn wir miteinander spielten, wärmten wir uns nicht lange auf, sondern spielten bald einmal Punkte. Stundenlang Bälle ›longline‹ oder ›cross-court‹ hin- und herzuspielen, das war nicht unser Ding. Ich finde es unglaublich, wie sich Rogi in dieser Hinsicht veränderte. Wie er diese Disziplin und die Coolness hinbekam. Das hätte ich nie gedacht. Dass er Talent hat, wusste ich immer. Aber dass er Tag für Tag diese Knochenarbeit leisten würde, dass er ein Modellsportler werden würde und der Traum aller Schwiegermütter, überraschte mich doch. Ich glaubte eher, er würde einer werden wie Gaël Monfils: verspielt und nicht immer so diszipliniert, ein charismatischer Künstler, der mit dem Publikum spielt und ab und zu ein Racket zerschlägt. Denn Rogi hatte schon seinen eigenen Kopf, er war auf eine gute Art ein Lausbub.«
Die Wege der beiden trennten sich, als Federer im Herbst 1995 ins nationale Trainingszentrum in Ecublens eintrat. »Rogi entwickelte sich dort rasant. Schon nach einem halben Jahr merkte ich eine große Veränderung. Er ließ sich auf dem Court nicht mehr so schnell aus dem Konzept bringen«, sagt Schnyder. »Er schaute nicht mehr, was die Leute rundherum machten. Die Entscheidung für Ecublens war für seinen Werdegang wegweisend. Er hatte nun viel mehr Zeit fürs Tennis. Und wahrscheinlich spürte er auch mehr Druck, weil er nun ganz auf den Sport setzte. Ab da war er in allem viel fokussierter. Und ich hatte bald einmal keine Chance mehr gegen ihn.«
Danny Schnyder studierte in Basel Spanisch im Hauptfach, Politikwissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaften im Nebenfach. 2003 wanderte er nach Mexiko aus und studierte in Monterrey am College International Affairs mit dem Fokus Business. Nach dem Master zog er aus beruflichen Gründen nach Houston um, später nach San Diego. 2018 warb ihn der Schweizer Baustoffproduzent Holcim ab, und er kehrte mit seiner Familie als Head of Sales in den Großraum Houston zurück. Er ist zufrieden, wie sein Leben verlaufen ist. Inzwischen Vater einer Tochter und eines Sohns, ist er nur noch selten in der Schweiz. Von zwanzig bis dreißig nahm er kaum mehr ein Racket in die Hand, inzwischen spielt er in den USA wieder regelmäßig Tennis. Sogar wettkampfmäßig und auf einem guten Niveau.
Er schaue heute lieber Baseball als Tennis, gesteht Schnyder. Aber bei den großen Finals von Federer habe er immer eingeschaltet. »Ich bin ein großer Sportfan, aber kein Tennisfan. Ich schaute nur Tennis, wenn Rogi spielte. Bei ihm sah immer alles so flüssig und natürlich aus. Das gefiel mir am besten an ihm. Diese Leichtigkeit. Wenn ich Nadal zuschaue, habe ich immer das Gefühl, er sei die ganze Zeit am Kämpfen. Bei Rogi war stets alles so smooth. Da macht es Spaß, zuzuschauen.«
Erwähnt er noch ab und zu, dass er den großen Roger Federer einst achtmal in Folge schlug? Schnyder schmunzelt. »Es ist nicht so, dass ich von mir aus darauf zu sprechen komme. Aber wenn ich sage, ich sei aus der Schweiz, heißt es oft: ›Ah, wie Roger Federer!‹ Und dann sage ich schon, dass ich ihn kenne und früher sogar gegen ihn gespielt und ihn geschlagen habe.« Natürlich glaubten ihm das viele nicht, deshalb nahm er, als er Federer in Indian Wells traf, ein Kurzvideo mit ihm auf. Darin bestätigte dieser, dass sein Jugendrivale früher oft gegen ihn gewonnen hatte. Danny Schnyder zeigt das Video: Es ist eine entspannte Atmosphäre, Danny sagt: »Wir sind jetzt hier mit Roger.« Dieser wirft ein: »In Indian Wells.« Dann fährt Federer mit einem spitzbübischen Lächeln fort: »Und es ist Zeit für Nostalgie. Wir haben festgestellt: Der einzige Spieler, der mich öfter geschlagen hat oder so oft wie Nadal und Djokovic, ist Danny Schnyder. Da ist er!« Das Handy schwenkt zu Schnyder, der ein Victory-Zeichen macht. Federer schließt: »Prost darauf!« – »Dank diesem Video habe ich in Bars schon viele Wetten und Gratisbiere gewonnen«, sagt Schnyder schmunzelnd. Und er verhehlt nicht, dass ihm seine Beziehung zu Federer auch schon geschäftlich zum Vorteil gereichte. »Mit CEOs, die Tennisfans sind, hatte ich damit eine gute Gesprächsbasis. Du beginnst gleich auf einem anderen Level.«
Tennisprofi ist Danny Schnyder nicht geworden. Seine Jahre als erfolgreicher Junior und erster großer Rivale Federers prägen sein Leben aber bis heute.
MARC ROSSETEx-Tennisprofi und »großer Bruder«
»Ich mochte diesen Jungen einfach«
Marc Rosset lächelt, als er von seiner ersten Begegnung mit Roger Federer erzählt: »Er war vierzehn oder fünfzehn, als er nach Genf kam, um mit mir zu trainieren. Man sagte mir, er sei sehr talentiert. Ich war gespannt auf ihn. Als ich selbst Jahre zuvor als Teenager erstmals mit dem großen Henri Leconte hatte Bälle schlagen dürfen, war ich sehr angespannt gewesen. Ich wollte mich damals von meiner besten Seite präsentieren, gab alles, bis an den Rand der Erschöpfung. Und Roger? Von Nervosität keine Spur! Er war so entspannt, wie man nur sein kann. Er bewegte sich nicht groß auf dem Platz, seine Bälle flogen in alle Richtungen. Ich musste lachen, er war derart anders als ich einst bei Leconte.«
Nervte es Rosset nicht, dass sich dieser Teenager so gar nicht ehrfürchtig zeigte gegenüber ihm, dem Olympiasieger? »Ach, im Gegenteil. Ich schloss Roger sofort ins Herz. Mir gefiel seine Lockerheit.« Dass Federer talentiert gewesen sei, habe er gesehen. »Aber das war für mich nicht so bedeutend. In diesem Alter kannst du noch nicht sagen, ob jemand ein großer Spieler wird. Das ist unmöglich. Was mich beeindruckte, war seine lockere Art. Ich mochte diesen Jungen einfach. Ich mochte schon immer diejenigen, die ein bisschen anders sind. Deshalb freundete ich mich auch mit Marat Safin und Goran Ivanisevic an.«