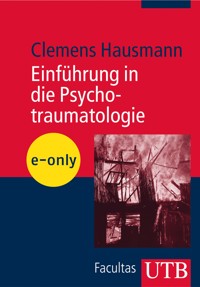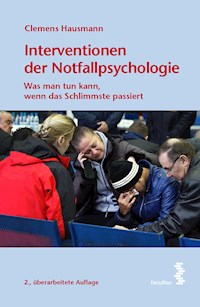
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Notfallpsychologische Hilfe unterstützt Betroffene bei traumatischen Ereignissen, hilft die psychische Stabilität wiederzuerlangen und fördert Verarbeitung und Erholung. Dieses Buch geht von praktischen Fragen aus: Was brauchen Betroffene in den ersten Stunden, Tagen und Wochen nach einem Notfall? Welche psychologischen Interventionen helfen bei der Bewältigung? Welche Ressourcen und Risikofaktoren gibt es? Was können Betroffene selbst tun, was ihre Angehörigen, Freundinnen und Freunde? Wann ist eine weiterführende Behandlung notwendig? Die notfallpsychologischen Interventionen sind von der Akuthilfe über die psychologische Stabilisierung bis zur Weiterbetreuung in Phasen gestaffelt und orientieren sich an den jeweiligen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Betroffenen. Damit ist dieses Buch ein verlässlicher Begleiter für die Hilfe und Behandlung nach Notfällen, aber auch für Vorbereitung und Schulung von Helferinnen und Helfern. Mit Übersichtskarte: die wichtigsten Maßnahmen vor Ort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Clemens Hausmann
Interventionen der Notfallpsychologie
Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Clemens Hausmann Kardinal Schwarzenberg Akademie Baderstraße 10
A-5620 Schwarzach/Pongau
E-Mail: [email protected]: www.clemens-hausmann.at
Eine geschlechtergerechte Schreibweise wird in diesem Buch durch die abwechselnde Verwendung männlicher und weiblicher Formen realisiert. Ist die Nennung auf diese Weise nicht möglich oder hemmt sie den Lesefluss, wird nach Möglichkeit auf neutrale Formen zurückgegriffen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr; eine Haftung des Autors oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
2., überarbeitete Auflage 2021
Copyright © 2016 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Verlag, 1050 Wien, Österreich
Umschlagfoto: APA
Satz: Wandl Multimedia-Agentur
Druck: finidr
Printed in the E.U.
ISBN 978-3-7089-2106-8
E-ISBN 978-3-99111-335-5
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I Grundlagen
1 Ausnahmezustand
1.1 Notfall – wenn das Schlimmste passiert
1.2 Erleben im Ausnahmezustand
1.3 Schock, Gefühle, Gedanken und Verhalten – Die ersten Reaktionen
1.4 Der gesprengte Bezugsrahmen
1.5 Gruppen von Betroffenen
1.6 Notfall, Trauma, Krise
1.7 Interventionsformen – Krisenintervention und Notfallpsychologie
1.8 Geschichtliche Entwicklung
2 Psychotrauma
2.1 Traumatische Ereignisse
2.2 Verlauf der Traumatisierung
2.3 Posttraumatische Störungen
2.4 Neurobiologische Prozesse
2.5 Erschütterte Grundannahmen
2.6 Psychische Traumatisierung und körperliche Krankheiten
2.7 Soziale und berufliche Folgeprobleme
3 Resilienz und Risikofaktoren
3.1 Resilienz
3.2 Individuell-biografische Faktoren
3.3 Soziale Unterstützung
3.4 Kohärenzerleben
3.5 Hilfreiche Copingstile
3.6 Risikofaktoren
3.7 Posttraumatische Reifung
4 Notwendige und angemessene Hilfe
4.1 Wann wird interveniert? – Phasen und Zeitfenster
4.2 Wer braucht welche Hilfe? – Kriterien, Reaktionen, Symptome
4.3 Wer ist weiter gefährdet? – Screening, Triage
4.4 Wer hilft? – Kompetenzstufen – die drei Ebenen der Hilfe
4.5 Wer macht was? – Helfende und Berufsgruppen
4.6 Effektivität notfallpsychologischer Interventionen
II Akutphase
5 Akutinterventionen
5.1 Aufgaben, Bedürfnisse, Ressourcen – Das salutogenetische Vorgehen
5.2 Fünf wesentliche Elemente früher Interventionen
5.3 Grundprinzipien der Akutinterventionen
5.4 „Ich habe Zeit für Sie“ – Die ersten Schritte
5.5 Gesprächsführung und professionelles Verhalten
5.6 Die Rolle der Sprache
5.7 Gefühle und Schuld in der Akutphase
5.8 Im Detail: Zehn Akutinterventionen
5.9 Hypnotische Kommunikation
6 Besondere Situationen und Gruppen
6.1 Psychosoziale Erste Hilfe nach Unfällen
6.2 Eine schlechte Nachricht mitteilen
6.3 Überbringen der Todesnachricht
6.4 Begleitung bei der Identifizierung und Verabschiedung
6.5 Plötzlicher Kindstod
6.6 Ablehnen der angebotenen Hilfe
6.7 Psychiatrische Notfälle
6.8 Akute Suizidalität
6.9 Angehörige in Akutsituationen
6.10 Angehörige nach einem Suizid
6.11 Kinder als Primärbetroffene
6.12 Kinder als Angehörige
6.13 Alte Menschen
6.14 Angehörige anderer Kulturen und Reisende
6.15 Ersthelfende, Zeugen, Zuschauende
III Stabilisierungsphase
7 Psychologische Stabilisierung
7.1 Ziele, Inhalte, Settings
7.2 Hauptelemente der psychologischen Stabilisierung
7.3 Das Entlastungsgespräch
7.4 Psychologische Stabilisierung von Betroffenen im Krankenhaus
7.5 Angehörigenunterstützung im Krankenhaus
7.6 Stabilisierung von Angehörigen und Familien zu Hause/ambulant
7.7 Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen
7.8 Stabilisierung in der Schule
7.9 Stabilisierung am Arbeitsplatz
7.10 Suizid am Arbeitsplatz
7.11 Stabilisierung von großen Gruppen – Crisis Management Briefing
7.12 Trauer in den ersten Tagen und Wochen
7.13 Trauer bei Kindern und Jugendlichen
8 Hilfe für Helfende
8.1 Kritische Ereignisse und psychologische Unterstützung
8.2 Stressmanagement nach kritischen Ereignissen (CISM)
8.3 Vorbereitung auf kritische Ereignisse
8.4 Einzelgespräche und Hilfe vor Ort – Das SAFER-Gespräch
8.5 Demobilisierung
8.6 Defusing
8.7 Debriefing (CISD)
8.8 Familienunterstützung, Nachsorge, Überweisung
8.9 Freiwillige oder verpflichtende Teilnahme
8.10 KIMA – Krisenintervention im Krankenhaus
IV Weiterbetreuung
9 Individuelle Weiterbetreuung und Trauerbegleitung
9.1 Gelungene Verarbeitung und offene seelische Wunden
9.2 Trauerbegleitung bei unterdrückter oder verschleppter Trauer
9.3 Trauer und Depression
9.4 Früher Tod eines Kindes
9.5 Schuldgefühle und reale Schuld in der Weiterbetreuung
10 Traumatherapie
10.1 Traumatherapie – Ziele und Grundprinzipien
10.2 Kognitive Verhaltenstherapie
10.3 EMDR
10.4 Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT)
10.5 Narrative Expositionstherapie
V Spezielle Themen
11 Katastrophen und Großschadensereignisse
11.1 Katastrophen als notfallpsychologische Aufgabe
11.2 Psychosoziale Katastrophenhilfe
11.3 TENTS-Richtlinien
11.4 Psychologische Erste Hilfe bei Katastrophen
11.5 Sanitätshilfsstelle (SanHiSt)
11.6 Interventionen in der Akutphase
11.7 Psychologische Stabilisierung und individuelle Weiterbetreuung
11.8 Terrorismus
11.9 Panikvermeidung
11.10 Psychologische Unterstützung in der Covid-19-Pandemie
12 Psychohygiene in der Notfallpsychologie
12.1 Akutfälle und allgemeine Psychohygiene
12.2 Stabilisierungsphase und Nachbetreuung/Therapie
12.3 Bei Katastrophen und Großschadensereignissen
13 Anhang
13.1Empfehlungen für Betroffene, Angehörige und Helfende
13.2 Angemessene Berichterstattung über Notfälle und Katastrophen
13.3 Berichterstattung über Suizid
Literatur
Einleitung
Wien, 2. November 2020: Auf einen milden Herbsttag folgt ein ungewöhnlich lauer Abend. Ab dem nächsten Morgen wird die Stadt im zweiten Lockdown der Covid-19-Pandemie sein. Viele Menschen nutzen den Abend, um noch einmal auszugehen, Bekannte zu treffen und gemeinsam Spaß zu haben; auch und besonders im Bermudadreieck, einer Partymeile am Rand der Innenstadt.
Kurz vor 20:00 Uhr eröffnet ein junger Mann mit einem Sturmgewehr das Feuer auf Passanten, Gäste und Kellnerinnen. Er tötet vier Menschen und verletzt 23 weitere, ehe er selbst, neun Minuten nach Auslösung des Terroralarms, von der Polizei erschossen wird.
In den Medien werden Augenzeugenberichte beinahe in Echtzeit veröffentlicht:
„Ein mit einer Langwaffe bewaffneter Mann läuft die Gasse entlang und schießt auf einen […] Mann, der daraufhin zusammenbricht.“
„Mindestens ein Angreifer […] hat auf die Menschen geschossen, die vor den Bars und Pubs im Bermudadreieck gesessen sind. Die sind panisch in die Bars reingerannt, aber der Angreifer ist hinterhergelaufen und hat auch in den Bars geschossen.“
„Wir sind aus der U-Bahn gekommen, als es passiert ist … Wir sind mitten in der Schießerei gestanden.“
„Eine Ärztin hat im Innenhof eines Wohnhauses […] ein Notquartier zur Erstversorgung von Schussverletzten eingerichtet.“
Es „… kursieren mehrere Videos, die bewaffnete Männer zeigen, die wild um sich schießen“.
„Handyvideos zeigen, wie Menschen angeschossen werden.“ „Aus einem Fenster schreit ein Augenzeuge Arschloch!“
(diepresse.com, News-Ticker, 2.11.2020)
Notfälle und traumatische Ereignisse treffen die meisten Menschen unvorbereitet. Sie beanspruchen in höchstem Maß die Verarbeitungs- und Anpassungsfähigkeit der Betroffenen. Heftige psychische Reaktionen setzen manchmal sofort ein, manchmal zeitversetzt nach einigen Stunden oder Tagen. Hinzu kommen mittel- und langfristige Folgen in den Tagen oder Wochen danach.
Notfallpsychologische Hilfe unterstützt die Betroffenen dabei, die Ereignisse psychisch zu bewältigen und wieder orientiert, handlungs- und entscheidungsfähig zu werden. Die Interventionen helfen bei der Aufrechterhaltung bzw. Wiedererlangung der psychischen Stabilität und fördern die natürlichen Prozesse der Verarbeitung und Erholung. Ein Hauptansatzpunkt ist die Aktivierung und Förderung der individuellen Ressourcen und Bewältigungsstrategien.
Das vorliegende Buch geht von praktischen Fragen aus: Was brauchen Betroffene in den ersten Stunden, Tagen und Wochen nach einem Notfall? Welche psychologischen Interventionen helfen bei der Bewältigung? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, welche Risikofaktoren spielen eine Rolle? Was können Betroffene selbst tun, was ihre Angehörigen und Freunde? Wann ist eine weiterführende Behandlung notwendig?
Die notfallpsychologischen Interventionen sind zeitlich gestaffelt und orientieren sich an den jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfnissen der Betroffenen. Als Leitfaden dient folgende Einteilung:
■ Notfallpsychologische Akuthilfe: die ersten Stunden bis Tage nach dem Notfall
■ Psychologische Stabilisierung: die ersten Tage bis Wochen nach dem Notfall
■ Weiterbetreuung und Therapie: Monate bis Jahre nach dem Notfall
■ Schulung und Vorbereitung: laufend vor zu erwartenden Notfällen oder Einsätzen
In jeder dieser Phasen stehen unterschiedliche Belastungen, Bedürfnisse und Bewältigungsmöglichkeiten im Vordergrund. Dadurch sind jeweils spezifische Interventionen sinnvoll. Die folgenden Kapitel vermitteln das konkrete Vorgehen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Theorien der Psychotraumatologie.
Teil I – Grundlagen beschreibt den psychischen Ausnahmezustand nach einem Notfall, die möglichen psychischen Folgen traumatischer Ereignisse, Resilienz und Risikofaktoren sowie die Rahmenbedingungen angemessener und wirksamer Hilfe.
Teil II – Akutphase stellt die Inhalte und Grundprinzipien notfallpsychologischer Akutinterventionen dar und geht auf 15 verschiedene Situationen und spezielle Gruppen von Betroffenen im Detail ein.
Teil III – Stabilisierungsphase vermittelt die Hauptelemente psychologischer Stabilisierung und beschreibt das hilfreiche Vorgehen in 10 verschiedenen Situationen (in Einzelgesprächen, in der Familie, im Krankenhaus, in der Schule, am Arbeitsplatz, in großen Gruppen) sowie die psychologische Hilfe für Helfende, die mit potenziell traumatischen Ereignissen konfrontiert sind.
Teil IV – Weiterbetreuung legt den Schwerpunkt auf längerfristige Trauerbegleitung sowie die Behandlung von posttraumatischen Störungen und stellt wichtige Methoden der Traumatherapie vor.
Teil V – Spezielle Themen umfasst notfallpsychologische Hilfe bei Katastrophen, Terroranschlägen, Massenpanik und in der Covid-19-Pandemie sowie die eigene Psychohygiene der Intervenierenden.
Das Vorgängerbuch – Handbuch Notfallpsychologie und Traumabewältigung – erschien in der ersten Auflage 2003. Seine Grundstruktur ist im vorliegenden Buch übernommen. Für die zweite Auflage der Interventionen der Notfallpsychologie wurden die Literatur aktualisiert sowie die beschriebenen Interventionen und Formulierungen überprüft, aktualisiert und wenn nötig erweitert oder neu gefasst. Neue Kapitel behandeln
■ Gefühle und Schuld in der Akutphase
■ Suizidalität am Arbeitsplatz
■ Schuldgefühle und reale Schuld in der Weiterbetreuung
■ Psychologische Unterstützung in der Covid-19-Pandemie
Insgesamt soll das Buch einen fundierten Überblick über die verschiedenen Bereiche der Notfallpsychologie bieten und konkrete Interventionen im Umgang mit Notfallbetroffenen in den verschiedenen Settings möglichst genau beschreiben. Dass alle Betroffenen zur rechten Zeit jene professionelle Hilfe erhalten, die sie zur Bewältigung der Ereignisse brauchen – dazu soll auch dieses Buch beitragen.
Clemens HausmannSalzburg, im Mai 2021
I Grundlagen
1 Ausnahmezustand
„Der Zugführer konnte nicht mehr bremsen. Unser Auto wurde von der Fahrbahn geschleudert. Heli war sofort tot, unsere Kinder wurden lebensgefährlich verletzt. So hörten es Freunde und Fremde schon mittags im Radio, so stand es zwanzig Stunden später in der Zeitung.
Dieser Moment hat mein gesamtes Leben verändert. Er hat mir meine Familie genommen, und mit ihm begann ein neuer, unbekannter Lebensweg.“ (Pachl-Eberhart, 2010, S. 33)
1.1 Notfall – Wenn das Schlimmste passiert
Notfälle – ein Unfall, Unglück, Überfall, eine Verletzung, eine schlimme Diagnose – durchbrechen auf extreme, gefährliche, schreckliche Weise den gewohnten Ablauf der Ereignisse. Sie führen zu einem psychischen „Ausnahmezustand“, der das gesamte Erleben und Verhalten betrifft.
Ein Notfall ist ein plötzlich auftretendes, gefährliches Ereignis oder eine Situation, die das Funktionieren eines Systems (körperlich, psychisch, familiär, sozial, ökologisch, technologisch etc.) akut gefährdet. Die normalen Abläufe sind stark eingeschränkt oder überhaupt unterbrochen. Die Fähigkeit, Veränderungen, Belastungen und unvorhergesehene Situationen zu bewältigen, wird durch einen Notfall extrem beansprucht. Das kann den Körper ebenso betreffen wie das Erleben und Verhalten, die Familie, ein Team, die Umwelt etc. Ein schwerer Schaden ist nicht auszuschließen oder bereits eingetreten, der Zusammenbruch des gesamten Systems könnte folgen.
Die Dimension des Notfalls kann sehr unterschiedlich sein: Sie reicht von Ereignissen mit einzelnen Betroffenen (medizinischer Notfall, Autounfall, plötzlicher Todesfall) oder mehreren Beteiligten (Brand, Geiselnahme) bis hin zu Großschadensereignissen und Katastrophen (Massenkarambolage, Lawinenunfall, Überflutungen, Großfeuer, Terroranschlag). Manche Ereignisse sind schnell vorbei (Verkehrsunfall, Herzinfarkt), bei anderen dauert es lange, bis der äußere Ausnahmezustand endet (Evakuierung, Naturkatastrophe, Entführung).
Notfälle sind zumeist:
■sehr intensiv (es kann sehr laut/heiß/hell sein, stark riechen etc.)
■ unvorhergesehen und plötzlich auftretend („von einer Sekunde auf die andere“)
■ unausweichlich (man kann nicht einfach „wegklicken“ wie bei einem Video)
■ bedrohlich (es kann zum Schlimmsten kommen)
Notfälle sind potenziell traumatisch, aber nicht jeder Notfall bewirkt eine psychische Störung. Tatsächlich kann ein Großteil der Betroffenen – mit Unterstützung – den Notfall und seine Folgen bewältigen und mittelfristig überwinden. Nach dem anfänglichen Schock beginnen bei den meisten Menschen die individuellen Copingmechanismen zu greifen. Die Betroffenen können dann die Ereignisse rund um den Notfall einordnen und innerlich verarbeiten sowie die verschiedenen Folgeprobleme nach und nach bewältigen.
Bei Notfällen, die die Bewältigungsmöglichkeiten einzelner Betroffener überfordern, kann es jedoch zu psychischer Dekompensation („Nervenzusammenbruch“) und zu psychischen Störungen kommen. Das Gleiche gilt, wenn die Bewältigungsmechanismen aufgrund anderer Belastungen bereits geschwächt oder bisher nur ungenügend ausgebildet waren. Die Symptome können während oder unmittelbar nach dem Notfall, aber auch erst nach Tagen, Wochen oder sogar Monaten auftreten.
Nicht alle Notfälle sind für die Betroffenen traumatisch. Umgekehrt können auch Ereignisse, die nicht die Charakteristika eines Notfalls aufweisen, als Trauma erlebt werden und eine posttraumatische Störung verursachen (siehe Kap. 2). Eine besondere Art von Notfällen, die für Einsatzkräfte trotz umfangreicher Schulung und Erfahrung potenziell traumatisch wirken, sind sogenannte kritische Ereignisse (siehe Kap. 8.1).
1.2 Erleben im Ausnahmezustand
Ein Notfall bedeutet einen äußeren und inneren Ausnahmezustand. Der übliche Ablauf der Dinge ist unterbrochen. Zentrale Bereiche des Alltags sind außer Kraft gesetzt. Betroffene haben oft keinen Einfluss auf wichtige Entscheidungen, die von Helfenden, Einsatzkräften, Behörden usw. gefällt werden. Das Erleben und Verhalten ändert sich auf mehreren Ebenen zum Teil radikal. Diese Änderungen sind direkte Ansatzpunkte für erste Interventionen:
Wahrnehmungen
Die Betroffenen sind in Notfällen teilweise extremen Reizen ausgesetzt, sowohl was die Intensität als auch was die Art der Wahrnehmungen betrifft. Der Anblick von Zerstörung, Blut und Verletzungen, das Mitanhören von Schreien und Weinen, ein ungewöhnlicher oder ekelerregender Geruch etc. sind für viele Menschen erschreckend oder lösen Angst aus. Auch Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht vor dem Haus sowie das Auftreten von Uniformierten (Rettung, Exekutive, Feuerwehr) in der Wohnung oder am Arbeitsplatz wirken oft sehr befremdlich und verunsichernd. Hinzu kommt manchmal eine veränderte optische Perspektive: Verletzte liegen am Boden und sehen das Geschehen von unten, aus der „Froschperspektive“; nach einem Verkehrsunfall steht man mitten auf der Fahrbahn usw. Auch das Körperempfinden ist verändert. Manche Menschen spüren in Notfällen fast gar nichts (Temperatur, Schmerzen etc.), andere haben eine besonders intensive Wahrnehmung. Beides kann bei den Betroffenen Angst auslösen. → Die Reduktion von intensiven Reizen (z. B. Abschirmen, Wegführen zu einem ruhigeren Ort) bewirkt eine erste Erleichterung.
Zeiterleben
Personen, die den Ablauf eines Notfalls bewusst erleben, berichten oft von einem befremdlichen „Zeitlupenerlebnis“ – alles passiert mit einem Mal ganz langsam, aber sie können trotzdem nicht schneller handeln; Augenblicke dehnen sich wie zu Minuten. Die Ursache für dieses veränderte Zeiterleben ist eine blitzartige neurophysiologische Aktivierung, die bei Gefahr einsetzt und zu einem Zustand hoch gespannter Wachheit führt, in dem sich kleinste Details im Bewusstsein einprägen können. Wie in einem Zeitlupenfilm werden pro Sekunde mehr Eindrücke als sonst verarbeitet, wodurch sich die Zeit zu dehnen scheint. – Auch in den folgenden Stunden und manchmal Tagen kann das Zeiterleben verändert bleiben. Vergangenheit und Zukunft scheinen abgeschnitten, die Zeit erstreckt sich als „unendliche Gegenwart“. Die Betroffenen wissen nicht mehr, wie viel Zeit seit dem Unfall vergangen ist, wie lange sie schon warten usw. Sie sind wie aus der Zeit gefallen. → Fragen oder Hinweise, die sich auf die Zeit beziehen („Wann sind Sie weggefahren?“, „Das dauert noch 10 Minuten“), helfen bei der Orientierung in der Gegenwart.
Handlungen, Pläne
Im Alltag haben alle Menschen etwas vor: Sie sind unterwegs oder bei Freundinnen, am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin, haben ein paar Stunden frei oder unternehmen etwas mit der Familie, wollen zu einer Besprechung, später noch etwas essen gehen oder zu Hause fernsehen, ein Telefonat führen usw. Alle diese Handlungen und Pläne werden durch einen Notfall unterbrochen und können zunächst nicht wieder aufgenommen werden. Viele Betroffene verhalten sich daher anfangs oft passiv: Sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Sie fühlen sich von ihren Bewältigungsmöglichkeiten abgeschnitten und hilflos. → Die meisten akut Betroffenen sind dankbar, wenn man ihnen klare Anweisungen gibt („Setzen Sie sich dort hin“, „Warten Sie hier“).
Kontrollierbarkeit
Notfälle sind per se Ereignisse, die außer Kontrolle geraten: Schlimme Dinge passieren, ohne dass sie aufgehalten werden können. Viele Betroffene können auch danach die Situation, ihren Körper, ihr Verhalten und ihre Emotionen nur eingeschränkt oder überhaupt nicht kontrollieren (z. B. nicht aufstehen können bei Verletzung oder Schmerzen; nicht entscheiden können, ob man ins Krankenhaus gebracht wird; Kraftlosigkeit, Weinen, Schreien, Apathie, obwohl man das nicht möchte). Kontrollverlust ist für die meisten Menschen sehr unangenehm. Sie versuchen, zumindest irgendeine Form von Kontrolle über die Situation oder über ihre eigenen Reaktionen wiederzugewinnen. → Hilfreich ist, die Betroffenen erste Entscheidungen treffen zu lassen und in die Maßnahmen der Helfenden einzubeziehen bzw. ihre Zustimmung zu den notwendigen Schritten zu gewinnen.
Selbstbild
Ein Notfall kann bewirken, dass man wichtige Aufgaben und Rollenverpflichtungen zumindest vorübergehend nicht mehr erfüllen kann: sich als Mutter um die Kinder kümmern, als Lehrer für die Klasse verantwortlich sein, als Geschäftsführerin entscheidungsfähig sein etc. Hinzu kommen der Verlust von Eigenständigkeit und Situationskontrolle sowie die Ungewissheit über die Folgen der Ereignisse. Auch die eigenen emotionalen Reaktionen erscheinen manchen als anomal und unkontrollierbar („Das bin nicht ich, ich hab’ mich doch im Griff“). Dies alles kann das Selbstbild der Betroffenen nachhaltig erschüttern. Bei vielen stellt sich der Eindruck ein, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Diese Erschütterung des Selbstbildes kann dazu führen, dass jemand die angebotene Hilfe ablehnt („Ich komme schon zurecht“) oder versucht, den Rollenerwartungen entsprechend weiter zu funktionieren, obwohl das momentan nicht möglich ist. Oft wird die erlebte Hilflosigkeit auch als beschämend erlebt. Zuschauerinnen („Gaffer“, „Katastrophentouristen“) oder aufdringliche Journalisten verstärken diesen negativen Effekt. → Das Selbstbild kann durch einfache Aussagen und Aufforderungen angesprochen und bestätigt werden. („Natürlich wollen Sie wissen, in welche Klinik Ihre Tochter gebracht wird. Sobald das geklärt ist, erfahren Sie es als Erste.“)
Weltbild
Manche Ereignisse erschüttern sehr allgemeine Grundannahmen über die Welt und das menschliche Zusammenleben („Wir leben doch in einer sicheren Gegend“, „Wieso hilft denn keiner?“). Bei einigen Betroffenen setzen diesbezügliche Gedanken bereits in der Notfallsituation selbst bzw. in den ersten Stunden danach ein. Der Rückgriff auf vertraute Sicherheiten scheint zu versagen; materielle, soziale und kognitive Ressourcen sind momentan nicht zugänglich. Andere Betroffene finden bald Halt bei positiven Überzeugungen („Jetzt helfen wir alle zusammen“, „Mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen“). Terrorgruppen versuchen mit ihren Angriffen eine Erschütterung des Weltbildes zu erreichen („Ihr seid nirgendwo sicher“). → Aufgrund der Komplexität der Thematik und der starken emotionalen Belastung können solche allgemeinen Gedanken in den ersten Stunden nach dem Notfall nicht diskutiert werden.
Soziale Ordnung
Notfälle setzen oft auch die soziale Ordnung außer Kraft: Pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz wird hinfällig, Unterricht und Schulbetrieb fallen aus, materielle Güter sind rationiert oder werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch das Verhältnis der Menschen zueinander steht manchmal scheinbar auf dem Kopf: Unscheinbare Menschen können zu Helden werden, bisher selbstständige plötzlich auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Notfallsituationen führen zu einer sogenannten asymmetrischen Beziehungskonstellation, d. h. „schwachen“ Menschen wird von „starken“ geholfen. → Wenn möglich, sollte rasch zumindest ein Teil der vertrauten Ordnung wiederhergestellt werden; diese gibt Sicherheit und wirkt psychisch stabilisierend für alle Beteiligten.
1.3 Schock, Gefühle, Gedanken und Verhalten – Die ersten Reaktionen
Der durch einen Notfall ausgelöste individuelle oder kollektive Ausnahmezustand stellt für alle Beteiligten eine erhebliche Stressbelastung dar. Die Verarbeitungs- und Bewältigungsmöglichkeiten der Betroffenen sind mitunter aufs Äußerste gefordert. Je nachdem, ob man als Verletzter, Angehörige, Helferin, Zuseher oder in einer anderen Rolle in das Geschehen verwickelt ist, kann die Belastung sehr unterschiedliche Formen annehmen. Auch die persönlichen Vorerfahrungen und Strategien, mit großen Schwierigkeiten umzugehen, spielen eine wichtige Rolle. Die unmittelbaren Reaktionen können von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein, das Spektrum der Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen ist dabei sehr breit. Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die häufigsten Reaktionsweisen bei Notfällen (erweitert nach Lasogga/Frommberger, 2004).
Schock
Die erste Reaktion von Betroffenen ist oft ein mehr oder weniger stark ausgeprägter Schock. Dieser kann im Normalfall wenige Sekunden bis mehrere Stunden andauern. Körperlich äußert er sich durch Zittern, Schwitzen, schwache Beine, bleierne Glieder, Übelkeit oder Harndrang. Zu den psychischen Schocksymptomen zählen emotionale Taubheit („Ich fühle nichts“), Gedankenblockade („leer im Kopf“), Gedächtnisstörungen und Orientierungslosigkeit („Wo bin ich? Wie komme ich hierher?“). Aber auch heftige und schnell wechselnde Gefühle (Angst, Verzweiflung, Wut), Enthemmung (unkontrolliertes Schreien oder Schimpfen), aggressive Handlungen (Angriffe auf vermeintlich Schuldige) oder demonstrative Ruhe können im Schock auftreten.
Unwirklichkeit
Viele Betroffene haben unmittelbar nach dem Notfall den Eindruck, das Geschehen sei „unwirklich“, „wie in einem Traum“, „wie in einem Film“. Manche sehen die Ereignisse gar „von außen“, „wie durch eine Glaswand“ oder haben den Eindruck, „neben sich zu stehen“. Verstärkt wird dieses Gefühl durch das veränderte Zeiterleben, fehlende Handlungsmuster und veränderte Körperempfindungen. In den meisten Fällen wissen die Betroffenen durchaus, dass die Ereignisse „eigentlich“ wahr und echt sind. Es dauert jedoch einige Zeit (meist Minuten, selten Stunden, in Einzelfällen Tage), bis sie den Eindruck der Unwirklichkeit überwinden können und handlungsfähig werden.
Gefühle
Häufige Gefühle während des Notfalls sind Angst und Unruhe, Wut, Niedergeschlagenheit, Scham, Schuld und Einsamkeit.
■ Ängste können eher diffus sein („Wie wird das weitergehen?“, „Was passiert jetzt mit mir?“) oder sehr konkret (z. B., dass ein Bein amputiert werden muss). Nicht immer sind diese Ängste sachlich begründet.
■ Wut und Aggression können sich gegen andere Notfallbeteiligte (vermeintliche Verursacher), Ersthelfende und Zeuginnen („Tun Sie doch etwas!“) sowie gegen Einsatzkräfte richten (Schimpfen, Vorwürfe).
■ Niedergeschlagenheit bis hin zur Verzweiflung tritt im Akutfall unter anderem dann auf, wenn die aktuelle Situation nicht bewältigbar erscheint oder Betroffene den Eindruck haben, allein gelassen zu werden.
■ Scham entsteht, wenn private oder intime Bereiche offenbar werden (z. B. zerrissene Kleidung, Einsatzkräfte im Schlafzimmer) sowie aufgrund des erschütterten Selbstbildes und der ungewohnten sozialen Situation (Hilfsbedürftigkeit, Zuschauer).
■ Schuldgefühle können auch dann sehr stark sein, wenn kein Verschulden der Betroffenen erkennbar ist.
■ Einsamkeit ergibt sich aus dem Eindruck, dass niemand verstehen kann, was man erlebt hat, und dass keine Hilfe zu erwarten ist oder dass man andere mit den eigenen Problemen nicht belasten darf.
Die emotionale Labilität lässt bei vielen Menschen den Wunsch nach Information sowie überhaupt nach einem Gespräch entstehen. Viele wollen einfach reden und so die innere Spannung und Erregung abbauen. Dieser Wunsch nach einem Zuhörer und einer Gesprächspartnerin ist ein zentraler Ansatzpunkt für notfallpsychologische Interventionen. Wenn Menschen jedoch nicht reden wollen, so ist das als Ausdruck ihrer momentanen Abwehrmechanismen unbedingt zu respektieren (man kann sie trotzdem hilfreich unterstützen).
Gedanken
Die ersten Gedanken der Betroffenen beziehen sich häufig
■ auf den eigenen Körper („Bin ich verletzt?“), wobei die Selbsteinschätzung nicht den objektiven Umständen entsprechen muss. Manche Menschen halten ihre Verletzungen für bedeutungslos, andere befürchten das Schlimmste;
■ auf die Angehörigen („Was ist mit meiner Tochter?“, „Wie benachrichtige ich meine Familie?“);
■ auf materielle Dinge („Wie groß ist der Schaden?“, „Hauptsache, es ist niemand verletzt“);
■ auf die Zukunft („Was wird das für Folgen haben?“).
Viele Menschen sind während eines akuten Notfalls nicht in der Lage, die Situation rational voll zu erfassen und zu verarbeiten. Die Gedanken sind zumeist stark von Gefühlen beeinflusst. Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Verleugnung, Rationalisierung und Regression spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Verhalten
Die Verhaltensweisen in akuten Notfällen sind zumeist ein Abbild des momentanen emotionalen Zustandes. Folgende Reaktionen treten häufig auf:
■ schweigen, apathisch dasitzen
■ reden und viele Fragen stellen
■ heftige Gefühlsäußerungen: Weinen, Schreien, aggressive Ausbrüche
■ äußerliche Gelassenheit (z. B. bei einem Unfallverursacher, der während der Bergungsarbeiten Fotos macht)
■ weggehen, sich verstecken oder verbergen wollen
■ die angebotene Hilfe ablehnen, sich sozial zurückziehen
Ob die ersten Reaktionen zu einer angemessenen Verarbeitung führen, zeigt sich im Einzelfall oft erst nach einiger Zeit.
Als psychologische Grundregel für eine Akutsituation gilt: für Sicherheit sorgen, im Gespräch keine bohrenden Fragen stellen, nicht über Schuld und Verantwortung diskutieren (dafür ist es in der Akutphase zu früh) und bei Verdacht auf unangemessene Verarbeitung die Betroffenen im Auge behalten.
Der manchmal geäußerte Wunsch, „einfach in Ruhe gelassen“ zu werden, ist natürlich – außer bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung – zu respektieren. Aus notfallpsychologischer Sicht ist darin, wie auch in betonter Gelassenheit, den Versuch zu sehen, Haltung zu bewahren, Scham- und Schuldgefühle abzuwehren, Kontrollgefühl und Selbstwert aufrechtzuerhalten etc.
Ein späterer Gefühlsausbruch oder ein allgemeiner Zusammenbruch ist möglich. Darauf sollten die Helfenden und das soziale Umfeld der Betroffenen vorbereitet sein.
1.4 Der gesprengte Bezugsrahmen
Ein Notfall ist ein ungewöhnliches und bedrohliches Ereignis. Es „fällt aus dem Rahmen“. Genauer: Das Notfallereignis liegt zunächst außerhalb des kognitiven und emotionalen Bezugsrahmens. Es erscheint vielen Menschen unfassbar, unverständlich, nicht handhabbar. Bisher für unerschütterlich gehaltene Grundannahmen sind plötzlich bedroht oder scheinen haltlos geworden zu sein (Horowitz, 2011). Der Notfall sprengt die Grenzen des Normalen, er liegt außerhalb.
Abbildung 1 Alltäglicher kognitiver und emotionaler Bezugsrahmen und Notfallereignis
Das Ereignis des Notfalls kann zunächst als völlig unverbunden mit der eigenen Biografie, dem Selbst- und dem Weltbild erlebt werden. Wesent-
liche Grundannahmen über die Welt werden erschüttert (Janoff-Bulman, 2002; Schuler/Boals, 2016):
■ dass man in der eigenen Welt im Wesentlichen sicher ist;
■ dass man schlimme Ereignisse durch kontrollierende Handlungen abwehren oder abschwächen kann;
■ dass wichtige Ereignisse in einem Sinnzusammenhang stehen (persönliche Bedeutung, verstehbare Gründe, Gerechtigkeit);
■ dass auf wichtige Bezugspersonen Verlass ist.
Auch der soziale Bezugsrahmen ist bei vielen Betroffenen gesprengt. Manche haben das Gefühl, dass nur diejenigen sie verstehen können, die das Gleiche erlebt haben wie sie. Das kann einerseits ein Gefühl enger Verbundenheit unter den Betroffenen erzeugen, andererseits ein Gefühl der Entfremdung gegenüber denjenigen, die nicht oder weniger stark von den Ereignissen betroffen wurden. Dies kann in weiterer Folge zu Rückzug und sozialer Isolierung führen (Herman, 2018).
Notfallpsychologische Interventionen setzen früh an, um den erschütterten Bezugsrahmen zu stabilisieren: indem die Betroffenen wieder handlungsfähig werden, soziale Unterstützung aktiviert und die (vorläufige) Sicherheit betont wird – insgesamt also durch direkte, beziehungsvolle Kommunikation.
Die Mehrzahl der Betroffenen kann nach einem Notfall die Ereignisse in das bestehende Weltbild integrieren oder die Grundannahmen über sich selbst und die Welt überprüfen un den neuen Erfahrungen anpassen. Wenn jedoch die Belastungen zu groß sind, das bisherige Weltbild der Betroffenen zerbricht und der Bruch in der Biografie nicht überwunden werden kann, ist die Gefahr einer psychischen Folgestörung groß. In diesen Fällen ist zumeist eine individuelle Weiterbetreuung oder -behandlung notwendig.
Beispiel: Opfer des Bombenkriegs
„Im Sommer 1943, nach dem Feuersturm von Hamburg […] als ein Sonderzug mit Flüchtlingen eintraf, von denen die meisten noch vollkommen außer sich waren, unfähig, irgendeine Auskunft zu geben, mit Stummheit geschlagen oder schluchzend und heulend vor Verzweiflung. Und mehrere der mit diesem Transport aus Hamburg angelangten Frauen […] hatten tatsächlich in ihren Gepäcksstücken ihre toten, im Qualm erstickten oder auf andere Weise während des Angriffs ums Leben gekommenen Kinder dabei. Was aus den mit solcher Fracht geflohenen Müttern geworden ist, ob und wie sie sich wieder in das normale Leben eingewöhnen konnten, wissen wir nicht.“ (Sebald, 2001, S. 94 f.)
1.5 Gruppen von Betroffenen
Ein Notfall stellt für die Betroffenen eine psychische Belastung dar, die je nach den Umständen erheblich, schwer oder auch extrem ausfallen kann. Das gilt für die unmittelbaren Betroffenen des Notfalls ebenso wie für professionelle und freiwillige Helfende, Angehörige und andere indirekt Beteiligte.
Je nachdem, wie stark und in welchen Rollen sie in das traumatische Geschehen involviert sind, unterscheidet man:
1. Primärbetroffene, die vom Ereignis selbst unmittelbar betroffen sind, z. B. Insassen eines Unfallwagens, Verletzte, Opfer von Gewalt und Missbrauch
2. Sekundärbetroffene, die durch das Beobachten des Ereignisses oder durch die geleistete Hilfe traumatisiert werden, z. B. Zeuginnen, Einsatzkräfte, freiwillig Helfende, Klinikpersonal, Psychologen, Therapeutinnen und andere
3. Tertiärbetroffene, die allein durch die Nachricht vom Ereignis traumatisiert werden, z. B. Familienangehörige, Freunde, Nachbarinnen oder Kollegen von Betroffenen
Folgende Personengruppen sind nach Notfällen besonders häufig zu betreuen bzw. brauchen spezifische Hilfe und Unterstützung:
Primärbetroffene
stehen zunächst im Zentrum der Hilfestellung. Verletzte brauchen rasch angemessene medizinische Versorgung. In der Akutphase kann psychosoziale Erste Hilfe eine drohende psychische Dekompensation verhindern. Das entlastet auch die anderen Helfenden vor Ort.
In der Phase der psychischen Stabilisierung befinden sich einige Primärbetroffene in stationärer oder ambulanter Behandlung, wodurch sie für notfallpsychologische Angebote leicht erreichbar sind. Aber auch Leicht- oder Unverletzte brauchen in dieser Phase oft noch psychologische Unterstützung, um das Ereignis innerlich abzuschließen und Folgestörungen zu verhindern. Bei Auftreten einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder anderer psychischer Symptome und Störungen ist individuelle Weiterbehandlung bzw. Traumatherapie notwendig.
Angehörige
geraten durch die Nachricht oder Details des Notfalls und seiner Folgen oft in eine traumatische Krise. Wenn sie zum Ort des Geschehens kommen, können sie zusätzlich eine sekundäre Traumatisierung erleben. Sie brauchen vor Ort und in der Zeit nach dem Notfall vielfältige soziale, oft auch psychologische Unterstützung. Selbst wenn sie es zunächst zurückweisen, profitieren die meisten Angehörigen von einem solchen Angebot. Bei Hinterbliebenen dauert der Prozess der Trauer umso länger an, je enger die Beziehung zum Verstorbenen war. Wenn die Trauer blockiert ist oder nicht abgeschlossen werden kann, sind verschiedene Formen von Weiterbetreuung und Psychotherapie möglich.
Zeuginnen und freiwillige Helfende
werden oft völlig unvorbereitet mit einem Notfall konfrontiert. Durch die fehlende Einbindung in eine Organisation bleiben sie nach Ende des Einsatzes oft ohne weitere psychologische Unterstützung. Aufgrund der mangelnden Erfahrung und Vorbereitung ist bei ihnen die Gefahr einer sekundären Traumatisierung besonders groß. Bei Maßnahmen zur psychologischen Stabilisierung nach Ende des Hilfseinsatzes dürfen diese Personen auf keinen Fall ausgeschlossen oder vergessen werden.
Einsatzkräfte und professionelle Helfende
verfügen über Ausbildung und Erfahrung, unterschätzen jedoch oft die Gefahr einer sekundären Traumatisierung. Kritische Ereignisse, die auch professionelle Verarbeitungsmechanismen überfordern, können Neulinge ebenso treffen wie sehr erfahrene Kollegen. Vor Ort brauchen Einsatzkräfte jedoch nur in seltenen akuten Fällen psychologische Unterstützung. Die meisten profitieren nach Ende des Einsatzes von einem Gespräch zur psychologischen Stabilisierung. Vor allem die oftmalige Konfrontation mit Extremsituationen stellt für die Einsatzkräfte eine erhöhte Gefährdung dar. Es liegt bei den Personal- und Führungsverantwortlichen der verschiedenen Organisationen, diese Gefahr rechtzeitig zu erkennen und geeignete psychologische Maßnahmen für ihre Mitarbeitenden bereitzustellen. Ziel dieser Schritte ist die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit.
Kinder
reagieren je nach Alter und Entwicklungsstand sehr unterschiedlich auf Notfälle und ihre Folgen. Die Bewältigungsmöglichkeiten sind stark von den kognitiv-emotionalen Konzepten beeinflusst, mit denen sich das Kind die Situation zu erklären versucht. Das bezieht sich auf den eigenen Körper, Schmerzen und Behandlungsschritte, auf das veränderte Verhalten der Eltern, Geschwister und anderer Menschen, auf die Umwelt im Allgemeinen sowie auf die vermutlichen Ursachen und die Bedeutung der plötzlichen Veränderungen. Alle notfallpsychologischen Interventionen müssen an den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein. Für psychologische Stabilisierung und Traumatherapie wurden eigene Interventionen speziell für Kinder entwickelt.
Alte Menschen
können durch die komplexen biologischen, kognitiven und sozialen Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, in ihren Bewältigungsmöglichkeiten bei und nach Notfällen eingeschränkt sein. Das betrifft die Wahrnehmung, Einschätzung und Verarbeitung der Situation ebenso wie die psychischen und kommunikativen Funktionen im Allgemeinen. Bei manchen alten Menschen können durch akute Notfälle weit zurückliegende Traumata (z. B. Krieg und Vertreibung) aktualisiert werden. Andererseits haben viele aufgrund ihrer Lebenserfahrung innere Haltungen und existenzielle Einsichten erreicht, die als protektive Faktoren wirken können.
Psychisch Kranke
werden durch Notfälle und traumatische Erlebnisse oft leichter erschüttert als Personen ohne psychische Beeinträchtigung. Mögliche Folgen sind eine Verstärkung bestehender Symptome und Störungen bzw. Rückfälle. Bei akuter Suizidalität steht die Sicherheit der Betroffenen an erster Stelle. Die weitere Vorgangsweise hängt dann von den jeweiligen Umständen und Möglichkeiten ab. Bei psychotischer Symptomatik (Wahnvorstellungen, Halluzinationen etc.) und anderen psychiatrischen Notfällen muss umgehend psychiatrische Betreuung eingeschaltet werden. Bei Suchtkranken und Alkoholisierten steht zunächst die medizinische Behandlung im Vordergrund.
Angehörige anderer Kulturen und Reisende
stehen oft vor dem Problem ungenügender sprachlicher Verständigung mit dem Rettungs- und Betreuungspersonal. Auch kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle, wie z. B. in Bezug auf das besorgte oder fordernde Verhalten der Angehörigen oder die Nähe der Eltern zu ihrem verletzten Kind. Nicht alle Formen von Hilfe werden akzeptiert (z. B. für verletzte oder vergewaltigte Frauen). Auch der Umgang mit Trauer und Schmerz kann je nach kulturellem Hintergrund der Betroffenen sehr unterschiedlich sein (z. B. lautes Weinen und Klagen, fassadenhafte Gefasstheit). Eine Diskussion über religiöse Vorschriften ist in Notfällen absolut kontraproduktiv. Für eine angemessene notfallpsychologische Hilfe sind das Wissen um kulturelle Besonderheiten, Sprachkenntnisse bzw. Dolmetschen sowie eine große Flexibilität in der Anwendung der verfügbaren Mittel notwendig.
Zuschauer und Journalistinnen
werden von den Betroffenen und Helfenden zumeist als Belastung, in manchen Fällen geradezu als Schuldige empfunden. Man kann das Zuschauen unattraktiv machen, Zuschauende in die Hilfsmaßnahmen einbinden oder sie wegschicken. Andererseits können auch Zuschauerinnen und Journalisten sekundär traumatisiert werden, wenn sie mit extremen Aspekten oder Details des Ereignisses konfrontiert werden, die sie nicht verarbeiten können. Aufgrund des Spannungsverhältnisses zu den Betroffenen und Helfenden vor Ort ist eine Betreuung für diese Personen jedoch nur getrennt von den direkt am Geschehen Beteiligten sinnvoll.
1.6 Notfall, Trauma, Krise
Notfall bezeichnet ein Ereignis, Trauma eine mögliche Qualität des Ereignisses, Krise einen möglichen Zustand infolge dieses Ereignisses.
Notfall
Notfälle sind potenziell traumatische Ereignisse, die eine psychische Krise auslösen oder verstärken können.
Ein psychischer Notfall ist ein plötzlich auftretendes, bedrohliches Ereignis, das die psychische Stabilität akut gefährdet. Die individuellen Bewältigungsund Verarbeitungsstrategien werden massiv beansprucht. Ein Notfall kann bei den betroffenen Personen und Gruppen massive Reaktionen auslösen sowie zu gravierenden Folgestörungen führen.
Einsatzkräfte und viele professionelle Helfende – Polizei, Feuerwehr, Notärztinnen, Sanitäter, aber auch Pflegepersonen, Sozialarbeiterinnen, Psychologen etc. – sind quasi berufsmäßig mit Notfällen konfrontiert. Sie verfügen über einen erweiterten Bezugsrahmen, in dem solche Notfallsituationen erwartet und als normal erlebt werden. Einzelne Notfälle können jedoch den erweiterten Bezugsrahmen sprengen und auch für erfahrene Kräfte sehr belastend werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von kritischen Ereignissen (Everly/Mitchell, 2002).
Ein kritisches Ereignis ist ein potenziell traumatisches Ereignis, das über die gewöhnlichen Belastungen im Beruf weit hinausgeht; es liegt jenseits des erweiterten Bezugsrahmens professionell Helfender. Art und Ausmaß des Notfalls überschreiten die „kritische Marke“ der professionellen Bewältigungsund Schutzstrategien der Betroffenen. Das kann auch bei gut ausgebildeten Personen und erfahrenen Einsatzkräften eine erhebliche Stressbelastung und Beeinträchtigung der Handlungs- und Arbeitsfähigkeit bewirken.
Spezielle Eigenschaften kritischer Ereignisse werden in Kap. 8.1 näher beschrieben. Kritische Ereignisse können zu starken negativen Reaktionen und in der Folge zu psychischen Störungen führen. Sie können jedoch auch – bei entsprechenden Bewältigungsmöglichkeiten bzw. psychologischer Stabilisierung – ohne Folgestörungen bleiben (siehe Kap. 8).
Trauma
Notfälle und kritische Ereignisse sind nicht in jedem Fall traumatisch. Sie können auch „nur“ belastend sein, aber bei hinreichenden Ressourcen und mit entsprechender Unterstützung relativ rasch bewältigt und überwunden werden, ohne nachhaltige Schädigung bzw. psychisches Trauma. Ein Trauma hat folgende Qualitäten (nach Fischer/Riedesser, 1998; WHO, 2019):
Ein psychisches Trauma ist ein Ereignis, das als entsetzlich und/oder äußerst bedrohlich erlebt wird, verbunden mit subjektiver Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe gegenüber der Bedrohung. Betroffene sind in ihrem Selbst- und Weltverständnis zutiefst erschüttert und fühlen eine unmittelbare, vitale Diskrepanz zwischen der erlebten Gefahr und den eigenen Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten. Ein traumatisches Ereignis bewirkt eine nachhaltige psychische Verletzung und kann zu einer Reihe von erheblichen bis schweren psychischen Störungen führen.
Wie stark sich ein traumatisches Ereignis auf die Betroffenen auswirkt, hängt vom Ereignis selbst, den unmittelbaren Reaktionen darauf, den Ressourcen und dem Coping der Betroffenen sowie von der weiteren Unterstützung ab (siehe Kap. 2 und 3).
Krise
Das Konzept „psychische/psychosoziale Krise“ ist das historisch älteste der in diesem Abschnitt besprochenen. Es bezieht sich sehr allgemein auf Ereignisse oder Lebensumstände, mit denen Betroffene zunächst nicht zurechtkommen. Eine Krise ist begleitet von Gefühlen der Hilflosigkeit und des Versagens, starker innerer Gespanntheit sowie des Gefühls von Bedrohung und Gefahr. Die Spannung führt häufig zu Angst bis hin zu Panik oder depressiver Verstimmung. Weder wirkungsvolles Handeln noch Rückzug scheinen möglich. Der Selbstwert sinkt, ein psychischer Zusammenbruch ist möglich (Sonneck et al., 2016).
Psychische Krise bedeutet den Verlust des seelischen Gleichgewichts, wenn wichtige Aufgaben, Ereignisse oder Lebensumstände nicht bewältigt werden können. Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Ressourcen reichen zur Bewältigung der neuen Situation nicht mehr aus. Früher erworbene Fähigkeiten und bisher bewährte Hilfsmittel versagen.
Ein Notfall oder ein traumatisches Ereignis können eine Krise auslösen oder erheblich verschärfen. Nach ihren Ursachen unterscheidet man zwei Arten von Krisen:
■Traumatische Krisen werden ausgelöst durch ein plötzlich auftretendes Ereignis, das allgemein als schmerzlich angesehen wird (z. B. Verlust oder Tod eines nahestehenden Menschen, Unfall, plötzliche schwere Krankheit, plötzliche Beendigung einer Partnerschaft, soziale Kränkung, Gewalt und sexueller Missbrauch, Großschadensereignisse und Naturkatastrophen). Traumatische Krisen verlaufen üblicherweise in vier Phasen: Schock-, Reaktions-, Bearbeitungs- und Neuorientierungsphase (Cullberg, 1978).
■Veränderungskrisen ergeben sich, wenn allgemeine Lebensveränderungen größere Umstellungen (sozial, körperlich, psychisch) erfordern, die für die Betroffenen zu schwierig oder zu umfangreich sind, sodass sie nicht bewältigt werden können (z. B. Pubertät, Schwangerschaft, Berufswechsel, Entwicklungsstillstand [„Midlife-Crisis“], chronische Erkrankung, Pensionierung, Konfrontation mit dem eigenen Sterben). Caplan (1964) beschreibt den Verlauf in mehreren Phasen: 1. Konfrontation mit den Veränderungen, 2. Gefühl des Versagens, 3. Mobilisierung aller Ressourcen; dies führt entweder zur Bewältigung oder zu 4. Vollbild der Krise; der Weg aus der Krise verlangt 5. eine lange Bearbeitungsphase und endet mit 6. der Neuanpassung an die veränderten Umstände.
In akuten Krisensituationen können sich die Probleme und Gefahren subjektiv enorm zuspitzen. Die affektive Belastung ist dann sehr hoch und es besteht ein starkes Bedürfnis nach Entlastung. Zu den großen Gefahren, die mit psychischen Krisen verknüpft sind, gehören deshalb Kurzschlusshandlungen (z. B. Kündigung, „alles hinschmeißen“) sowie Gewalt- und Aggressionshandlungen, die möglicherweise nicht mehr umkehrbar sind (Suizid-, Mordversuch). Weitere negative Folgen können Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, Somatisierungen, psychische Erkrankungen sowie eine allgemeine Chronifizierung der Symptome sein.
1.7 Interventionsformen – Krisenintervention und Notfallpsychologie
Konzepte psychologisch-psychiatrischer Krisenintervention existieren seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie bilden den Hintergrund, vor dem sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Notfallpsychologie mit ihren spezifischen Interventionen etabliert hat.
Krisenintervention umfasst alle gezielten Handlungen, die den Betroffenen bei der Bewältigung ihrer psychosozialen Krisen helfen, ihre innere Anspannung verringern und sie dabei unterstützen, ihre Probleme und Aufgaben zu meistern. Dazu zählen emotionale Unterstützung und Gespräche sowie praktische und materielle Hilfeleistungen aller Art. Die Interventionen sind allgemeiner und breiter gefächert als jene der Notfallpsychologie.
Für die einzelnen Phasen von traumatischen Krisen wie für Veränderungskrisen wurden verschiedene Vorgehensweisen formuliert, um den Betroffenen die jeweils notwendige Unterstützung zu bieten („BELLA“System, Sonneck et al., 2016; „BASIS“-Modell, Juen et al., 2012; s. a. Krisengespräch für Pflegeberufe, Hausmann, 2020a).
Die übergeordneten Ziele der Krisenintervention lauten:
■ körperlich: Überleben sichern, Gesundheit erhalten bzw. wiederherstellen
■ emotional: entlasten, Gefühle ausdrücken können, Fassung wiedergewinnen
■ gedanklich: wieder klar denken können, entscheidungsfähig werden, die Ereignisse, ihre Ursachen und Folgen verstehen
■ verhaltensbezogen: wieder handlungsfähig werden, Verhalten und Beziehungen an die veränderte Situation anpassen
■ sozial: die sozialen Systeme (Familie, Schule, Firma) wieder funktionsfähig machen
Krisenintervention ist historisch aus der psychiatrischen Behandlung von Patienten und Patientinnen mit akuter Symptomatik hervorgegangen. Die Versorgung von Kriegstraumatisierten und Katastrophenopfern sowie von suizidalen Menschen stand dabei oft im Vordergrund. Heute gibt es nicht nur multiprofessionelle Kriseninterventionszentren in vielen psychiatrischen Kliniken und psychologische Krisenintervention in Allgemeinspitälern, sondern auch Krisenintervention im Rahmen der Psychotherapie, ambulante Kriseninterventionsteams zur Akutbetreuung, Krisenhotlines, Telefonseelsorge u. v. m. All diese Interventionsformen beziehen sich auf einen krisenhaften psychischen Zustand, der entweder durch ein plötzliches schlimmes Ereignis oder durch sich immer weiter zuspitzende Belastungen verursacht wurde. Das Spektrum der Probleme (und der zur Bewältigung aktivierten Ressourcen) ist diesem allgemeinen Zugang entsprechend sehr breit.
Notfallpsychologie
Die Notfallpsychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten während und nach Notfallsituationen sowie mit der Bewältigung klar umrissener, potenziell traumatischer Ereignisse. Sie definiert sich über einen Anlass, den konkreten Notfall (nicht über seine traumatische Wirkung oder die Krise, die er auslösen kann).
Historisch ist die Notfallpsychologie aus der Krisenintervention bei traumatischen Krisen hervorgegangen. Allgemeine Lebenskrisen (bezüglich Partnerschaft, Familie, Arbeit, Gesundheit, Finanzen u. v. m.) können durch einen Notfall natürlich verstärkt werden. Notfallpsychologische Interventionen konzentrieren sich aber auf die Bewältigung des aktuellen Notfalls und der damit verbundenen Aufgaben.
Notfallpsychologie ist die gezielte Anwendung spezifischer psychologischer Mittel während und nach Notfällen, Katastrophen und potenziell traumatischen Ereignissen. Sie umfasst alle psychologischen Interventionen, die in Bezug darauf nötig sind. Diese reichen von Akuthilfe in den ersten Stunden über psychologische Stabilisierung in den folgenden Tagen bis zur individuellen Weiterbetreuung sowie Schulung und Prävention von besonders gefährdeten Personen und Gruppen
Notfallpsychologische Interventionen sind immer auf ein konkretes Ereignis bezogen. Für verschiedene Personengruppen, Zeitfenster und Settings wurden spezielle Vorgehensweisen entwickelt und klare Handlungsleitfäden für die Intervenierenden ausgearbeitet. Diese sind spezifischer und thematisch begrenzter als die oft eher allgemein formulierten Vorgehensweisen der Krisenintervention. Neben der Hilfe für Betroffene nach einem Notfall ist die systematische Prävention und Schulung von Einsatzkräften und professionellen Helfenden ein wesentliches Element der Notfallpsychologie.
Notfallpsychologie im engeren und weiteren Sinn
Bezüglich des zeitlichen Rahmens notfallpsychologischer Interventionen bestehen unterschiedliche Auffassungen:
■ Notfallpsychologie im engeren Sinn umfasst Präventions-, Interventions- und Nachsorgemaßnahmen, bezogen auf einen relativ kurzen Zeitraum (einige Stunden bis Tage nach dem Ereignis; Lasogga/Gasch, 2011, S. 23).
■Notfallpsychologie im weiteren Sinn umfasst rasch einsetzende Akutinterventionen, psychologische Stabilisierungsmaßnahmen in den Tagen und Wochen nach dem Notfall sowie, falls nötig, individuelle Weiterbetreuung oder Unterstützung bis zum Beginn einer speziellen Trauma-/ Psychotherapie (Hausmann, 2003, 2006).
In den meisten Überblicksarbeiten wird die Notfallpsychologie im engeren Sinn, d. h. für den Zeitraum von wenigen Stunden bis Tagen nach dem Notfall beschrieben. In der Praxis werden jedoch auch darüber hinausgehende Anforderungen und Fragen an die Intervenierenden gestellt. Es ist deshalb für notfallpsychologisch Tätige (und alle anderen in diesem Bereich Beschäftigten) sehr hilfreich, auch über die nachfolgenden Möglichkeiten der Weiterbetreuung bis hin zur Traumatherapie informiert zu sein bzw. sie selbst durchführen zu können.
1.8 Geschichtliche Entwicklung
„Am 23. morgens erschien Napoleon mit seiner Armee auf den Anhöhen von Regensburg. Nach einer heftigen Kanonade drangen die Franzosen durch eine Bresche mit Sturm in die Stadt, und gegen 6 Uhr abends über die Donaubrücke nach Stadtamhof. Die Österreicher zogen sich auf die nahe gelegenen Berge und schossen von da unser sonst so schönes Städtchen in Brand. Ans Löschen war nicht zu denken, weil auf die brennenden Häuser unaufhörlich geschossen wurde. […] Der verursachte Schaden ist unermesslich; die meisten haben nichts als ihr Leben gerettet. Ohne Obdach, ohne Nahrung, mit verzweiflungsvollem Blick in die Zukunft schleichen die Unglücklichen zwischen den rauchenden Trümmern ihrer Häuser und ihres ehemaligen Wohlstandes herum. Gott erfülle die Herzen unserer glücklicheren Nebenmenschen mit Mitleid gegen unser Elend!“ (Anonym, 1810, S. 321 f.)
Traumatische Ereignisse und ihre psychischen Folgen gehören seit jeher zu den Grunderfahrungen der Menschen. Schon die ältesten Texte der Menschheit berichten von Gewalt, Katastrophen und Krieg, schweren seelischen Erschütterungen und schmerzlichen Verlusten (GilgameschEpos, Ilias, Altes Testament; siehe Shay, 1991). Von alters her gibt es auch Versuche, die negativen Folgen psychischer Traumata abzumildern oder auszugleichen. Trauerrituale, mythologische und religiöse Erzählungen, bildnerische und literarische Darstellungen sowie philosophische Reflexionen sind als zentrale kulturelle Leistungen oftmals aus der Konfrontation mit Traumata entstanden. Sie versuchen, deren Ursachen, Verlauf und Folgen zu erklären und zugleich Möglichkeiten aufzuzeigen, angesichts des Schrecklichen weiterzuleben, den Ereignissen einen Sinn zu geben und aus ihnen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit psychischen Traumatisierungen setzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Sie geht einher mit der allgemeinen Entwicklung der Medizin und Psychologie sowie des technischen Fortschritts. So kam es mit der Einführung der Eisenbahn immer wieder zu schweren Unfällen mit einer großen Anzahl von Betroffenen, deren nachfolgende Verhaltensauffälligkeiten zunächst rein organisch erklärt wurden („railroad spine syndrome“; Erichsen, 1867). Auch psychovegetative Störungen bei Soldaten nach Fronteinsätzen galten zunächst als organisch bedingt („soldier’s heart“, „irritable heart“; DaCosta, 1871). Hermann Oppenheim (1889) führte den Begriff der „traumatischen Neurose“ ein und vermutete anatomische Veränderungen des Gehirns als Ursache. Daneben bestand lange Zeit der Verdacht, dass die Betroffenen ihre Symptome nur vortäuschten, um Entschädigungen zu erhalten („Rentenneurose“) oder aus dem Militärdienst entlassen zu werden („Simulant“).
Auf die psychischen Prozesse infolge traumatischer Ereignisse verwiesen als Erste Pierre Briquet (1859), Jean-Martin Charcot (1887) und Pierre Janet (1889). Janet prägte den Begriff der „Dissoziation“, um zu beschreiben, wie Erinnerungen an ein Trauma vom Bewusstsein abgespalten werden und dann vom Unbewussten her psychische und körperliche Symptome hervorrufen können. Er betonte als Erster, dass die Integration des Traumas in das Bewusstsein, also ein rein psychologischer Prozess, für eine Bewältigung traumatischer Erfahrungen notwendig ist, und entwarf ein Phasenmodell der Traumatherapie (Stabilisierung und Symptomreduktion; Modifikation der traumatischen Erfahrung; Integration und Rehabilitation; Janet, 1898).
Sigmund Freud entwickelte diese Ideen in seinem psychoanalytischen Traumakonzept weiter. Dabei verstand er das Trauma zunächst als reales Ereignis, das die bewusste Verarbeitung überfordert und in jedem Fall späteren Neurosen zugrunde liegt (Freud, 1896). Später revidierte Freud diese pauschalisierende Theorie und interpretierte frühkindliche Traumaerinnerungen als Fantasien im Rahmen der psychosexuellen Entwicklung (Freud, 1905). Dies hatte zur Folge, dass die Bedeutung realer Traumatisierungen (z. B. sexueller Missbrauch) zugunsten innerpsychischer Konflikte und inakzeptabler Triebwünsche und -impulse vernachlässigt wurde. Das psychoanalytische Traumakonzept wurde unter anderem von Masud Khan (1963; „kumulatives Trauma“) und John Bowlby (1976; Bindung und frühkindliche Deprivation) entscheidend weiterentwickelt.
Früh waren es Katastrophen, welche die Aufmerksamkeit auf die psychischen Folgen traumatischer Ereignisse lenkten. Zu den ersten systematischen Untersuchungen der Katastrophenpsychologie gehören die Arbeiten von Edward Stierlin (1909), der die psychischen Nachwirkungen eines großen europäischen Minenunglücks im Jahre 1906 untersuchte. Ein weiteres folgenschweres Unglück ereignete sich 1943 in Boston, als bei einem Feuer in einem Nachtclub 492 Menschen ums Leben kamen. Erich Lindeman organisierte zusammen mit Gerald Caplan ein psychosoziales Versorgungsprogramm für die Bevölkerung und untersuchte unter anderem die Trauerprozesse bei den Hinterbliebenen der Opfer (Lindemann, 1944).
Kriegsbedingte Traumatisierungen wurden lange Zeit ignoriert, die psychischen Auswirkungen von Bombardierung, Trommelfeuer, Nahkampf etc. als Simulation abgetan. Während des Ersten Weltkrieges begannen einzelne Militärpsychiater, Soldaten mit „Kriegszittern“, „Grabenneurose“ oder „shell-shock“ psychologisch zu behandeln, was zu teilweise überraschenden Erfolgen führte (Salmon, 1919). Im Zweiten Weltkrieg wurden die psychovegetativen Symptome von Soldaten (Kardiner, 1941) und Zivilistinnen, insbesondere von Kindern, untersucht (Mercer/Despert, 1943; Carey-Trefzer, 1949). Aufgrund dieser Erfahrungen formulierten Kardiner/Spiegel (1947) sowie Artiss (1963) drei zentrale Prinzipien der Krisenintervention: rascher Beginn, räumliche Nähe zum Krisenschauplatz und Aufbau angemessener Erwartungen bei Betroffenen („immediacy“, „proximity“, „expectancy“).
Die Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg und die z. T. gravierenden psychischen und sozialen Auffälligkeiten, die viele amerikanische Soldaten nach ihrer Rückkehr zeigten, lenkten die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Betreuung dieser Personen. Sie trugen wesentlich dazu bei, dass 1980 die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS, engl. PTSD) in das Diagnosemanual (DSM-III) der American Psychiatric Association (APA) aufgenommen wurde. Seit den 1990er-Jahren gehören spezifisch notfallpsychologische Maßnahmen als Teil der Wehrpsychologie in vielen Ländern zum militärischen Standard, mit umfangreichen Erfahrungen bei friedenssichernden Auslandseinsätzen, Katastrophen- und Hilfseinsätzen, aber auch bei Gefechten und Kriegshandlungen (Übersicht in Biesold, 2019; Kreim et al., 2011).
In den 1950er- und 60er-Jahren verstand man unter Psychotraumatologie vor allem die wissenschaftliche Beschäftigung mit den psychischen Folgen von Internierung, Folter und Verfolgung. Zu den schlimmsten Traumata zählen jene Gewaltakte, die den Opfern gezielt und systematisch zugefügt werden. Der Holocaust bildete dabei in seiner ungeheuren Dimension und kalten Systematik einen schrecklichen Höhepunkt. Psychologen, Psychotherapeutinnen und Psychiater versuchten, die Opfer des Nationalsozialismus, aber auch der kommunistischen Regimes und verschiedener Militärdiktaturen in der Aufarbeitung ihrer traumatischen Erfahrungen und in einer Neuorientierung zu unterstützen (Niederland, 1980). Die Therapie von Opfern des Holocaust zeigt, wie lange die Traumatisierung bei vielen Betroffenen nachwirkt. Das betrifft das individuelle Erleben der Überlebenden ebenso wie ihre Partnerschafts- und Familiendynamik und die Nachwirkungen des Traumas auf die zweite und sogar dritte Generation (Freyberger et al., 2019). Neben einem wachsenden Verständnis für die Natur psychischer Traumatisierung und der Entwicklung wirksamer Behandlungsformen konnten auch Erkenntnisse hinsichtlich schützender Faktoren, wichtiger Selbstheilungskräfte und psychischer Stabilität gewonnen werden.
Sexuelle Traumatisierung – vor allem von Frauen und Minderjährigen – sowie Misshandlungen in der Kindheit wurden erstmals von Janet (1889) und Freud (1896) als Ursache für bestimmte Symptome, die man damals unter dem Begriff Hysterie zusammenfasste, diskutiert. Sie warfen damit ein erstes grelles Licht in einen bis dahin praktisch völlig tabuisierten Bereich. Es dauerte noch mehr als 60 Jahre, bis dieser im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer stärker ins Zentrum psychologischer Forschung rückte (Amann/Wipplinger, 2005; Keupp, 2019). Die seelischen und körperlichen Verletzungen sowie die langfristigen psychischen und sozialen Folgen wurden ebenso diskutiert wie die gerichtliche Aufarbeitung der Taten. In oftmals demütigenden Verfahren waren es immer wieder die Opfer, denen ein vermeintliches Defizit zugeschrieben wurde und die belegen sollten, dass ihre körperlichen und psychischen Symptome tatsächlich auf die sexuelle Gewalt der Beschuldigten zurückging und nicht in einer besonderen „Empfindlichkeit“ begründet waren. Die jahrzehntelangen Anstrengungen der Frauenbewegung sowie die einschlägige Forschung haben schließlich den Umgang der Öffentlichkeit und auch der Behörden mit den Betroffenen sexueller Gewalt deutlich verändert.
Die Krisenintervention inklusive der Unterstützung und Behandlung von psychisch traumatisierten Menschen hatte ihren Schwerpunkt zuerst in der Allgemeinmedizin, dann in der Psychiatrie. Zu den frühesten organisierten Versuchen zählt die „National Save-A-Life League“, die ab 1906 in verschiedenen Großstädten der USA entstand mit dem Ziel, die dortige Suizidhäufigkeit zu reduzieren. In Wien wurde 1928 die sogenannte „Lebensmüdenstelle“ gegründet, die ebenfalls suizidprophylaktisch ausgerichtet war. Diese Institution war wiederum das Vorbild für ähnliche Einrichtungen in Ungarn, Deutschland und der Tschechischen Republik. Um 1950 gründete Erwin Ringel in Wien ein interdisziplinär ausgerichtetes „Selbstmordverhütungszentrum“, in dem Menschen nach Suizidversuchen allgemeinmedizinisch und psychiatrisch versorgt wurden. Ähnliche stationäre und ambulante Einrichtungen entstanden in ganz Europa und den USA. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts etablierte sich eine „Regelversorgung“ für Menschen in psychischen Krisen, in der regionale Kriseninterventionszentren mit psychosozialen Diensten kooperieren. Hinzu kamen Psychologen und Psychotherapeutinnen in Akutspitälern und Rehabilitationseinrichtungen, die die psychologisch-psychotherapeutische Betreuung von Patienten und Patientinnen nach Unfällen und anderen traumatischen Ereignissen in zunehmendem Maße übernehmen konnten.
Die Aufnahme der Posttraumatischen Belastungsstörung in die offiziellen Diagnosemanuale (DSM-III 1980, ICD-10 1991) bedeutete die offizielle Anerkennung posttraumatischer Leidenszustände und Symptome als eigenständige psychische Störung. Sie stellt einen Meilenstein in der Geschichte der Psychotraumatologie dar. Der Aufbau von Präventions- und Behandlungseinrichtungen wurde dadurch wesentlich erleichtert. Zugleich untersuchte eine rasch wachsende Zahl an wissenschaftlichen Studien Epidemiologie, Verlauf und Folgen der Störungen, spezifische Risikofaktoren, Hochrisikogruppen und Schutzfaktoren (Teegen, 2003). Die aktuelle Klassifikation des DSM-5 (APA, 2013) fasst verschiedene posttraumatische Störungen (PTSD, Akute Belastungsstörung, Anpassungsstörung) in einer eigenen Kategorie zusammen. In die gründlich überarbeitete ICD-11-Klassifikation (WHO, 2019) wurde u. a. die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung als neue Kategorie aufgenommen.
In den 1990er-Jahren kamen zigtausende Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie aus anderen Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten in die Europäische Union, viele von ihnen durch die Zustände in ihrer Heimat sowie durch die Flucht schwer traumatisiert. Eine Welle der Hilfsbereitschaft erfasste damals die Gemeinschaft der Psychologen (darunter auch den Autor dieses Buches), Psychotherapeutinnen und viele andere, die sich um eine angemessene Unterbringung, Versorgung und Betreuung kümmerten. Heute wird die kontinuierliche psychologisch-psychotherapeutische Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen und Vertriebenen zumeist von speziellen Vereinen geleistet. Die Betreuung leidet jedoch häufig unter den ungesicherten Bedingungen, unter denen sie ablaufen muss. Auch der Umgang einzelner Behördenvertreter mit den Flüchtlingen kann zu massiven Retraumatisierungen führen und monatelange therapeutische Bemühungen in kurzer Zeit zunichtemachen (Ottomeyer, 2001; Nesterko et al., 2019). In der Flüchtlingswelle 2015/16 konnten die damit verbundenen traumatherapeutischen Aufgaben nach anfänglicher Überforderung vielerorts gut bewältigt werden.
Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts stießen bei einer Serie verheerender Unglücksfälle und Terroranschläge die vorhandenen psychologisch-psychiatrischen Einrichtungen und die psychosoziale Regelversorgung an ihre Grenzen. Das Zugunglück von Eschede 1998, bei dem 101 Personen ums Leben kamen, die Lawinenkatastrophe von Galtür 1999 und der Brand der Tunnelbahn von Kaprun 2000, bei dem 155 Menschen starben, zeigten die positiven Wirkungen eines gezielten, systematischen und professionellen notfallpsychologischen Einsatzes. Wie groß der diesbezügliche Bedarf ist, veranschaulichten unter anderem die Terroranschläge in New York und Washington 2001, Madrid 2004 und London 2005 sowie die katastrophalen Überschwemmungen in Mitteleuropa 2002, 2013 und 2021, der Tsunami in Südasien 2004, der Absturz des Germanwings-Airbus 2015 sowie Terroranschläge u. a. in Paris 2015, Berlin 2016 und Wien 2020.
Die Unterstützung und Behandlung von psychisch traumatisierten Menschen hatte ihren Schwerpunkt zuerst in der Allgemeinmedizin, dann in der Psychiatrie. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sie sich weiter in Richtung einer interdisziplinären Krisenintervention. Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer immer weitergehenden Differenzierung und Spezialisierung der Behandlungsmethoden und Interventionen. In den Jahren um 2000 wurden
■ bewährte psychotherapeutische Verfahren zu spezifischen Formen der Traumatherapie weiterentwickelt (Shapiro, 1998; Ehlers, 1999; Fischer, 2000; Reddemann, 2004);
■ Maßnahmen der psychologischen Stabilisierung (nach dem Ereignis, vor Auftreten einer psychischen Störung) zu systematischen Betreuungsprogrammen zusammengefasst (Mitchell/Everly, 2001; Everly/ Mitchell, 2002);
■ eine spezifische Notfallpsychologie formuliert, die sowohl Akuthilfe als auch psychologische Stabilisierung in den Tagen und Wochen nach dem Notfall umfasst (Lassogga/Gasch, 2002; Hausmann, 2003).
Im deutschen Sprachraum erschienen Ende der 1990er-Jahre erste Übersichtsdarstellungen der Psychotraumatologie (Fischer/Riedesser, 1998; Maercker, 1997). Fast zeitgleich wurden verschiedene psychotraumatologische Fachgesellschaften und Sektionen in Berufsverbänden gegründet. Es etablierten sich notfallpsychologische und psychosoziale Akutbetreuungsdienste. In verschiedenen Einsatzorganisationen und Krisenstäben wurde die psychosoziale Betreuung nach traumatischen Ereignissen systematisch auf- und ausgebaut. Diese Entwicklungen waren begleitet von Diskussionen über allgemeine Wirksamkeit, den richtigen Zeitpunkt, korrekte Durchführung und Terminologie der Interventionen und Maßnahmen (siehe Kap. 4.6).
Der gegenwärtige Stand der Notfallpsychologie im deutschsprachigen Raum ist durch eine breite Implementierung notfallpsychologischer Maßnahmen in Organisationen und Betreuungsprogrammen gekennzeichnet. Mobile Krisenintervention, Care-Teams und psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) setzen die entsprechenden Interventionen unmittelbar in Akutfällen ein. Darüber hinaus werden notfallpsychologische Maßnahmen in vielen Institutionen und Organisationen, die mit Notfällen konfrontiert sind, bereitgehalten und angewandt, z. B. in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, psychosozialen Diensten und Einsatzorganisationen, Militär, Schulen, Verkehrsbetrieben, NichtRegierungs-Organisationen u. a. m.
An den Universitäten sind Notfallpsychologie und Psychotraumatologie vielerorts expliziter Lehrinhalt des Psychologiestudiums. Notfallpsychologische Ausbildungen werden auf akademischem Niveau von verschiedenen Berufsverbänden, Weiterbildungsinstituten und Universitäten angeboten. Fachtagungen und jährliche Kongresse zeigen die Vielfalt und das hohe fachliche Niveau des Bereiches.
Der fachliche Austausch zwischen Notfallpsychologie, Psychotherapie, Psychiatrie und psychotraumatologischer Forschung hat in den letzten Jahren erkennbar zugenommen. Allerdings werden in einigen Publikationen die sog. frühen Interventionen noch immer von oben herab behandelt. Die Feldkompetenz der Intervenierenden und zum Teil auch wissenschaftliche Erkenntnisse bleiben damit bei diesen Veröffentlichungen unberücksichtigt. Demgegenüber gilt: Der Blick über die Grenzen des eigenen Fachbereichs hinaus erweitert den theoretischen und/oder praktischen Horizont aller Beteiligten. Das Interesse an fundierten Konzepten und wirksamen Vorgehensweisen, auch wenn man sie nicht selbst entwickelt hat, hilft mehr denn je bei der Präzisierung von Behandlungsmethoden und Interventionsformen.
In der Covid-19-Pandemie ab 2020 traten immer wieder plötzliche bedrohliche und sehr belastende Situationen auf, die Einzelpersonen, Familien, Betriebe und Schulen, Regionen, Berufsgruppen und ganze Gesellschaften betrafen. Obwohl es sich dabei nicht um Notfälle im engeren Sinn handelte, waren Notfallpsychologen vielerorts in die akute Unterstützung von Betroffenen eingebunden. In Krisenstäben und Planungsgruppen konnten sie ihre Expertise u. a. für Katastrophen, Krisenkommunikation und Resilienz einbringen. Der psychosozialen Unterstützung des Personals von Kliniken und Pflegeheimen sowie der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen kam mit dem Andauern der Belastungen immer größere Bedeutung zu. Bestehende notfallpsychologische Systeme, die eigentlich für die Bewältigung kritischer Einzelereignisse am Arbeitsplatz eingerichtet waren, wurden für verschiedene pandemiebedingte Stressoren adaptiert (siehe Kap. 11.10).
2 Psychotrauma
Psychotraumatologie beschäftigt sich mit traumatischen Ereignissen und ihren Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Einzelpersonen, Gruppen und sozialen Systemen sowie mit der Diagnostik, Behandlung und Prävention von Traumafolgestörungen.
2.1 Traumatische Ereignisse
Ein Trauma ist allgemein die Verletzung und nachhaltige Schädigung einer bestehenden Struktur. Das betrifft den körperlichen Bereich (z. B. Schädel-Hirn-Trauma, Polytrauma) ebenso wie den psychischen. Die Art des Ereignisses und die näheren Umstände spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Personen, die davon betroffen sind, und die Folgen, die daraus auf den verschiedensten Ebenen (psychisch, körperlich, sozial, finanziell usw.) entstehen.
Traumatische Ereignisse sind zumeist plötzlich auftretende Umstände oder Situationen, die auf die Betroffenen sehr bedrohlich wirken und akute traumatische Reaktionen sowie längerfristige psychische Symptome und Störungen verursachen können. Zwischen der intensiv erlebten Bedrohung und den subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten besteht ein „vitales Diskrepanzerlebnis“, das mit Gefühlen der Hilflosigkeit und schutzlosen Preisgabe einhergeht und so zu einer dauerhaften Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis führt (Fischer/Riedesser, 1998, S. 79). Ereignisse sind nicht „von sich aus“ traumatisch, sondern haben ein „traumatisierendes Potenzial“, das für verschiedene Menschen sehr unterschiedliche Folgen nach sich ziehen kann. Der Zusammenhang zwischen realem Ereignis, psychischer Disposition und weiteren Einflussvariablen entscheidet, ob eine Traumatisierung erfolgt, wie schwer sie ausfällt und wie stark die Folgen sind.
Die diagnostischen Kriterien für ein traumatisches Ereignis wurden in den verschiedenen Klassifikationssystemen psychischer Störungen ähnlich, aber nicht einheitlich definiert.
■ Das DSM-IV spricht von der Konfrontation mit Ereignissen, die Tod, Lebensgefahr oder starke Körperverletzung mit sich brachten, oder durch welche die eigene körperliche Unversehrtheit bzw. jene anderer Personen bedroht war. Hinzu kommen Gefühle von intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen (APA, 1994).
■ Das DSM-5 differenziert genauer die Art, wie Betroffene das traumatische Ereignis erleben: die Konfrontation mit Tod oder Lebensbedrohung, ernsthaften Verletzungen oder sexueller Gewalt (jeweils tatsächlich oder angedroht) erfolgt 1. direkt und persönlich, 2. als Zeuge, wie das Ereignis anderen zustößt, 3. indirekt, indem man erfährt, dass ein traumatisches Ereignis Verwandten oder engen Freundinnen zugestoßen ist, oder 4. durch wiederholte oder extreme Konfrontation mit aversiven Details des traumatischen Ereignisses, zumeist im Rahmen der Berufsausübung (APA, 2013).
■ ICD-10 definiert ein traumatisches Ereignis als „ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ (Dilling et al., 2013, S. 169). Die auftretenden Störungen sind die direkte Folge einer akuten schweren Belastung oder eines fortgesetzten traumatischen Geschehens und nicht durch eine besondere Verletzbarkeit des Individuums zu erklären. Ohne die Einwirkung des Traumas wären die Störungen nicht entstanden.
■ ICD-11 definiert ein Trauma als Ereignis oder Serie von Ereignissen von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß (WHO, 2019). Eine negative subjektive Reaktion („tiefe Verzweiflung“ nach ICD-10) ist nun kein Kriterium mehr; dies entspricht den häufigen Verhältnissen z. B. bei Betroffenen lang andauernder Gewalt, Kindern und Jugendlichen sowie trainierten Einsatzkräften.
Die Definition traumatischer Ereignisse ist insofern wichtig, als die jeweiligen Kriterien die Basis verschiedener epidemiologischer Studien bilden. Je nachdem, ob strengere oder weiter gefasste Kriterien verwendet werden, ergeben sich unterschiedliche Traumatisierungs- und Störungshäufigkeiten (Stein et al., 2014). Das wiederum hat Auswirkungen auf die Diskussion, wie groß der psychologische Handlungsbedarf nach Traumatisierung ist, sowie auf die Bewertung der Effektivität von Präventionsmaßnahmen und Interventionen.
Die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal im Leben ein Trauma zu erleben, ist regional und national unterschiedlich hoch. In einem weltweiten Ländervergleich der WHO (Koenen et al., 2017) lag die allgemeine Lebenszeitprävalenz traumatischer Erfahrungen bei 70 % (mit einer PTBS-Lebenszeitprävalenz von 3,9 % der Gesamtpopulation, mit jeweils höheren Raten in entwickelten Industrieländern). Bei rund 3.200 älteren Deutschen (Spitzer et al., 2008) wurde eine Trauma-Lebenszeitprävalenz von 53,2 % bei Männern und 56 % bei Frauen festgestellt. In einem repräsentativen Sample von 6.800 Schweizer Schülern der 9. Schulstufe fanden Landolt et al. (2013) eine Traumahäufigkeit von rund 56 %, wobei sozioökonomische Faktoren die Traumawahrscheinlichkeit signifikant beeinflussten (keine Schweizer Nationalität, Getrenntleben von mindestens einem biologischen Elternteil, geringe Bildung der Eltern). Besonders exponierte Berufsgruppen (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Militär, Intensivpersonal) haben eine Traumaexposition von bis zu 100 % (Übersicht in Teegen, 2003; Ehlert/Brönnimann, 2019).
Generell als besonders gravierend erwiesen sich willentlich durch andere Menschen verursachte Traumata wie kriminelle bzw. körperliche Gewalt, Vergewaltigung, Misshandlungen und sexueller Missbrauch in der Kindheit, Geiselnahme, Krieg, Folter und Terroranschläge (Santiago et al., 2013).
2.2 Verlauf der Traumatisierung
Fischer und Riedesser (1998) entwerfen ein Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung, das die unterschiedlichen Aspekte, die mit traumatischen Ereignissen, ihrer Verarbeitung und Bewältigung verknüpft sind, zusammenfasst:
Abbildung 2 Verlauf der psychischen Traumatisierung(vereinfacht nach Fischer/Riedesser, 1998, S. 121)
Traumatisches Ereignis
Das traumatische Ereignis ist gekennzeichnet durch seine Intensität (Schweregrad des Traumas), spezifische Traumafaktoren (z. B. Häufung traumatischer Ereignisse oder Umstände, direkte versus indirekte Betroffenheit, Verursachung und Schuld, Verhältnis zwischen Schuldigen und Opfer), die Konstellation der Faktoren (was spielt in der konkreten Situation eine besondere Rolle) sowie traumatische Inhalte (das „Thema“ der traumatischen Situation, z. B. Lebensgefahr, sexuelle Integrität, symbolische Bedeutung eines bedrohten Bereiches u. a. m.).
Traumatisches Erleben
Wie das Trauma erlebt wird, hängt vom aktuellen Zustand der Betroffenen ab (psychische und körperliche Fitness, aktuelle Belastungen etc.) sowie von der überdauernden Disposition (Einstellungen, Persönlichkeit, Vorerfahrungen, Wissen etc.). Verschiedene Schutz- und Risikofaktoren wirken als Mediatoren, die die Wirkung der traumatischen Situation abfedern oder auch verstärken können.
Traumatisches Ereignis und Traumaerleben beeinflussen einander. Je nachdem, welche Aspekte der Situation wahrgenommen werden, kann diese mehr oder weniger bedrohlich wirken. Das Verhalten der Betroffenen kann wiederum bis zu einem gewissen Grad die Situation mitbestimmen (z. B. bleiben oder weglaufen, erdulden oder sich wehren).
Kurzzeitfolgen
Die direkten Auswirkungen des Traumas lassen sich in Kurz- und Langzeitfolgen unterteilen. Zu den Kurzzeitfolgen zählen die unmittelbare Notfallreaktion, akute psychische Symptome und erste unmittelbare Bewältigungsversuche in den ersten Tagen und Wochen nach dem Ereignis.
Korrektive Faktoren
Die akuten Folgen des Traumas können durch verschiedene korrektive Faktoren abgemildert werden. Zu diesen Faktoren zählen körperliche Erholung, angemessene Copingstrategien, bewusste Erinnerung an das Ereignis, Aufarbeiten der subjektiven Bedeutung, erweiterte Kompensation (veränderte Lebensführung) etc. Sie wirken auch der Entstehung von Langzeitfolgen entgegen.
Langzeitfolgen
Typische Langzeitfolgen sind chronische psychische und körperliche Symptome und Störungen, Entstehung dauerhafter Defizite, aber auch verzögerter Symptombeginn sowie halb- oder unbewusste Wiederholungen der traumatischen Situation.
Weitere indirekte Folgen
Erlittene Traumatisierungen haben immer auch indirekte Folgen für die Betroffenen und ihr Umfeld. Das Traumaerleben kann andere (bestehende oder später auftretende) Belastungen verstärken, in Schlüsselsituationen aktualisiert werden und gravierende soziale Folgen haben (in Familie, Arbeit und Freundeskreis). In manchen Familien wird ein erlittenes Trauma an die nächste Generation weitergegeben („Opferkinder – Täterkinder“).
Typ-I- und Typ-II-Traumatisierung
Terr (1995) unterscheidet je nach Dauer des Ereignisses zwei Typen von Traumatisierung:
■Traumatisierung Typ I erfolgt durch ein einzelnes, meist plötzliches Ereignis von kurzer Dauer mit klarem Beginn und Ende. Dazu zählen z. B. Unfall, Vergewaltigung, Überfall, Naturkatastrophe, technische Katastrophe, Schusswechsel u. a. Das Ereignis prägt sich oft in allen Details in das Gedächtnis der Betroffenen ein. Die psychischen Folgen sind gravierend und können akut oder zeitversetzt zu Störungen führen.
■Traumatisierung Typ II entsteht durch mehrmalige, sich wiederholende oder andauernde Traumata. Das ist z. B. der Fall bei wiederkehrender Konfrontation mit Extremsituationen im Dienst (Feuerwehr, Exekutive, Rettung etc.), im Krieg, bei wiederholter körperlicher oder sexueller Gewalt, fortgesetztem Missbrauch, Geiselnahme u. a. Dabei treten nach und nach Anpassungsprozesse auf, d. h. Versuche, die traumatische Situation gedanklich, emotional oder auf der Verhaltensebene irgendwie erträglicher zu machen.