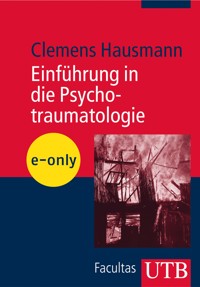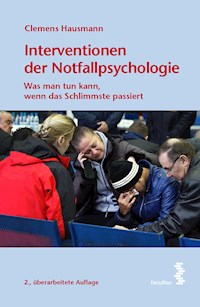28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Psychologie und Kommunikation sind zwei wesentliche Grundpfeiler der Gesundheits- und Krankenpflege. Dieses Buch gibt einen fundierten und praxisnahen Überblick über alle wichtigen Bereiche: Grundlagen der Psychologie, die psychische Seite von Krankheit und Behinderung, Kommunikation und Gesprächsführung sowie Stressmanagement und Psychohygiene. Ver-schiedene typische und/oder schwierige Konstellationen des Pflegealltags wie Chronische Krankheiten, Psychoonkologie, Psychotrauma, Behinderung, psychosoziale Unterstützung, Kommunikation in Krisen- und Notfallsituationen, Umgang mit aggressiven Patienten, Konfliktmanagement sowie Mobbing und Burnout finden spezielle Berücksichtigung und werden in eigenen Kapiteln behandelt. Zahlreiche Beispiele und konkrete Hinweise für den Umgang mit heiklen Situationen machen dieses Buch zu einem zuverläs-sigen Begleiter in Ausbildung und beruflicher Praxis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Ähnliche
Clemens Hausmann
Psychologie und Kommunikation für Pflegeberufe
Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis
4., überarbeitete und erweiterte Auflage
Anschrift des Verfassers:Dr. Clemens HausmannKardinal Schwarzenberg AkademieBaderstraße 10A-5620 Schwarzach/PongauÖsterreich
E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen unter: www.clemens-hausmann.at
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung des Autors oder des Verlages ist ausgeschlossen.Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
4. Auflage 2019Copyright © 2005 Facultas Verlags- und Buchhandels AGFacultas Verlag, Stolberggasse 26, 1050 Wien, ÖsterreichLektorat: Katharina Schindl, WienUmschlagfoto: © Jacob Wackerhausen, istockphoto.comSatz: Wandl Multimedia-AgenturDruck: finidrPrinted in the EUeISBN 978-3-99111-025-5ISBN 978-3-7089-1871-6
Vorwort
Das vorliegende Buch behandelt jene Bereiche der Psychologie und Kommunikation, die für die Pflege von zentraler Bedeutung sind. Es ist gleichermaßen für die Ausbildung wie für die Praxis gedacht.
Als Lehrbuch orientiert es sich an den österreichischen Curricula für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege (Bachelor-Studium, Diplomausbildung, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz). Der Schwerpunkt liegt auf psychologischem Wissen und kommunikativen Fähigkeiten, die wissenschaftlich fundiert in ihrer praktischen Umsetzung dargestellt werden.
Als Handbuch für die Praxis enthält es konkrete Hinweise, Anregungen und Tipps für situationsgerechtes und psychologisch richtiges Handeln in den unterschiedlichsten pflegerischen Situationen.
Das Buch gliedert sich in vier Teile:
• Im ersten Teil werden die Grundlagen der Psychologie dargestellt, die für das Verständnis und die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen wichtig sind. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen den unmittelbaren Bezug zur pflegerischen Praxis.
• Der zweite Teil beschreibt die psychologische Seite von Krankheit und Behinderung. Die psychosoziale Unterstützung der Patienten und Bewohner bildet einen besonderen Schwerpunkt.
• Im dritten Teil wird die pflegerische Kommunikation in ihren vielfältigen Möglichkeiten besprochen. Spezielle Kapitel zu Aggression, Krisen, Notfällen, Konflikten und Mobbing vertiefen die Darstellung. Auf das wichtige Thema Praxisanleitung wird besonders eingegangen.
• Der vierte Teil widmet sich der Psychohygiene, die entscheidend für langfristige Berufszufriedenheit und psychische Stabilität ist. Stressmanagement, Helfer- und Burnout-Syndrom werden ebenso besprochen wie berufsbedingte Traumatisierungen und die Möglichkeiten des professionellen Umgangs mit beruflichen Belastungen.
Die dargestellten Theorien und Maßnahmen basieren auf dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrung (im Sinne von best practice und evidence based care). Personenbezogene Ausdrücke umfassen stets beide Geschlechter.
Für die 4. Auflage wurde der Text durchgehend aktualisiert sowie in vielen Abschnitten erweitert, insbesondere bezüglich neurobiologischer Grundlagen des Erlebens und Verhaltens, Entwicklungsaufgaben, Trauma und Notfall, Mobbinghandlungen und KIMA.
Clemens Hausmann, im Sommer 2019
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil IGrundlagen der Psychologie
1 Psychologie als Wissenschaft
1.1 Gegenstand und Fragestellungen der Psychologie
1.2 Der Beitrag der Psychologie zur Pflege
1.3 Psychologe – Psychiater – Psychotherapeut
1.4 Zusammenfassung
2 Neurobiologische Grundlagen des Erlebens und Verhaltens
2.1 Signalübertragung zwischen Nervenzellen
2.2 Großhirnrinde und limbisches System
2.3 Neuromodulatoren
2.4 Zusammenfassung
3 Andere Menschen wahrnehmen
3.1 Der Wahrnehmungsprozess
3.2 Eigenschaften der Wahrnehmung
3.3 Beeinflussung der Wahrnehmung
3.4 Soziale Wahrnehmung
3.5 Zusammenfassung
4 Gefühle – Die Farben des Seelenlebens
4.1 Gefühle als Reaktionen
4.2 Gefühle im Zusammenhang mit Krankheit
4.3 Urvertrauen und Selbstwertgefühl
4.4 Zusammenfassung
5 Was wir wirklich wollen – Bedürfnisse und Motivation
5.1 Die Bedürfnispyramide nach Maslow
5.2 Bedürfnisse bei Krankheit
5.3 Emotionale Bedürfnisse
5.4 Motivation
5.5 Reaktanz
5.6 Erlernte Hilflosigkeit
5.7 Zusammenfassung
6 Die Macht der Gedanken
6.1 Erwartungen, sich selbst erfüllende Prophezeiungen
6.2 Der Placebo-Effekt
6.3 Einstellungen zur Krankheit
6.4 Attributionen
6.5 Zusammenfassung
7 Lernen und Erinnern
7.1 Im Gedächtnis abspeichern
7.2 Nachahmen (Lernen am Modell)
7.3 Lernen durch Verstärkung
7.4 Klassisches Konditionieren
7.5 Generalisierung
7.6 Lerntipps
7.7 Tipps für die Prüfung
7.8 Zusammenfassung
8 Der Einfluss des Unbewussten
8.1 Veränderte Bewusstseinszustände
8.2 Das Unbewusste
8.3 Wirkungen des Unbewussten
8.4 Abwehrmechanismen
8.5 Zusammenfassung
9 Der Mensch als soziales Wesen
9.1 Soziales Handeln
9.2 Normen und Werte
9.3 Rolle und Rollenkonflikt
9.4 Krankenrolle – Patientenrolle
9.5 Zusammenfassung
10 Die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne
10.1 Entwicklungsaufgaben
10.2 Geburt und Bindungsverhalten
10.3 Kinder im Krankenhaus
10.4 Jugend und frühes Erwachsenenalter
10.5 Kritische Lebensereignisse und Entwicklungsregulation
10.6 Entwicklung im Alter
10.7 Zusammenfassung
Teil IIKrankheit und Behinderung
11 Krankheitserleben – Krankheitsverhalten
11.1 Das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit
11.2 Subjektive Krankheitstheorie des Patienten
11.3 Kognitive Dissonanz
11.4 Gesundheits- und Krankheitsverhalten
11.5 Gendermedizin
11.6 Zusammenfassung
12 Phasen des Krankheitsverlaufs aus psychologischer Sicht
12.1 Krankheitsbeginn
12.2 Diagnosestellung
12.3 Behandlungsphase
12.4 Rekonvaleszenz und Rehabilitation
12.5 Chronische Beschwerden und Krankheiten
12.6 Terminale Phase
12.7 Zusammenfassung
13 Krankheitsbewältigung
13.1 Psychische Belastungen durch Krankheit
13.2 Coping
13.3 Angemessenes Coping und Compliance
13.4 Resilienz und Ressourcen der Krankheitsbewältigung
13.5 Kohärenzerleben
13.6 Zusammenfassung
14 Beispiel: Chronische Krankheiten
14.1 Merkmale chronischer Krankheiten
14.2 Spezifische Belastungen und emotionale Folgen
14.3 Verleugnung und Krankheitsverhalten
14.4 Krankheitsbewältigung bei chronischen Krankheiten
14.5 Psychosoziale Unterstützung durch Pflegepersonen
14.6 Schmerz
14.7 Zusammenfassung
15 Beispiel: Psychoonkologie
15.1 Krankheitserleben bei Krebs
15.2 Krankheitsbewältigung bei Krebs
15.3 Psychoonkologische Betreuung
15.4 Psychoonkologie und Pflege
15.5 Das onkologische Team
15.6 Zusammenfassung
16 Beispiel: Psychotraumatologie
16.1 Psychische Traumatisierung
16.2 Psychische Traumafolgen und körperliche Störungen
16.3 Opfer von Verkehrsunfällen
16.4 Psychologische Stabilisierung
16.5 Psychosoziale Aufgaben von Pflegepersonen bei Traumapatienten
16.6 Unterstützung von Angehörigen nach einem Notfall
16.7 Kinder als Angehörige
16.8 Zusammenfassung
17 Psychologische Beratung und Behandlung
17.1 Was ist psychologische Behandlung?
17.2 Behandlungsschwerpunkte und Methoden
17.3 Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung
17.4 Krisenintervention
17.5 Behandlung psychischer Störungen
17.6 Aufgaben der Pflegepersonen – Vermittlung psychologischer Unterstützung
17.7 Zusammenfassung
18 Psychosoziale Unterstützung
18.1 Die Bedeutung psychosozialer Unterstützung
18.2 Unterstützung durch Angehörige
18.3 Unterstützung durch Ärzte
18.4 Unterstützung durch Pflegepersonen
18.5 Unterstützung durch Psychologen
18.6 Seelsorger
18.7 Sozialarbeiter
18.8 Selbsthilfegruppen
18.9 Regression vermeiden
18.10 Zusammenfassung
19 Körperliche Behinderungen
19.1 Funktionale Gesundheit und Behinderung
19.2 Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen
19.3 Beeinträchtigung von Aktivitäten und Teilhabe
19.4 Einfluss von Umweltfaktoren
19.5 Individuelle Bewältigung
19.6 Rehabilitation
19.7 Zusammenfassung
20 Geistige Behinderung
20.1 Formen und Ursachen geistiger Behinderung
20.2 Verhaltensauffälligkeiten
20.3 Betreuungseinrichtungen
20.4 Soziale Integration, Empowerment und Inklusion
20.5 Unterstützung der Angehörigen
20.6 Zusammenfassung
Teil IIIKommunikation in der Praxis
21 Grundlagen der Kommunikation
21.1 Kommunikation und Pflege
21.2 Verbal und nonverbal kommunizieren
21.3 Einflussfaktoren
21.4 Sachebene – Beziehungsebene
21.5 Die vier Seiten einer Nachricht
21.6 Zusammenfassung
22 Gesprächsführung
22.1 Gespräche als Pflegehandlung
22.2 Basiskompetenzen
22.3 Techniken der Gesprächsführung
22.4 Zusammenfassung
23 Spezielle Gesprächssituationen
23.1 Fragen stellen
23.2 Informieren
23.3 Motivieren
23.4 Beraten, Feedback geben
23.5 Am Telefon
23.6 Zusammenfassung
24 Spannungsgeladene Situationen
24.1 Es gibt keine „schwierigen“ Patienten
24.2 Verschiedene Sichtweisen – handlungsfähig bleiben
24.3 Selbstsicher auftreten
24.4 Ungerechtfertige Vorwürfe und Anschuldigungen
24.5 Aggressive Patienten
24.6 Sexuelle Belästigung
24.7 Neun Fallen im Gespräch
24.8 Zusammenfassung
25 Umgang mit Krisen
25.1 Arten von Krisen
25.2 Krisenanzeichen bei Patienten und Heimbewohnern
25.3 Krisenbewältigung
25.4 Krisengespräch
25.5 Suizidale Krise
25.6 Zusammenfassung
26 Kommunikation in Notfallsituationen
26.1 Notfall als psychischer Ausnahmezustand
26.2 Zeitliche Gliederung der Hilfe nach Notfällen
26.3 Ebenen der psychosozialen Notfallhilfe – Die Rolle von Pflegepersonen
26.4 Psychosoziale Akuthilfe – Grundregeln und erste Schritte
26.5 Suggestionen
26.6 Ablehnen der angebotenen Hilfe
26.7 Tipps für Angehörige und Freunde
26.8 Zusammenfassung
27 Konflikte im Team
27.1 Entstehung von Konflikten
27.2 Konfliktscheu – Streitlust
27.3 Konfliktfähig sein
27.4 Kooperation
27.5 Mögliche Lösungen
27.6 Eskalation eines Konflikts
27.7 Ein klärendes Gespräch führen
27.8 Zusammenfassung
28 Mobbing
28.1 Mobbing in Gesundheitsberufen
28.2 Ursachen und Folgen
28.3 Der Verlauf von Mobbing
28.4 Mobbinghandlungen
28.5 Mobbingabwehr
28.6 Selbstbehauptung
28.7 Betroffenen Kollegen helfen
28.8 Führungsverhalten, Mobbingprävention
28.9 Zusammenfassung
29 Praxisanleitung
29.1 Aufgaben und Rahmenbedingungen der Praxisanleitung
29.2 Die ersten Tage
29.3 Feedback
29.4 Gespräch bei geringer Motivation
29.5 Zwischengespräch
29.6 Kritikgespräch
29.7 Beurteilung
29.8 Zusammenfassung
Teil IVAuf sich selber achten – Psychohygiene
30 Umgang mit beruflichen Belastungen
30.1 Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit
30.2 Die Grenzen der Belastbarkeit
30.3 Stress und seine Folgen
30.4 Stressmanagement
30.5 Schutzfaktoren und persönliche Ressourcen
30.6 Selbst das innere Gleichgewicht wahren
30.7 Zusammenfassung
31 Wenn es zu viel wird: Helfer- und Burnout-Syndrom
31.1 Angemessene Hilfe und Helfersyndrom
31.2 Burnout in helfenden Berufen
31.3 Ursachen und Risikofaktoren
31.4 Der Verlauf des Burnout-Syndroms
31.5 Maßnahmen gegen das Burnout-Syndrom
31.6 Burnout-Prävention
31.7 Das große Ganze: Beschleunigung, Entfremdung und Resonanz
31.8 Zusammenfassung
32 Professionelle Hilfe
32.1 Wann ist professionelle Hilfe notwendig?
32.2 Supervision
32.3 Coaching
32.4 Psychologische Stabilisierung nach kritischen Ereignissen – KIMA
32.5 Mediation
32.6 Zusammenfassung
Literatur
Index
Teil I
Grundlagen der Psychologie
1 Psychologie als Wissenschaft
Psychologie ist eine wesentliche Grundlage der Gesundheits- und Krankenpflege. Im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen unterstützt sie das Erkennen der psychischen Situation von Patienten, Heimbewohnern und Angehörigen. Sie ermöglicht das tiefergehende Verstehen von Einstellungen, Verhaltensweisen und Reaktionen. Damit bildet sie die Grundlage für angemessenes Handeln auch in psychologisch heiklen Situationen.
1.1 Gegenstand und Fragestellungen der Psychologie
Die Psychologie behandelt Fragen, die uns Menschen von alters her bewegen: Was sind Gefühle und woher kommen sie? Welchen Einfluss haben unsere Gedanken und Erwartungen auf unser Leben? Warum bleiben manche Menschen unter Stress psychisch stabil und andere nicht? Warum verhalten wir uns in Gruppen manchmal anders, als wenn wir allein sind? Was bestimmt unsere seelische Entwicklung im Laufe der Jahre? Was genau sind psychische Störungen, und wie kann man sie behandeln?
In früheren Jahrhunderten galt Psychologie als „Lehre von der Seele“. Allerdings vermochte man die menschliche Seele weder näher zu definieren noch wissenschaftlich klar zu umschreiben. Der Begriff bezeichnet etwas „Inneres“ – zum Beispiel Gedanken und Gefühle -, das sich von körperlichen Prozessen unterscheidet, andererseits mit diesen auch eng verknüpft ist. Theologen spekulierten über die Bedingungen ihrer Unsterblichkeit, während Materialisten sie als eine Art Begleiterscheinung der „Körper-Maschine“ ansahen. Die jahrhundertelange Diskussion über Art und Beschaffenheit der Seele brachte letztlich kein befriedigendes Ergebnis (Lück/Guski-Leinwand 2014).
Die moderne Psychologie wird über ihren Gegenstandsbereich definiert):
Psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten.
Zum Erleben gehören Wahrnehmung, Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, Bedürfnisse, Erwartungen, die Inhalte des Bewusstseins und des Unbewussten.
Das Verhalten umfasst alle unsere Handlungen und Reaktionen – alles, was wir bewusst oder unbewusst tun, einzeln oder in der Gruppe, sowie alle Arten von verbaler und nonverbaler Kommunikation, d. h. alles, was wir der Umwelt mitteilen und wie wir das tun.
Direkt zugänglich ist uns dabei nur das eigene Erleben. Das Erleben anderer Menschen kann aber durch Beobachtung und begründete Vermutung erschlossen werden. Wie sich z. B. jemand fühlt, ob er sich freut oder traurig ist, können wir aufgrund des Gesichtsausdrucks, der Körperhaltung und Gestik usw. durchaus erschließen. Wie genau die Freude oder Traurigkeit aber beschaffen ist, welche spezielle und individuelle Tönung sie für die Person aufweist, wissen wir von außen nicht. Darüber kann nur die erlebende Person selbst Auskunft geben.
Die Psychologie ist eine grundsätzlich empirische Wissenschaft, d. h. ihre Erkenntnisse und Theorien werden auf der Grundlage überprüfbarer Tatsachen (empirischer Daten) gewonnen und formuliert. Ihre Ziele sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens sowie, im Rahmen psychologischer Behandlung, deren Veränderung zur Verbesserung der Lebensqualität.
Beispiel
Frau R. ist 67 Jahre alt, Pensionistin, seit 6 Jahren Witwe und kinderlos. Sie wird wegen eines Darmverschlusses stationär aufgenommen und soll in zwei Tagen operiert werden. Auf die Pflegepersonen und den behandelnden Arzt wirkt sie „misstrauisch“ und „verschlossen“.
Beschreibung des Verhaltens:
Obwohl sie völlig mobil ist, hält sich Frau R. den ganzen Tag in ihrem Zimmer auf. Von sich aus beginnt sie kein Gespräch, weder mit dem Krankenhauspersonal noch mit den Mitpatienten. Wenn sie angesprochen oder etwas gefragt wird, antwortet sie knapp und kurz angebunden. Dabei fixiert sie ihr Gegenüber mit ihrem Blick. Als sie einmal von einer Nichte besucht wird, spricht sie mit ihr leise und hastig, aber so, dass niemand anderer das Gespräch mitverfolgen kann.
Erklärung:
Frau R. lebt seit dem Tod ihres Mannes allein und hält außer zu einigen Verwandten keine sozialen Kontakte. Die vielen verschiedenen Menschen im Krankenhaus stellen für sie eine erhebliche Belastung dar, auf die sie mit Rückzug reagiert. Darüber hinaus ist ihr Mann vor 6 Jahren in ebendiesem Krankenhaus an Krebs gestorben. Die Erinnerungen an die Ärzte und das Pflegepersonal, die ihrem sterbenden Mann nicht mehr helfen konnten, sind noch immer schlimm für sie. Zugleich hat sie insgeheim Angst, dass es ihr nun selber so ergehen könnte wie ihrem Mann.
Vorhersage und Veränderung:
An die vielen neuen Bezugspersonen wird sich Frau R. nach und nach gewöhnen. Das Pflegepersonal kann sie dabei unterstützen, indem sie Pflegepersonen betreuen, zu denen sie leichter einen Bezug herstellen kann, etwa weil sie aus derselben Gegend stammen wie sie oder indem man gezielt ihre Interessen und Bedürfnisse anspricht.
Die Erinnerungen an den Tod ihres Mannes werden für Frau R. so lange eine Rolle spielen, wie sie ihre jetzige Situation mit der ihres Mannes gleichsetzt. Ein klinischer Psychologe kann ihr helfen, ihren jetzigen Krankenhausaufenthalt von dem ihres Mannes gedanklich zu trennen und die beiden Ereignisse unabhängig voneinander zu sehen. Dadurch wird sie frei, sich auf ihre eigene Genesung zu konzentrieren.
1.2 Der Beitrag der Psychologie zur Pflege
Psychologische Fragen spielen während des gesamten Pflegeprozesses eine wichtige Rolle. Gesprächsführung und Kommunikation sowie Beratung und psychosoziale Betreuung gehören zu den Kernkompetenzen der Gesundheits- und Krankenpflege. Dabei sind vor allem folgende Punkte bedeutsam:
• Das Verständnis für Patienten in ihrer jeweils besonderen Situation wird durch klinisch-psychologisches Wissen gefördert. Es ermöglicht die fundierte Beschreibung und Erklärung von psychischen Veränderungen und Verhaltensauffälligkeiten (z. B. Angst, Kontrollbedürfnis, sozialer Rückzug, Aggression).
• Im Gespräch kann besser auf Patienten eingegangen werden. Es ist leichter möglich, wichtige Informationen zu gewinnen und zu geben, bestimmte Themen anzusprechen (z. B. Gefühle) und Fehler oder Fallen in der Gesprächsführung zu vermeiden (z. B. bei gereizten Patienten). Die Motivation der Patienten und die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und Pflegepersonen kann gezielt verbessert werden.
• Die Kooperation im Team wird durch psychologisches Wissen vertieft. Schwierige Situationen, Stress und Konflikte können frühzeitig erkannt und konstruktiv geklärt werden.
• Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit werden Psychologen aufgrund des klinisch-psychologischen Wissens rechtzeitig informiert und in die Behandlung einbezogen. Psychologen geben ihrerseits Hinweise für die weitere Kommunikation und Betreuung.
• Die Psychohygiene der Pflegenden wird gefördert durch Selbstreflexion, Stress- und Konfliktmanagement. Der aktive Umgang mit den vielfältigen beruflichen Belastungen beugt innerer Erschöpfung und dem emotionalen Ausbrennen vor.
1.3 Psychologe – Psychiater – Psychotherapeut
„Du brauchst ja einen Psychiater!“ – Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die sogenannten „Psycho-Berufe“ – Psychologe, Psychiater und Psychotherapeut – immer wieder miteinander verwechselt. Zu allen drei Berufen gehören die Diagnose von psychischen Leidenszuständen und die Behandlung psychischer Störungen. Daneben bestehen auch wichtige Unterschiede.
Psychologe
Grundausbildung ist das Universitätsstudium der Psychologie (Bachelor und Master). Das berufliche Spektrum eines Psychologen ist sehr breit und umfasst u. a. folgende Arbeitsbereiche: Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Heime und Schulen, psychosoziale Beratungsstellen, Erwachsenenbildung, Personalwesen, Wirtschaft, Werbung und Forschung sowie die freie Praxis.
Spezialisierungen für den klinischen und den Gesundheitsbereich sind in Österreich eigens gesetzlich geregelt (Psychologengesetz 2013):
• Ein klinischer Psychologe hat nach Ende des Studiums eine mehrjährige postgraduelle Ausbildung absolviert. Zu den Aufgabengebieten zählen die klinisch-psychologische Diagnostik bei körperlich kranken und psychisch beeinträchtigten Personen, die Erstellung von psychologischen Befunden und Gutachten sowie die klinisch-psychologische Beratung und Behandlung. Diese umfasst die Unterstützung bei der Bewältigung körperlicher Krankheiten (z. B. Krebs) ebenso wie die fokussierte, ziel- und lösungsorientierte Behandlung von psychischen Störungen und Leidenszuständen (z. B. Depression, Angststörungen, Burnout) und die Begleitung in Krisensituationen.
• Ein Gesundheitspsychologe arbeitet präventiv im Sinne der Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung. Die gesundheitspsychologischen Maßnahmen beziehen sich u. a. auf Gesundheits- und Risikoverhalten (Ernährung, Bewegung, Rauchen) sowie auf die Analyse und Beratung von Betrieben und Organisationen in Bezug auf gesundheitsbezogene Rahmenbedingungen, Vorsorge und Rehabilitation (z. B. Arbeitsplatzanalyse, Stressmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung).
Psychiater
Ein Psychiater ist Facharzt für Psychiatrie. Er arbeitet zumeist in psychiatrischen Kliniken bzw. Stationen und/oder in freier Praxis. Psychiatrische Patienten weisen oft schwere psychische Störungen auf (z. B. Schizophrenie, bipolare Störung), die häufig mittels Medikamenten (Psychopharmaka) behandelt werden. Daneben kommen auch psychotherapeutische Methoden zum Einsatz (therapeutische Gespräche, Gruppentherapie u. a.). In modernen multimodalen Behandlungsansätzen werden möglichst alle Lebensbereiche des Patienten berücksichtigt (Schneider et al. 2012).
Psychotherapeut
Ein Psychotherapeut ist Spezialist für die Behandlung von psychischen Störungen. Um in Österreich tätig sein zu dürfen, muss ein Psychotherapeut zunächst eine Grundausbildung in einem gesetzlich definierten psychosozialen Beruf absolvieren (die meisten Psychotherapeuten sind Psychologen oder Ärzte). Daran schließt sich eine vier- bis sechsjährige Spezialausbildung nach einer speziellen psychotherapeutischen Methode an. Ein Psychotherapeut arbeitet meist in einer psychosozialen Betreuungseinrichtung und/oder in freier Praxis, oft in Kooperation mit Ärzten und Psychologen (zur Diagnostik, medizinischen Behandlung etc.). Die am häufigsten angewandten psychotherapeutischen Methoden in Österreich sind Systemische Familientherapie (21 %), Verhaltenstherapie (10 %) und Personenzentrierte Psychotherapie (9 %) (psyonline.at 2018).
Aktuell sind in Österreich rund 10.700 klinische Psychologen und 9.600 Psychotherapeuten (BMFG, Stand Februar 2019) sowie rund 1.500 Fachärzte für Psychiatrie tätig.
1.4 Zusammenfassung
Psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten. Ihre Ziele sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens sowie, im Rahmen psychologischer Behandlung, deren Veränderung zur Verbesserung der Lebensqualität. Der Beitrag der Psychologie zur Pflege betrifft Verständnis für den Patienten, Gesprächsführung und Motivation, Kooperation im Team, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Psychohygiene. Das berufliche Spektrum eines Psychologen ist sehr umfangreich. Es unterscheidet sich in wichtigen Punkten von dem eines Psychiaters und eines Psychotherapeuten.
2 Neurobiologische Grundlagen des Erlebens und Verhaltens
Biologische Prozesse beeinflussen auf vielfältige Weise das Erleben und Verhalten. Gleichzeitig steuern psychische Prozesse verschiedenste Körperfunktionen mit. Das betrifft insbesondere den Bereich von Gesundheit und Krankheit (Schandry 2016).
Das menschliche Gehirn ist jenes Organ, in dem Informationen über die Außenwelt und den Körper gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden. Im Gehirn laufen alle höheren geistigen Prozesse ab, die wir als Bewusstsein, Denken, Gefühle, Bedürfnisse, Wissen etc. erleben und die unser persönlichstes Inneres ausmachen. Das Gehirn steuert und koordiniert weiters Körperfunktionen und Muskelaktivitäten und bestimmt so unser Verhalten, von einfachen Reaktionsmustern bis zu hoch spezialisierten Handlungen. Aus neurobiologischer Sicht bringt „das Gehirn die Seele hervor“ (Roth/Strüber 2014, S. 43).
2.1 Signalübertragung zwischen Nervenzellen
Nervenzellen (Neuronen) bilden die Grundeinheiten des Nervensystems. Das Gehirn besteht aus 60 bis 100 Milliarden Neuronen; davon entfallen allein auf die Großhirnrinde rund 15 Milliarden. Die Nervenzellen nehmen Reize (Informationen) auf, verarbeiten sie und leiten sie an andere Zellen weiter. Sie sind in ausgedehnten und stark überlappenden neuronalen Netzwerken (nicht nur in eng umgrenzten „Zentren“) organisiert.
Größe und Form der Nervenzellen sind sehr unterschiedlich, jedoch weisen alle den gleichen Grundplan auf: Sie bestehen aus einem Zellkörper (Soma) und Fortsätzen an diesem Zellkörper: einem mehr oder weniger langen Axon (Neuriten) und meist mehreren Dendriten mit kleinen knollenförmigen Endknöpfchen (Synapsen). Die Signalübertragung zwischen den Neuronen läuft in folgenden Schritten ab (siehe Abb. 1):
Abb. 1: Signalübertragung zwischen Nervenzellen
1. Ein Nervenimpuls erreicht als elektrisches Signal die Synapse und muss, um an die nächste Nervenzelle weitergeleitet zu werden, den sogenannten synaptischen Spalt, den Abstand zwischen zwei Neuronen, überwinden. Das geschieht chemisch, durch Neurotransmitter. Diese werden in den synaptischen Spalt ausgeschüttet.
2. Die Neurotransmitter binden sich an die Rezeptoren der postsynaptischen Zelle und können dort ein elektrisches Signal auslösen, das dann in der neuen Zelle weiterverarbeitet wird. Sie können aber auch hemmend wirken und Impulse in der postsynaptischen Zelle unterbinden. Die Art der Wirkung hängt u. a. von der chemischen Bauweise der Transmitter und der Rezeptoren ab.
3. Nach der Rezeption werden die Neurotransmitter entweder zersetzt oder wandern zurück in die Synapse.
Die einwandfreie Signalübertragung innerhalb und zwischen den Nervenzellen bildet die Grundlage der Wahrnehmung, der kognitiven und emotionalen Verarbeitung sowie der Verhaltenssteuerung. Störungen dieser biochemischen Prozesse können dramatische Folgen für das Erleben und Verhalten haben.
Halluzinationen sind Scheinwahrnehmungen von Objekten oder Ereignissen, die objektiv nicht da sind. Die betroffene Person hält sie jedochüfür völlig real. Sie hört sich ihre beunruhigenden Erlebnisse zu erklären. Daraus können komplizierte, unverrückbare Gedankengebäude entstehen, die für andere Menschen nicht nachvollziehbar sind. Denkstörungen äußern sich in zerfahrenen und zusammenhanglosen Gedanken, unlogischen Verknüpfungen und willkürlichen Sprüngen. Bei Ich-Störungen verschwimmen die Grenzen zwischen dem Ich und der Umwelt (Depersonalisation: die eigenen Gedanken, Gefühle oder Körperteile werden als unwirklich erlebt; Derealisation: die Umwelt erscheint unwirklich und andersartig; Gedankeneingebung, Gedankenentzug: die eigenen Gedanken scheinen von außen gesteuert). Bei Schizophrenie treten diese Symptome oft gemeinsam auf.
In früheren Zeiten stand man diesen und anderen psychotischen Symptomen weitgehend hilflos gegenüber. Die Geschichte der Psychiatrie zeugt von den fortgesetzten Versuchen, mit ihnen irgendwie zurande zu kommen (Brückner 2010). In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden jedoch Wirkstoffe entdeckt, die diese Symptome zum Verschwinden bringen. Die Psychopharmaka, die heute zur Behandlung von Schizophrenie und anderen psychotischen Störungen verwendet werden, wirken auf den gestörten Mechanismus der Signalübertragung und bringen ihn sozusagen wieder in geordnete Bahnen. Allerdings wirken sie nur symptomatisch, d. h., sie bringen die Störungsbilder zwar zum Verschwinden, heilen aber nicht die damit verbundene Grundstörung (etwa Schizophrenie). Deshalb müssen die Medikamente oft über einen sehr langen Zeitraum eingenommen werden.
Die Neurotransmittersysteme können auch künstlich durch verschiedene psychoaktive Drogen beeinflusst und vorübergehend verändert werden. So bewirken Haschisch und LSD oft Wahrnehmungssteigerungen und Halluzinationen, Heroin und Morphium Euphorie und Schmerzstillung, Kokain und Ecstasy Antriebssteigerung usw. Die Wirkstoffe jeder dieser Drogen spricht bestimmte Neurotransmitter-Rezeptoren an. Aufgrund ihrer chemischen Ähnlichkeit mit Neurotransmittern werden sie von den Rezeptoren irrtümlich „akzeptiert“ und lösen so dieselben Wirkungen aus.
Die Transmittersysteme gewöhnen sich jedoch meist rasch an die künstliche Zufuhr von Wirkstoffen und reduzieren den körpereigenen Einsatz der Neurotransmitter. Dies führt z. B. bei Heroin zur körperlichen Abhängigkeit von der Droge, die dann nicht mehr des schnellen Glücksgefühls wegen gebraucht wird, sondern um die normale, alltägliche Funktionsweise des Nervensystems aufrechtzuerhalten.
2.2 Großhirnrinde und limbisches System
Das Gehirn steht an der Spitze des menschlichen Nervensystems, was Größe, Dichte und Komplexität der Neuronen und ihrer Verknüpfung betrifft. Es sammelt, verarbeitet und speichert Informationen über die Außenwelt und den Körper. Es ist jenes Organ, in dem alle höheren geistigen Prozesse ablaufen, die wir als Bewusstsein, Denken, Gefühle, Bedürfnisse, Wissen etc. erleben und die unser persönlichstes Inneres ausmachen. Das Gehirn steuert und koordiniert weiters Körperfunktionen und Muskelaktivitäten und bestimmt so unser Verhalten, von einfachen Reaktionsmustern bis zu hoch spezialisierten Handlungen.
Die verschiedenen Hirnregionen sind auf komplexe Weise miteinander verknüpft. Ihr Zusammenspiel ist die Grundlage von fundamentalen psychischen Prozessen wie z. B. Wahrnehmung, Denken, Lernen und emotionalen Reaktionen.
Höhere geistige Prozesse sind in der Großhirnrinde (dem Cortex) lokalisiert. Bestimmte Teile sind hauptsächlich für spezifische Kontroll- und Koordinierungsfunktionen zuständig, z. B. für visuelle Wahrnehmung, Wortgedächtnis oder situationsgerechtes Handeln. Man nennt sie Rindenfelder oder primäre Zentren. Wenn eine solche Cortexregion zerstört wird (z. B. durch einen Unfall oder einen Schlaganfall), können andere Regionen die ausgefallenen Funktionen übernehmen. Dieser Prozess wird im Rahmen der Rehabilitation gezielt angeregt.
Beispiel: Schädigung des präfrontalen Cortex
Der Stirnlappen der Großhirnrinde (präfrontaler Cortex) ist u. a. für die räumlichzeitliche Einordnung von Wahrnehmungen und die Planung und Vorbereitung von angemessenen Handlungen zuständig. Schädigungen im präfrontalen Cortex können dazu führen, dass Patienten sich nicht mehr flexibel auf neue Situationen oder Probleme einstellen können, während Alltagsroutinen (Haushalt, gewöhnlicher Einkauf) keine Probleme darstellen. Zugleich kann die Impulskontrolle vermindert sein („Ich will alles, sofort“), verbunden mit Selbstüberschätzung und Aggressivität im Umgang mit anderen Menschen. Auch Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung und Sprachverarmung können auftreten. (Man nennt diese Symptomgruppen auch Pseudodemenz, Pseudopsychopathie, Pseudodepression).
Das limbische System besteht aus einer Reihe kleiner Strukturen unterhalb der Großhirnrinde sowie des Zwischenhirns. Seine zentrale Funktion ist es, Ereignisse und Verhaltensweisen als angenehm bzw. unangenehm zu bewerten und abzuspeichern. Damit ist das limbische System die neuronale Grundlage für Gefühle, Motivation und Gedächtnisprozesse.
Die Emotionen reichen von elementaren Affekten (Wut, Zorn, Freude, Trauer) und damit verbundenen Reaktionsweisen (Flucht, Aggression, Erstarren) über konditionierte Reaktionen (siehe Kap. 7) bis zu komplexen Gefühlen und Motiven (z. B. in Bezug auf Eltern, Partner, Arbeit). Dazu zählen auch die Fähigkeit zur Einfühlung in andere Menschen (Empathie), zur Abwägung von Risiken und möglichen Folgen einer Handlung und zur Impulskontrolle. Auch Merken und Lernen – die Speicherung einer Wahrnehmung oder eines Erlebnisses im Langzeitgedächtnis -stehen mit dem limbischen System in Verbindung. Wir merken uns Dinge umso leichter, je stärkere Gefühle wir damit verknüpfen.
Eine psychische Traumatisierung (z. B. durch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen) kann zu neurophysiologischen Veränderungen führen. Das limbische System ist bei extremer Stressbelastung überfordert, die äußerst intensiven sensorischen Informationen können räumlich, zeitlich und biografisch nicht mehr zugeordnet werden. Sie bleiben unverknüpft und entziehen sich der bewussten Verarbeitung, Bewertung und Kontrolle. Viele Betroffene befinden sich danach in einer Art Dauererregung bzw. einem anhaltenden Alarmzustand. Kleinste Irritationen und harmlose Wahrnehmungen können zu heftigen Reaktionen führen. Im Zuge einer Traumatherapie lernt der Betroffene, die einzelnen Eindrücke in Worte zu fassen und miteinander in Beziehung zu setzen. Neurophysiologisch werden die Trauma-Erinnerungen mit den anderen Lebenserfahrungen verknüpft, das limbische System lernt die emotionalen Reaktionen wieder angemessen zu steuern (Hausmann 2016).
2.3 Neuromodulatoren
Neurotransmitter bewirken innerhalb von Millisekunden den Informationsaustausch zwischen Synapsen und angrenzenden Nervenzellen. Diese Wirkung wird von weiteren neurochemischen Substanzen, den sogenannten Neuromodulatoren, verändert (moduliert).
•Dopamin lässt bestimmte Reize besonders attraktiv erscheinen und erzeugt eine Belohnungserwartung; es ist das neurochemische Motivationssystem. Bei Dopaminmangel erscheinen wichtige Ziele nicht mehr attraktiv oder sogar unerreichbar; Apathie und Hoffnungslosigkeit sind die Folge.
•Serotonin hemmt u. a. die Bereitschaft zu Aggression sowie zu schnellen, ungeplanten, riskanten Handlungen. Es ist das neurochemische „Brems- und Beruhigungssystem“, das uns abwarten und überlegen lässt. Bei Mangel an Serotonin erscheint die Welt bedrohlicher und gefährlicher. Ängstlichkeit und Depression, aber auch Impulsivität und reaktive Aggression und Gewalt können die Folge sein.
•Endogene Opioide fördern das Wohlgefühl und lindern körperlichen Schmerz. Sie sind das körpereigene Belohnungssystem, wenn ein Ziel erreicht ist. Störungen im Opioidhaushalt können zu stärkerer Schmerzempfindlichkeit sowie zu größerer Empfindlichkeit gegenüber sozialer Ablehnung führen. Der verstärkte Drang nach intensiver positiver Erfahrung (sensation seeking) kann die Grundlage für Drogensucht werden.
•Oxytocin erhöht die Fähigkeit, emotionale und soziale Signale zu erkennen; es fördert die Bereitschaft sich auf andere Menschen einzulassen sowie Vertrauen und elterliche Fürsorge. Frühkindliche Vernachlässigung beeinträchtigt jedoch die Entwicklung des Oxytocinsystems. Zusammen mit einer bestimmten genetischen Disposition kann das zu schweren Bindungs- und Persönlichkeitsstörungen führen (Roth/Strüber 2014).
2.4 Zusammenfassung
Das Gehirn ist jenes Organ, das „die Seele hervorbringt“. Die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen ist die Voraussetzung für rasche Informationsverarbeitung und zielgerichtetes Handeln. Störungen im Neurotransmitterhaushalt können u. a. zu Schizophrenie und anderen psychotischen Störungen führen. Verschiedene Areale der Großhirnrinde sind zuständig für Wahrnehmung, Motorik, Denken und überlegtes Handeln. Schädigungen können zentrale psychische Funktionen beeinflussen. Das limbische System ist die neuronale Grundlage für Gefühle, Motivation und Gedächtnisprozesse. Ein psychisches Trauma kann zu neurophysiologischen Veränderungen führen. Neuromodulatoren steuern u. a. Motivation, Beruhigung, Belohnung und soziales Bindungsverhalten.
3 Andere Menschen wahrnehmen
Die Wahrnehmung versorgt uns mit Informationen über die Umwelt und den eigenen Körper. Sie macht uns Gegenstände, Ereignisse und körperliche Zustände erfahrbar: Was wir nicht – direkt oder indirekt – wahrnehmen können, existiert scheinbar nicht. Die Wahrnehmung ermöglicht es, sich in der Welt zu orientieren und gezielt zu bewegen. Zugleich bildet sie die Voraussetzung für viele nachfolgende psychische Prozesse wie Gedanken, Gefühle, Lernen usw. (Spering/Schmidt 2017).
3.1 Der Wahrnehmungsprozess
Die physikalische Welt, in der wir uns bewegen, besteht aus Atomen und Molekülen, elektromagnetischen und mechanischen Schwingungen. Der Prozess der Wahrnehmung macht sie psychisch erlebbar. Dies geschieht jedoch nicht im Sinne eines simplen Abbildes, in dem die äußere Wirklichkeit quasi eins zu eins in das Bewusstsein projiziert würde. Der Wahrnehmungsprozess ist eine Folge von Umwandlungen, in denen schrittweise ein Bild der Wirklichkeit konstruiert wird (siehe Abb. 2).
Die in diesem Prozess gewonnenen Wahrnehmungen sind die Grundlage für weiterführende Einschätzungen, Bewertungen und Urteile (z. B. gefährlich/harmlos, angenehm/unangenehm, sympathisch/unsympathisch). Im Alltagsleben gehen Wahrnehmung und Beurteilung oft sehr schnell ineinander über. Die Verwechslung von Wahrnehmungen und Bewertung ist eine Quelle unzähliger Missverständnisse und Fehldeutungen.
Abb. 2: Die Stufen des Wahrnehmungsprozesses
Beispiel
In die Ambulanz eines Krankenhauses kommt ein Mann um die 50, mit verschmutztem Anzug und ungepflegtem Haar. Er geht schwankend, mit der Hand greift er immer wieder ins Leere. Seine Aussprache ist verwaschen, der Atem riecht säuerlich. Er wird für einen Betrunkenen oder Obdachlosen gehalten. Andere Wartende rücken von ihm ab. Auch das Pflegepersonal verhält sich zunächst sehr distanziert. Der untersuchende Arzt diagnostiziert einen Schlaganfall.
In sozialen Berufen und speziell in der Pflege und Betreuung hilfsbedürftiger Menschen ist eine genaue Wahrnehmung (von Veränderungen, Verhaltensauffälligkeiten etc.) besonders wichtig. Nur durch eine klare Trennung zwischen Wahrnehmung und Interpretation ist eine weitgehend vorurteilsfreie Betreuung möglich.
3.2 Eigenschaften der Wahrnehmung
Wahrnehmung ist kein passives „Aufnehmen“, sondern ein Konstruktionsprozess. Wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sie wahrzunehmen gewohnt sind bzw. wie es uns leicht fällt, sie wahrzunehmen und zu verarbeiten.
Der Wahrnehmungsprozess ist durch drei grundlegende Eigenschaften gekennzeichnet: Subjektivität, Selektivität und Tendenz zur Vereinfachung.
Subjektivität
Jede Wahrnehmung ist subjektiv, d. h., ein und derselbe Reiz wird von verschiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen. Auch ein und dieselbe Person kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten einen konstanten Reiz verschieden wahrnehmen. Gründe dafür sind u. a. verschiedene Intensitätsschwellen, ab denen Reize überhaupt wahrgenommen werden können, sowie subjektive Bezugspunkte, von denen aus verglichen wird, ob ein Gegenstand leicht oder schwer, groß oder klein, hell oder dunkel ist.
Beispiel
Die Praktikantin Renate soll Herrn G. baden. Sie lässt Wasser in die Wanne und prüft mit ihrer Hand die Temperatur, bis ihr das Wasser warm genug erscheint. Kurz vorher hat sie Medikamente in den Stationskühlschrank eingelagert, weshalb sie kalte Hände hat. Herr G. kommt direkt aus dem warmen Bett. Er steigt nur zögernd in die Wanne: Ihm ist das Wasser zu kalt.
Selektivität
Von allen Reizen, die wir wahrnehmen könnten, wählen wir (bzw. unsere Sinne) nur einen Bruchteil aus. Der Wahrnehmungsapparat filtert die Informationen aus der Umwelt und dem Körper und lässt nur einen Bruchteil in das Bewusstsein passieren. Dieser Filterprozess ist die Grundlage von Aufmerksamkeit und Konzentration und somit entscheidend für Denken, Lernen und schnelles Reagieren.
•Aufmerksamkeit wird wie ein Scheinwerfer auf die momentan wichtigen Dinge und Sachverhalte gelenkt. Dadurch werden sie besonders deutlich wahrgenommen. Die unwichtigen treten kaum ins Bewusstsein. Zum Beispiel ändert sich die Schmerzintensität je nachdem, ob man die Aufmerksamkeit auf die betroffene Körperregion oder auf etwas ganz anderes richtet.
•Konzentration ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit längere Zeit auf einen Gegenstand oder ein Thema zu richten. Bei schwierigen Arbeiten ist diese Fähigkeit ebenso wichtig wie beim Lernen für eine Prüfung. Sie kann durch verschiedene Lerntechniken geübt werden (siehe Kap. 7.6).
Vereinfachung
Die vielen verschiedenen Einzeleindrücke und Beobachtungen werden zu einem Gesamtbild zusammengefügt, das in sich möglichst geschlossen und „griffig“ ist. Das führt zu einer Vereinfachung der wahrgenommenen Information. Komplizierte Zusammenhänge werden umstrukturiert und zurechtgebogen, sodass sie ein möglichst einfaches, gut erkennbares Muster ergeben. Diese Tendenz ist in unserem Wahrnehmungsapparat angelegt. Sie führt dazu, dass wir manchmal Dinge wahrnehmen, die eigentlich gar nicht da sind (siehe Abb. 3).
Abb. 3: Was ist hier zu sehen? (Sbz 1993)
Bei Pflegeanamnesen werden die Informationen, die der Patient über seinen Körper, seine Lebensumstände, Bedürfnisse und Gewohnheiten gibt, in verschiedenen Kategorien zusammengefasst und abgekürzt festgehalten.
Beispiel
Ein Patient berichtet im Anamnesegespräch von seinen Schwierigkeiten beim Telefonieren und dass er sich schämt, wenn er mehrmals nachfragen muss, was der Gesprächspartner gesagt hat. In der Pflegeplanung steht vereinfachend „Beeinträchtigung der Kommunikation und der sozialen Kontakte“.
Auch ärztliche oder psychologische Diagnosen stellen eine Vereinfachung dar: Auffälligkeiten werden als Symptome erkannt und klassifiziert, die Symptome bestimmten Störungsbildern zugeordnet. Bei Vorliegen genügender relevanter Symptome wird eine Diagnose gestellt. Diese Vereinfachungen erlauben es uns, gezielt und effektiv zu handeln.
3.3 Beeinflussung der Wahrnehmung
Der Wahrnehmungsprozess kann durch eine Reihe von Faktoren erheblich beeinflusst werden:
•Wissen: Je mehr man über eine bestimmte Sache weiß, desto mehr nimmt man davon wahr. Je genauer beispielsweise eine Pflegeperson über die psychische Seite von Alter und Krankheit Bescheid weiß, desto mehr Gefühlsäußerungen eines Patienten nimmt sie wahr; je mehr sie über die Folgen von Dauerstress weiß, desto früher erkennt sie die Symptome bei sich und kann frühzeitig darauf reagieren.
•Erwartungen: Wenn man bestimmte Dinge oder Ereignisse erwartet, nimmt man bereits erste Anzeichen sehr genau wahr. Beim Zahnarzt z. B. erwarten viele Menschen, dass es wehtun wird. Sie nehmen bereits einfache Berührungen des Zahnfleisches als Schmerz wahr.
•Bedürfnisse, Wünsche: Wünsche und Bedürfnisse schärfen die Wahrnehmung. Wer z. B. eine Diät halten muss, sieht und riecht in der ersten Zeit oft die „verbotenen“ Speisen.
•Einstellungen: Einstellungen wirken auf die Wahrnehmung wie Filter: Wahrgenommen wird vor allem, was mit bereits bestehenden Einstellungen übereinstimmt und sie bestätigt. Was nicht zu ihnen passt, wird oft nur ungern oder lückenhaft wahrgenommen.
•Gefühle: Je emotionaler ein Objekt oder Thema erscheint, desto intensiver wird es wahrgenommen. Das gilt im positiven Bereich (Freude, Dankbarkeit) wie auch im negativen (Angst, Wut, Verzweiflung). Sachliche Informationen z. B. über eine bevorstehende Untersuchung oder Behandlung werden oft weniger gut aufgenommen als emotionale Berichte („Horrorgeschichten“, „Wunderheilungen“).
•Soziale Umgebung: Unsere Mitmenschen lenken mit ihrem Verhalten, ihren Aussagen und Reaktionen die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche, auf die man bisher wenig geachtet hat (z. B. Unfallverhütung aufgrund der Arbeit im Notfallbereich).
3.4 Soziale Wahrnehmung
Wie man auf eine bestimmte Person zugeht und sich zu ihr verhält – freundlich oder vorsichtig, entgegenkommend oder fordernd -, hängt weitgehend davon ab, welches Bild man sich von ihr macht.
Soziale Wahrnehmung ist ein Prozess, der zu Meinungen, Bewertungen und Einstellungen gegenüber anderen Personen führt und das Verhalten ihnen gegenüber beeinflusst.
Die soziale Wahrnehmung setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
•Beobachtungen von konkreten Verhaltensweisen, selbst erlebte Situationen, selbst gehörte Aussagen etc.
•Vermutungen über dahinterliegende oder „dazu passende“ Fähigkeiten, Eigenschaften, Einstellungen, Motive und Verhaltensweisen.
•Verallgemeinerungen: Man nimmt an, dass das beobachtete Verhalten immer wieder auftritt und die Person immer ungefähr so „ist“, wie sie sich jetzt verhält.
•Emotionale Bewertung: Die Person und was sie tut, findet man sympathisch bzw. unsympathisch.
•Blinde Flecken: Manche Verhaltensweisen, die nicht „ins Bild“ passen, werden ausgeblendet.
Eine Reihe von sozialen Faktoren beeinflusst die soziale Wahrnehmung und kann sie zum Teil erheblich verzerren:
Erster Eindruck
Von all den Dingen und Merkmalen, die man an einem Menschen beobachten kann – äußere Erscheinung, Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Gestik, Sprache usw. -, werden in der Regel die hervorstechendsten ausgewählt. Auf dieser Grundlage entsteht der erste Eindruck. Wissen, Normen und Einstellungen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die weitere soziale Wahrnehmung orientiert sich am ersten Eindruck. Dieser wirkt wie ein Wahrnehmungsfilter, der die dazu passenden Beobachtungen hervorhebt und alle anderen ausblendet.
Vorurteile, Klischees
Häufig nimmt man bei anderen Menschen Eigenschaften an, auf die es keinen direkten Hinweis im beobachteten Verhalten gibt. Sie werden hinzugedacht, weil sie (scheinbar) ins Bild passen. Vorurteile sind Urteile, die man fällt, bevor man eine Person richtig kennengelernt hat. Wenn sie sich auf eine ganze Gruppe beziehen, spricht man von Klischees oder Stereotypen (z. B. „typisch Mann/Frau“, „typisch Psychiatrie“). Es handelt sich um vorgeprägte Meinungen, wie eine Person „eben ist“, z. B. „Pflegepersonen sind freundlich. Ärzte sind fachlich kompetent. Psychologen können gut zuhören“. Häufig wird vor allem auf solche Eigenschaften geachtet, die diese Klischees bestätigen. Im Umgang mit anderen Menschen – Patienten, Heimbewohnern, Angehörigen, Kollegen, Vorgesetzten – können sie zu erheblichen Fehleinschätzungen führen.
Sympathie
Schon nach kurzem Kennenlernen kann ein Mensch sympathisch oder unsympathisch wirken. Sympathie und Antipathie wirken als Wahrnehmungsfilter, die die weiteren Beobachtungen lenken und verfälschen. Manche Menschen wirken sympathisch, weil sie dem Beobachter ähnlich sind. Andere erscheinen unsympathisch, weil sie an eine andere Person erinnern oder weil sie Eigenschaften zeigen, die man an sich selbst nicht mag.
Möglichst neutral bleiben
Für Pflegepersonen ist es wichtig, andere Menschen möglichst neutral und vorurteilsfrei wahrzunehmen. Nur so kann man sich in die anvertrauten Menschen richtig einfühlen, auf ihre Bedürfnisse angemessen eingehen und ihnen die Pflege und Betreuung zukommen lassen, die sie brauchen.
In der Praxis kann der Einfluss des ersten Eindrucks und der Sympathie nicht völlig ausgeschaltet werden, und niemand ist ganz ohne Vorurteile. Diese Störfaktoren können jedoch in ihrem Einfluss möglichst klein gehalten werden. Dabei helfen vor allem
• genau beobachten (Was sehe/höre ich wirklich?)
• sich der eigenen Vorannahmen bewusst sein (erster Eindruck, Vermutungen, Vorurteile)
• akzeptieren, dass jede Einschätzung eines Menschen vorläufig ist
• offen für neue Eindrücke bleiben (auch wenn sie zunächst nicht ins Bild passen)
3.5 Zusammenfassung
Die Wahrnehmung ist ein mehrstufiger Prozess, in dem schrittweise ein Bild der Wirklichkeit konstruiert wird. Jede Wahrnehmung ist subjektiv, selektiv und neigt zur Vereinfachung. Sie wird durch Wissen, Erwartungen, Bedürfnisse, Wünsche, Einstellungen, Unsicherheit und die soziale Umgebung beeinflusst. Die soziale Wahrnehmung enthält Beobachtungen, Vermutungen, Verallgemeinerungen, emotionale Bewertungen und blinde Flecken. Sie wird zusätzlich bestimmt durch den ersten Eindruck, Vorurteile und Sympathie. Eine möglichst neutrale Wahrnehmung ist in der Pflege besonders wichtig.
4 Gefühle – Die Farben des Seelenlebens
Das menschliche Gefühlsleben ist außerordentlich vielfältig. Wir fühlen Freude, Liebe, Hoffnung, Glück und Zufriedenheit ebenso wie Sehnsucht, Überdruss, Enttäuschung, Unzufriedenheit und vielleicht Hass. (Hunger und Durst sind keine Gefühle, sondern Wahrnehmungen.) Im klinischen Bereich spielen Angst, Hilflosigkeit, Traurigkeit und Wut eine wichtige Rolle, aber auch positive Gefühle wie Dankbarkeit, Erleichterung und Zuversicht.
4.1 Gefühle als Reaktionen
Gefühle (Emotionen) sind ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Existenz. Sie umfassen einen allgemeinen affektiven Zustand (Lust – Unlust, angenehm – unangenehm) und eine spezielle Gefühlstönung (z. B. Freude, Ärger, Angst). Gefühle werden durch verschiedene Prozesse ausgelöst bzw. von diesen begleitet und äußern sich im Verhalten auf vielfältige Weise (Lächeln, Weinen, Rückzug, Aggression etc.). Zugleich können sie komplexe Handlungen auslösen.
Gefühle sind Reaktionen auf Wahrnehmungen, Vorstellungen und Erinnerungen bzw. Folgen körperlicher Zustände.
•Wahrnehmungen: Freude, wenn man sieht, dass ein Angehöriger zu Besuch kommt, Angst beim Ertönen eines Notsignals, Beruhigung beim Hören einer ruhigen Stimme
•Vorstellungen: Vorfreude, Zuversicht vor einer Operation, Prüfungsangst
•Erinnerungen: angenehme bzw. unangenehme Gefühle bei der Erinnerung an einen früheren Krankenhausaufenthalt, beim Gedenken an die „gute alte Zeit“
•körperliche Zustände: Erschöpfungsdepression, Stimmungsänderung durch Medikamente
Auf einen Auslöser sind stets mehrere emotionale Antworten möglich: Einer bevorstehenden Chemotherapie kann ein Patient z. B. mit Gefühlen von Zuversicht, Sorge oder Niedergeschlagenheit entgegensehen, je nachdem, was er sich von ihrer Wirkung verspricht: „Das hilft den Krebs zu besiegen“, „Mir werden alle Haare ausfallen“, „Es hat ohnehin keinen Sinn mehr.“
Die Gefühlsreaktionen folgen keiner strikten Automatik, sondern sind veränderbar. Darin liegt ein wichtiger Ansatzpunkt für psychosoziale Unterstützung und psychologische Behandlung.
4.2 Gefühle im Zusammenhang mit Krankheit
Durch körperliche Beschwerden, Symptome und Krankheiten ist das emotionale Gleichgewicht oft empfindlich gestört. Zwei extreme Reaktionsweisen sind immer wieder zu beobachten:
• Bisher unbekannte oder längst überwunden geglaubte Gefühle (Angst, Hilflosigkeit, ohnmächtige Wut etc.) treten neu auf und verstärken sich. In manchen Fällen können sie das Bewusstsein des Patienten geradezu überschwemmen. „Vernünftige“, d. h. bewusst geplante Verhaltensweisen werden dadurch verzögert. Der Patient wirkt „kopflos“ und emotional labil, heftige Gefühlsausbrüche sind ohne Vorwarnung möglich.
• In scheinbarer Gefühlskälte wirkt der Patient sehr kontrolliert, gefasst oder emotional unbeteiligt. Gefühle werden nicht zugelassen oder sind scheinbar überhaupt nicht vorhanden. Hinter der Fassade können jedoch starke Emotionen verborgen sein, die bei Fortschreiten der Krankheit oder zusätzlichen Belastungen unvermutet hervorbrechen können.
Beide Extreme – das haltlose Ausleben wie das völlige Unterdrücken von Gefühlen – sind für den Patienten oft sehr anstrengend. Auf lange Sicht ist es am besten, wenn die Gefühle nach und nach bewusst erlebt und in angemessener Form ausgedrückt werden können. Den meisten Menschen bringt es Erleichterung, wenn sie den inneren Druck ablassen und sich etwas „von der Seele reden“ können. Wann, mit wem und in welcher Form das am besten geht, ist von Fall zu Fall verschieden. Eine wesentliche Aufgabe der Krankheitsbewältigung ist es, einen angemessenen Umgang mit den neuen und verstärkten Gefühlen zu finden (siehe Kap. 13).
Abb. 4: Häufige Gefühle im Zusammenhang mit Krankheit
Unsicherheit, Angst
Das Gefühl von Unsicherheit begleitet in verschiedenen Ausprägungen das gesamte Krankheitsgeschehen. Der Patient sieht sich mit Veränderungen konfrontiert, von denen er nicht genau weiß, welche Folgen sie letztlich haben werden. Die Unsicherheit kann sich zur Angst steigern. Diese bezieht sich auf die Krankheit und ihre Begleiterscheinungen (z. B. Schmerzen, Behinderungen, Lebensgefahr) sowie auf ihre Folgen (körperliche, psychische, soziale). Manche Patienten versuchen die Angst zu überspielen oder Angst auslösende Gedanken zu verdrängen, um sich zu entlasten und vor den anderen „stark“ zu wirken. Wenn die Angst so massiv ist, dass sie ein angemessenes Krankheitsverhalten verhindert, sollte sie psychologisch oder psychotherapeutisch behandelt werden.
Verlegenheit, Scham
Vielen Menschen ist es peinlich, wenn sie auf fremde Hilfe angewiesen sind. Im Zustand der Krankheit ist man oft schon bei alltäglichen Verrichtungen (Waschen, Ankleiden, Essen) beeinträchtigt und hilfsbedürftig. Die Folge sind Verlegenheit und Scham, die manchmal so weit gehen können, dass ein Patient nicht um Hilfe bittet, obwohl er sie dringend benötigt. Scham bezieht sich in unserer Kultur oft auf die Körperpflege, den Genitalbereich und die Ausscheidung. Pflegehandlungen in diesen Bereichen erfordern deshalb in besonderem Maße, die Intimsphäre des Patienten zu wahren.
Geringes Selbstwertgefühl, Pessimismus
Durch die Einschränkungen und Verlusterlebnisse sinkt bei vielen Patienten das Selbstwertgefühl. Sie kommen sich dann schwach und hilflos, manchmal auch unnütz und wertlos vor. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schwindet, Mutlosigkeit und Pessimismus können dazu führen, dass sich die Patienten gehen lassen, sich Ärzten und Pflegepersonal gegenüber passiv verhalten oder unkooperativ werden. Wenn dadurch die Krankheitsbewältigung blockiert wird oder dieser Zustand in eine Depression übergeht, sollte ein Psychologe zugezogen werden.
Traurigkeit, Verzweiflung
Nach einem Verlust traurig zu sein, ist normal. Krankheiten und Verletzungen können mit vielen Verlusten verbunden sein (Verlust von Wohlbefinden, Sicherheit und Kontrolle bis hin zum Verlust von Körperfunktionen und Körperteilen oder Bedrohung des Lebens). Traurigkeit und Niedergeschlagenheit beziehen sich auf bereits erlittene, aber auch auf bevorstehende oder nur befürchtete Verluste. Als vorübergehende Gefühle gehören sie bei vielen Krankheiten dazu. Wenn sie sich jedoch zur Verzweiflung steigern oder als Depression verfestigen, ist psychologische Hilfe dringend angezeigt.
Ärger, Wut
Aggressive Gefühle von Ärger bis hin zu Wut und Zorn verspüren viele Patienten. Oft richten sie sich auf die eigene Person (in Form von Selbstvorwürfen: „Warum habe ich nicht …“) oder die Umstände („Wie konnte das nur passieren!“, „Warum immer ich?“). Auch Pflegepersonen und Ärzte können zum Ziel dieses Zorns werden. Missverständnisse zwischen Patienten und Personal sollten so rasch wie möglich geklärt werden, um die Krankheitsbewältigung nicht zusätzlich zu erschweren.
Misstrauen
Misstrauische Patienten glauben, dass sie nicht optimal behandelt oder gepflegt werden. Dieser Eindruck kann durch konkrete Erfahrungen mit den aktuellen Betreuern hervorgerufen werden oder auch durch Erfahrungen in der Vergangenheit (nicht abklingende Schmerzen, mangelnde Aufklärung, unfreundliches Personal, Fehlbehandlungen etc.). Manche Patienten sind grundsätzlich eher misstrauisch ihren Mitmenschen gegenüber. Bei anderen verschiebt sich die Unsicherheit bezüglich des Krankheitsverlaufs auf die Betreuungspersonen. Misstrauen beeinträchtigt die Kooperation und das Krankheitsverhalten und sollte deshalb so schnell wie möglich ausgeräumt werden.
Beispiel
Frau B. ist 27 Jahre alt, Sekretärin und will in wenigen Monaten heiraten. Seit Jahren leidet sie an einer entzündlichen Darmerkrankung. Bei einer Kontrolluntersuchung wird ein bösartiger Tumor entdeckt, der sofort operiert werden sollte. Frau B. ist sehr besorgt, hofft jedoch, dass alles gut ausgehen wird.
Als sie nach der Operation aus der Narkose erwacht und feststellt, dass ihr tatsächlich, wie angekündigt, ein Stoma gelegt worden ist, bricht sie in Tränen aus. Erst nach einem halben Tag ist sie bereit, sich die operierte Stelle anzusehen. Sie will mit der ganzen betroffenen Körperregion nichts zu tun haben und fühlt sich völlig hilflos. Besonders große Angst hat sie vor der Reaktion ihres zukünftigen Ehemannes. Als dieser sie am Abend besucht, stellen sich diese Sorgen aber als unbegründet heraus.
Frau B.s psychischer Zustand bleibt labil. Sie braucht viel Unterstützung bei der Körperpflege und bei der Versorgung des Seitenausgangs. Sie schämt sich, dass sie so sehr auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ihr Selbstbild als selbstständige junge Frau ist schwer beeinträchtigt. Sie wird von Tag zu Tag verzweifelter und aggressiver gegenüber den Ärzten, dem Pflegepersonal und auch ihrem Verlobten. Sie versteht nicht, warum gerade sie so leiden muss. Besonders deprimiert ist sie nach Besuchen einer Freundin. Frau B. hat immer figurbetonte Kleidung getragen; damit, so glaubt sie, ist es nun vorbei.
In den folgenden Tagen will Frau B. sich in keiner Weise mit dem Seitenausgang aktiv auseinandersetzen. Ihre Gefühle schwanken zwischen Angst, Hilflosigkeit, Ekel und Wut. Sie macht sich Vorwürfe, weil sie die Symptome so lange ignoriert hat. Die geplante Hochzeit muss um ein halbes Jahr verschoben werden, und Frau B. schämt sich, ihren Verwandten den Grund zu nennen. In der Folge tritt zusätzlich eine Blasenentleerungsstörung auf. Frau B. befürchtet, dass bei der Operation die Blase verletzt worden ist. Sie sieht immer neue Komplikationen auf sich zukommen und keinen Weg zur Besserung. Als die Psychologin des Krankenhauses sie aufgrund ihrer schlechten psychischen Verfassung aufsucht, nimmt sie das Angebot einer psychologischen Unterstützung nach kurzem Zögern an.
Neben vielen negativen und belastenden Gefühlen treten im Krankheitsverlauf auch positive auf.
Sicherheit, Vertrauen
Patienten, die sich sicher fühlen, treten den Betreuern und dem Pflegepersonal vertrauensvoller entgegen als unsichere. Das fördert die Kooperation, ein angemessenes Krankheitsverhalten und eine erfolgreiche Krankheitsbewältigung.
Erleichterung, Dankbarkeit
Wenn Schmerzen nachlassen, Behinderungen zurückgehen und die Lebenskräfte und das Wohlbefinden wiederkehren, sind Patienten oft sehr erleichtert. Viele empfinden den Betreuern gegenüber Dankbarkeit, die sich z. B. in Abschiedsgeschenken für die Station ausdrücken kann. Für Patienten ist es wichtig, ihre Dankbarkeit äußern zu können, da es sich dabei um eine Art subjektiven Ausgleich für die erhaltene Pflege und Betreuung handelt.
Lebensfreude
Immer wieder haben Patienten Grund zur Freude: über eine für sie beruhigende Diagnose, über Behandlungserfolge, Fortschritte in der Rehabilitation, den letzten Kontrolltermin usw. Gegen Ende des Krankheitsprozesses kommt bei vielen Patienten allgemein die Lebensfreude wieder zurück, insbesondere wenn sie einen klaren Plan für die nächste Zeit sowie wirkungsvolle Unterstützung bei möglichen Schwierigkeiten haben.
4.3 Urvertrauen und Selbstwertgefühl
Neben den rasch wechselnden Stimmungen und länger anhaltenden Gefühlen (z. B. Freude über einen Erfolg, Angst vor einer Untersuchung, Trauer nach einem Verlust) bestimmen auch Grundgefühle die allgemeine Gefühlslage einer Person. Sie sind der emotionale „Hintergrund“ des alltäglichen Erlebens, z. B. allgemeine Lebensfreude, Ängstlichkeit oder Depression, optimistische Grundhaltung oder Schuldgefühle nach einem Unfall. Eine besondere Rolle spielen Urvertrauen und Selbstwertgefühl.
Das Urvertrauen entwickelt sich im ersten Lebensjahr. Jedes Baby erlebt sehr unangenehme Situationen. Es ist hungrig, hat Schmerzen, ängstigt sich, es ist ihm kalt oder langweilig – es schreit. Meistens kommt sehr rasch ein Erwachsener und „rettet“ das Baby. Die Menschen, die es aus seiner Not befreien, egal ob Eltern, Großeltern, ältere Geschwister oder Pflegepersonen, lassen bei ihm nach und nach den Eindruck entstehen: „Ich bin nicht allein. Wenn es mir schlecht geht, kommt jemand und hilft mir. Ich kann mich auf die anderen verlassen.“ Das umfassende Gefühl, das sich daran knüpft, ist das Urvertrauen (Erikson 1988). Die meisten Menschen machen in der frühen Kindheit die beschriebenen positiven Erfahrungen und entwickeln somit das Urvertrauen. Im späteren Leben ist es die Voraussetzung für Freundschaft, partnerschaftliche Liebe sowie Teamarbeit und Kooperation. Durch schwere Enttäuschungen oder Traumata kann es zwar erschüttert, jedoch kaum wirklich ausgelöscht werden.
Manche Menschen haben allerdings als Baby erlebt, dass ihnen nicht oder nur manchmal geholfen wurde, wenn sie aus Angst, Hunger, Schmerz usw. um Hilfe schrien. Diese Menschen bilden dann kein Urvertrauen, sondern das sogenannte Urmisstrauen aus. Sie hegen im weiteren Leben ein grundsätzliches Misstrauen der Welt und den Menschen gegenüber und tun sich mit Freundschaften und engeren sozialen Kontakten sehr schwer. In der Pflege ist das Urvertrauen eine wichtige psychische Ressource, die Patienten und Heimbewohner mitbringen. Wenn es nur gering ausgeprägt ist, neigen die Betroffenen zu Misstrauen und sozialem Rückzug. Ihrer Unterstützung sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Das Selbstwertgefühl ist ein Grundgefühl in dem Sinn, dass es uns das ganze Leben hindurch begleitet. Es drückt sich in Sätzen aus wie: „Ich bin wichtig. Ich bin etwas wert. Ich kann etwas. Was ich mache, ist in Ordnung.“ Dieses Gefühl entsteht aufgrund von Erfahrungen: wenn Handlungen zum Erfolg führen, wenn man Ziele erreicht, die man sich gesteckt hat, wenn man von anderen Menschen gelobt und geschätzt wird (Satir 2004).
Anders als das Urvertrauen ist das Selbstwertgefühl gewissen Schwankungen unterworfen. Man kann es mit dem Pegelstand in einem Gefäß vergleichen: Je nachdem, welche wichtigen Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht wurden, ob man Erfolge erzielt hat oder Niederlagen hinnehmen musste, steigt oder sinkt der Pegel des Selbstwertgefühls.
Menschen mit stark ausgeprägtem Selbstwertgefühl haben ein positives Bild von sich selbst. Sie äußern ihre Meinung und ihre Wünsche, stehen zu ihren Handlungen, können loben und Lob annehmen und sind nicht leicht zu kränken. Bei Schwierigkeiten und Problemen bleiben sie optimistisch und versuchen, eine gute Lösung für sich und andere zu finden. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl zweifeln an sich und ihren Fähigkeiten. Sie sind oft traurig und missmutig. Vor allem in schwierigen Situationen und Krisen tun sie sich schwer, trauen sich selbst wenig zu und fühlen sich abhängig von anderen Menschen oder dem Schicksal. Viele werden passiv und lassen sich gehen.
Krankheiten und Unfälle, aber auch normale Alterungsprozesse können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen („Ich bin nichts mehr wert“, „Ich falle allen zur Last“). In solchen Fällen sind psychosoziale Unterstützung und psychologische Hilfe sehr wichtig. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewusstmachung der eigenen körperlichen und psychischen Ressourcen sowie auf der Verdeutlichung von Fortschritten und Erfolgen beim Weg aus der Krise. Je früher neue positive Erfahrungen gemacht werden, desto schneller steigt das Selbstwertgefühl wieder.
Menschen mit ausgeprägtem Selbstwertgefühl achten auf sich und auf andere, erkennen ihre eigenen Bedürfnisse ebenso wie die anderer Menschen und können rasch darauf eingehen. Sie sind nicht egoistisch, sondern klar. Bei der Bewältigung ihrer Aufgaben geben sie nicht so bald auf und können zumeist auch anderen Menschen gut helfen.
4.4 Zusammenfassung
Gefühle werden durch Wahrnehmungen, Vorstellungen und Erinnerungen ausgelöst und von körperlichen Zuständen begleitet. Im Zusammenhang mit Krankheit treten häufig Angst, Scham, vermindertes Selbstwertgefühl, Traurigkeit, Ärger und Misstrauen, aber auch Sicherheit, Erleichterung und Freude auf. Die Dauer von Gefühlen ist sehr unterschiedlich. Von den Grundgefühlen kommen u. a. dem Urvertrauen und dem Selbstwertgefühl besondere Bedeutung zu.
5 Was wir wirklich wollen – Bedürfnisse und Motivation
Warum tun Menschen überhaupt etwas, und was sind die psychischen Ursachen für ihre Handlungen? Die Antwort auf diese Grundfrage liegt in den Bedürfnissen: Sie motivieren uns, Schwierigkeiten zu überwinden, Herausforderungen anzunehmen und immer wieder Neues zu wagen. Für eine gute Betreuung von Patienten und Heimbewohnern ist es unerlässlich, ihre Bedürfnisse zu kennen. Je genauer man weiß, was ein Mensch will und braucht, desto besser kann man auf ihn eingehen und ihn zu notwendigen Schritten motivieren, die er sich zunächst vielleicht nicht zugetraut hätte.
5.1 Die Bedürfnispyramide nach Maslow
Für eine differenzierte Erfassung der Bedürfnisse von Patienten und Heimbewohnern ist ein psychologisches Modell geeignet, das einer der großen Motivationsforscher des 20. Jahrhunderts entwickelt hat: die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow (siehe Abb. 5).
Maslow stellt zwei Arten von Motiven und Bedürfnissen einander gegenüber:
•Mangelbedürfnisse veranlassen uns, das physische und psychische Gleichgewicht zu halten bzw. wiederherzustellen.
•Wachstumsbedürfnisse veranlassen uns, Neues zu wagen und das hinter uns zu lassen, was wir in der Vergangenheit getan haben und gewesen sind.
Die einzelnen Bedürfnisse sind in Gruppen zusammengefasst und in einer Hierarchie geordnet. Selten sind einer Person alle ihre Bedürfnisse zugleich bewusst. Zumeist konzentriert sie sich auf diejenigen, die in der nächsten Zeit befriedigt werden sollen. Solange ein Bedürfnis unbefriedigt ist, beeinflusst es das Handeln. Die Befriedigung der niedrigeren Bedürfnisse hat zunächst Vorrang. Je höher ein Bedürfnis ist, desto weniger dringlich ist es für das bloße Überleben und umso länger kann seine Befriedigung zurückgestellt werden. Höhere Bedürfnisse sind subjektiv weniger drängend. Zugleich verschafft die Befriedigung höherer Bedürfnisse tiefes Glück, heitere Gelassenheit und inneren Reichtum.
Abb. 5: Bedürfnispyramide nach Maslow (1981)
Maslows Theorie der Bedürfnishierarchie hatte großen Einfluss auf Psychotherapie und Pädagogik. Das angeborene Bedürfnis, zu wachsen und die in einem selbst angelegten Möglichkeiten auszuschöpfen, ist die zentrale motivationale Kraft des Menschen. Daraus leitet sich als übergeordnetes Ziel jeder Behandlung – auch der Pflege – ab, das innere Potenzial, über das jeder Mensch verfügt, zu aktivieren. Die dabei gewonnene Kraft hilft, die Anforderungen des Lebens positiv zu meistern.
5.2 Bedürfnisse bei Krankheit
Die aktuellen Lebensumstände eines Menschen haben großen Einfluss darauf, welche Bedürfnisse in welche Ausprägung für ihn gerade im Vordergrund stehen. Bei Krankheit und physischer Einschränkung können allgemeine Bedürfnisse sehr spezifische Formen annehmen.
Die Bedürfnisse von Patienten sind vielfältig. Sie wollen mehr als bloß „Aufmerksamkeit“.
Physiologische und Sicherheitsbedürfnisse stehen zunächst im Vordergrund, z. B.
• das Bedürfnis, schmerzfrei zu sein
• das Bedürfnis nach einer guten medizinisch-pflegerischen Behandlung
• das Bedürfnis nach ausreichender und verständlicher Information
• das Bedürfnis, möglichst wieder gesund zu werden
Diese Bedürfnisse werden im Krankenhaus üblicherweise gut abgedeckt.
Soziale Bindungs- und Selbstachtungsbedürfnisse werden bei längerer Krankheit wichtig, z. B.
• das Bedürfnis, mit anderen über die eigene Lage (körperlich, psychisch, privat) reden zu können
• das Bedürfnis, in die Behandlung miteinbezogen zu werden und aktiv mitzumachen
• das Bedürfnis, als mündiger Patient und nicht als „Nummer“ behandelt zu werden
Besonders in der Rehabilitation sind Bindungs- und Selbstachtungsbedürfnisse zentral:
• Das Bedürfnis nach Leistung und Eigenständigkeit ist ein starker Motivator für das Wiedererlernen verlorener Fähigkeiten.
• Lob und Anerkennung verstärken die Motivation und bringen Zuversicht.
Selbstverwirklichung und spirituelle Bedürfnisse kommen bei lebensverändernden oder gar lebensbedrohenden Krankheiten hinzu, z. B.
• das Bedürfnis, den Lebensplan zu verwirklichen: Was will ich in meinem Leben erreichen oder unternehmen? Wie muss ich meine Pläne jetzt anpassen?
• das Bedürfnis nach Sinn: Welchen Sinn hat es, mich (weiter) behandeln zu lassen? Welchen Sinn hat mein Leben überhaupt?
• das Bedürfnis nach Ganzheit: Was habe ich noch zu erledigen, um mein Leben rund zu machen und abschließen zu können?
5.3 Emotionale Bedürfnisse
Aus den beobachteten Gefühlen von Patienten und Heimbewohnern (Kap. 4.2) kann man unmittelbar auf emotionale Bedürfnisse schließen. Auf diese können Pflegepersonen oft sehr direkt und mit einfachen Mitteln eingehen.
Emotionale Bedürfnisse
Angst
braucht
Sicherheit.
Scham
braucht
Intimsphäre.
Mutlosigkeit
braucht
Erfolgserlebnisse.
Verzweiflung
braucht
emotionale Unterstützung.
Wut
braucht
Ernstgenommenwerden.
Misstrauen
braucht
Entscheidungsmöglichkeiten.
Sicherheit geben
Ängstlichen Patienten kann Sicherheit auf verschiedene Weise vermittelt werden: durch ausreichende und verständliche Information, durch Hilfe bei der Regelung des Alltags, durch praktische Unterstützung bei Bewegungen, aber auch durch eine kurze Berührung, eine ruhige feste Stimmlage, Blickkontakt u. v. m.
Intimsphäre wahren
Die Wahrung der Intimsphäre ist in der Pflege besonders wichtig. Zur Reduzierung der Schamgefühle genügt es oft, wenn einfache Regeln eingehalten werden: anklopfen; ankündigen, wenn die Bettdecke zurückgeschlagen wird; nur die notwendigen Körperteile aufdecken; vor fremden Blicken abschirmen; Gespräche über persönliche Themen in einem ungestörten Raum führen usw.
Erfolgserlebnisse vermitteln
Mutlose oder pessimistische Patienten haben oft die Erfahrung gemacht, dass die Krankheit bzw. die Behandlung nicht so verläuft, wie sie erhofft haben. Hinzu kommen Folgebelastungen, mit denen sie scheinbar nicht fertig werden können. Diese Patienten brauchen Erfolgserlebnisse. Pflegepersonen können die Aufmerksamkeit des Patienten auf die täglichen oder wöchentlichen Fortschritte lenken, auch wenn diese klein und unscheinbar sind. Dabei sollten auch die Angehörigen miteinbezogen werden. Von ihnen hängt es wesentlich mit ab, wie sich ein Patient mit seinen (vorübergehenden oder bleibenden) Einschränkungen fühlt, ob er sie akzeptiert und wie er mit ihnen umgeht.
Emotionale Unterstützung bereithalten
Verzweiflung oder ein sehr starkes emotionales Tief kann bei vielen Patienten vorübergehend auftreten. In solchen Fällen ist es entscheidend, die Betroffenen mit ihren Gedanken und Gefühlen nicht alleinzulassen. Für eine intensivere Unterstützung fehlt Pflegepersonen allerdings oft die Zeit. Deshalb ist die Einbindung von Angehörigen, Psychologen, Seelsorgern und anderen Unterstützungspersonen wichtig (siehe Kap. 18). Bei Hinweisen auf Depression und andere psychische Störungen muss ein klinischer Psychologe, Psychiater oder Psychotherapeut hinzugezogen werden. Dieser stellt die Diagnose und führt eine dem Patienten entsprechende Behandlung durch. In die weitere psychologische Unterstützung ist oft auch das Pflegepersonal eingebunden.
Ärger ernst nehmen
Wer wütend ist, will ernst genommen werden. Patienten brauchen jemanden, der ihre Sorgen und Gefühle ernst nimmt und ihnen zuhört. Auch Ärger und Vorwürfe, die Ärzte, Pflegepersonen oder andere Betreuer betreffen, sollten in geeigneter Form geäußert werden können. Wichtig dabei ist, dass diese Äußerungen zunächst unkommentiert bleiben und der Patient nicht eingeschüchtert wird.
Entscheidungsmöglichkeiten bieten
Misstrauische Patienten haben häufig den Eindruck, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird, dass sie falsch oder unvollständig informiert werden, dass sie nicht jene Behandlung und Pflege erhalten, die notwendig wäre, etc. Es fehlt ihnen an Information und Entscheidungsmöglichkeiten. Ihr Misstrauen schwindet, wenn sie ihre Situation selbst mitbestimmen oder gestalten können. Wichtig sind dabei sowohl das tatsächliche Ausmaß der Kontrolle als auch der subjektive Eindruck, Entscheidungen treffen zu können.
Viele Patienten können schon durch ein einfaches Gespräch entlastet oder beruhigt werden. Am besten gelingt dies, wenn die aktuellen Bedürfnisse des Patienten erkannt und angesprochen werden. Das Eingehen auf die emotionalen Bedürfnisse erfordert eine gewisse Übung und innere Festigkeit. Diese können durch das Beobachten von Vorbildern (erfahrenen Pflegepersonen) und im Rahmen von Kommunikationstrainings erworben und erweitert werden.
5.4 Motivation
Motivieren heißt Bedürfnisse anzusprechen. Zu einer Handlung motiviert ist eine Person dann, wenn sie erwartet, dass dadurch ein für sie wichtiges Bedürfnis befriedigt wird.
Beispiel: Lernmotivation
Eine Person lernt dann intensiv, wenn sie glaubt, dass sie das Wissen später brauchen kann, z. B. um eine Prüfung zu bestehen. Dadurch kann sie zweierlei Bedürfnisse befriedigen: 1. Erfolg zu haben und 2. Misserfolg zu vermeiden. Wenn sie aber glaubt, durch Lernen weder einen Erfolg zu erzielen („Ich schaffe das nicht“) noch einen Misserfolg zu vermeiden („Es hat eh keinen Sinn“), ist sie auch nicht motiviert und wird sich, wenn überhaupt, nur sehr lustlos ans Lernen machen. Gleiches gilt für die Motivation von Patienten, die eine Diät einhalten, regelmäßig Medikamente einnehmen, körperliche Übungen durchführen sollen usw.
Die Befriedigung von Bedürfnissen wird im Allgemeinen als angenehm oder lustvoll erlebt. Dieses angenehme Gefühl wirkt verstärkend auf das Verhalten: Die Handlung, die zur Befriedigung des Bedürfnisses geführt hat, wird beim nächsten Mal wiederholt (siehe Kap. 7.3).
Wenn ein Bedürfnis trotz Bemühungen unbefriedigt bleibt, spricht man von Frustration oder Enttäuschung. Diese bewirkt zunächst einen unangenehmen Zustand von erhöhter Aktivierung: Manche Menschen werden aggressiv, andere strengen sich an, das Ziel doch noch zu erreichen. Wieder andere geben jedoch bald auf und resignieren. Welche Verhaltensweisen auftreten – Aggression, Leistungsbereitschaft oder Resignation -, hängt von der persönlichen Lerngeschichte ab. Eine Person wird jenes Verhalten zeigen, welches am ehesten zum Ziel geführt hat und mit welchem sie weitere Schwierigkeiten am besten zu vermeiden glaubt.
5.5 Reaktanz
Für die meisten Menschen ist es wichtig, sich in bestimmten Bereichen frei zu fühlen. Dabei geht es weniger um den objektiven Entscheidungsspielraum als um den subjektiven Eindruck von Freiheit: Kann ich selbst bestimmen, was ich will? Wie leicht kann ich ein Ziel erreichen? Wie viele Dinge behindern mich? Wie frei und ungezwungen kann ich zwischen mehreren Alternativen wählen? Je besser und zahlreicher diese Möglichkeiten sind, desto mehr Freiheit erlebt man.
Viele Patienten und Heimbewohner erfahren, dass sie in vielen Bereichen wenige bis gar keine Wahlmöglichkeiten haben. Schmerzen, Einschränkungen und Behinderungen lassen sich nicht immer beseitigen. Bei vielen Untersuchungen, Pflegemaßnahmen und Behandlungsmethoden wird ihre Zustimmung ungeprüft vorausgesetzt. Sie erleben immer wieder, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird, etwa wie lange sie im Krankenhaus bleiben, welche Behandlungen sie erhalten und welche nicht. Auch der normale Krankenhausalltag kann bereits als Einschränkung erlebt werden. Manche Patienten wissen nicht oder nur unzureichend, was eigentlich genau mit ihnen geschieht. Bei Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen kommen oft Einschränkungen der Sinne, des Gedächtnisses und des Bewegungsapparates hinzu: alles Faktoren, die die Bewohner in der Folge oft als „mürrisch“ oder „gereizt“ erscheinen lassen. Die Folge dieser Einschränkungen wird Reaktanz genannt (Brehm/Brehm 1981).
Reaktanz ist der unangenehme innere Spannungszustand, der entsteht, wenn die subjektive Freiheit bedroht oder eingeschränkt wird. Sie ist gekoppelt mit dem Bedürfnis, die bedrohte Freiheit zu schützen bzw. die verlorene Freiheit wiederzugewinnen.
Je wichtiger die bedrohte Freiheit für eine Person ist, umso stärker ist die Reaktanz. Auch das Ausmaß und die Dauer der Freiheitsbeschränkung spielen eine Rolle. Vor allem bei bleibenden Einschränkungen ist die Reaktanz oft heftig.
Beispiel
Frau M., eine alleinstehende ältere Dame, verletzt sich bei einem Sturz die Lendenwirbelsäule. Sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Nach einigen Untersuchungen und einem kurzen Gespräch mit dem behandelnden Arzt bekommt sie ein Gipsmieder angelegt, das sie die nächsten drei Monate tragen muss. Der Unfall ereignet sich Mitte Juni. In der Sommerhitze ist das Korsett sehr heiß, Frau M. schwitzt, kann sich aber weder waschen noch kratzen, wenn es sie juckt. Das Gipskorsett drückt sie in praktisch jeder Körperhaltung. Den Großteil des Sommers verbringt Frau M. in ihrem Haus. Sie muss mit vielen Freiheitsbeschränkungen fertigwerden: Wohlbefinden, Beweglichkeit und die Mobilität im Wohnort sind eingeschränkt, ihre Urlaubspläne hinfällig geworden. Sie hat Schmerzen und fühlt sich hässlich. Über die Behandlungsmethode (Gipskorsett) fühlt sie sich nur unzureichend informiert, Behandlungsalternativen wurden mit ihr nicht besprochen. Auch wie es nach den drei Monaten weitergehen wird, ist ihr unklar. Sie fühlt sich ausgeliefert und ohnmächtig.
Die Folgen von Reaktanz sind vielfältig:
1. Wiedergewinnen der verlorenen Freiheit, z. B. durch erhöhte Anstrengung und Ausdauer, durch Training, eventuell mit Unterstützung anderer.
Beispiel – Fortsetzung
Frau M. lernt in den ersten Wochen nach ihrem Sturz, sich in der Wohnung zu bewegen und, so gut es geht, den Haushalt eigenständig zu führen. Die Liegefläche ihres Bettes lässt sie sich höher stellen, sodass sie ohne Hilfe aufstehen kann.
2. Mit etwas möglichst Ähnlichem die Einschränkung wettmachen.