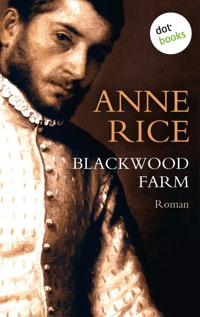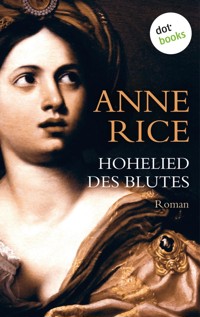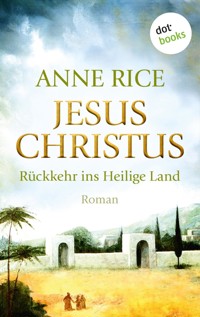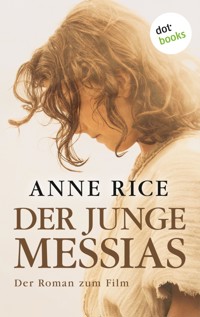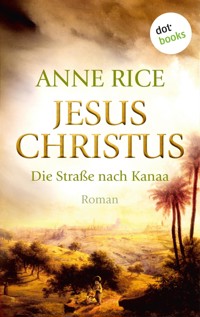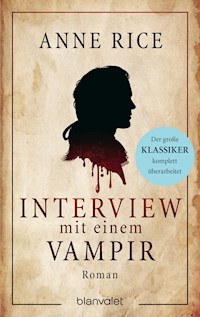
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Geständnisse eines Vampirs – die Romanvorlage der spektakulären Serie auf Sky.
Mit »Interview mit einem Vampir« transportierte Bestsellerautorin Anne Rice den klassischen Vampirroman in die Moderne und gab einem ganzen Genre eine neue Richtung. Plötzlich führten Vampire ein (Un)Leben jenseits aller Blutgier und waren nicht mehr nur übermächtige Wesen, die es zu bekämpfen galt. Stattdessen wurden sie zu Helden mit ihren eigenen Sorgen und Hoffnungen. Die Einführung des jungen, schönen Louis in die Welt der Untoten durch den düsteren, aber charismatischen Lestat ist bis heute unvergessen. Ein Vampir mit Gefühlen und einem Gewissen – seine Geständnisse sind mitreißend und schockierend, bewegend und unsterblich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Gerade erst fünfundzwanzig Jahre alt ist der hübsche, begehrenswerte Louis, als er im New Orleans des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts zum Vampir wird – »gezeugt« von Lestat de Lioncourt, dem unbelehrbaren Rebellen unter den Vampiren, dem gefallenen Engel mit den blauen Augen und dem blonden Haar. Und Lestat wird für Louis zum Lehrmeister, der ihn in die Welt des Übersinnlichen einführt und ihm mit dem Mädchen Claudia eine Vampirgefährtin schenkt. Als Louis und Claudia Lestat schließlich den Rücken kehren, beginnt für sie eine Reise durch die ganze Welt, auf der Suche nach anderen Untoten, nach Gefährten und Abenteuern in der ewigen dunklen Unsterblichkeit.
Autorin
Anne Rice wurde 1941 als Tochter irischer Einwanderer in New Orleans geboren. Sie ist Autorin zahlreicher Romane und gilt als Königin des modernen Schauerromans. Berühmt wurde sie mit ihrer »Chronik der Vampire«, einem Zyklus von jeweils vier in sich abgeschlossenen Romanen um den Vampir Lestat. Anne Rice lebt mit ihrer Familie in einem alten Landhaus in New Orleans.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
ANNE RICE
Interview mit einem Vampir
Roman
Deutsch von Karl Berisch und C. P. Hofmann
Die Originalausgabe erschien 1976 unter dem Titel »Interview with the Vampire« bei Knopf, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1976 by Anne Rice and The Stanley Travis Rice, Jr. Testamentary Trust
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
Copyright © der deutschen Übersetzung 1978 by Marion von Schröder in der Econ-Gruppe, Düsseldorf
Erschienen im Marion von Schröder Verlag
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
AF · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-28037-6V001
www.blanvalet.de
Erster Teil
Ich verstehe …«, sagte der Vampir nachdenklich und ging langsam durch das Zimmer zum Fenster. Dort blieb er eine Weile stehen. Seine Gestalt zeichnete sich vor dem trüben Licht ab, das von der Divisadero Street hereindrang und ab und zu durch die hellen Scheinwerfer der Autos verstärkt wurde. Der junge Mann konnte jetzt die Zimmereinrichtung deutlicher erkennen, den runden Eichentisch, die Stühle und ein Waschbecken an der Wand mit einem Spiegel darüber. Er platzierte seine Aktentasche auf dem Tisch und wartete.
»Wie viele Bänder hast du mitgebracht?«, fragte der Vampir und wandte den Kopf, sodass der junge Mann sein Profil sehen konnte. »Genug für die Geschichte eines Lebens?«
»Bestimmt, wenn es ein gutes Leben ist. Manchmal interviewe ich drei bis vier Leute an einem Abend, wenn ich Glück hab. Aber es muss eine gute Geschichte sein. Das ist nur recht und billig, nicht wahr?«
»Absolut«, antwortete der Vampir. »Dann will ich dir gern meine Lebensgeschichte erzählen. Ich werde es sehr gern tun.«
»Großartig«, sagte der junge Mann. Und er nahm schnell einen kleinen Kassettenrekorder aus der Tasche und legte eine Tonbandkassette ein. »Ich bin wirklich gespannt zu hören, warum Sie …«
»Moment«, unterbrach ihn der Vampir. »So können wir nicht beginnen. Ist dein Gerät in Ordnung?«
»Ja«, sagte der junge Mann.
»Dann setz dich. Ich will die Deckenbeleuchtung einschalten.«
»Ich dachte, Vampire mögen kein Licht«, entgegnete der junge Mann. »Zudem schafft die Dunkelheit eine Atmosphäre, die …« Er verstummte mitten im Satz.
Der Vampir betrachtete ihn scharf, den Rücken dem Fenster zugewandt. Das Gesicht war zwar nicht zu erkennen, doch etwas an der reglosen Gestalt verwirrte den jungen Mann. Er wollte etwas sagen, unterließ es jedoch, denn der Vampir trat bereits an den Tisch und griff nach der Schnur der Lampe.
Unvermittelt war das Zimmer in grelles gelbes Licht getaucht, und als der junge Mann zu dem Vampir aufblickte, tastete er unwillkürlich mit den Händen nach hinten, um sich an der Tischkante festzuhalten. »Großer Gott!«, flüsterte er und starrte den Vampir an.
Dessen Gesicht war ganz und gar weiß und glatt, als wäre es aus gebleichten Knochen geschnitzt, und unbewegt wie das einer Statue, die beiden leuchtend grünen Augen ausgenommen, die den jungen Mann ansahen wie Flammen in einem Totenschädel. Doch dann lächelte der Vampir fast wehmütig, und in der glatten, weißen Fläche seines Gesichts zeigten sich feine Linien, als hätte man sie hineingezeichnet. »Siehst du!«, sagte er leise.
Den jungen Mann schauderte, und er hob die Hand, wie um sich gegen ein übermächtiges Licht zu schützen. Sein Blick glitt langsam über den tadellos geschneiderten Rock, die langen Falten des Umhangs, die schwarze Seidenkrawatte und den glänzend weißen Kragen, der so weiß war wie das Fleisch des Vampirs. Er starrte auf das volle schwarze Haar, das in Wellen über den Ohren zurückgekämmt war, und auf die Locken, die den Rand des weißen Kragens kaum berührten. »Nun, möchtest du immer noch dein Interview?«, fragte der Vampir.
Der junge Mann öffnete den Mund, ohne einen Ton hervorzubringen. Er nickte. Dann sagte er endlich: »Ja.«
Der Vampir setzte sich langsam ihm gegenüber, beugte sich vor und sagte sanft, fast vertraulich: »Fürchte dich nicht. Lass einfach den Kassettenrekorder laufen.«
Und dann streckte er den Arm über den ganzen Tisch aus. Der junge Mann schrak zurück, und Schweiß lief ihm übers Gesicht. Der Vampir umklammerte die Schulter des jungen Mannes und sagte: »Ich tue dir nichts, glaub mir. Ich nutze nur die Gelegenheit, und die ist für mich wichtiger, als du dir jetzt vorstellen kannst. Bitte fang an.« Er zog die Hand zurück und blieb gefasst und abwartend sitzen.
Der junge Mann brauchte eine Weile, wischte sich erst mit einem Taschentuch über Stirn und Mund und stammelte dann, das Mikrophon sei bereit, drückte die Aufnahmetaste und erklärte, dass das Gerät liefe.
»Sie waren nicht immer Vampir, nicht wahr?«, begann er.
»Nein. Ich war ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren, als ich Vampir wurde, und es geschah im Jahre siebzehnhunderteinundneunzig.«
Der junge Mann war verblüfft und wiederholte die Jahreszahl, bevor er fragte: »Was ist damals passiert?«
»Darauf gibt es eine einfache Antwort. Aber ich möchte keine einfachen Antworten geben. Ich möchte lieber die Geschichte erzählen, so, wie sie sich ereignet hat.«
»Ja«, sagte der junge Mann schnell. Er faltete das Taschentuch mehrmals zusammen und wischte sich wieder über die Lippen.
»Es gab eine Tragödie«, begann der Vampir. »Mit meinem jüngeren Bruder … Er starb.« Daraufhin verstummte er.
Der junge Mann räusperte sich und wischte sich über das Gesicht, ehe er das Taschentuch fast ungeduldig wieder zurücksteckte. »Darüber zu reden, ist hoffentlich nicht schmerzhaft für Sie?«, fragte er schüchtern.
»Scheint es dir so? Nein.« Der Vampir schüttelte den Kopf. »Es ist nur, dass ich die Geschichte erst ein einziges Mal erzählt habe. Und das ist so lange her … Nein, es tut nicht weh … Damals lebten wir in Louisiana. Wir hatten Land zugeteilt bekommen und eine Indigoplantage am Mississippi, ganz in der Nähe von New Orleans …«
»Ach ja, Ihr Akzent«, sagte der junge Mann leise.
Einen Augenblick schaute der Vampir verständnislos drein. »Ich habe einen Akzent?« Er musste lachen.
Der junge Mann wurde rot und sagte schnell: »Ich hab es in der Bar gemerkt, als ich Sie gefragt habe, was für einen Beruf Sie ausüben. Es ist nur eine leichte Schärfe bei den Konsonanten. Ich hab nicht gewusst, dass es vom Französischen kommt.«
»Schon gut«, sagte der Vampir beruhigend. »Ich bin nicht so gekränkt, wie ich vorgebe. Es ist nur, dass ich es von Zeit zu Zeit vergesse. Aber lass mich weitererzählen.«
»Bitte«, sagte der junge Mann.
»Ich sprach von den Plantagen. Sie haben viel damit zu tun, ich meine, dass ich ein Vampir geworden bin, du kannst es mir glauben. Aber dazu komme ich noch. Unser Leben in Louisiana war luxuriös und primitiv zugleich. Wir selber fanden es außerordentlich angenehm. Wir lebten dort weit besser, als wir je in Frankreich hätten leben können. Vielleicht kam es uns in der völligen Wildnis von Louisiana auch nur so vor, aber so war es nun mal. Ich erinnere mich an die Möbel, die wir aus Frankreich mitgebracht hatten.« Der Vampir lächelte. »Und an das Cembalo, das war wunderbar. Meine Schwester spielte darauf. An Sommerabenden saß sie mit dem Rücken zur geöffneten Gartentür und verwöhnte uns mit ihrem musikalischen Können. Ich höre noch die dünnen, schnellen Töne, und ich sehe weit hinten die Sümpfe und die moosbewachsenen Zypressen vor dem dunklen Himmel. Und ich höre auch die Geräusche der Sümpfe, einen Chor von Tierstimmen, den Gesang der Vögel. Wir haben ihn geliebt, denn er machte die Musik noch zarter und liebreizender, die Möbel aus Rosenholz noch kostbarer. Sogar als die Glyzinien in weniger als einem Jahr die Fensterläden überwucherten und ihre Ranken in die weiß getünchten Ziegel gruben … Ja, wir liebten das, wir alle. Außer meinem Bruder. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals klagen hörte, doch ich wusste, was er empfand. Mein Vater war schon tot, und ich war das Haupt der Familie und musste meinen Bruder stets vor Mutter und meiner Schwester in Schutz nehmen. Sie wollten ihn immer nach New Orleans mitnehmen, auf Besuche und Gesellschaften, doch er hasste dergleichen. Ich glaube, er hat sie nicht mehr begleitet, seit er zwölf wurde. Das Gebet war ihm alles, das Gebet und seine in Leder gebundenen Heiligengeschichten.
Schließlich richtete ich ihm eine kleine Kapelle außerhalb des Hauses ein, und dort verbrachte er seitdem den größten Teil des Tages und oft auch noch den frühen Abend. Es war eine wirkliche Ironie – er war so anders als wir, so verschieden von jedermann, und ich war so normal! Ich hatte überhaupt nichts Ungewöhnliches an mir.«
Der Vampir lächelte erneut.
»Manchmal ging ich abends zu ihm und fand ihn im Garten neben der Kapelle, ruhig und gelassen auf einer Steinbank, und ich erzählte ihm von meinen Sorgen, den Schwierigkeiten, die ich mit den Sklaven hatte, und wie ich dem Aufseher misstraute oder dem Wetter oder meinen Agenten … all die Kümmernisse, die mein Dasein erfüllten. Und er hörte mir zu und machte nur hier und da eine Bemerkung, immer voller Verständnis, sodass ich, wenn ich ihn verließ, das Gefühl hatte, er hätte alle Probleme für mich gelöst. Ich hätte ihm nichts abschlagen können, und ich schwor mir, ihn Priester werden zu lassen, sobald die Zeit gekommen sei, einerlei, ob mein Herz brechen würde, wenn ich ihn verlöre. Natürlich lag ich damit falsch.« Der Vampir hielt inne.
Einen Augenblick lang starrte ihn der junge Mann nur wie in Gedanken versunken an, dann fragte er stockend, so als würde er nicht die richtigen Worte finden: »Ah, er wollte gar nicht Priester werden?«
Der Vampir musterte ihn, als wollte er die Miene des anderen ergründen. »Ich meinte, ich habe mich in mir selbst geirrt – dass ich ihm nichts abschlagen könnte.« Sein Blick schweifte über die gegenüberliegende Wand und blieb am Fenster haften. »Er hatte auf einmal Visionen.«
»Richtige Visionen?«, fragte der junge Mann, erneut zögerlich, so als ginge er einem anderen Gedanken nach.
»Natürlich glaubte ich es damals nicht«, antwortete der Vampir. »Es fing an, als er fünfzehn war. Damals war er sehr hübsch. Er hatte eine Haut wie Seide und ganz große blaue Augen. Er war kräftig, nicht so dünn, wie ich heute bin und damals schon war. Doch seine Augen … wenn ich in seine Augen schaute, war es, als stünde ich allein am Rande der Welt … an einer winddurchwehten Meeresküste, und da wäre nichts als das sanfte Brausen der Wellen.
Ja«, fuhr er fort, den Blick noch immer auf das Fenster gerichtet, »er hatte Visionen. Zuerst deutete er es nur an, und dann erschien er eines Tages nicht mehr zu den Mahlzeiten. Er lebte ganz in der Kapelle. Zu jeder Tages- und Nachtstunde konnte ich ihn dort finden, wo er auf den nackten Fliesen vor dem Altar kniete. Nicht nur sich selbst, auch die Kapelle vernachlässigte er, kümmerte sich nicht mehr um die Kerzen, wechselte die Altartücher nicht und entfernte auch die welken Blätter nicht mehr. Einmal bekam ich es mit der Angst zu tun, als ich im Laubengang stand und ihn eine volle Stunde beobachtete, während der er sich nicht von den Knien erhob und nicht einmal die Arme senkte, die er wie ans Kreuz genagelt ausgestreckt hielt. Die Sklaven hielten ihn alle für verrückt.«
Der Vampir legte bekümmert die Stirn in Falten. »Doch ich war überzeugt, dass er nur … übereifrig war, vielleicht zu weit gegangen in seiner Liebe zu Gott. Dann sprach er mit mir über seine Visionen. Der heilige Dominik und die Jungfrau Maria wären zu ihm in die Kapelle gekommen, sie hätten ihn geheißen, unseren ganzen Besitz in Louisiana zu verkaufen, alles, was uns gehörte, und das Geld dazu zu verwenden, Gottes Werk in Frankreich zu tun. Mein Bruder sollte ein großer religiöser Führer werden, er sollte gegen den Atheismus und die Revolution kämpfen und das Land zu seinem früheren Glauben zurückführen. Natürlich besaß er kein eigenes Geld, daher sollte ich die Plantage und unsere Stadthäuser in New Orleans verkaufen und ihm das Geld geben.«
Der Vampir verstummte, und der junge Mann saß regungslos da und betrachtete ihn erstaunt. »Ach … entschuldigen Sie«, flüsterte er schließlich. »Was sagten Sie? Haben Sie die Plantage verkauft?«
»Nein«, sagte der Vampir. Sein Gesicht war ruhig wie zu Anfang. »Ich habe ihn ausgelacht. Und er … er wurde zornig. Er beteuerte, sein Auftrag käme von der Heiligen Jungfrau selbst. Und wer sei ich, dass ich einen solchen Auftrag missachten könne? In der Tat, wer war ich?«, fragte er leise, als ob er sich dessen wieder besänne. »Wer war ich wirklich? Je mehr er mich zu überzeugen versuchte, desto mehr lachte ich. Es sei Unsinn, sagte ich ihm auf den Kopf zu, die Ausgeburt eines unreifen und kranken Gemüts. Die Kapelle sei ein Fehler gewesen, sagte ich, ich würde sie sofort niederreißen lassen, er werde in New Orleans zur Schule gehen und sich solche sinnlosen Fantastereien aus dem Kopf schlagen. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, was ich sagte, aber ich weiß noch, was ich fühlte. Hinter all meinem Zorn und meiner Ablehnung schwelten Verbitterung und Enttäuschung. Ja, ich war bitter enttäuscht, und ich glaubte ihm kein bisschen.«
»Das ist doch verständlich«, sagte der junge Mann schnell, als der Vampir innehielt. »Ich meine … wer hätte ihm geglaubt?«
»Ist es tatsächlich so verständlich?« Der Vampir sah den jungen Mann an. »Vielleicht war es nur abscheuliche Selbstsucht. Ich will es dir erklären. Wie ich dir sagte, liebte ich meinen Bruder, und manchmal hielt ich ihn wirklich für einen Heiligen, einen lebenden Heiligen. Und wie ich dir sagte, habe ich ihn in seinen Gebeten und Meditationen bestärkt und war bereit, ihn Priester werden zu lassen. Und wenn mir jemand von einem Heiligen in Arles oder Lourdes erzählt hätte, der Visionen hätte, so hätte ich es geglaubt. Ich war Katholik, ich glaubte an Heilige. Ich zündete Kerzen vor ihren Marmorstatuen in den Kirchen an, ich kannte ihre Namen, ihre Bilder, ihre Attribute. Doch ich konnte meinem Bruder nicht glauben. Nicht nur, dass ich nicht glaubte, dass er Visionen hatte, nicht einmal die Vorstellung kam auch nur einen Augenblick lang in Betracht. Warum nicht? Weil er mein Bruder war. Heilig mochte er sein, ohne Zweifel, aber kein Franz von Assisi. Mein Bruder nicht. Kein Bruder von mir konnte so etwas sein. Und das ist Selbstsucht, verstehst du?«
Der junge Mann dachte nach, ehe er antwortete, und dann nickte er und sagte, ja, er glaube, er könne das verstehen.
»Vielleicht hat er wirklich Visionen gehabt«, sagte der Vampir.
»Dann können Sie … dann können Sie auch jetzt nicht sagen, ob er welche hatte oder nicht?«
»Nein, aber ich weiß, dass er nie einen Augenblick in seiner Überzeugung schwankte. Das weiß ich jetzt und wusste es an jenem Abend, als er aufgebracht und tief bekümmert mein Zimmer verließ. Er hat nie einen Augenblick geschwankt. Und wenige Minuten später war er tot.«
»Wie kam das?«, fragte der junge Mann.
»Er ging durch die Glastür auf die Terrasse hinaus und blieb kurz vor der Steintreppe stehen. Und dann stürzte er. Er war tot, als ich ihn erreichte.« Der Vampir schüttelte bekümmert den Kopf, doch seine Miene blieb gelassen.
»Haben Sie ihn fallen sehen?«, fragte der junge Mann. »Hat er das Gleichgewicht verloren?«
»Nein, aber zwei Diener sahen es und sagten, er habe nach oben geschaut, als hätte er etwas am Himmel erblickt. Dann habe sich sein Körper nach vorne bewegt, wie von einem Windhauch getrieben. Er habe etwas sagen wollen, als er stürzte. Und auch ich glaubte, er hat etwas sagen wollen, doch ich stand gerade mit dem Rücken zum Fenster, als es geschah.« Er warf einen schnellen Blick auf den Kassettenrekorder. »Ich konnte es mir nicht verzeihen, ich fühlte mich schuldig an seinem Tod«, sagte er. »Und alle anderen dachten ebenso.«
»Aber wie konnten sie? Sagten Sie nicht, die Diener hätten ihn stürzen sehen?«
»Es war keine direkte Anklage. Die anderen wussten nur, dass etwas zwischen uns vorgefallen war, dass wir wenige Minuten vor dem Sturz miteinander gestritten hatten. Die Dienstboten hatten uns gehört, meine Mutter hatte uns gehört. Und meine Mutter fragte mich unaufhörlich, was zwischen uns vorgefallen sei, und wieso mein sonst so ruhiger Bruder die Beherrschung verloren hatte. Meine Schwester stimmte mit ein, aber ich weigerte mich, etwas zu sagen. Ich war so erschüttert und unglücklich, dass ich niemanden um mich herum ertragen konnte. Ich war nur fest entschlossen, nichts von seinen ›Visionen‹ zu äußern. Sie sollten nicht wissen, dass er letztlich kein Heiliger, sondern nur ein … Fanatiker gewesen war.
Meine Schwester zog es vor, sich ins Bett zu legen, statt zur Beerdigung zu gehen, und meine Mutter erzählte in der ganzen Kirchengemeinde herum, dass sich in meinem Zimmer etwas Schreckliches zugetragen habe und ich nichts verraten wolle. Ich wurde sogar von der Polizei vernommen, da meine eigene Mutter darauf bestand. ›Es war nur ein Streit‹, sagte ich, ›und ich bin nicht auf der Terrasse gewesen, als er stürzte‹, beteuerte ich. Alle sahen mich an, als hätte ich meinen Bruder umgebracht. Und mir war ganz so, als hätte ich es getan.
Zwei Tage lang saß ich neben seinem Sarg, erfüllt von dem Gedanken, ihn getötet zu haben. Ich starrte in sein Gesicht, bis es vor meinen Augen verschwamm und ich fast das Bewusstsein verlor. Seine Schädeldecke war auf dem Steinboden zerschmettert, und der Kopf auf dem Kissen war seltsam verformt. Ich zwang mich, ihn genau anzublicken, obwohl ich die Qual und den Geruch der Verwesung kaum ertragen konnte, und dachte, er würde jeden Moment die Augen aufschlagen. Es waren wahnwitzige Gedanken, wahnwitzige Anwandlungen, die mich überkamen. Vor allem musste ich daran denken: Ich hatte ihn ausgelacht, ich hatte ihm nicht geglaubt, ich war grässlich zu ihm gewesen. Ich war schuld daran, dass er zu Tode gestürzt war.«
»Das ist wirklich geschehen, nicht wahr?«, flüsterte der junge Mann. »Sie erzählen mir doch … die Wahrheit?«
»Ja«, erwiderte der Vampir und blickte ihn ruhig an. »Und ich möchte weitererzählen.« Sein Blick huschte wieder zum Fenster, scheinbar ohne Interesse für den jungen Mann, der einen inneren Kampf auszufechten schien.
»Aber Sie sagten, dass Sie sich über die Visionen nicht im Klaren waren, dass Sie selbst jetzt, als Vampir, nicht genau wissen, ob …«
»Ich möchte alles der Reihe nach erzählen«, sagte der Vampir, »so wie es sich zugetragen hat. Nein, ich war mir über die Visionen nicht im Klaren. Das bin ich bis heute nicht.«
Er wartete, bis der junge Mann sagte: »Bitte fahren Sie fort.«
»Also … ich wollte die Plantage verkaufen. Ich wollte das Landhaus und die Kapelle nie wieder sehen. Schließlich verpachtete ich die Plantage an eine Agentur, die sie für mich verwaltete, sodass ich mich nicht mehr darum kümmern musste, und zog mit Mutter und meiner Schwester in eins unserer Häuser in New Orleans. Natürlich konnte ich dadurch meinem Bruder nicht einen Augenblick entrinnen. Ich konnte an nichts anderes denken als an seinen Leib, der in der Erde verfaulte. Er wurde auf dem Friedhof von St. Louis in New Orleans begraben. Ich betrat den Friedhof nie, doch immer musste ich an meinen Bruder denken. Nüchtern oder betrunken, ich sah stets seinen Leib im Sarg verfaulen und konnte es nicht ertragen. Immer wieder träumte ich, wie er oben auf der Treppe der Terrasse stand, dass ich ihn am Arm hielt und freundlich auf ihn einredete, ihn bat, ins Zimmer zurückzukehren, und ihm sanft sagte, ich glaube ihm und er müsse für mich beten, damit mir Zuversicht zuteilwerde.
Mittlerweile behaupteten die Sklaven auf Pointe du Lac (das war meine Plantage), sie hätten den Geist meines Bruders auf der Terrasse gesehen. Sie wurden unruhig, und der Aufseher konnte keine Ordnung unter ihnen halten. Die Leute in der Stadt stellten meiner Schwester zudringliche Fragen über den Vorfall, und sie verhielt sich hysterisch. Sie war nicht wirklich hysterisch, sie dachte einfach, dass sie so reagieren sollte, also tat sie es. Ich trank die ganze Zeit und hielt mich so wenig wie möglich zu Hause auf. Ich lebte wie ein Mensch, der sterben will, aber nicht den Mut hat, sich selber das Leben zu nehmen. Ich streifte allein durch finstere Straßen und Gassen und versackte in Nachtlokalen. Zwei Duellen wich ich aus, nicht aus Feigheit, sondern aus Gleichgültigkeit, denn eigentlich wünschte ich mir ja den Tod. Und dann wurde ich überfallen. Es hätte jedermann sein können, und es waren genug in der Stadt – Seeleute, Straßenräuber, Mordgesindel. Aber es war ein Vampir. Er griff mich eines Nachts nur wenige Schritte vor meiner Haustür an und ließ mich tot zurück, so dachte ich jedenfalls.«
»Sie meinen … er hat Ihnen das Blut ausgesaugt?«, fragte der junge Mann.
»Ja.« Der Vampir lachte. »Er hat mein Blut getrunken. So wird es gemacht.«
»Aber Sie sind am Leben geblieben?«, fragte der junge Mann. »Sie sagten, er habe Sie tot zurückgelassen.«
»Ja, er hat mein Blut getrunken, bis ich fast tot war. Als man mich fand, brachte man mich ins Haus und ins Bett. Ich war verstört und wusste nicht recht, was mit mir geschehen war. Ich dachte, mich habe in der Trunkenheit der Schlag getroffen. Ich war bereit zu sterben und lag apathisch da, ohne zu essen oder zu trinken oder mit dem Arzt zu sprechen. Meine Mutter ließ den Priester holen. Ich fieberte und erzählte ihm alles, was für Visionen mein Bruder gehabt und was ich getan hatte. Ich klammerte mich an seinen Arm und ließ ihn schwören, es niemandem zu verraten. Ich wüsste, dass ich ihn nicht umgebracht habe, sagte ich dem Priester, aber ich könne nicht weiterleben, nachdem er gestorben sei. Nicht, nachdem ich so zu ihm gewesen war.
›Das ist lächerlich‹, sagte der Priester. ›Natürlich können Sie weiterleben. Sie dürfen sich nicht gehen lassen. Ihre Mutter und Schwester brauchen Sie. Und was Ihren Bruder betrifft, so war er vom Teufel besessen.‹
Als der Priester dies sagte, war ich so bestürzt, dass ich nicht widersprechen konnte. Die Visionen wären Teufelswerk gewesen, fuhr er fort. Der Teufel gehe um, würde den Menschen Lügen einflüstern, ganz Frankreich stehe mittlerweile unter seinem Einfluss, und die Revolution wäre sein größter Triumph. Nur Exorzismus, Gebete und Fasten hätten meinen Bruder retten können. Es hätten ihn starke Männer festhalten müssen, während der Teufel in ihm wütete und ihn zu bezwingen versuchte. ›Der Teufel hat ihn die Treppe hinabgestürzt, daran besteht kein Zweifel‹, erklärte er. ›Nicht zu Ihrem Bruder haben Sie in diesem Zimmer gesprochen, sondern zum Teufel.‹
Darüber geriet ich in Wut. Ich hatte gedacht, ich wäre am Ende meiner Kräfte, doch dem war nicht so. Als der Priester weiter vom Teufel schwatzte, über Voodoo-Zauber unter den Sklaven und von Fällen von Besessenheit in anderen Teilen der Welt, verlor ich die Fassung und hätte beinahe die Zimmereinrichtung zertrümmert, während ich versuchte, ihn zu erwürgen.«
»Woher nahmen Sie diese Kraft?«, fragte der junge Mann. »Sie waren noch kein Vampir, oder?«
»Ich war völlig außer mir«, erklärte der Vampir, »und tat Dinge, die ich in gesundem Zustand nicht fertiggebracht hätte. Ich habe die Szene nur noch verworren und blass in Erinnerung, doch ich weiß noch, dass ich den Priester durch den Hinterausgang aus dem Haus und über den Hof jagte und dass ich seinen Kopf gegen die Mauer schlug, bis er fast tot war. Als man mich schließlich gebändigt hatte, zu Tode erschöpft, ließ man mich zur Ader. Diese Narren. Aber ich wollte etwas anderes sagen, nämlich, dass ich in diesem Augenblick meine eigene Überheblichkeit erkannte. Vielleicht hatte ich einen Abglanz davon in dem Priester erkannt. Seine verachtungsvolle Haltung meinem Bruder gegenüber spiegelte meine eigene wider, seine vorschnelle und oberflächliche Verurteilung meines Bruders war ebenso die meinige gewesen, und ebenso verhielt es sich mit seinem Unverständnis hinsichtlich des Gedankens, dass uns vielleicht echte Heiligkeit so nahe gewesen war.«
»Aber er hat geglaubt, Ihr Bruder wäre vom Teufel besessen gewesen. Also war er doch ein frommer Mann.«
»Ist das denn nicht eine ziemlich weltliche Vorstellung?«, entgegnete der Vampir sogleich. »Leute, die nicht mehr an Gott oder an das Gute glauben, glauben immer noch an den Teufel, auch wenn ich nicht weiß, warum. Doch, ich weiß es. Das Böse ist immer möglich, das Gute ist unendlich schwieriger zu begreifen. Du musst verstehen: Zu sagen, einer wäre vom Teufel besessen, ist nur eine andere Bezeichnung dafür, dass der Betreffende verrückt sei. Ich begriff, dass es für den Priester so war. Ich bin überzeugt, dass er dies alles als Wahnsinn empfunden hat. Ja, ich bin mir sicher, der Priester hat meinen Bruder für wahnsinnig gehalten und es nur Besessenheit genannt. Man braucht ja den Teufel nicht zu sehen, um ihn auszutreiben. Aber die Anwesenheit eines Heiligen zu erkennen … zu glauben, dass der Heilige eine Vision gehabt hat … Ist es nicht Überheblichkeit, davon auszugehen, dass so etwas unter uns unmöglich wäre.«
»So habe ich das noch nie gesehen«, gestand der junge Mann. »Aber was wurde aus Ihnen? Sie sagten, man hat Sie zur Ader gelassen, um Sie zu kurieren, aber das muss Sie ja fast umgebracht haben.«
Der Vampir lachte. »Ja. Fast. Doch der Vampir kam in der Nacht zurück. Er wollte Pointe du Lac haben, weißt du, meine Plantage.
Es war sehr spät, und meine Schwester war an meinem Bett eingeschlafen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Er kam vom Garten herein, öffnete lautlos die Glastür, ein großer, hellhäutiger Mann mit vollem blondem Haar und anmutigen, fast katzenhaften Bewegungen. Leise und unauffällig drehte er die Lampe herunter und legte meiner Schwester ein Tuch über die Augen, und sie rührte sich nicht bis zum Morgen. Aber in der Zeit hatte ich mich sehr verändert.«
»Wie war die Veränderung?«, fragte der junge Mann.
Der Vampir seufzte, lehnte sich im Stuhl zurück und starrte die Wand an. »Zuerst dachte ich, es wäre ein anderer Arzt oder jemand, den die Familie gebeten hatte, mich zur Vernunft zu bringen. Doch ich merkte alsbald, dass es kein gewöhnlicher Mensch war. Er trat an mein Bett, beugte sich über mich, sodass die Lampe sein Gesicht erhellte. Seine grauen Augen glühten, und die langen weißen Hände, die ihm an den Seiten herabhingen, waren nicht die eines menschlichen Wesens. Ich glaube, in diesem Augenblick wusste ich alles, und was er zu mir sagte, war nur die Bestätigung. Sobald ich ihn sah, seine ungewöhnliche Aura spürte und wusste, dass er keinem Wesen glich, das ich je gekannt hatte, schrumpfte ich zu nichts zusammen. Das Ich, das die Anwesenheit eines ungewöhnlichen menschlichen Wesens nicht hatte ertragen können, war zermalmt. Alle meine Vorstellungen, sogar mein Schuldbewusstsein und mein Wunsch zu sterben, schienen höchst unwichtig geworden. Ich vergaß mich völlig.«
Der Vampir schlug sich mit der Faust gegen die Brust. »Ich vergaß mich ganz und gar. Und im gleichen Moment war mir die Bedeutung der Möglichkeiten völlig bewusst. Von diesem Augenblick an erlebte ich Wunder über Wunder. Als der Mann zu mir sprach und sagte, was ich werden könne und welcher Art sein Leben war und immer bleiben würde, zerfiel meine Vergangenheit zu Asche. Ich sah mein bisheriges Dasein, als stünde ich daneben – die Eitelkeit, all den Eigennutz, die ständige Flucht von einem nichtigen Verdruss zum nächsten, der Lippendienst an der Jungfrau Maria und den zahllosen Heiligen, deren Namen meine Gebetbücher füllten und von denen nicht einer mein beschränktes, materialistisches und selbstsüchtiges Dasein zu ändern vermochte. Ich erkannte meine wahren Götter – die Götter der meisten Menschen: Essen, Trinken, Sicherheit in der Eintönigkeit. Asche, Asche …«
Das Gesicht des jungen Mannes zeigte Erstaunen und Verwirrung. »Und da haben Sie beschlossen, ein Vampir zu werden?«, fragte er.
Der Vampir schwieg für einen Moment.
»Beschlossen … es scheint mir nicht das rechte Wort. Zwar könnte ich nicht sagen, es sei zwangsläufig gewesen, von dem Augenblick an, da er ins Zimmer trat. Nein, es war nicht zwangsläufig. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich es beschlossen hätte. Lass es mich so ausdrücken: Als er zu Ende gesprochen hatte, gab es für mich keine andere Entscheidung, und ich ging meinen Weg ohne einen Blick zurück. Mit einer Ausnahme.«
»Und die war?«
»Mein letzter Sonnenaufgang«, sagte der Vampir. »An jenem Morgen war ich noch kein Vampir. Und ich sah zum letzten Mal die Sonne aufgehen.
Ich weiß es noch ganz deutlich; an keinen Sonnenaufgang zuvor kann ich mich derart erinnern. Das Licht kam zuerst durch die obersten Scheiben der Glastüren, ein blasser Schein hinter den Spitzenvorhängen, und dann wurden die Flecken zwischen den Blättern der Bäume heller und heller. Schließlich leuchtete die Sonne voll durch die Fenster, und die Spitzen warfen ein Schattenmuster auf den Steinfußboden und den vom Tuch abgedeckten Kopf und die Schultern meiner Schwester, die noch immer neben meinem Bett saß. Als sie die Wärme spürte, schob sie das Tuch fort, ohne wirklich zu erwachen, und die Sonne funkelte kurz in ihren Augen, bevor sie diese wieder schloss. Ich fühlte die Strahlen auf meinen Händen, die auf der Bettdecke lagen, und dann in meinem Gesicht.
Ich dachte über all das nach, was der Vampir mir erzählt hatte, und dann sagte ich dem Sonnenaufgang ›Lebe wohl!‹ und wurde zum Vampir. Es war … der letzte Sonnenaufgang.«
Der Vampir blickte wieder aus dem Fenster. Und nachdem er verstummt war, wirkte sein Schweigen so tief, dass der junge Mann es zu hören glaubte. Dann vernahm er Geräusche von der Straße. Ein Lastwagen machte einen derart ohrenbetäubenden Lärm, dass die Schnur der Lampe von der Erschütterung zitterte. Dann war der Wagen vorübergefahren.
»Vermissen Sie ihn?«, fragte der junge Mann mit zaghafter Stimme. »Den Sonnenaufgang, meine ich?«
»Eigentlich nicht«, antwortete der Vampir. »Es gibt so viel anderes. Aber … wo waren wir stehen geblieben? Ja, du wolltest wissen, wie es vor sich ging, als ich ein Vampir wurde.«
»Ja«, sagte der junge Mann. »Wie war es, als Sie sich verwandelt haben?«
»Genau kann ich es nicht sagen«, sagte der Vampir. »Ich kann darüber sprechen, kann es mit Worten umkleiden, die dir offenkundig machen, was es für mich bedeutete. Aber ich kann es nicht genau berichten, ebenso wenig wie ich dir die Liebe schildern könnte, wenn du sie nicht selber erlebt hast.«
Dem jungen Mann schien noch eine weitere Frage einzufallen, doch ehe er sie stellen konnte, fuhr der Vampir fort: »Wie ich dir schon sagte, hatte es dieser Vampir – Lestat war sein Name – auf die Plantage abgesehen. Ein sehr banaler Grund, zweifellos, um mir ein Leben zu gewähren, das bis ans Ende aller Tage andauern soll. Doch er war nicht sehr scharfsinnig. Er betrachtete die kleine Schar der Vampire auf dieser Welt nicht als einen exklusiven Klub, möchte ich sagen. Er hatte sehr menschliche Sorgen – einen blinden Vater, den er pflegen musste und der nicht wusste und nicht erfahren durfte, dass sein Sohn ein Vampir war. Das Leben in New Orleans war ihm unter diesen Umständen zu schwierig geworden, und er wollte Pointe du Lac haben.
Am nächsten Abend fuhren wir sogleich zur Plantage hinaus, brachten den blinden Vater in einem Schlafzimmer des Hauses unter, und ich bereitete mich auf die Verwandlung vor.
Ich könnte nicht sagen, dass sie aus bestimmten Schritten bestand – obwohl es an einem gewissen Punkt natürlich keine Rückkehr mehr gab. Aber es waren verschiedene Dinge zu tun, und das erste war der Tod des Aufsehers. Lestat überwältigte ihn im Schlaf. Ich musste zusehen und es gutheißen, was heißt, Zeuge sein, wie ein menschliches Leben ausgelöscht wurde, als Beweis meiner Bindung und Teil meiner Verwandlung. Dies erwies sich als der schwierigste Punkt für mich. Wie ich dir schon sagte, hatte ich keine Angst vor dem eigenen Tod, nur eine gewisse Scheu, mir selber das Leben zu nehmen. Doch hatte ich die höchste Achtung vor dem Leben anderer, und seitdem mein Bruder gestorben war, flößte der Tod mir Schrecken ein. Nun musste ich mit ansehen, wie der Aufseher beim Erwachen zusammenfuhr, Lestat mit beiden Händen abzuwehren suchte und dann unter seinem Zugriff verzweifelt kämpfte, bis sein Leib schließlich erschlaffte, entleert, blutlos. Er starb, doch er war nicht sofort tot. Wir standen eine gute Stunde in dem engen Schlafzimmer und sahen ihm beim Sterben zu. Es gehörte zu meiner Verwandlung, wie ich sagte, und danach mussten wir uns des Toten entledigen, was mir fast den Magen umdrehte. Ich war schon schwach und fiebrig und am Ende meiner Kräfte. Der Umgang mit der Leiche verursachte mir Übelkeit. Lestat lachte und sagte gefühllos, wenn ich erst ein Vampir wäre, würde auch ich darüber lachen. Aber darin täuschte er sich. Ich lache nie im Angesicht des Todes, sooft ich auch selber die Ursache bin.
Doch alles der Reihe nach. Wir mussten über die Straße am Fluss fahren, bis wir auf das offene Feld gelangten, wo wir den toten Aufseher niederlegten. Wir nahmen ihm sein Geld, zerrissen ihm die Kleidung und benetzten seine Lippen mit Branntwein. Ich kannte seine Frau, die in New Orleans wohnte, und wusste, wie verzweifelt sie sein würde, wenn man die Leiche fand. Noch mehr als die Sorge um ihr Schicksal schmerzte mich, dass sie nie erfahren würde, was geschehen war, dass ihr Mann nicht betrunken auf der Straße ausgeraubt worden war.
Während wir auf den Körper einschlugen und das Gesicht und den Leib übel zurichteten, packte mich mehr und mehr eine seltsame Erregung, und Lestat kam mir vor wie ein überirdisches Wesen, wie ein biblischer Engel. Doch war dies auch eine Art Probe. Meine Verwandlung hatte sich bisher unter zwei Aspekten vollzogen. Der erste war eine Art Verzauberung, als mich Lestat auf dem Sterbebett überwältigt hatte. Der andere war mein Wunsch nach Selbstvernichtung, mein Verlangen nach totaler Verdammung, und dies war die offene Tür, durch die Lestat in mein Dasein getreten war. Doch jetzt zerstörte ich nicht mich selber, sondern einen anderen, den Aufseher und dazu seine Frau, seine Familie. Ich schrak zurück, als mir dies klar wurde, und ich wäre Lestat womöglich entflohen, hätte er nicht mit untrüglichem Instinkt gefühlt, was in mir vorging. Dieser untrügliche Instinkt …« Der Vampir stockte, grübelte. »Sagen wir, es war der übernatürliche Instinkt eines Vampirs, dem nicht die geringste Veränderung im Gesichtsausdruck eines Menschen verborgen bleibt. So drängte er mich in den Wagen und trieb die Pferde nach Hause.
›Ich will sterben‹, murmelte ich. ›Das ist unerträglich. Ich will sterben. Es liegt in deiner Macht, mich zu töten, also lass mich sterben.‹ Ich vermied, ihn anzublicken, um nicht von seiner äußeren Schönheit in den Bann geschlagen zu werden. Er nannte mich sanft beim Namen und lachte. Er wollte unbedingt die Plantage haben.«
»Hätte er Sie denn niemals gehen lassen?«, fragte der junge Mann. »Unter keinen Umständen?«
»Ich weiß es nicht. So wie ich Lestat inzwischen einschätze, würde ich sagen, er hätte mich eher umgebracht. Aber das war ja gerade das, was ich wollte. Nein, dies war, was ich dachte, dass ich es wollte …
Als wir das Haus erreichten, stieg ich aus und schritt willenlos zu der Steintreppe, die mein Bruder hinabgestürzt war. Das Haus war seit Monaten unbewohnt, da der Aufseher sein eigenes gehabt hatte, und die Feuchtigkeit und Hitze Louisianas hatten schon ihr Werk getan. In jeder Spalte spross Gras und Unkraut. Ich erinnere mich an die feuchte Luft, die sich in der Nacht abgekühlt hatte. Ich setzte mich auf die unteren Stufen, legte den Kopf auf die Steine, berührte die Wildblumen und pflückte ein paar von ihnen. ›Ich will sterben! Töte mich!‹, sagte ich zu dem Vampir. ›Ich bin jetzt ein Mörder, doch als ein solcher kann ich nicht weiterleben.‹
Er lächelte höhnisch und ungeduldig, wie jemand lächelt, wenn der andere offensichtlich lügt. Und dann warf er sich plötzlich auf mich, wie er sich auf meinen Aufseher geworfen hatte. Ich setzte mich wie im Fieber zur Wehr, schlug um mich und trat ihm gegen die Brust. Doch er grub die Zähne in meine Kehle. Dann ließ er mich mit einer unglaublich schnellen Bewegung los und stand vor mir am Fuße der Treppe. ›Ich dachte, du wolltest sterben, Louis‹, sagte er verächtlich.«
Der junge Mann blickte überrascht auf, als der Vampir seinen Namen nannte. Doch dieser sagte nur kurz: »Ja, das ist mein Name.« Dann fuhr er in seiner Erzählung fort.
»Nun, ich lag also da, hilflos aufgrund meiner eigenen Feigheit und Dummheit«, sagte er. »Vielleicht hätte ich allmählich den Mut gefunden, mir selbst das Leben zu nehmen und nicht andere anzuflehen, es für mich zu tun. Ich sah mich im Geist ein Messer ergreifen und es mir in die Brust stoßen oder mich die Treppe hinabstürzen und mir das Genick brechen, so wie es meinem Bruder widerfahren war.
Doch es war keine Zeit mehr, Mut zu fassen. Oder besser gesagt, Lestats Pläne ließen mir keine Zeit. ›Hör mir zu, Louis‹, sagte er und streckte sich neben mir auf den Stufen aus, mit so anmutigen Bewegungen, dass ich an einen Liebhaber denken musste.
Ich wich zurück, doch er umfing mich mit dem rechten Arm und zog mich an seine Brust. Nie zuvor war ich ihm so nahe gewesen, und ich konnte im Halbdunkel seine Augen leuchten sehen und sein Gesicht, das wie eine Maske war. Als ich mich rühren wollte, legte er mir die Finger auf die Lippen und sagte: ›Sei still. Ich werde dir jetzt das Blut aussaugen, bis du an die Schwelle des Todes gelangst. Und du musst ruhig sein, so ruhig, dass du glaubst, das Blut durch deine Adern fließen zu hören, so ruhig, dass du hören kannst, wie dein eigenes Blut auch durch meine Adern fließt. Du brauchst deinen Willen, dein ganzes Bewusstsein, um dich am Leben zu erhalten.‹
Ich wollte mich wehren, doch er hielt mich fest und meinen Körper mit beiden Armen umfangen, und sobald ich meinen nutzlosen Widerstand aufgab, grub er seine Zähne in meinen Hals.«
Der junge Mann machte große Augen. Er war mehr und mehr in seinem Stuhl zurückgewichen, während der Vampir erzählte, und jetzt war seine Miene angespannt, und er kniff die Augen zusammen, als würde er einen Schlag erwarten.
»Hast du jemals eine große Menge Blut verloren?«, fragte der Vampir. »Kennst du das Gefühl?«
Die Lippen des jungen Mannes formten sich zu einem Nein, doch es kam kein Ton heraus. Er räusperte sich. »Nein«, sagte er schließlich.
»Oben in dem Zimmer, wo wir den Tod des Aufsehers geplant hatten, brannten Kerzen. Auf der Terrasse schwankte eine Öllampe im Nachtwind. Und all dies Licht verschmolz und schimmerte, als ob eine goldene Erscheinung über mir schwebte, und durchdrang das Treppenhaus wie feiner Rauch. ›Hör zu und halt die Augen auf‹, flüsterte Lestat, die Lippen an meinem Hals. Ich erinnere mich, dass sich mir bei der Bewegung seiner Lippen die Haare am ganzen Körper sträubten und mich eine Empfindung durchfuhr, die den Freuden der Fleischeslust nicht unähnlich war …«
Er grübelte, zwei Finger unter das Kinn gelegt. »In wenigen Minuten war ich wie gelähmt. Entsetzt merkte ich, dass ich mich nicht einmal zwingen konnte zu sprechen. Noch immer hielt mich Lestat umfangen, und sein Arm war wie eine Eisenklammer. Er zog seine Zähne so heftig zurück, dass die beiden schmerzenden Einstiche mir ungeheuer groß erschienen. Und dann beugte er sich über meinen Kopf, nahm die rechte Hand von mir und biss sich selber ins Handgelenk. Das Blut schoss heraus und floss mir über Hemd und Rock, und er sah es mit leuchtenden Augen fließen. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, und der Lichtschimmer hing jetzt wie ein Heiligenschein hinter seinem Kopf. Ich glaube, ich wusste, was er tun wollte, noch ehe er es tat, und ich wartete in meiner Hilflosigkeit, als hätte ich seit Jahren darauf gewartet. Er drückte sein blutendes Handgelenk an meinen Mund und sagte eindringlich, ein wenig ungeduldig: ›Trink, Louis.‹ Und ich gehorchte. ›Weiter, Louis‹ und ›Schneller‹, flüsterte er mir mehrmals zu.
Ich trank das Blut und erlebte zum ersten Mal seit meiner frühesten Kindheit wieder das Vergnügen, Nahrung einzusaugen, Körper und Geist auf nichts als auf die einzige Lebensquelle konzentriert. Dann geschah etwas.«
Der Vampir lehnte sich zurück, mit einem leichten Stirnrunzeln.
»Wie jämmerlich, etwas beschreiben zu wollen, was man gar nicht beschreiben kann«, sagte er, fast flüsternd. Der junge Mann saß wie erstarrt da.
»Ich sah nichts als das Licht, während ich das Blut saugte. Und dann … dann kam – ein Ton. Ein dumpfes Dröhnen zuerst, und dann wie das Schlagen einer Trommel, lauter und lauter, wie wenn eine riesenhafte Kreatur langsam durch einen dunklen und fremden Wald auf dich zukommt und dabei eine ungeheure Trommel schlägt. Und gleich darauf eine zweite Trommel, als ob ein zweiter Riese hinter dem ersten schritt und jeder seine eigene Trommel schlug und nicht auf den andern achtete. Das Dröhnen wurde lauter und lauter, bis es nicht nur mein Gehör, sondern all meine Sinne zu erfüllen schien, und es bebte in meinen Lippen und Fingern, in meinen Schläfen und Adern. Vor allem in den Adern, Trommel gegen Trommel. Und dann zog Lestat plötzlich sein Handgelenk fort, und ich öffnete die Augen und ertappte mich dabei, wie ich nach seinem Handgelenk griff und es mit aller Kraft wieder an meinen Mund führte. Und auf einmal wusste ich, dass die erste Trommel mein Herz war und die zweite Trommel sein Herz.« Der Vampir seufzte. »Verstehst du?«
Der junge Mann wollte etwas sagen, dann schüttelte er den Kopf. »Nein … oder vielleicht doch … Ich meine, ich …«
»Natürlich«, sagte der Vampir und blickte beiseite.
»Warten Sie bitte«, sagte der junge Mann aufgeregt. »Die Kassette ist zu Ende. Ich muss sie umdrehen.« Er wechselte sie, und der Vampir sah geduldig zu.
»Wie geht es weiter?«, fragte der junge Mann. Sein Gesicht war feucht, und er wischte mit dem Taschentuch darüber.
»Ich sah jetzt mit den Augen eines Vampirs«, fuhr der Vampir fort. Seine Stimme klang abwesend, etwas zerstreut. Dann nahm er sich zusammen. »Lestat stand wieder am Fuße der Treppe, und ich sah ihn, wie ich ihn unmöglich früher gesehen haben konnte. Vorher war er mir weiß erschienen, ganz fahl, sodass er nachts fast durchscheinend wirkte. Jetzt sah ich ihn von seinem eigenen Leben und Blut erfüllt – strahlend, nicht mehr durchscheinend. Nicht nur Lestat, alles hatte sich verändert.
Es war, als ob ich erst da imstande gewesen wäre, Farben und Formen zu sehen. Ich war derart verzaubert von den Knöpfen auf Lestats schwarzem Rock, dass ich eine Zeitlang nichts anderes anschauen konnte. Dann lachte Lestat, und ich hörte sein Lachen, wie ich zuvor nichts anderes vernommen hatte. Noch immer hörte ich sein Herz wie eine Trommel schlagen, und nun kam dieses metallische Gelächter hinzu. Es war verwirrend, wie jeder Ton in den nächsten überging, so wie sich nachhallende Glockentöne vermischen, bis ich die Töne schließlich zu unterscheiden lernte, sanft, aber bestimmt, das dumpfe Dröhnen und das perlende Gelächter – ein Glockenspiel.« Der Vampir lächelte verzückt. »Wie ein Glockenspiel.
›Hör auf, meine Knöpfe anzustarren‹, sagte Lestat. ›Geh hinaus unter die Bäume. Entledige dich aller menschlichen Reste in deinem Leib, doch verliebe dich nicht zu sehr in die Nacht, damit du nicht den Weg verlierst.‹
Das war eine kluge Anweisung. Als ich den Mondschein auf den Fliesen sah, war ich davon so bezaubert, dass ich fast eine Stunde dort verbrachte. Ich ging an meines Bruders Kapelle vorbei, ohne einen einzigen Gedanken an ihn, und zwischen den Pappeln und Eichen hörte ich die Nacht wie einen Chor von flüsternden Frauen, die mich an ihre Brust riefen.
Die Verwandlung meines Körpers war noch nicht abgeschlossen, und als ich mich an alles das gewöhnte, was ich hörte und sah, begann er zu schmerzen. Ich wurde all meiner menschlichen Säfte beraubt. Ich starb als Mensch und lebte schon als Vampir, und mit meinen neu erwachten Sinnen erlebte ich das Sterben meines Körpers mit Unbehagen und schließlich mit Furcht.
Ich lief zurück zum Haus und hinein, wo sich Lestat schon über die Geschäftsbücher der Plantage hergemacht hatte und die Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres prüfte. ›Du bist ein reicher Mann‹, sagte er, als ich eintrat.
›Mit mir geht etwas vor!‹, rief ich.
›Du stirbst, das ist alles, sei nicht albern. Hast du sonst keine Lampen? So viel Geld, und du kannst dir nur für eine Laterne Öl leisten?‹
›Ich sterbe!‹, rief ich. ›Ich sterbe!‹
›Das widerfährt jedem‹, sagte er unbeirrt und machte keinerlei Anstalten, mir zu helfen.
Wenn ich daran denke, verachte ich ihn noch immer. Nicht, dass ich mich fürchtete, aber er hätte mich schicklich auf diese Veränderungen vorbereiten können, mich beruhigen und mir sagen können, ich möge meinen Tod mit der gleichen Faszination betrachten, wie ich die Nacht angeschaut und empfunden hatte. Aber er unterließ es. Lestat war nie ein Vampir wie ich. Durchaus nicht.«
Der Vampir sagte das nicht prahlerisch. Er sagte es so, als hätte er es in der Tat anders gemacht.
Er seufzte. »Alors, ich starb schnell, und das bedeutete, dass meine Fähigkeit, mich zu fürchten, ebenso schnell schwand. Ich bedauere nur, dass ich dem Vorgang nicht mehr Aufmerksamkeit schenkte. Lestat erwies sich als ein völliger Dummkopf. ›Oh, um der Hölle willen!‹, rief er. ›Weißt du, dass ich gar nicht für dich vorgesorgt habe? Was bin ich für ein Idiot!‹ Ich war versucht zu sagen: Ja, das bist du! Doch ich schwieg. ›Du wirst dich heute Morgen mit mir schlafen legen müssen. Ich habe dir keinen Sarg besorgt.‹«
Der Vampir lachte. »Der Sarg erregte einen solchen Schrecken in mir, dass ich seitdem über nichts mehr erschrecken konnte. Ich sollte mir also mit Lestat einen Sarg teilen.
Er ging in das Schlafzimmer seines Vaters und sagte dem alten Mann auf Wiedersehen und dass er am Morgen wiederkommen würde. ›Aber wohin gehst du?‹, wollte der Alte wissen. ›Was ist das für eine Tageseinteilung!‹
Lestat wurde ungeduldig. Bisher war er gütig zu seinem Vater gewesen, so sehr, dass es manchmal fast peinlich war. Doch nun wurde er grob. ›Ich kümmere mich um dich, nicht wahr? Du hast durch mich ein besseres Dach über dem Kopf, als ich es je bei dir hatte. Wenn ich Lust habe, den ganzen Tag zu schlafen und nachts zu trinken, dann tue ich dies, zum Donnerwetter!‹
Der Alte begann zu wimmern. Nur die besondere Erregung, die ich empfand, und die außerordentliche Erschöpfung, die mich befallen hatte, hinderten mich, meine Missbilligung zu äußern. Ich beobachtete die Szene durch die offene Tür, fasziniert von der Farbe der Bettdecke und die im Gesicht des Alten. Die blauen Adern pulsierten unter dem Rosa und Grau des Fleisches, und sogar die gelben Zähne fesselten mich, und ich betrachtete fast hypnotisiert das Beben seiner Lippen.
›So ein guter Sohn, so ein guter Sohn‹, murmelte er. Natürlich hatte er von der wahren Natur seines Sohnes keine Ahnung. ›Also gut, geh nur. Ich weiß, du hast irgendwo eine Geliebte und gehst zu ihr, sobald ihr Mann morgens das Haus verlässt. Gib mir meinen Rosenkranz. Wo ist mein Rosenkranz?‹ Lestat sagte etwas Blasphemisches und gab ihm den Rosenkranz …«
»Aber …« Der junge Mann stutzte.
»Ja?«, sagte der Vampir. »Ich fürchte, ich lasse dich nicht genug Fragen stellen.«
»Ich wollte fragen – Rosenkränze haben doch Kreuze, nicht wahr?«
»Ach, das Gerede von den Kreuzen!« Der Vampir lachte. »Du meinst, wir fürchten uns vor Kreuzen?«
»Sie können den Anblick nicht ertragen, dachte ich.«
»Unsinn, mein Freund, der reine Unsinn. Ich kann anblicken, was ich will. Und Kreuze sehe ich besonders gern.«
»Und was hat es mit den Schlüssellöchern auf sich? Dass Sie … sich in Nebel verwandeln und hindurchschlüpfen können?«
»Ich wollte, ich könnte es«, sagte der Vampir lachend. »Es wäre wirklich reizend. Wie gern würde ich durch die verschiedensten Schlüssellöcher schlüpfen und ihre besonderen Formen auskosten. Nein«, er schüttelte den Kopf, »das ist – wie sagt man heutzutage? – Quatsch!«
Der junge Mann musste lachen. Dann wurde seine Miene wieder ernst.
»Nur nicht so schüchtern«, bat der Vampir. »Was gibt es noch?«
Der junge Mann errötete. »Die Geschichte von den Pfählen … die durchs Herz getrieben werden …«
»Ebenfalls Quatsch«, sagte der Vampir und betonte das Wort so, dass der junge Mann lächeln musste. »Willst du nicht eine Zigarette rauchen? Ich sehe, du hast welche in der Hemdtasche.«
»Ach ja, danke«, sagte der junge Mann, als wäre es ein wunderbarer Vorschlag. Aber als er die Zigarette zwischen den Lippen hatte, zitterten seine Hände, und das Streichholz zerbrach.
»Gestatte«, sagte der Vampir, nahm ihm die Streichhölzer ab und zündete ihm die Zigarette an. Der junge Mann tat einen Zug, den Blick auf die Finger des Vampirs gerichtet, der sich mit einem leisen Rascheln seiner Kleidung auf die andere Seite des Tischs zurückzog.
»Auf dem Waschbecken steht ein Aschenbecher«, sagte der Vampir, und der junge Mann stand nervös auf, ihn zu holen. Er starrte auf die wenigen Zigarettenkippen darin, und als er den kleinen Papierkorb erblickte, leerte er den Aschenbecher aus und stellte ihn schnell auf den Tisch. Seine Finger hinterließen feuchte Spuren auf der Zigarette, als er sie ausdrückte.
»Ist das Ihr Zimmer?«, fragte er.
»Nein. Nur irgendein Zimmer.«
»Was geschah weiter?«, fragte der junge Mann.
Der Vampir schien damit beschäftigt, dem Rauch nachzuschauen, der sich unter der elektrischen Birne kräuselte. »Nun … wir fuhren schnellstens nach New Orleans zurück. Lestat hatte seinen Sarg in einem armseligen Zimmer bei den Festungswällen.«
»Und Sie legten sich in diesen Sarg?«
»Mir blieb nichts anderes übrig. Ich bat Lestat, mich in der Kammer schlafen zu lassen, aber er lachte nur und fragte mich erstaunt: ›Weißt du nicht, was du bist?‹
Ich konnte die Vorstellung nicht ertragen, doch während wir noch darüber stritten, merkte ich, dass ich gar keine wirkliche Angst hatte. Es war seltsam – mein ganzes Leben hatte ich geschlossene, enge Räume gefürchtet. Ich war in französischen Häusern mit hohen Decken und bis zum Boden reichenden Fenstern geboren und aufgewachsen und hatte es immer gehasst, eingeschlossen zu sein. Selbst im Beichtstuhl in der Kirche fühlte ich mich beengt. Nun aber, während ich gegen Lestat aufbegehrte, merkte ich, dass ich dieses Gefühl ganz verloren hatte. Es war nur noch die Erinnerung, eine Gewohnheit, denn ich war mir noch nicht meiner gegenwärtigen unbeschwerten Freiheit bewusst.
›Du benimmst dich schlecht‹, sagte Lestat schließlich. ›Und fast dämmert es schon. Ich sollte dich sterben lassen. Die Sonne wird das Blut verzehren, das ich dir gegeben habe, in all deinen Adern, deinem Gewebe, und du wirst sterben, du weißt es. Aber du solltest diese Furcht nicht haben. Du bist wie einer, der ein Bein oder einen Arm verloren hat und behauptet, er fühle Schmerz, wo das Glied gewesen ist.‹
Nun, das war tatsächlich das Vernünftigste, was Lestat je in meiner Gegenwart gesagt hat, und es stimmte mich sogleich um.
›Also, ich lege mich jetzt in den Sarg‹, sagte er schließlich geringschätzig, ›und du wirst dich auf mich legen, wenn du weißt, was gut für dich ist.‹
Und ich tat es. Ich lag mit dem Gesicht nach unten auf ihm, ganz verwirrt, dass ich so gar keine Angst hatte, nur von dem Widerwillen erfüllt, ihm so nahe zu sein, wie schön und verlockend er auch sein mochte. Und er schloss den Deckel. Dann fragte ich ihn, ob ich schon vollständig tot sei. Es juckte und kribbelte mich am ganzen Körper.
›Nein, noch nicht‹, sagte er. ›Wenn du es bist, hörst und siehst du die Veränderung, aber du fühlst nichts. Wenn es wieder Nacht wird, bist du tot. Schlaf jetzt.‹«
»Und hatte er recht? Waren Sie … tot, als Sie aufgewacht sind?«
»Nun … verändert, sollte ich sagen. Da ich offensichtlich lebe. Mein Leib war gestorben. Er war noch nicht völlig von den Stoffen und Flüssigkeiten gereinigt, die er nicht mehr brauchte, aber er war schon tot. Und als es mir bewusst wurde, erreichte ich eine neue Stufe in meiner Loslösung von menschlichen Empfindungen. Das Erste, was ich erkannte, während wir den Sarg in einen Leichenwagen luden und einen anderen aus einer Leichenhalle stahlen, war, dass ich Lestat durchaus nicht leiden konnte. Noch war ich weit davon entfernt, ihm gleich zu sein, doch war ich ihm nun unendlich näher als vor dem Tod meines Leibes. Ich kann es dir wirklich nicht erklären, aus dem einfachen Grund, weil du jetzt so bist, wie ich war, bevor mein Leib starb. Du wirst es nicht verstehen. Doch bevor ich starb, war Lestat zweifellos das überwältigendste Erlebnis gewesen, das ich je gehabt hatte. Deine Zigarette ist ganz zu Asche abgebrannt.«
»Oh!« Der junge Mann drückte sie aus. »Sie meinen, als die Kluft zwischen Ihnen geschlossen war, hat er seinen … Zauber verloren?«, fragte er, den Blick auf den Vampir geheftet, während er eine neue Zigarette herausnahm und anzündete.
»Ja, das ist richtig«, antwortete der Vampir mit offensichtlichem Vergnügen. »Die Fahrt zurück nach Pointe du Lac war aufregend. Doch Lestats unaufhörliches Geschwätz war entschieden zu langweilig und deprimierend. Natürlich war ich, wie ich sagte, ihm noch lange nicht gleich, und musste noch mit meinen toten Gliedern fertigwerden … Doch ich lernte es am selben Abend, als ich zum ersten Mal töten musste.«
Der Vampir streckte den Arm über den Tisch und streifte etwas Asche vom Anzug des jungen Mannes, der daraufhin erschreckt auf die Hand starrte, als der Vampir sie wieder zurückzog. »Entschuldige«, sagte der Vampir, »ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Ich muss um Entschuldigung bitten«, antwortete der junge Mann. »Ich hatte nur soeben den Eindruck, dass Ihr Arm … ungewöhnlich lang ist. Sie haben über den Tisch gelangt, ohne sich vorzubeugen.«
»Nein«, sagte der Vampir und legte seine Hände wieder auf die übereinandergeschlagenen Knie. »Ich habe mich so schnell vorgebeugt, dass du es nicht sehen konntest. Es war eine Sinnestäuschung.«
»Sie haben sich vorgebeugt? Aber nein. Sie haben gesessen, so wie Sie jetzt sitzen, mit dem Rücken an der Stuhllehne.«
»Nein«, erwiderte der Vampir bestimmt, »ich habe mich vorgebeugt, wie ich dir sagte. Pass auf, ich tue es noch einmal.« Und er wiederholte es, und der junge Mann starrte ihn mit einer Mischung aus Bestürzung und Furcht an. »Du hast es immer noch nicht gesehen«, sagte der Vampir. »Aber wenn du meinen ausgestreckten Arm betrachtest … er ist nun wirklich nicht besonders lang.« Und er hob den Arm und wies mit dem Zeigefinger nach oben, als wäre er ein Engel, der Gottes Wort verkündete. »Du hast soeben einen grundlegenden Unterschied erfahren zwischen der Art, wie du siehst, und der, wie ich sehe. Mir erschien meine Bewegung langsam und ein wenig schlaff. Und das Geräusch, das mein Finger machte, als er dein Revers berührte, war deutlich zu hören. Nun, ich wollte dich nicht erschrecken, glaub mir. Aber vielleicht kannst du jetzt erahnen, dass meine Rückfahrt nach Pointe du Lac ein Fest für die Sinne war, voller neuer Erlebnisse – schon das Wiegen eines Zweiges im Wind war ein Vergnügen.«
»Ja«, sagte der junge Mann, jedoch sichtlich noch immer erschüttert. Der Vampir sah ihn einen Augenblick lang an und sagte dann: »Ich wollte dir gerade erzählen …«
»Wie Sie zum ersten Mal getötet haben.«
»Ja. Doch sollte ich vorausschicken, dass es auf der Plantage chaotisch zuging. Man hatte die Leiche des Aufsehers entdeckt und den blinden alten Mann im Schlafzimmer des Hausherrn. Niemand konnte sich erklären, wie er dorthin gekommen war. Und keiner hatte mich in New Orleans finden können. Meine Schwester hatte die Polizei verständigt, und einige Beamte erwarteten mich in Pointe du Lac. Es war natürlich schon ziemlich dunkel, und Lestat riet mir schnell, ich solle mich, besonders in dem gegenwärtig außergewöhnlichen Zustand meines Körpers, nicht von den Polizeibeamten sehen lassen, auch nicht beim geringsten Lichtschimmer. Darum sprach ich mit ihnen in der Eichenallee vor dem Haus und überhörte ihre Aufforderung, mit ihnen hineinzugehen. Ich erklärte, ich sei die vorige Nacht in Pointe du Lac gewesen, und der blinde alte Mann sei mein Gast. Was den Aufseher betraf, so sei er an dem Abend in Geschäften nach New Orleans gefahren.
Nachdem dies erledigt war, wobei mir vorzüglich zustattenkam, dass ich jetzt über den Dingen stand, blieb das Problem der Plantage selber. Meine Sklaven waren völlig durcheinander, und den ganzen Tag war nicht gearbeitet worden. Wir hatten damals einen großen Betrieb zur Anfertigung von Indigofarbe, der unter der Leitung des Aufsehers gestanden hatte. Er war mir unentbehrlich erschienen, obwohl ich einige äußerst kluge Sklaven besaß, die seine Arbeit längst hätten übernehmen können, wenn ich ihre Intelligenz erkannt hätte und nicht vor ihrem afrikanischen Aussehen und Gehabe zurückgeschreckt wäre. Jetzt prüfte ich sie genau, übergab ihnen die Leitung des Betriebs und versprach demjenigen, der sich dabei am besten anstellen würde, das Haus des bisherigen Aufsehers. Zwei junge Frauen wurden vom Feld ins Haus geholt, damit sie sich um Lestats Vater kümmerten, und ich sagte ihnen, ich dürfe auf keinen Fall gestört werden und würde sie extra belohnen, wenn sie mich und Lestat völlig in Ruhe ließen.
Damals erkannte ich nicht, dass diese Sklaven als Erste – und vielleicht als Einzige – argwöhnten, dass Lestat und ich keine natürlichen Geschöpfe waren, denn das Übernatürliche war Teil ihrer Kultur und Weltanschauung. In meiner Dummheit hielt ich sie für Wilde. Das war ein grober Fehler. Aber ich will in meiner Geschichte fortfahren.
Ich wollte dir erzählen, wie ich zum ersten Mal tötete … Lestat hat es mit dem ihm eigenen Mangel an Vernunft verpfuscht.«
»Verpfuscht?«, fragte der junge Mann.
»Ich hätte nicht mit Menschen beginnen sollen. Aber das musste ich allein lernen. Nachdem wir die Sache mit der Polizei geregelt hatten, trieb Lestat uns Hals über Kopf ins Moor. Es war sehr spät, die Hütten der Sklaven lagen im Dunkel, und bald sahen wir die Lichter von Pointe du Lac nicht mehr. Ich wurde sehr aufgeregt, da war wieder die Erinnerung an alte Ängste, die Verwirrung. Hätte Lestat über eine Spur von Verstand verfügt, hätte er mir die Sache ruhig und geduldig erklärt – dass ich das Moor nicht zu fürchten brauchte, weil mir Schlangen und Insekten nichts anhaben konnten, und zu meinen neuen Fähigkeiten gehörte, im Dunkeln sehen zu können. Stattdessen war er nur auf unsere Opfer konzentriert und darauf bedacht, die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.
Als wir schließlich auf unsere Opfer stießen, drängte er mich zur Tat. Es war ein kleines Lager geflohener Sklaven. Lestat hatte sie schon vorher heimgesucht und sich vielleicht über ein Viertel von ihnen hergemacht, indem er im Dunkeln gewartet hatte, bis einer das Feuer verließ, oder er hatte sie im Schlaf angefallen. Doch sie wussten absolut nichts von Lestats Gegenwart. Wir mussten eine gute Stunde warten, ehe einer der Männer – es waren alles Männer – ein paar Schritte zwischen die Bäume ging, um sich zu erleichtern. Lestat packte mich an der Schulter und sagte: ›Greif ihn dir!‹«
Der Vampir lächelte, als er sah, wie der junge Mann große Augen machte. »Ich glaube, ich war ebenso vom Grauen gepackt, wie du es gewesen wärest«, sagte er. »Damals wusste ich nicht, dass ich auch Tiere statt Menschen töten konnte. Ich sagte, ich könne dies unmöglich tun. Der Sklave hörte mich sprechen, drehte sich um, den Rücken dem Feuer zugekehrt, und äugte ins Dunkel. Dann zog er schnell und geräuschlos ein langes Messer. Er war nackt bis zum Gürtel, ein hochgewachsener, kräftiger junger Mann. Er sagte etwas auf Patois und trat nach vorn. Obwohl ich ihn deutlich sah, vermochte er wiederum nicht, uns auszumachen.
Lestat sprang ihn mit verblüffender Schnelligkeit von hinten an, packte ihn und hielt den linken Arm fest. Der Sklave schrie auf und versuchte Lestat abzuschütteln, der ihm jedoch die Zähne in den Hals grub. Der Sklave erstarrte, wie von einer Schlange gebissen, und sackte auf die Knie, während Lestat in vollen Zügen trank. Die anderen Sklaven kamen herbeigelaufen.
›Du machst mich krank‹, sagte Lestat, als er wieder bei mir war.