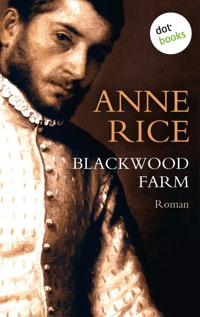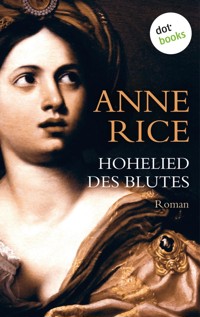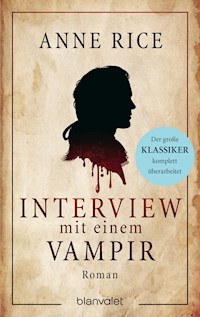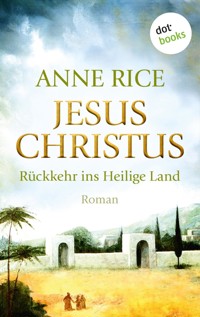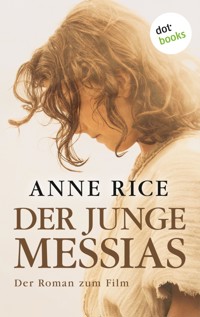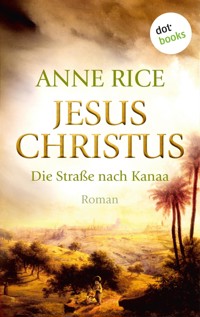
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einfühlsam und kraftvoll: Der historische Roman "Jesus Christus – Die Straße nach Kanaa" von Bestsellerautorin Anne Rice als eBook bei dotbooks. Ein einfaches Leben in Frieden und Glück in den Armen seiner Geliebten: Das ist alles, was der Zimmermann Jesus sich wünscht. Doch während Galiläa und Judäa von unerbittlicher Dürre und politischen Unruhen heimgesucht werden, reift in ihm die Gewissheit, dass dies nicht sein Weg sein soll. Aber wird er mutig genug sein, seine Berufung anzunehmen und sein Schicksal zu finden? Ein Mann aus Fleisch und Blut – und doch so viel mehr: Sprachgewaltig erzählt Anne Rice über jene prägenden Jahre im Leben des Menschen Jesus, in denen er seinen Glauben fand. "Gründlich recherchiert, ehrfürchtig und bewegend." People Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Jesus Christus – Die Straße nach Kanaa" von Bestsellerautorin Anne Rice. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein einfaches Leben in Frieden und Glück in den Armen seiner Geliebten: Das ist alles, was der Zimmermann Jesus sich wünscht. Doch während Galiläa und Judäa von unerbittlicher Dürre und politischen Unruhen heimgesucht werden, reift in ihm die Gewissheit, dass dies nicht sein Weg sein soll. Aber wird er mutig genug sein, seine Berufung anzunehmen und sein Schicksal zu finden?
Ein Mann aus Fleisch und Blut – und doch so viel mehr: Sprachgewaltig erzählt Anne Rice über jene prägenden Jahre im Leben des Menschen Jesus, in denen er seinen Glauben fand.
»Gründlich recherchiert, ehrfürchtig und bewegend.« People
Über die Autorin:
Anne Rice, geboren 1941 in New Orleans, studierte in San Francisco Englisch, Kreatives Schreiben und Politikwissenschaften. 1976 wurde sie mit ihrem Debütroman Interview mit einem Vampir weltberühmt.
Mehr Informationen finden sich auf ihrer Website: www.annerice.com
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/annericefanpage
Bei dotbooks veröffentlichte Anne Rice die Romane Jesus Christus – Rückkehr ins Heilige Land und Jesus Christus – Die Straße nach Kanaa. Weitere eBooks sind in Vorbereitung.
***
Neuausgabe März 2016
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel Christ the Lord. The Road to Cana im Verlag Alfred A. Knopf, New York
Copyright © 2008, 2009 by Anne O’Brian Rice
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Gemäldes »Jérusalem« von Otto Georgi
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-611-9
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Straße nach Kanaa an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Anne Rice
JESUS CHRISTUS Die Straße nach Kanaa
Aus dem Englischen von Monika Köpfer
Für Christopher Rice
Anrufung
Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
»Herr Gott Einer, Gott Dreieinheit, was immer ich in diesen Büchern von deinem gesagt habe, mögen auch die Deinen anerkennen; habe ich etwas von mir gesagt, verzeihe du es und die Deinen!«
Heiliger Augustinus
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.
Das Evangelium nach Johannes
Kapitel 1
Wer ist Jesus Christus?
Bei dessen Geburt Engel sangen und drei Weise aus dem Morgenland ihre Gaben darbrachten: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gaben für ihn und Maria, seine Mutter, sowie Josef, den Mann, der sich für seinen Vater ausgab.
Im Tempel nahm ein alter Mann das Kleinkind hoch. Der Alte hob den Blick gen Himmel und sprach zum Herrn: »Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.«
Meine Mutter erzählte mir all diese Geschichten.
Das ist schon viele, viele Jahre her.
Ist es möglich, dass Jesus Christus tatsächlich ein Zimmermann in der kleinen Stadt Nazareth ist, ein Mann der die dreißig überschritten hat und zu einer Familie gehört, deren Mitglieder – Frauen, Männer und Kinder – zehn Räume eines alten Hauses bewohnen? Ein Mann, der in einem regenlosen Winter voller Staub, in dem sich Gerüchte über Unruhen in Judäa verbreiten, in einem abgetragenen wollenen Gewand neben anderen Männern in einem Zimmer schläft, das von einem rauchenden Kohlenfeuer beheizt wird? Ist es möglich, dass er dort schläft und träumt?
Ja. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich bin Jesus Christus. Ich weiß es. Was ich wissen muss, weiß ich. Und was ich lernen muss, lerne ich.
In der Haut dieses Mannes lebe, schwitze, atme und stöhne ich. Meine Schultern schmerzen. Meine Augen sind trocken vom Staub der Straße, dem täglichen Fußmarsch nach Sepphoris, der mich durch graue Felder führt, in denen die Saat seit Wochen unter der diesigen Wintersonne verdorrt.
Ich bin Jesus Christus. Ich weiß. Andere wissen es auch, aber die Menschen vergessen oft, was sie wissen. Meine Mutter hat seit Jahren nicht mehr davon gesprochen. Josef, mein Stiefvater, ist alt geworden, ein Greis mit weißem Haar, der in den Tag hineinlebt.
Ich vergesse niemals.
Vor dem Einschlafen überkommt mich hie und da die Angst vor den Träumen, die mich immer wieder heimsuchen. Meine Träume sind verworren wie wucherndes Farnkraut oder die jäh einsetzenden heißen Winde, die durch die ausgetrockneten Täler Galiläas fegen.
Wie alle anderen Menschen träume auch ich.
Und diese Nacht habe ich geträumt, während ich, nur mit meinem Mantel zugedeckt, mit kalten Händen und Füßen in der Nähe des erloschenen Kohlenfeuers schlief.
Ich träumte von einer Frau, die neben mir lag, meiner Frau. Doch im nebulösen Gewirr der Traumbilder verwandelte sie sich allmählich in ein junges Mädchen, wurde zu meiner Abigail.
Ich erwachte. Im Dunkeln setzte ich mich auf. Die anderen Männer lagen friedlich schlafend mit offenem Mund auf ihren Matten, und die Kohle im Becken war zu Asche geworden.
Geh weg, geliebtes Mädchen. Das hier gehört nicht zu dem, was ich wissen muss, und Jesus Christus wird nicht erfahren, was er nicht erfahren muss – und wenn, dann nur schemenhaft und aus der Ferne.
Doch sie ging nicht – nicht die Abigail meiner Träume, deren Haar weich über meine Hände floss, so als hätte der Herr sie im Garten Eden für mich erschaffen.
Nein. Vielleicht hat der Herr die Träume gemacht, damit ich auch das hier kennenlerne – so zumindest erschien es Jesus Christus.
Ich stand von meiner Matte auf und legte so leise wie möglich Kohle nach. Meine Brüder und Neffen rührten sich nicht. Jakob, mein Bruder, verbrachte die Nacht im Zimmer seiner Frau. Doch der kleine Judas und der kleine Josef, beide inzwischen Väter, lagen hier, während ihre Frauen mit den Jüngsten ein Zimmer teilten. Auch Jakobs Söhne schliefen bei uns – Menachem, Isaak und Schabi –, wie Welpen aneinandergeschmiegt.
Vorsichtig stieg ich über die Schlafenden hinweg und ging zur Truhe, um ein sauberes Gewand herauszuholen. Die Wolle roch nach Sonne und Wind. Alles in der Truhe war frisch.
Ich nahm das Gewand und ging nach draußen. Im Hof schlug mir eine kalte Windbö entgegen. Herabgefallene Blätter raschelten.
Auf der steinigen Straße hielt ich einen Moment lang inne und blickte in den von glitzernden Sternen übersäten Himmel, der sich hinter den zusammengedrängten Dächern abzeichnete.
Kalt und wolkenlos und voller winziger Lichter, war der Himmel in diesem Moment wunderschön. Das Herz tat mir weh. Es war, als würde er auf mich herabblicken, mich warm und wie ein wohlmeinender Zeuge umfangen, gleich einem unendlichen Netz, von einer einzigen Hand ausgeworfen.
Ganz anders als sonst erschien mir der Himmel in diesem Augenblick – nicht wie eine riesige nächtliche Kuppel, die sich über das schlummernde Dorf spannte, das sich wie Hunderte andere auch zwischen ausgedörrten Feldern, Olivenhainen und Höhlen hangabwärts erstreckte.
Ich war allein.
Irgendwo weiter unten in der Nähe des Platzes, wo an gewissen Tagen Markt abgehalten wurde, sang ein betrunkener Mann ein Lied, und in der Tür der Taverne war ein Lichtschein zu erkennen. Gelächter erscholl.
Ansonsten war es still, und kein Fackelschein erhellte die Straße.
Die Tür des Hauses auf der anderen Straßenseite, in dem Abigail wohnte, war ebenso verschlossen wie alle anderen. Drinnen schlief Abigail, auch sie eine Verwandte, im selben Zimmer mit der stummen Hannah, ihrer sanften Gefährtin, sowie den beiden alten Frauen, die ihnen und Schemaja dienten, dem verbitterten alten Mann, der ihr Vater war.
Nazareth hatte nicht immer eine Schönheit aufzuweisen. Ich hatte mehrere Generationen junger Mädchen aufwachsen sehen, alle frisch und hübsch anzuschauen wie wild wachsende Blumen, aber keine war wie Abigail gewesen. Im Übrigen wollten die Väter nicht, dass ihre Töchter schön waren. Aber nun hatte Nazareth eine wahre Schönheit, und sie hieß Abigail. Erst kürzlich hatte sie zwei Heiratsanträge abgelehnt, oder besser gesagt, ihr Vater. Die Frauen unserer Familie fragten sich, ob Abigail überhaupt von den Bewerbern wusste, die um ihre Hand angehalten hatten.
Es gab mir einen Stich, als mir bewusst wurde, dass ich wohl bald als einer der Fackelträger an ihrer Hochzeit teilnehmen würde.
Abigail war fünfzehn. Manche Mädchen wurden schon mit vierzehn verheiratet, aber Schemata wollte sie nicht so schnell gehen lassen. Er war ein reicher Mann, den abgesehen von seinen Reichtümern nur eine einzige Sache glücklich machte, und das war seine Tochter Abigail.
Ich erklomm den höchsten Punkt des Berges, an dessen Hang unser Dorf lag. Ich kannte jede der Familien, die hinter den einzelnen Türen wohnten. Auch die wenigen Fremden, die kamen und gingen, kannte ich. Einer von ihnen lag zusammengekauert im Hof vor dem Haus des Rabbi, ein anderer auf dem Dach, wo immer irgendwelche Menschen schliefen, sogar im Winter. Es war ein verschlafenes Dorf, in dem es keine Geheimnisse zu geben schien.
Auf der anderen Seite des Berges folgte ich abwärts der Straße in Richtung der Quelle. Staub stob bei jedem meiner Schritte auf und ließ mich husten.
Staub, Staub und nichts als Staub.
Danke, Vater des Universums, dass diese Nacht nicht so kalt ist wie viele andere Nächte. Ich bitte dich, schicke uns Regen, sobald es dir gefällt, denn du weißt, wie dringend wir ihn benötigen.
Ich kam an der Synagoge vorbei und konnte das Plätschern der Quelle hören, noch ehe ich sie erblickte.
Wenn es nicht bald regnete, würde die Quelle womöglich versiegen, aber noch sprudelte sie und füllte die beiden in den Fels gehauenen Becken mit Wasser; von dort aus ergoss es sich in glitzernden Strängen in sein steinernes Bett und wurde zu einem Bach, der in der Ferne im Wald verschwand.
In der Nähe der Quelle wuchs das Gras üppig und duftend.
In weniger als einer Stunde würden die Frauen herbeiströmen; die wohlhabenderen, um ihre Krüge zu füllen, und die ärmeren, um die Kleidung hier zu waschen, so gut sie konnten, und sie auf den Felsen zum Trocknen auszubreiten.
Aber noch hatte ich die Quelle ganz für mich allein.
Ich ging zu einem der Becken. Dort streifte ich mein Gewand ab und tauchte es in den Bach, wo das Wasser die Wolle rasch durchtränkte und dunkler werden ließ, sodass ich die Umrisse kaum mehr ausmachen konnte. Ich stieg hinein, schöpfte mit den gewölbten Händen Wasser und wusch mir Haare, Gesicht und Brust, ließ es den Rücken und die Beine hinabfließen. Ja, die Träume abstreifen wie die getragene Kleidung und sie wegwaschen. Die Frau aus dem Traum hatte nunmehr keinen Namen und keine Stimme, und die Erinnerung an das schmerzhafte Flackern in meiner Brust, als sie gelacht und die Hand nach mir ausgestreckt hatte, verblasste allmählich wie die Nacht. Verschwunden war auch der Staub, wenigstens für den Moment, der alles erstickende Staub. Nur noch das Wasser war da und die Kälte.
Am anderen Ufer des Bachs, gegenüber der Synagoge, legte ich mich ins Gras. Die Vögel hatten zu singen begonnen, und wie immer hatte ich den genauen Augenblick ihres Erwachens verpasst. Es war ein Spiel, das ich spielte – zu versuchen, den ersten Ton wahrzunehmen, den Moment, da die Vögel als Einzige zu wissen schienen, dass bald die Sonne aufgehen würde.
Ich sah zu, wie sich die Palmen, die die Synagoge umstanden, aus den unförmigen Schatten lösten. Palmen wuchsen auch in einer Zeit der Dürre. Palmen kümmerten sich nicht darum, wenn sich der Staub auf jeden ihrer Äste legte. Palmen machten einfach weiter, als könnte keine Jahreszeit und keine Witterung ihnen etwas anhaben.
Die Kälte war jetzt nur noch äußerlich. Wahrscheinlich hielt mich mein klopfendes Herz von innen warm. Dann sah ich, wie über dem Felsplateau in der Ferne das erste Licht heraufzog, und ich schlüpfte in das saubere Gewand, das ich aus der Truhe mitgenommen hatte. Ah, dieser frisch gewaschene, herrlich duftende Stoff, was für eine Wohltat!
Ich ließ mich wieder auf meinen Platz zurücksinken und die Gedanken schweifen. Zuerst spürte ich den Luftzug, ehe ich das Rascheln in den Bäumen vernahm.
Weit oben am Berg gab es einen alten Olivenhain, den ich bisweilen aufsuchte, um allein zu sein. Ich stellte mir vor, wie gut es täte, dort in einem Bett aus abgestorbenen Blättern zu liegen und den Tag zu verschlafen.
Aber daran war nicht zu denken, nicht bei der vielen Arbeit, die auf uns wartete, und bei den Unruhen, die die Ankunft des neuen römischen Statthalters in Judäa unweigerlich mit sich bringen würde. Denn so war es bislang immer gewesen, wenn ein neuer Machthaber gekommen war.
Das Land. Wenn ich vom »Land« spreche, meine ich Judäa ebenso wie Galiläa. Ich meine das Heilige Land Israel, das Land Gottes. Es spielte keine Rolle, dass dieser neue Mann nicht über uns Galiläer herrschte. Er war der Statthalter von Judäa und der Heiligen Stadt, in der der Tempel stand, und deshalb hätte er ebenso gut unser König sein können, statt Herodes Antipas. Sie arbeiteten Hand in Hand, diese beiden, Herodes Antipas, der Herrscher über Galiläa, und dieser neue Mann, Pontius Pilatus, den die Menschen fürchteten. Und jenseits des Jordans saß Herodes Philippus auf dem Thron, der Dritte im Bunde. Seit langer Zeit schon war das Land zerstückelt. Im Gegensatz zu Antipas und Philippus war Pontius Pilatus ein Fremder für uns, und der Ruf, der ihm vorauseilte, verhieß nichts Gutes.
Was sollte ein Zimmermann schon dagegen ausrichten? Nichts. Aber in einer Zeit, da wir alle sehnsüchtig auf Regen hofften, da die Menschen launisch und mürrisch und voller Angst waren und beim Anblick des welkenden Grases vom Fluch des Himmels und vom Zorn der Römer sprachen, da der Cäsar ins Exil gegangen war, aus Trauer um seinen Sohn, den man vergiftet hatte, da die ganze Welt eine riesige Last auf den Schultern spürte, nun, in solch einer Zeit ging ich freilich nicht zu meinem geliebten Olivenhain, um dort den Tag zu verschlafen.
Es wurde hell.
Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten der Häuser und eilte mit erhobener Hand die Straße herab auf mich zu.
Mein Bruder Jakob. Mein älterer Bruder – der Sohn von Josef und seiner ersten Frau, die gestorben war, ehe Josef meine Mutter heiratete. Es war zweifelsohne Jakob, ich erkannte ihn an dem langen Haar, das er im Nacken geknotet hatte, an den nervös hochgezogenen Schultern und an den eiligen Schritten – Jakob der Nasiräer, Jakob, der unserem Handwerkertrupp Vorstand, Jakob das Familienoberhaupt, nun, da Josef ein alter Mann war.
Auf der anderen Seite der Quelle blieb er stehen. An der Stelle, wo das Wasser zwischen gesetzten Steinen als glitzerndes Band aus der Erde hervorsprudelte; in dem gleißenden Licht konnte ich kaum sein Gesicht ausmachen.
Vorsichtig trat er von einem Stein auf den nächsten, als er den Bach überquerte, um zu mir herüberzugelangen. Inzwischen hatte ich mich aufgesetzt und erhob mich, als er mich erreicht hatte, eine Geste der Höflichkeit meinem älteren Bruder gegenüber.
»Was machst du denn hier?«, wollte er wissen. »Was ist los? Musst du mir ständig Sorgen bereiten?«
Ich sagte nichts.
Er riss die Hände in die Höhe, während er den Blick zu den Palmen wandte, als hoffte er von dort eine Erklärung zu bekommen.
»Wann wirst du dir endlich eine Frau nehmen?«, fragte er. »Nein, unterbrich mich nicht. Du brauchst gar nicht die Hand zu heben, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich werde mir den Mund nicht verbieten lassen. Wann also gedenkst du zu heiraten? Oder bist du mit diesem elenden Bach hier, diesem kalten Wasser vermählt? Was wirst du tun, wenn es versiegt – und das wird dieses Jahr unweigerlich geschehen, wie du weißt.«
Ich lachte still in mich hinein.
Er ließ sich nicht beirren. »Es gibt zwei Männer in deinem Alter, die ebenfalls nicht verheiratet sind. Einer ist ein Krüppel. Der andere ist schwachsinnig!«
Er hatte recht: Ich war jenseits der dreißig und noch immer ledig.
»Wie oft haben wir schon darüber gesprochen, Jakob?«, fragte ich.
Es war schön zuzuschauen, wie das Tageslicht zunahm, zu sehen, wie Farbe in die Palmen rings um die Synagoge kam. In der Ferne meinte ich ein Rufen vernommen zu haben. Aber vielleicht waren es die gewöhnlichen Geräusche des Dorfes, das zum Leben erwachte.
»Sag mir, was heute Morgen wirklich an dir nagt«, sagte ich. Ich nahm das nasse Gewand aus dem Wasser und breitete es auf dem Gras zum Trocknen aus. »Mit jedem Jahr siehst du deinem Vater ähnlicher«, fuhr ich fort. »Nur seinen Gesichtsausdruck hast du nicht. Seine Gelassenheit und Ruhe wirst du wohl nie ausstrahlen.«
»Ich bin nun mal so zur Welt gekommen, voller Sorgen«, sagte er mit einem Schulterzucken. Er blickte unruhig in Richtung des Dorfes. »Hörst du das?«
»Ja, ich habe auch etwas gehört.«
»Das hier ist die schlimmste Dürre, die wir je hatten«, sagte er und blickte in den Himmel. »Und es ist nicht kalt genug. Du weißt ja, dass die Zisternen so gut wie ausgetrocknet sind. Auch die Mikwe ist leer. Und als wäre damit nicht genug, musst auch du mir ständig Kummer bereiten, Jeschua. Mitten in der Nacht gehst du hinaus zu diesem Bach. Oder zu dem Hain, den zu besuchen sich kein anderer traut…«
»Es ist falsch, was die Leute über die Lichtung im alten Olivenhain sagen«, erwiderte ich. »Es ist doch nur ein Haufen alter Steine, der nichts bedeutet.« Im Dorf hegten sie den Aberglauben, dass einst etwas Schlimmes in dem Olivenhain geschehen sei. Dabei befand sich auf diesem Platz nur die Ruine einer alten Olivenpresse, Steine, die in eine Zeit zurückreichten, als es Nazareth noch nicht gegeben hatte. »Jahraus, jahrein erkläre ich dir, was es mit dem Steinhaufen auf sich hat, oder nicht? Jedenfalls will ich dir bestimmt keine unnötigen Sorgen bereiten, das kannst du mir glauben, Jakob.«
Kapitel 2
Ich wartete darauf, dass Jakob etwas sagte. Aber er war in Schweigen versunken und starrte unentwegt in Richtung des Dorfes.
Jetzt war das Geschrei deutlich zu vernehmen; dem lauten Stimmengewirr nach zu urteilen, mussten es viele Menschen sein.
Mit den Fingern kämmte ich das noch feuchte Haar, ehe ich wieder zum Dorf hinübersah.
Inzwischen war es taghell geworden, und nun erkannte ich auf dem Bergrücken eine große Menschenansammlung: Männer und Jungen, die sich, aufgeregt fuchtelnd und einander stoßend, langsam hangabwärts auf uns zu bewegten.
Plötzlich löste sich die Gestalt des Rabbi, des alten Jacimus, aus der Menge, gefolgt von seinem Neffen Jason. Offensichtlich versuchte der Rabbi, die aufgebrachten Menschen zu beschwichtigen, doch die ließen sich nicht aufhalten. Sie marschierten einfach weiter und rissen den Rabbi mit sich in Richtung der Synagoge, die am Fuß des Berges stand. Wie eine außer Rand und Band geratene Viehherde wälzte sich der Pulk weiter, bis er vor der Palmenlichtung zum Stehen kam.
Jakob und ich standen noch immer an der jenseitigen Uferböschung des Quellbachs, von wo aus wir das Geschehen gut beobachten konnten.
Aus der Mitte heraus wurden zwei Jungen an den Rand der Menschenansammlung gestoßen – Jitra bar Nahom und der Bruder der stummen Hannah, den wir alle nur den »Waisenjungen« nannten.
Der Rabbi eilte die Stufen zum Dach der Synagoge hinauf.
Als ich Anstalten machte hinüberzugehen, hielt mich Jakob zurück.
»Misch dich da nicht ein«, sagte er.
Rabbi Jacimus’ Worte übertönten das Rauschen des Bachs und das Gemurmel der Menge.
»Wir werden eine Gerichtsverhandlung abhalten, das sage ich euch«, begann er. »Aber ich will Zeugen haben, wo sind die Zeugen? Die Zeugen mögen vortreten und sagen, was sie gesehen haben.«
Jitra und der Waisenjunge standen abseits, als trennte sie eine unüberwindbare Kluft von den aufgebrachten Dorfbewohnern. Einige schwenkten wütend die Fäuste, während andere leise Flüche ausstießen. Unverständliche Schwüre, deren Inhalt sich den anderen dennoch vermittelte.
Wieder wollte ich hinübergehen, aber Jakob legte mir abermals die Hand auf den Arm. »Halt dich da raus. Ich wusste gleich, dass es so kommen würde.«
»Was? Was sagst du da?«, fragte ich.
Schreie und Gegröle ertönten lauter. Arme wurden ausgestreckt, und es wurde mit dem Finger gedeutet. Jemand schrie: »Schande.«
Jitra, der ältere der beiden Beschuldigten, stand ruhig und finster dreinblickend da.
Er war ein rechtschaffener Junge, der allseits beliebt war, einer der Klassenbesten. Als er im vergangenen Jahr zum Tempel nach Jerusalem mitdurfte, hatte er so klug auf die Fragen der Gelehrten geantwortet, dass der Rabbi stolz auf ihn war.
Der Waisenjunge, der kleiner als Jitra war, stand mit zitternden Lippen und kalkweißem Gesicht da, in dem die schwarzen Augen riesig wirkten.
Jason, der Neffe des Rabbi, ein Schreiber, trat zu seinem Onkel auf das Dach und wiederholte dessen Forderung.
»Hört jetzt mit diesem Wahnsinn auf!«, rief er. »Es wird eine Gerichtsverhandlung gemäß dem Gesetz geben. Wo sind die Zeugen? Tretet vor, wenn ihr etwas zu sagen habt. Ober haben diejenigen unter euch, die das Ganze angezettelt haben, etwa Angst?«
Seine letzten Worte gingen im Gebrüll der Menschen unter.
Ich wandte den Kopf in Richtung des Berges und erkannte die Ursache der wiederauflebenden Unruhe: Den Abhang herab kam jetzt Nahom, Jitras Vater, mit Frau und Töchtern. Wieder stießen die aufgebrachten Menschen Beleidigungen und Schmähungen aus, erhoben die Fäuste und stampften mit den Füßen. Unten angekommen, bahnte sich Nahom unbeirrt einen Weg durch das Gewühl, bis er vor seinem Sohn stand.
Der Rabbi hatte wieder das Wort ergriffen und bemühte sich, dem Aufruhr Einhalt zu gebieten, aber seine Stimme war nicht mehr zu hören.
Nahom sagte etwas zu seinem Sohn, aber ich konnte ihn nicht verstehen.
Die Menschen steigerten sich zusehends in ihren Hass hinein. Plötzlich streckte Jitra den Arm aus und zog den Waisenjungen schützend an sich.
Ich schrie: »Nein!« Aber mein Ruf ging im Lärm unter. Da rannte ich los.
Steine flogen durch die Luft. Die Menge tobte, während immer mehr Steine in Richtung der beiden Jungen sausten, die vor dem Palmenhain standen.
Gefolgt von Jakob, überquerte ich die Steine im Bachlauf und schob mich durch das Getümmel auf die beiden Jungen zu.
Aber ich kam zu spät.
Auf dem Dach der Synagoge schrie der Rabbi wie ein wildes Tier.
Die Menge war mit einem Mal still.
Die Hände entsetzt vor den Mund geschlagen, starrte der Rabbi auf den Steinhaufen hinab. Jason wandte sich kopfschüttelnd ab.
Jitras Mutter stieß ein Heulen aus, und ihre Töchter schluchzten laut. Die Menschen stoben auseinander. Sie eilten den Berg hinauf zu ihren Häusern oder auf die Felder, wieder andere durchquerten den Bach, um auf der anderen Seite hügelaufwärts zu streben. In alle Himmelsrichtungen flohen die Menschen.
Der Rabbi riss die Arme in die Höhe:
»Lauft nur weg, ja, lauft weg vor dem, was ihr getan habt! Aber der Herr im Himmel sieht euch!« Er ballte die Hände zu Fäusten. »Der Satan herrscht in Nazareth! Rennt, rennt weg vor der Schande, die ihr begangen habt, gesetzloser, elender Pöbel!« Er legte die Hände an den Kopf und begann so stark zu schluchzen, dass er sich vornüberbeugte und Jason ihn stützen musste.
Schließlich lösten sich auch Jitras Eltern und Schwestern von dem Ort des Grauens. Nahom blickte über die Schulter zurück, ehe er den Arm seiner schluchzenden Frau ergriff und sie die Straße den Berg hinaufschob. Die Mädchen folgten ihnen gebeugt.
Jetzt waren nur noch ein paar Nachzügler übrig, ein paar Landarbeiter und Tagelöhner sowie ein paar Kinder, die das Geschehen im Schatten einer Palme oder in einem Hauseingang verfolgt hatten. Jakob und ich standen noch immer da und starrten auf den Steinhaufen, unter dem die beiden Jungen begraben lagen.
Jitras Arm war um die Schultern des Waisenjungen geschlungen, den Kopf hatte er an seiner Schulter geborgen. Aus einer Wunde am Kopf des Waisenjungen war Blut gesickert. Jitras Augen waren halb geschlossen. Er schien am Kopf verletzt worden zu sein, denn sein Haar war blutverkrustet.
Aus ihren Körpern war alles Leben gewichen.
Hinter mir hörte ich, wie sich auch die restlichen Männer entfernten.
Dann sah ich, wie Josef, der alte Rabbi Berekhia, der kaum noch gehen konnte, sowie die anderen weißhäuptigen Männer, die die Ältesten des Dorfes ausmachten, neben uns auf die Lichtung traten. Auch meine Onkel Kleopas und Alphäus nahmen ihren Platz an der Seite von Josef ein.
Alle wirkten zunächst noch etwas verschlafen, dann verwirrt und schließlich entsetzt.
Josef starrte die toten Jungen an.
»Wie konnte das geschehen?«, fragte er im Flüsterton. Sein Blick wanderte zu Jakob und mir.
Jakob seufzte. Tränen rannen ihm über die Wangen. »Es ist … wie aus dem Nichts passiert«, sagte er ebenfalls flüsternd. »Wir hätten … Ich dachte nicht, dass …« Er ließ den Kopf hängen.
Über uns stand noch immer der Rabbi auf dem Dach der Synagoge und stützte sich schluchzend auf die Schulter seines Neffen, der den Blick auf die Felder gerichtet hatte. In seinem Gesicht spiegelte sich tiefste Trauer.
»Wer hat sie beschuldigt?«, fragte Onkel Kleopas an mich gewandt. »Jeschua, wer hat sie beschuldigt?«
Josef und Rabbi Berekhia wiederholten seine Frage.
»Ich weiß es nicht, Vater«, sagte ich. »Soweit ich mitbekommen habe, sind keine Zeugen vorgetreten.«
Der Rabbi wurde von Schluchzern geschüttelt.
Ich ging näher zu dem Steinhaufen.
Wieder fasste mich Jakob an der Schulter, diesmal jedoch sanfter als zuvor. »Bitte, Jeschua«, sagte er leise.
Ich blieb stehen und betrachtete die beiden Gestalten unter den Steinen, die so friedlich aussahen wie schlafende Kinder. Es war nicht viel Blut zu erkennen, wahrlich nicht genug Blut, um den Todesengel auf sie aufmerksam zu machen.
Kapitel 3
Wir gingen zum Haus des Rabbi. Die Tür war offen.
Ich sah Jason mit über der Brust gekreuzten Armen in der hinteren Ecke neben den Bücherregalen stehen. Der alte Rabbi Jacimus saß zusammengesunken an seinem Schreibtisch, die Ellbogen auf einem Pergamentbogen aufgestützt, das Gesicht in den Händen begraben.
Er schaukelte vor und zurück und betete oder las, ich vermochte es nicht zu sagen.
»Zürne den Menschen nicht, denn wir sind nichts«, sprach er flüsternd. »Beachte nicht, was wir tun; denn was sind wir schon?«
Ich stand neben Josef und Jakob und hörte ihm zu. Kleopas war hinter uns.
»Denn siehe, nur durch deinen Willen kommen wir auf die Erde, und wir verlassen sie nicht durch unseren eigenen Willen; wer hat je zu seinem Vater und seiner Mutter gesagt: ›Zeuget mich!‹ Und wer begibt sich in das Reich des Todes und sagt: ›Nehmet mich auf!‹? Woher sollen wir die Kraft nehmen, o Herr, deinen Zorn zu ertragen? Wer sind wir, dass wir deine Gerechtigkeit ertragen könnten?«
Er drehte den Oberkörper ein wenig in unsere Richtung, als er uns bemerkte, um dann mit seinem Gebet fortzufahren.
»Birg uns in deiner Gnade, und sei bei uns mit deiner Barmherzigkeit.«
Mit sanfter Stimme wiederholte Josef die letzten Worte.
Einen Moment lang sah Jason aus, als könnte er all das nicht länger ertragen, doch eine sanfte Wehmut lag in seinen Augen, wie ich sie selten bei ihm wahrgenommen hatte. Mit seinem dunklen Haar und wie stets makellos gekleidet, war er ein schöner Mann; am Sabbat duftete sein Leinengewand oft nach Weihrauch.
Als ich als Kind nach Nazareth kam, war der Rabbi ein Mann in der Blüte seines Lebens gewesen, doch jetzt beugte sich seine Gestalt unter der Last der Jahre, und sein Haar war genauso weiß wie das von Josef oder meiner Onkel. Er blickte uns abwesend, ja, beinahe erstaunt an, als könnten wir ihn nicht sehen, als stünden wir nicht da und warteten auf ein Wort von ihm.
Schließlich sagte er müde: »Werden sie fortgeschafft?« Er meinte die Leichen der beiden Jungen.
»Ja, man kümmert sich darum«, sagte Josef. »Und auch um die blutbeschmutzten Steine.«
Der Rabbi hob den Blick an die Decke und seufzte. »Jetzt gehören sie Azazel.«
»Nein, das wohl nicht, aber sie sind von uns gegangen«, sagte Josef. »Und deshalb sind wir gekommen, um mit dir zu sprechen. Wir ahnen, wie du dich fühlst. Was können wir tun? Sollen wir zu Nahom und der Mutter des Jungen gehen?«
Der Rabbi nickte. »Josef, am liebsten wäre mir, du würdest hierbleiben und mich trösten.« Er schüttelte den Kopf. »Aber du hast recht, geh zu ihm, dein Platz ist jetzt bei der Familie des Jungen. Nahom hat Brüder in Judäa. Sag ihm, er soll mit den Seinen zu ihnen ziehen. In diesem Ort wird er nie mehr seinen Frieden finden. Sag mir, Josef, wie konnte das geschehen?«
Jason hob in seiner typisch auffahrenden Art den Kopf. »Man muss nicht in Rom und Athen gewesen sein, um die Dinge zu lernen, die die beiden Jungen getan haben«, sagte er. »Warum sollten sie nicht auch in Nazareth geschehen?«
»Das war nicht meine Frage«, sagte der Rabbi und sah seinen Neffen scharf an. »Ich habe nicht gefragt, was die Jungen getan haben. Wir wissen es ohnehin nicht! Es gab keine Verhandlung, keine Zeugen, keine Gerechtigkeit! Ich habe gefragt, wie es passieren konnte, dass sie die Jungen steinigten, das will ich wissen. Wo ist das Gesetz, wo ist die Gerechtigkeit?«
So heftig wie der Rabbi seinen Neffen zurechtwies, hätte man meinen können, er verachtete ihn, aber so war es nicht: Der Rabbi liebte Jason. Seine eigenen Söhne waren alle gestorben. Jason hielt den Rabbi jung, und wann immer sein Neffe nicht in Nazareth weilte, sondern an irgendeinem entfernten Ort, war der Rabbi abwesend und vergesslich. Sobald Jason jedoch durch die Tür kam, mit einem Sack Büchern über der Schulter, blühte der Rabbi wieder auf. Manchmal hatte man während der hitzigen Debatten, die Onkel und Neffe bisweilen führten, den Eindruck, zwei leidenschaftliche junge Männer vor sich zu haben.
»Ah, und was werden sie tun«, fuhr Jason fort, »wenn Jitras Vater die Jungen findet, die das Ganze angezettelt haben? Du weißt sehr wohl, dass es Kinder waren, diese Jungen, die immer bei der Taverne herumhängen. Und ebendiese Jungen waren verschwunden, noch bevor der erste Stein durch die Luft flog. Nahom wird sein ganzes Leben damit zubringen können, nach ihnen zu suchen.«
»Kinder«, sagte Onkel Kleopas, »Kinder, die wahrscheinlich nicht wussten, was sie sahen. Was wollen sie denn gesehen haben? Zwei Jungen unter einer Decke in einer kalten Winternacht.«
»Es ist vorbei«, sagte Jakob. »Sollen wir jetzt die Gerichtsverhandlung abhalten, da es zu spät ist? Es ist vorüber, sage ich euch.«
»Du hast recht«, sagte der Rabbi. »Aber würdest du zu der Mutter und dem Vater des Jungen gehen, tust du das für mich? Ich brächte vor lauter Schluchzen kaum ein Wort heraus, wenn ich selbst ginge, und Jason würde womöglich merkwürdige Dinge sagen …«
Jason stieß sein typisches dunkles Lachen aus. »Merkwürdige Dinge. Dass dieses Dorf ein einziger erbärmlicher Staubhaufen ist? Ja, solch merkwürdige Dinge würde ich sagen.«
»Du bist nicht gezwungen, hier zu leben, Jason«, sagte Jakob. »Niemand hat je behauptet, Nazareth brauchte seinen eigenen griechischen Philosophen. Geh zurück nach Alexandria oder Athen oder Rom oder an welchen Ort auch immer es dich von Zeit zu Zeit zieht. Brauchen wir etwa deine ewigen Grübeleien? Wir brauchen sie nicht und haben sie noch nie gebraucht.«
»Sei nachsichtig, Jakob«, sagte Josef.
Der Rabbi tat so, als hätte er den Streit gar nicht mitbekommen. »Geht zu ihnen, Josef und Jeschua, ihr findet immer die richtigen Worte. Jeschua gelingt es, jeden zu beruhigen. Erklär Nahom, dass sein Sohn noch ein Kind war, ebenso wie der Waisenjunge, ach, der arme Waisenjunge.«
Wir wollten uns gerade zum Gehen wenden, als sich Jason aus seiner Ecke löste und mich anstarrte. Ich erwiderte seinen Blick.
»Nimm dich in Acht, sonst sagen die Leute womöglich die gleichen Dinge über dich, Jeschua«, meinte er.
»Was sagst du da?« Der Rabbi stand von seinem Stuhl auf.
»Ach, lass doch«, sagte Josef ruhig. »Jason grämt sich nur wieder einmal, weil es so viele Dinge gibt, die er noch nicht weiß.«
»Wie, willst du etwa leugnen, dass die Menschen merkwürdige Dinge über Jeschua munkeln?« Jason starrte zuerst Josef an und dann mich. »Du weißt doch, wie sie dich nennen, mein schweigsamer, standhafter Freund«, sagte er an mich gewandt. »Sie nennen dich Jeschua den Sündenfreien.«
Ich lachte, drehte jedoch das Gesicht weg, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich lachte ihm ins Gesicht, auch wenn ich genau das tat. Er fuhr fort, doch ich hörte ihn nicht mehr. Stattdessen betrachtete ich seine Hände. Wie so oft, wenn er wieder einmal eine Schimpfrede hielt oder ein langes Gedicht vortrug. Seine Hände ließen mich an Vögel denken.
Plötzlich packte ihn der Rabbi an seinem Gewand und holte mit der rechten Hand aus, als wollte er ihn ohrfeigen. Doch stattdessen sank er auf seinen Stuhl zurück. Jason stieg die Röte ins Gesicht. Bestimmt bereute er seine Worte.
»Nun, sie reden eben, das weißt du doch, nicht wahr?«, sagte er. »Wo ist deine Frau, Jeschua, und wo sind deine Kinder?«
»Ich werde keine Minute länger hier herumstehen und mir dieses Geschwätz anhören.« Jakob nahm mich am Arm und zog mich in Richtung Tür. »Du wirst mit meinem Bruder nicht mehr so sprechen«, sagte er über die Schulter zu Jason. »Jeder weiß, was an dir nagt. Hältst du uns für Dummköpfe? Glaubst du, wir wüssten nicht, dass Abigail dich zurückgewiesen hat? Ihr Vater hat sich über dich lustig gemacht.«
Josef schob Jakob weiter. »Es reicht jetzt, mein Sohn. Musst du ihm denn jedes Mal auf den Leim gehen?«
Kleopas stimmte ihm mit einem Nicken zu.
Der Rabbi lehnte sich in seinem Stuhl zurück und legte den Kopf auf das Pergament vor ihm.
Josef beugte sich zu ihm hinab und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Ich hörte nur den tröstenden Klang seiner Worte, ohne sie zu verstehen. Währenddessen warf Jason Jakob wütende Blicke zu, so als wäre Jakob mit einem Mal sein Feind, und Jakob sah ihn seinerseits höhnisch an.
»Ist nicht schon genug Leid in diesem Dorf geschehen?«, fragte Kleopas ruhig. »Warum musst du immer den Satan mimen? Musst du meinen Neffen Jeschua auf die Anklagebank setzen, nur weil es für Jitra und den Waisenjungen keine Verhandlung gegeben hat?«
»Manchmal habe ich das Gefühl, nur deshalb geboren worden zu sein, um die Dinge auszusprechen, die die anderen sich nicht auszusprechen trauen. Ich will Jeschua nur warnen, weiter nichts.« Jason senkte seine Stimme zu einem Flüstern. »Wartet seine Verwandte denn nicht darauf, dass er sich ihr endlich erklärt?«
»Das stimmt nicht!«, sagte Jakob. »Nichts als das Fiebergeschwätz eines Neiders! Dich hat sie zurückgewiesen, weil du verrückt bist, und warum sollte eine Frau einen windigen Burschen wie dich heiraten, es sei denn, man zwänge sie dazu?«
Mit einem Mal redeten alle durcheinander, Jason, Jakob, Kleopas, ja, sogar Josef und der Rabbi.
Ich ging hinaus und weiter die Straße hinunter. Der Himmel war blau, und das Dorf war wie ausgestorben. Angesichts des Vorfalls am frühen Morgen wollte niemand das Haus verlassen, wenn er nicht unbedingt musste. Selbst nachdem ich ein gutes Stück gegangen war, konnte ich die Männer noch streiten hören.
»Geh und schreib einen Brief an deine epikureischen Freunde in Rom«, hörte ich Jakob sagen. »Erzähl ihnen von den Vorkommnissen in dem elenden Nest, in dem zu leben du verdammt bist. Warum schreibst du keine Spottrede darüber?«
Jakob folgte mir.
Auch Jason war mit den älteren Männern aus dem Haus getreten, schob sich an ihnen vorbei und rannte hinter Jakob und mir her.
»Ich werde dir mal was sagen: Wenn ich etwas wirklich Geistreiches schreiben würde, dann gäbe es im ganzen Dorf nur einen, der es verstünde, und das ist dein Bruder Jeschua.«
»Jason, Jason …«, sagte ich. »Nun lass doch. Warum diese Reden?«
»Nun, wenn es nicht um dich ginge, dann würde er sich eben über etwas anderes auslassen«, sagte Jakob. »Auch wenn man nicht mit ihm redet, ihn nicht beachtet, wird er eines Tages einen Grund finden, einen Streit vom Zaun zu brechen. Ist es nicht genug, dass wir unter diesem trockenen Winter zu leiden haben und dass Pontius Pilatus damit droht, die Heilige Stadt mit den römischen Flaggen bestücken zu lassen? Und doch fällt ihm nichts Besseres ein, als über so etwas zu streiten.«
»Du hältst die Geschichte mit der Beflaggung wohl für einen Witz«, erwiderte Jason. »Ich sage dir, dass seine Soldaten in diesem Augenblick auf Jerusalem zumarschieren, und wenn ihnen danach ist, werden sie sogar den Tempel selbst beflaggen. So weit wird es kommen.«
»Hör auf, niemand weiß etwas Genaues«, sagte Josef. »Wir warten auf Nachrichten über Pontius Pilatus, so wie wir sehnsüchtig auf Regen warten. Lasst es jetzt gut sein, ihr beiden.«
»Geh zu deinem Onkel zurück«, sagte Jakob. »Warum folgst du uns und behelligst uns? Es gibt niemanden in Nazareth, der noch mit dir spricht. Geh zurück. Dein Onkel braucht dich. Dort warten doch bestimmt leere Seiten, um beschrieben zu werden. Um mit Nachrichten über die Umtriebe beschrieben zu werden, die hier vorgehen und die du unbedingt jemandem mitteilen musst, nicht wahr? Oder ist dieses Land vielleicht so gesetzlos wie die Banditen, die sich in den Bergen verstecken? Sollen wir die Leichname etwa stillschweigend begraben, ohne die Todesursache aufgezeichnet zu haben? Also, geh zurück zu deiner Arbeit.«
Josef brachte Jakob mit einem strengen Blick zum Schweigen, woraufhin dieser mit gebeugtem Kopf weiterging.
Wir anderen taten es ihm gleich, doch ich bemerkte, dass Jason uns noch immer folgte.
»Ich will dir nichts Böses, Jeschua«, sagte er. Sein vertraulicher Ton brachte Jakob erneut auf, doch Josef hielt ihn zurück, als dieser sich abermals an Jason wenden wollte.
»Ich will dir wirklich nichts Böses«, sagte Jason nochmals. »Dieser Ort ist verflucht. Es wird nie mehr regnen. Die Felder werden vertrocknen. Die Gärten werden verdorren. Die Blumen werden verwelken.«
»Jason, mein Freund«, sagte ich, »der Regen kommt bestimmt, früher oder später.«
»Und was, wenn er nie mehr kommt? Was, wenn sich die Pforten des Himmels auf ewig geschlossen haben, und zwar zu Recht?« Die Worte wollten nur so aus ihm heraussprudeln, aber ich gebot ihm Einhalt, indem ich die Hand hob.
»Komm später zu mir, und wir werden bei einem Becher Wein darüber reden«, sagte ich. »Ich muss jetzt zu Nahom und seiner Familie.«
Jason blieb stehen, drehte sich um und ging zum Haus seines Onkels zurück. Kurz darauf hörte ich ihn aus einiger Entfernung rufen:
»Jeschua, verzeih mir.«
Seine Worte waren für alle vernehmlich.
»Jason«, rief ich, »es sei dir verziehen!«
Kapitel 4
Jitras Mutter hatte ihre Familie angewiesen, alle Habseligkeiten zu Bündeln zu packen und die Esel damit zu beladen. Die Jüngsten waren dabei, den Läufer auf der gestampften Erde zusammenzurollen; er war aus feiner Wolle und womöglich das Kostbarste in ihrem Haushalt.
Als sie Josef sah, erhob sie sich von den Knien und warf sich in seine Arme. Wie eine Ertrinkende klammerte sie sich an ihn.
»Ihr werdet sicher nach Judäa gelangen«, sagte Josef. »Die Reise wird euch bestimmt guttun, und ehe es Nacht wird, werden deine Kleinen weit weg sein vom Getuschel und den Blicken dieses Orts. Wir wissen, wo Jitra begraben ist, und werden sein Gedenken in Ehren halten.«
Sie starrte ihn aus aufgerissenen Augen an, als versuchte sie, den Sinn seiner Worte zu begreifen.
Nahom kam zusammen mit zwei Helfern herein, die er angeheuert hatte. Wir konnten sehen, dass die beiden Männer ihn dazu gezwungen hatten, nach Hause zurückzukehren. Kaum war er im Zimmer, ließ er sich erschöpft gegen die Wand fallen und blickte mit ausdruckslosen Augen ins Leere.
»Kümmere dich nicht weiter um diese elenden Geschöpfe«, sagte Josef zu ihm. »Sie sind längst über alle Berge. Sie wissen, dass sie unrecht getan haben. Überlass sie der Gnade des Himmels. Ihr geht jetzt nach Judäa, wo ihr den Staub dieses Dorfs von den Schuhen streifen könnt.«
Einer der Helfer, ein sanft aussehender Mann, trat vor, nickte und legte je einen Arm um Josef und Nahom. »Schemaja wird dir dein Land abkaufen und dir einen guten Preis dafür geben«, sagte er zu Nahom. »Ich würde es auch kaufen, wenn ich könnte. Jedenfalls könnt ihr in Frieden gehen. Josef hat recht, wenn er sagt, dass diese elenden Kinder längst über alle Berge geflohen sind. Womöglich werden sie sich den Banditen anschließen. Geschmeiß zieht sich gegenseitig an. Was könntest du schon ausrichten? Willst du alle Männer dieses Ortes verantwortlich machen und töten?«
Jitras Mutter schloss die Augen und ließ den Kopf auf die Brust fallen. Ich fürchtete schon, sie würde in Ohnmacht sinken, aber sie war nur erschöpft.
Josef zog die Eltern des gesteinigten Jungen an sich.
»Ihr habt noch immer diese Kleinen hier. Was soll aus ihnen werden, wenn ihr euch gehenlasst?«, fragte er. »Nun hört mir zu. Ich will euch sagen, dass …« Er geriet ins Stammeln. Seine Augen schwammen in Tränen. Er rang sichtlich nach Worten.
Ich trat zu ihnen und umarmte die Eltern. Beide sahen mich an wie verängstigte Kinder.
»Es gab keine Gerichtsverhandlung, wie ihr wisst«, sagte ich. »Das bedeutet, dass nie wirklich jemand erfahren wird, was Jitra und der Waisenjunge taten, wann und wo, und ob sie überhaupt etwas taten. Niemand wird es je erfahren. Auch die Burschen, die die beiden beschuldigten, wissen nichts. Nur der Himmel weiß es. Macht nicht den Fehler, diese Jungen in eurem Herzen zu verurteilen. Es kann keine Gerichtsverhandlung mehr geben, und das heißt, dass es richtig so ist.
Also trauert in eurem Herzen um Jitra. So wird Jitra für immer unschuldig bleiben.«
Jitras Mutter hob den Blick zu mir. Ihre Augen wurden schmal, aber dann nickte sie. Nahoms Gesicht blieb ausdruckslos, doch langsam machte er sich daran, die verbliebenen Bündel hochzuheben, um sie dann mit schlurfenden Schritten hinauszutragen und sie auf die Rücken der wartenden Lasttiere zu schnallen.
»Wir wünschen euch eine sichere Reise«, sagte Josef. »Und sagt mir, ob ihr noch etwas braucht. Meine Söhne und ich wollen euch geben, was immer ihr benötigt.«
»Wartet«, sagte Jitras Mutter. Sie ging zu einer Truhe und löste die Schnallen. Dann nahm sie ein zusammengefaltetes Gewand heraus, das aussah wie ein wollener Mantel.
»Das«, sagte sie, während sie es mir reichte, »ist für die stumme Hannah.«
Die stumme Hannah war die Schwester des Waisenjungen.
»Ihr werdet euch doch um sie kümmern, nicht wahr?«, fuhr die Frau fort.
Josef sah sie erstaunt an. »Mein Kind, mein armes Kind«, sagte er. »Wie lieb von dir, an die stumme Hannah zu denken in Zeiten, die so schwer für euch sind. Natürlich werden wir uns um sie kümmern. Wir werden uns immer um sie kümmern, das verspreche ich dir.«
Kapitel 5
Als wir ins Haus kamen, sahen wir, dass die stumme Hannah nicht allein war – Abigail war bei ihr.
Aber das erstaunte nicht weiter: Wo immer Abigail war, war auch die stumme Hannah, und wo immer die beiden auftauchten, folgte ihnen eine große Kinderschar. Jakobs Söhne Isaak und Schabi sowie meine anderen Nichten und Neffen – stets scharten sich die Kinder um die beiden Mädchen. Es war Abigail, die die Kinder anzog. Oft sang sie mit ihnen, lehrte sie die alten Lieder und kleine Abschnitte aus der Heiligen Schrift zu lesen; manchmal brachte sie ihnen selbst gedichtete Reime bei und zeigte den kleinen Mädchen, wie man mit Garn und Nadel umging, um all die Wäschestücke auszubessern, die sich in ihrem Nähkorb angesammelt hatten. Die stumme Hannah, die weder sprechen noch hören konnte, war die meiste Zeit bei Abigail. Nur manchmal, wenn Abigails Vater wieder einmal das kranke Bein zu schaffen machte, wohnte sie bei uns und schlief bei meiner Mutter und meinen Tanten im Zimmer.
Als wir nun das Haus betraten, waren die Frauen mit Abigail und der stummen Hannah allein. Die anderen Kinder waren zum Spielen hinausgeschickt worden. Sofort stand die stumme Hannah auf und sah uns an, in der Hoffnung, dass wir neue Nachrichten für sie hätten. Mit flehendem Blick wandte sie sich an Josef.
Abigail erhob sich ebenfalls, um ihr beiseitezustehen. Ihre Augen waren rot vom Weinen, und nichts an ihr erinnerte mehr an die Abigail, wie wir sie kannten. Die Verzweiflung und der Kummer über das Geschehene standen ihr ins Gesicht geschrieben, während sie die stumme Hannah voller Mitgefühl ansah.
Obwohl Hannah taubstumm war, besaß sie einen Reichtum an Gesten und konnte sich auf diese Weise sehr gut verständlich machen. Wir alle kannten die Bedeutung ihrer Gebärden, und ich fand ihre Hände so schön wie die Jasons. Es war einige Jahre her, da sie und der Waisenjunge als Obdachlose nach Nazareth gekommen waren. Seither wohnte sie bei uns, während der Waisenjunge mal hier und bald dort geschlafen hatte.
Niemand wusste, wie alt sie war. Sie mochte fünfzehn oder sechzehn sein. Der Waisenjunge war jünger gewesen.
Nun fragte sie Josef gestenreich nach ihrem Bruder. Wo war er? Was war mit ihm geschehen? Niemand hatte es ihr bisher gesagt. Ihr Blick glitt durch das Zimmer, streifte die Gesichter der Frauen, die an der Wand standen. Was ist meinem Bruder zugestoßen?, fragten ihre Augen flehentlich.