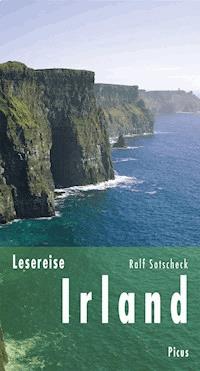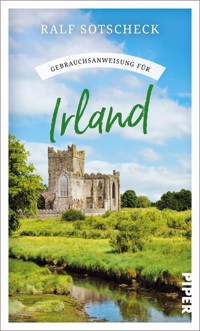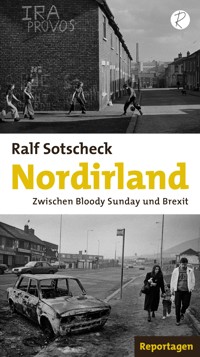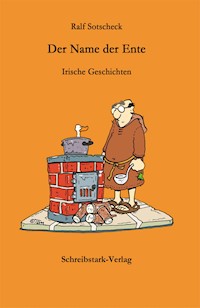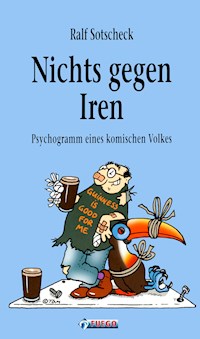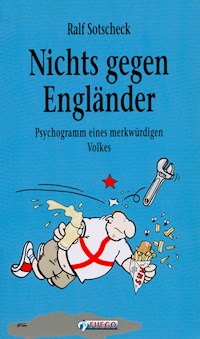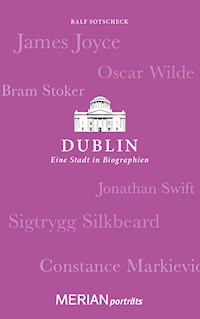6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Langsam glaube ich es selbst. Meine Freunde behaupten, ich habe ein Händchen des Todes für elektrische und elektronische Geräte. Es hatte bei mir schon in jungen Jahren angefangen: Als mein Onkel stolz seine neue Spiegelreflexkamera vorführte und ich ein Foto machen wollte, verklemmte sich der Spiegel. Das war der Auftakt, die Missgeschicke zogen sich fortan durch mein Leben. Mein großer Flachbildfernseher zeigt ohne ersichtlichen Grund grünstichige Bilder, so dass mich der Fernsehmechaniker nach dem dritten Hausbesuch bat, seine Visitenkarte zu zerreißen. Als ich in einem schottischen Hotel in der Badewanne saß und Wasser nachlaufen ließ, konnte ich den Hahn nicht mehr abstellen, so dass das Wasser überlief. Und meine Einwegfeuerzeuge geben regelmäßig den Geist auf, obwohl sie noch halb voll sind." Ralf Sotscheck ist ein Meister des Fabulierens. Hier setzt er sich und seinen Landsleuten wieder einmal ein bizarres Denkmal. Er untersucht das Talent der Iren, größere, kleinere und alltägliche Katastrophen hervorzurufen und sie dann grandios zu meistern. Die Geschichten in diesem Buch basieren auf Kolumnen, die zwischen 1991 und 2011 auf der Wahrheit-Seite der taz und zum Teil in längst vergriffenen Kolumnensammlungen erschienen sind. Sie wurden für dieses Buch überarbeitet und aktualisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ralf Sotscheck
Irland
Die tückische Insel
Mit Illustrationen von
© TOM
FUEGO
- Über dieses Buch -
»Langsam glaube ich es selbst. Meine Freunde behaupten, ich habe ein Händchen des Todes für elektrische und elektronische Geräte. Es hatte bei mir schon in jungen Jahren angefangen: Als mein Onkel stolz seine neue Spiegelreflexkamera vorführte und ich ein Foto machen wollte, verklemmte sich der Spiegel. Das war der Auftakt, die Missgeschicke zogen sich fortan durch mein Leben. Mein großer Flachbildfernseher zeigt ohne ersichtlichen Grund grünstichige Bilder, so dass mich der Fernsehmechaniker nach dem dritten Hausbesuch bat, seine Visitenkarte zu zerreißen. Als ich in einem schottischen Hotel in der Badewanne saß und Wasser nachlaufen ließ, konnte ich den Hahn nicht mehr abstellen, so dass das Wasser überlief. Und meine Einwegfeuerzeuge geben regelmäßig den Geist auf, obwohl sie noch halb voll sind.«
Aber diese Unheil bringenden Fähigkeiten beschränken sich nicht nur auf Ralf Sotscheck, vielmehr scheint es sich um eine Eigenart der Iren zu handeln, Katastrophen hervorzurufen und sie gleichzeitig souverän zu überstehen.
»Sotscheck gelingt es bei allem glänzend geschliffenem Spott, mit dem er die Zustände der grünen Bananenrepublik überzieht, dass ein Grundton amüsierter Sympathie für das komische Volk durch seine Texte summt.« (Frankfurter Allgemeine)
»Die Glossen, in denen Sotscheck unglaublich rasant und elegant von einem Thema wie dem Titanic-Untergang zum Umgang mit Cablelink-Angestellten kommt, sind einfach nur der Lust am Erzählen sehr guter Geschichten geschuldet.« (Schaumburger Nachrichten)
Das Händchen des Todes
Ein Vorwort
Langsam glaube ich es selbst. Meine Freunde behaupten, ich habe ein Händchen des Todes für elektrische und elektronische Geräte. Zeichner Tom zeigte mir stolz seinen unabstürzbaren Computer. Ich bewies ihm das Gegenteil. Dabei hatte ich lediglich eine Email geschrieben. Bei Redakteur Michael Ringels Handy fror der Bildschirm ein, als er mir ein Foto zeigen wollte. Er blieb erstaunlich gelassen. »Ich will mir morgen ohnehin das neue iPhone kaufen«, sagte er. »Glaubst du, ich hätte dir sonst mein Telefon in die Hand gegeben?«
Meinem eigenen schnurlosen Telefon erging es nicht besser. Es war ein Kombigerät, mit dem man auch skypen konnte. Theoretisch jedenfalls. Ich konnte weder skypen noch normale Telefongespräche führen. Mein Freund Aribert, der im Gegensatz zu mir über heilende Hände für Gerätschaften verfügt, nahm das Telefon mit und brachte es am nächsten Tag mit der Bemerkung zurück: »Bei mir funktioniert es tadellos.« Als ich es ausprobierte, brannte die Basisstation durch.
Es hatte bei mir schon in jungen Jahren angefangen: Als mein Onkel stolz seine neue Spiegelreflexkamera vorführte und ich ein Foto machen wollte, verklemmte sich der Spiegel. Das war der Auftakt, die Missgeschicke zogen sich fortan durch mein Leben. Mein großer Flachbildfernseher zeigte ohne ersichtlichen Grund grünstichige Bilder, so dass mich der Fernsehmechaniker nach dem dritten Hausbesuch bat, seine Visitenkarte zu zerreißen. Als ich in einem schottischen Hotel in der Badewanne saß und Wasser nachlaufen ließ, konnte ich den Hahn nicht mehr abstellen, so dass das Wasser überlief.
Offenbar beschränken sich meine Unheil bringenden Fähigkeiten aber nicht auf Kleingeräte. Als ich einmal nach Düsseldorf wollte, hatte das Flugzeug zwei Stunden Verspätung – »wegen rätselhafter technischer Probleme«. Dabei hatte ich die Maschine nicht mal angefasst. Der Zug, mit dem ich weiterreisen wollte, wurde in letzter Minute gestrichen – »wegen unerwarteter technischer Probleme«. Auf dem Rückweg geschah das gleiche: Erst musste ein ganzer Eisenbahnwaggon gesperrt werden, weil ihn jemand um acht Uhr morgens vollgekotzt hatte, wofür ich nun wirklich nichts konnte. Dann hatte die Bahn 20 Minuten Verspätung, natürlich wegen technischer Probleme, wodurch ich den Anschlusszug verpasste und ein Taxi nehmen musste, um nicht auch noch den Flug zu verpassen.
Ich muss nicht mal selbst Hand anlegen, es reicht, wenn Handwerker ins Haus kommen. Ein Angestellter vom Kabelfernsehen, der aufgrund meiner Beschwerde über den schlechten Empfang angerückt war, richtete Schäden in Höhe von 5.000 Euro an. Ein anderer deckte das halbe Dach ab, als er Laub aus der Regenrinne fegen wollte. Und der Tischler, der mir einen Küchenschrank bauen wollte, landete im Krankenhaus, weil seine Konstruktion einstürzte.
Auch ohne meine Beteiligung geht vieles in Irland schief: Eisenbahnen, die ihre Passagiere vergessen; Behörden, die Baugenehmigungen mit abenteuerlichen Begründungen ein ums andere Mal ablehnen; Linienbusse, die sich verfahren; Politiker, die sich so ungeschickt bestechen lassen, dass es auffliegt – die Liste ließe sich mühelos verlängern. Habe ich Irland infiziert, oder ist es umgekehrt?
Ich werde Aribert künftig bitten, seine heilenden Hände kurz auf meine Flug- und Bahntickets sowie auf meine elektrischen Geräte zu legen, um mein schlechtes Karma zu neutralisieren. Ringel meinte, ich solle mich von der Stiftung Warentest anstellen lassen: Falls ein Gerät meine Handhabung übersteht, bekomme es das Gütesiegel »S-geprüft«. Tom sagte hingegen, es wäre lukrativer, den Media-Markt zu erpressen: »Du drohst einfach damit, alle Geräte im Laden anzufassen, falls sie dir nicht umgehend Geld geben.«
Er empfahl mir den Film »Schrecken der Medusa«, eine Mischung aus Thriller, Horror- und Katastrophenfilm. Darin spielt Richard Burton einen Mann, der Katastrophen auslösen kann. So lässt er zum Beispiel eine Kathedrale einkrachen, einen Jumbo-Jet abstürzen und eine Mondlandung missglücken. »Im Grunde ist das ein Film über dich«, sagte Tom. Ich habe mir den Streifen bestellt. Vermutlich wird der DVD-Spieler explodieren.
Handwerker sind Vampire
Es war die Mutter aller Schiffskatastrophen. Und sie hatte ihren Anfang in Irland genommen. Die Titanic war der Stolz von Belfast. 1912 ist sie in die Geschichte geschwommen. Zunächst schwamm sie freilich in einen Eisberg. Vier Stunden später war von dem Schiff nichts mehr zu sehen. Nur 703 Menschen wurden gerettet, 1.503 starben. Mit Hilfe von Ultraschall hat man herausgefunden, dass es keineswegs ein großes Loch war, das dem in Belfast gebauten Kahn zum Verhängnis wurde, sondern lediglich sechs handbreite Risse.
Wie dem auch sei – das Boot ist längst zur Legende geworden, es gibt zahllose Bücher und Filme, von denen allerdings manche nicht den erhofften Profit einbrachten. »Hebt die Titanic« zum Beispiel war nicht nur grottenschlecht, sondern auch überaus teuer. Lew Grade, der Produzent, sagte damals, es wäre billiger gewesen, statt dessen den Ozean abzusenken. Auch das Broadway-Musical »Titanic« war nicht sonderlich erfolgreich. Die Generalprobe musste drei Mal wegen »technischer Schwierigkeiten« abgesagt werden: Das Schiffsmodell war im Gegensatz zu seinem Vorbild tatsächlich unsinkbar. Produzent Michael Braun erlebte das nicht mehr. Er war nach der ersten Probe an einem Herzinfarkt gestorben. Das gleiche Schicksal droht den Käufern einer CD mit Titanic-Liedern. Einer der Songs heißt: »Eis, Eis! O nein, o nein!« Oh nein.
Rund um den Globus sind Hunderte Titanic-Clubs gegründet worden. Die Ulster Titanic Society hält sich für die einzig authentische, weil sie in Belfast residiert. Schließlich, so sagen die Mitglieder, sei die Titanic hier länger als an irgendeinem anderen Ort gewesen. Abgesehen vom Meeresboden. War es aber damals gar kein Unglück, sondern ein Versicherungsbetrug? Vieles spricht dafür. Der Besitzer der Titanic, John Pierpoint Morgan, und seine Freunde sagten ihre Teilnahme an der Jungfernfahrt in letzter Sekunde ab. Viele von der Besatzung blieben ebenfalls an Land, weil sie angeblich Angst vor dem Schiff hatten. Und der Kapitän Edward Smith war ein Bruchpilot ersten Ranges: Er hatte bereits so viele Schiffe versenkt, dass man ihm eigentlich nicht mal ein Gummiboot anvertrauen durfte, geschweige denn das größte Schiff der Welt. Er soll denn auch trotz der Warnungen mit Volldampf in den Eisberg gerast sein.
Vermutlich lag es aber gar nicht an dem Kapitän, sondern an den irischen Handwerkern, die das Schiff gebaut hatten. Die kriegen alles klein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bei mir fing das Unglück damit an, dass ich mich bei der Kabelgesellschaft Cablelink über das erbärmliche Bild beschwerte. Noch am selben Abend stand ein schlechtgelaunter junger Mann vor der Tür und wollte ein neues Kabel ziehen. »Der Anschlusskasten unter dem Dach muss weg«, behauptete er. »Die Büsche davor stören den Empfang.« Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich über rudimentäre physikalische Kentnisse verfüge und seine Behauptung sofort als Lüge entlarven konnte. »Ich diskutiere nicht«, schnitt er mir jedoch das Wort ab. »Der Kasten kommt weg.«
Cablelink-Angestellte müssen wie rohe Eier behandelt werden: Ohne Kabel kann man nämlich weder die britischen Sender noch den Nachrichtenkanal empfangen. Der giftige Mechaniker genoss ganz offensichtlich seine Macht und schickte mich in die Küche zum Tee kochen, während er den Bohrer unten an der Hauswand ansetzte. Im nächsten Augenblick war es dunkel. Die Stille wurde nur durch leises Wasserplätschern unterbrochen. Der Tölpel hatte nicht nur das Stromkabel, sondern auch das Heizungsrohr unter dem Fußboden durchbohrt. Freilich wälzte er die Schuld sofort auf mich ab: »Da dürften gar keine Rohre verlaufen.« Das leuchtete mir ein. Ich hätte sie vorher beiseite räumen müssen. Wer konnte aber ahnen, dass der zerstörungswütige Mensch sich um 10 Zentimeter verschätzen und mit seinem Bohrer tief im Fußboden statt auf der anderen Seite der Wand landen würde?
Schließlich hatte er Erbarmen und holte Hilfe: Sieben Kollegen, die mir den Rat gaben, den Haupthahn zu schließen. Auf diese geniale Idee war ich bereits ohne ihr Zutun gekommen. »Mehr können wir heute auch nicht machen«, sagten die sieben einstimmig. Bei einer Tasse Tee, zubereitet auf dem Campingkocher, berieten sie über das weitere Vorgehen. Das Wasser hatte sich inzwischen unter den Teppichen im Wohnzimmer und Flur verteilt und arbeitete sich langsam bis ins Hinterzimmer vor. Bei jedem Schritt quietschte es leise. Am nächsten Morgen standen die »Magnificent Seven« wieder vor der Tür. Das Stromkabel war kein Problem, aber das Heizungsrohr war weitaus schwieriger. »Ich habe überhaupt nichts gegen Engländer«, sagte der teetrinkende Anführer. »Aber diese Heizung ist von einem Engländer eingebaut worden.« Das Reparatur-Hindernis bestand darin, dass in England metrische Rohre benutzt werden, während irische Rohre in Zoll gemessen werden. Ein Ersatzrohr gab es nur in Belfast.
Man wartete. Ich wusste längst, wer Tee und wer Kaffee bevorzugte, wer die Heißgetränke schwarz oder mit Milch zu sich nahm, und wieviel Zucker in die entsprechenden Tassen gehörte. Am Abend war es dann soweit, doch die Freude hielt sich in Grenzen: Das gesamte Heizungssystem war voller Luft. Es dauerte geschlagene drei Tage, bis es der Siebenerbande gelang, die Blähungen zu beseitigen. Der Besitzer des kleinen Ladens fragte mich, ob ich eine Pension eröffnet hätte, als ich am dritten Tag in Folge ein Päckchen Tee und ein Pfund Kaffee kaufte.
Der Fernsehempfang war danach schlechter als zuvor. »Das liegt an der Signalstäke«, erklärte der Cablelink-Täter. »Wir müssen das am Sender regeln.« Also war die ganze Verwüstung unnötig? »So kann man das nicht sehen«, sagte er. »An das neue Kabel kannst du sechs Fernseher anschließen.« Will ich aber nicht. »Dann sei getröstet: Der Empfang ist jetzt im gesamten Viertel schlecht.« Das ist die irische Lösung: Gleiches Recht für alle. Dabei hatte ich noch großes Glück gehabt, dass ich nicht in Limerick wohne. Die westirische Stadt ist für die nach ihr benannte Gedichtform bekannt. Außerdem hat Frank McCourt der Stadt mit seinem Buch »Die Asche meiner Mutter« ein Denkmal gesetzt, wenn auch ein wenig schmeichelhaftes, denn er hat Limerick als klerikalistisches Kaff dargestellt, in dem es ständig regnet. Im Rest des Landes ist Limerick hingegen als »Stab City« verschrien – als »Stadt der Messerstecher«. Die wahren Kriminellen sitzen dort aber offenbar in den Behörden.
John und Shirley O’Reilly kamen eines Tages aus dem Urlaub zurück und freuten sich auf einen entspannten Abend in ihrem neuen Haus in Limerick. Zu ihrer Überraschung fanden sie lediglich eine Wiese vor. Das Haus war weg, mitsamt Möbeln und persönlichen Gegenständen. Der Polizist, dem sie den Diebstahl ihres Eigenheims meldeten, tippte auf eine größere Verbrecherbande, denn so ein Haus sei ja nicht so leicht wegzuschaffen. Nachforschungen ergaben jedoch, dass die Stadtverwaltung das Haus abreißen ließ, weil die O’Reillys angeblich gegen die Bauauflagen verstoßen hatten. Man habe sie mehrmals gewarnt und den Abriss schriftlich angekündigt. Der Beamte wunderte sich allerdings, dass sie sich jetzt O’Reilly nannten. Die Briefe seien an Familie Murphy geschickt worden. Die Abrissfirma hatte sich in der Adresse geirrt und das falsche Haus dem Erdboden gleichgemacht. Haha, kleiner Zahlendreher, meinte der Beamte, kann ja mal passieren. Das fand John O’Reilly nicht. Er ist Jurist. Die Stadtverwaltung musste ihr Sparschwein schlachten.
Daran ist sie freilich gewöhnt. Fast auf den Tag genau drei Jahre zuvor hatte die Straßenbaubehörde in Limerick vier kleine Landhäuser abreißen lassen, weil eine Autobahn gebaut werden sollte. Die Eigentümer waren zwangsenteignet worden – jedenfalls drei von ihnen. Die vierte, Mary O’Shaughnessy, war ebenso verblüfft wie die O’Reillys, als sie nach Hause kam und eine Geröllhalde vorfand. Sie hatte kurz zuvor mit der Renovierung des hundert Jahre alten Cottages begonnen, denn es stand der Autobahn ja nicht im Weg. Bei der Abrissfirma war man offenbar nicht in der Lage, bis drei zu zählen – ein typisches Problem: Die meisten irischen Handwerker stehen mit der Mathematik auf Kriegsfuß. Das hat oft fatale Folgen.
Áine, die Gattin, wünschte sich Morgensonne im Schlafzimmer. Leider spielte das blöde Himmelsgestirn dabei nicht mit. Es geht an der falschen Stelle auf: Die Sonnenstrahlen erreichen erst mittags das Zimmer, was für mich als Eule, wie Spätaufsteher im Fachjargon genannt werden, völlig ausreichend wäre. Áine hingegen ist eine Lerche, also eine Frühaufsteherin.
Das Ansinnen, mein Arbeitszimmer mit dem Schlafzimmer zu tauschen, wies ich aufgrund der Horrorvorstellung, mit Tausenden von Büchern umziehen zu müssen, kategorisch zurück. Stattdessen schlug ich törichterweise vor, ein Fenster in die Giebelwand einbauen zu lassen.
Ich gab meine Bestellung bei Kevin auf, dem örtlichen Vertreter einer großen Fensterfirma in Cork. Das Fenster solle 150 Zentimeter breit und 75 Zentimeter hoch werden, sagte ich. Er werde vorbeikommen, um nachzumessen, meinte er. Das sei völlig sinnlos, entgegnete ich, schließlich gebe es noch gar kein Loch in der Wand, da die Lieferzeit für das Fenster ja zwei Wochen betrage und man Einbrechern, fremden Katzen und dem Regen nicht unnötig Zeit geben sollte, ins Haus einzudringen.
Nach dreizehn Tagen rückten wir der Wand mit schwerem Gerät zuleibe. Am Abend war ein exaktes Loch gestemmt, während sich der Zementstaub im ganzen Haus und in den Schränken verteilt hatte. Mir begann zu dämmern, dass der Bücherumzug das kleinere Übel gewesen wäre. Am Abend rief ich Kevin an und fragte, wann das Fenster am nächsten Tag geliefert würde. Er erzählte mir daraufhin von seinem schwarzen Auftragsbuch und seinem Faxgerät, zwischen denen es offenbar ein Missverständnis gegeben hatte. Ich verstand kein Wort, ahnte aber, dass meine Bestellung es nicht bis zur Fensterfirma nach Cork geschafft hatte. Kevin wollte das nun umgehend mit Dringlichkeitsvermerk nachholen. Zehn Tage würde es dennoch dauern. Die verbrachte ich damit, ein Misteldrosselpärchen am Nestbau in dem für das Fenster vorgesehenen Loch zu hindern.
Neun Tage später rief ich wieder bei Kevin an. Der Monteur käme am nächsten Vormittag, versprach er. Abends um sieben tauchte er endlich mit dem Fenster unter dem Arm auf. Ich sah von weitem, dass schon wieder etwas schiefgegangen war. Das Fenster war 35 Zentimeter zu schmal. Der Monteur behauptete, genau so sei es bestellt gewesen, und verwies auf seinen Auftragszettel. Dort stand »1150 Millimeter«. Ich rief abermals bei Kevin an und berichtete ihm von dem Malheur. »Diese Idioten«, schimpfte er, »ich habe ihnen doch die exakten Maße durchgegeben. Natürlich musste ich sie vorher umrechnen, denn wir arbeiten mit Millimetern. Also habe ich eine Eins davor gesetzt.« Er meine wohl, er habe eine Null ans Ende gehängt, korrigierte ich. »Wieso eine Null?« fragte er. Irland ist seit vielen Jahren dezimalisiert, Kevin leider nicht. Die Morgensonne kommt nun etwas später als geplant ins Schlafzimmer. Damit ist niemandem gedient: Für eine Eule ist das immer noch zu früh, für eine Lerche ist es zu spät.