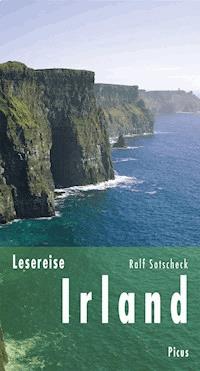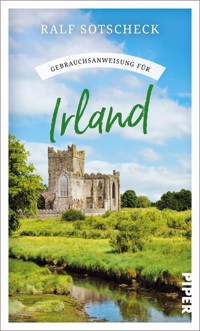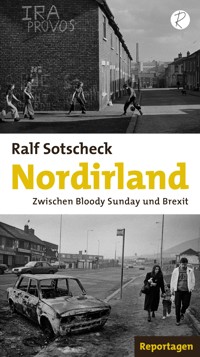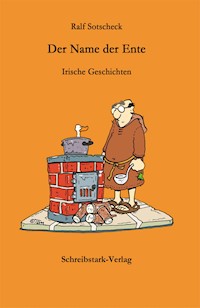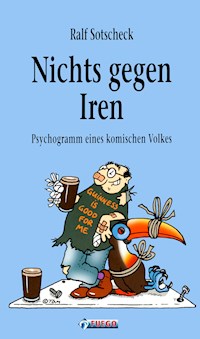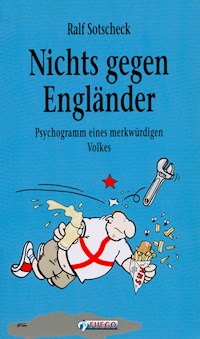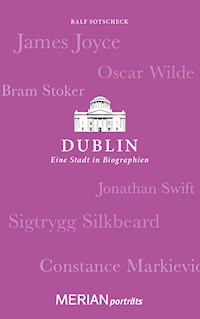8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Neues über die absonderlichen Bewohner der keltischen Inseln. So erfährt man einiges, von dem man gar nicht wusste, dass es einen interessieren könnte. Elisabeth II. hat beispielsweise Geldsorgen, aber einen eigenen Händewäscher. Dieser hat stets einen Silberkrug, eine Schüssel und ein Tablett mit einem Leinentuch bei sich, falls die Queen sich mal die Hände fettig macht. Ihr Sohn Charles hinterzieht in seinem Herzogtum Cornwall munter Steuern, wie es schon sein Vorfahr, der "schwarze Prinz", im 14. Jahrhundert tat. Charles findet, es sei auch heute noch ungehörig, in den finanziellen Angelegenheiten eines Prinzen herumzustöbern. In einigen Geschichten geht es sogar um Sex.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ralf Sotscheck
Türzwerge schlägt man nicht
Mit einem Vorwort von Vincent Klink
Illustrationen von © Tom
FUEGO
– Über dieses Buch –
Neues über die absonderlichen Bewohner der keltischen Inseln. So erfährt man einiges, von dem man gar nicht wusste, dass es einen interessieren könnte. Elisabeth II. hat beispielsweise Geldsorgen, aber einen eigenen Händewäscher. Dieser hat stets einen Silberkrug, eine Schüssel und ein Tablett mit einem Leinentuch bei sich, falls die Queen sich mal die Hände fettig macht. Ihr Sohn Charles hinterzieht in seinem Herzogtum Cornwall munter Steuern, wie es schon sein Vorfahr, der »schwarze Prinz«, im 14. Jahrhundert tat. Charles findet, es sei auch heute noch ungehörig, in den finanziellen Angelegenheiten eines Prinzen herumzustöbern. In einigen Geschichten geht es sogar um Sex.
»Sotscheck gelingt es bei allem glänzend geschliffenem Spott, mit dem er die Zustände der grünen Bananenrepublik überzieht, dass ein Grundton amüsierter Sympathie für das komische Volk durch die Texte summt.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
VORWORT
von Vincent Klink
Ralf Sotscheck lebt in einem Land, in dem ordentlich gesoffen wird, doch auch in gewissem Maße Feststoffe zu sich genommen werden. Als ich ihn vor einem knappen Jahr das letzte Mal sah, hatte sich der inzwischen gesetzte Herr trotz seines gefahrvollen Umfeldes überraschend gut gehalten. Ich fragte mich, wie entgeht man all den Verführungen der irischen Insulaner. Herr Sotscheck schaffte das eigentlich nie. Es mag am Irish Stew oder am Black & White Tard gelegen haben. Auf alle Fälle hat die Familie Guinness einiges dazu beigetragen, dass ein Koch über diesen Mann sagen kann: »Er ist einer von uns!«
Religiöse Hardcore-Prägung traue ich seinem freien Geist nicht zu, aber seine irische Staatsbürgerschaft hat über all die Jahrzehnte zweifelsfrei für eine Pint & Pub-Prägung gesorgt. Dagegen kann niemand etwas haben, wenn man sich auf die wenigen Generaltugenden dieser Geisteshaltung beschränkt: Verzeihen können, mangelhafte Kenntnisse der Naturwissenschaften, darüber hinaus: Kopfrechnen schwach, Appetit gut.
Der Mann wollte schon immer höher hinaus, und ich könnte ihn mir gut vorstellen, dass er über Irland und vor allem dem Commonwealth auf einer Wolke wie ein Cherubin dahinsegelt. Nicht nur weil er aussieht wie ein Wolkenpilot, sondern aus Gründen einer gewissen überlegenen Abgeklärtheit.
So ist er ständig auf Ausguck und richtet seine Lupe auf all die Wahnsinnigen, die sich nicht zum Kontinent zählen wollen und sich einiger Entwicklungsstufen über den Europäern wähnen.
Da Herr Sotscheck alles andere als kontaktscheu ist, sondern auch als Professor für Sozialkompetenz habilitieren könnte, hockt er meisten nicht auf der Wolke, sondern gräbt tief und ständig in den guten Pubs Irlands, Englands und Schottlands nach Hintersinn und Wahrheit.
Gute Resultate sind obligat. Seine Geschichten liefern streng fokussiert, doch stets wohlwollend Außen- und Innenansichten. Der sympathische Neugierler navigiert direkt am Volk, im Volk und stöbert nach Meinungen, falschen wie richtigen.
Daraus zieht er seine gescheiten lesenswerten Schlüsse. Er sorgte auch für die Beseitigung vieler blöder Vorurteile, die wir gegen die Insulaner hegen, und die in Deutschland gerne leichtfertig schwadroniert werden.
Ralf Sotscheck brachte mir die etwas schwer zugänglichen Wesenszüge der Kelten nahe, und sein Zutun für die Erkennisanreicherung seiner deutschen Leser kann man getrost als völkerverbindend loben. Darin ist er den »United Nations« um Lichtjahre überlegen. Und das meine ich nicht ironisch!
Keep on truckin‘, altes Haus. Allen seinen Lesern kann ich nur empfehlen: Lest dieses Buch – und nichts als dieses Buch.
Essen und Trinken
IRISCHER ALCOHOLIDAY
Jedes Jahr im September sieht die Grüne Insel schwarz: Es ist »Arthur’s Day«. Im September 1759 hatte Arthur Guinness nämlich den Pachtvertrag über 9000 Jahre für das Grundstück an der Liffey in Dublin unterschrieben, wo die Brauerei steht. Deshalb rief Guinness 2009 zum 250-jährigen Jubiläum erstmals den »Arthur’s Day« aus. Weil sich das überaus gelohnt hat, wie die vollgekotzten Bürgersteige am nächsten Morgen bewiesen, müssen die Iren nun jedes Jahr feiern. An jenem Tag finden rund 500 Veranstaltungen mit tausend Bands statt.
Irgendwie hat man den Iren eingeredet, dass das schwarze Gesöff eine irische Institution sei. Staatsgästen wie Barack Obama oder der englischen Queen wird ein Glas davon in die Hand gedrückt, und die Nation freut sich wie ein Schnitzel, wenn sie einen Schluck davon trinken. Dabei gehören die Brauerei sowie die 3000 führenden Schnapsmarken in der Welt seit 1997 zu dem britischen Getränkemulti Diageo. Der erfundene Name setzt sich aus dem lateinischen Wort für den Tag und dem griechischen Wort für die Welt zusammen. Damit will man suggerieren, dass der Konzern jeden Tag und überall Freude verbreitet.
Und Leberzirrhose, meint der Sänger Christy Moore, der eine echte irische Institution ist. In seinem Lied »Arthur’s Day«, das an eben diesem Tag 2013 erschienen ist, beklagt er, dass dieser »Alcoholiday« von Werbefuzzis erdacht worden sei, während Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenhäusern an dem Tag Überstunden schieben müssen. Aber es hat sich gelohnt, 2013 stellten sie einen neuen Weltrekord auf: Am »Arthur’s Day« pumpten sie innerhalb von 24 Stunden 921 Mägen aus. Das berichtete das Nachrichtenportal Waterford Whispers. Der bisherige Rekord vom St. Patrick’s Day 2012 stand bei 907 Mägen. Der Bier-Konzern bestätigte, dass die neue Bestmarke ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werde. Die Krankenschwestern waren überglücklich. Ihre Sprecherin Siobhán Murphy sagte: »Als wir schon um 19 Uhr die 300-Mägen-Grenze durchbrachen, wussten wir, dass wir es schaffen würden.« Diageo erklärte, man sei stolz auf die Iren. Als kleine Geste der Anerkennung will man die zehn Pubs, die am »Arthur’s Day« den höchsten Umsatz verzeichneten, auf Firmenkosten mit marmornen Kotzbecken ausrüsten.
Darüber hinaus, so prahlte der Konzern, sei der »Arthur’s Day« ein »einzigartiges Musikereignis, bei dem irische Nachwuchskünstler eine einmalige Chance bekämen. Die Manic Street Preachers zum Beispiel? Die stammen zwar aus Wales und sind schon vor 27 Jahren gegründet worden, aber wer ein Grundstück für 9000 Jahre pachtet, denkt wohl in anderen Zeitdimensionen.
Ein Politiker hat sogar verlangt, den »Arthur’s Day« zu einem nationalen Feiertag zu erklären. Aber muss es denn bei einem »Arthur’s Day« im Jahr bleiben? Es gibt doch so viel zu feiern im Hause Guinness. Leider ist Arthurs Geburtstag nicht bekannt, nicht mal das Geburtsjahr. Die Brauerei behauptet zwar, er sei am 28. September 1725 auf die Welt gekommen, doch das stimmt nicht mit seinem Grabstein überein. Aber man könnte die Geburtstage seiner Kinder mit »Arthur’s Children’s Day« begehen, denn deren Daten sind bekannt. Dann kämen die Iren gar nicht mehr aus dem Feiern heraus. Guinness und seine Frau Olivia Whitmore hatten 21 Kinder.
Der von der Schriftstellerin Dorothy L. Sayers erfundene Werbeslogan »Guinness is good for you« gilt übrigens nur, wenn das irische Nationalgetränk nicht in Irland gebraut ist. Das Wasser für den Brauprozess stamme aus den Wicklow-Bergen südlich von Dublin, heißt es in der Guinness-Werbung. Dabei stellt man sich grüne Hügel vor, in denen Quellen mit kristallklarem Wasser entspringen. Daneben stehen die Nachfolger des Firmengründers Arthur Guinness mit Kristallkrügen und fangen das köstliche Nass auf, um es dann mit geröstetem Malz und Gerste zu veredeln.
In Wirklichkeit kommt das Wasser aus dem öffentlichen Poulaphouca-Trinkwasser-Reservoir in Wicklow. Und das wird mit Hexafluoridokieselsäure versetzt, weil es ein irisches Gesetz von 1964 so vorschreibt. Die damalige Regierung meinte, durch die Zugabe von Fluor würden die Zähne der Kinder gestärkt. Das Fluor-Niveau von irischem Guinness ist sechs Mal so hoch wie bei dem gleichen Gesöff aus der Londoner Brauerei, wo dem Trinkwasser weniger Fluor beigemischt wird.
Hexafluoridokieselsäure ist ein giftiges Abfallprodukt der Düngemittelindustrie. Die irische Regierung – also der Steuerzahler – kauft es in Spanien teuer ein und mischt es als vorbeugendes Medikament dem Trinkwasser bei. Eigentlich wäre dafür eine Lizenz erforderlich. Gäbe es Guinness dann auf Rezept? Die Brauerei kann man dafür freilich nicht verantwortlich machen. Die Hexafluoridokieselsäure ist in allen irischen Lebensmitteln enthalten, die bei der Herstellung irisches Trinkwasser verwenden. Eigentlich müssten diese Produkte für den Export mit Warnhinweisen versehen werden, denn in den restlichen EU-Ländern ist die Zwangsfluoridierung verboten.
In Irland sind sämtliche Initiativen, das Zeug aus dem Trinkwasser zu verbannen, bisher gescheitert. Schon in den sechziger Jahren ging Gladys Ryan, eine Hausfrau mit fünf Kindern, gegen die Verabschiedung des Gesetzes gerichtlich vor – ein unerhörter Vorgang für die damalige Zeit. Die Richter fanden das so absurd, dass sie die Klage immer wieder abwiesen. Am Ende saß Ryan auf 230.000 Pfund Gerichtskosten. Zum Vergleich: Ein anständiges Einfamilienhaus kostete damals 2500 Pfund. Der Staat verzichtete auf die Zahlung. Ryan starb 2012 im Alter von 91 Jahren. Sie hatte stets öffentliches Trinkwasser gemieden.
Neuere Untersuchungen bestätigen Ryans Vermutung, dass die erzwungene Medikamentierung den Intelligenzquotienten senken kann. Das erklärt, warum sich die Regierung beharrlich weigert, das Gesetz aufzuheben. Es geht um die Verdummung der Bevölkerung, damit sie nicht merkt, wie sie von den Politikern über den Tisch gezogen wird. Und wer wegen der Austeritätspolitik aus Verzweiflung in den Alkohol flüchtet, wird noch dümmer. Bisher hatte man angenommen, dass der Alkohol daran schuld sei. Im Leinster House, dem irischen Parlamentsgebäude, sind übrigens sämtliche Wasserhähne mit Filtern gegen Hexafluoridokieselsäure ausgerüstet.
Manchmal kommt aber gar kein Wasser aus dem Hahn, wie ich betrübt feststellen musste, als ich mir einen heißen Whiskey zubereiten wollte. Ich hatte vergessen, dass abends ab acht das Wasser für die Nacht abgestellt würde. Wie soll man auch an Wasserknappheit denken, wenn es draußen pausenlos vom Himmel stürzt? Im Wasserreservoir Ballymore Eustace habe sich »der Charakter des Wassers stark verändert«, sagte Michael Phillips, der Ingenieur des Dubliner Stadtrats. Man arbeite rund um die Uhr, um die Ursache herauszufinden. Vorerst bleibe es aber bei den nachts versiegenden Hähnen, sonst säße Dublin binnen drei Tagen auf dem Trocknen, jedenfalls drinnen. Die Besitzer edler Restaurants rauften sich die Haare. Sie mussten das Foie Gras auf Papptellern und den Champagner in Plastikbechern servieren, weil sie den Geschirrspüler nicht einschalten konnten.
Irgendwie war das absehbar. Die technische Beraterfirma RPS hatte schon 2006 gewarnt, dass man etwas investieren müsse, um die Wasserversorgung zu sichern. Ein Projekt, um Wasser vom Shannon nach Dublin zu pumpen, würde 500 Millionen Euro kosten. Das hat man auf die lange Bank geschoben, so dass die Probleme für die nächsten zehn Jahre vorprogrammiert sind. In der irischen Hauptstadt werden täglich 540 Millionen Liter verbraucht, und die werden gerade mal so produziert, wenn alles glatt geht. Dabei entfallen auf die Haushalte lediglich 16 Prozent. Mehr als doppelt so viel versickert im Boden, denn die Rohre stammen noch aus viktorianischen Zeiten. Die Insel ist also gar nicht wegen des feuchten Klimas grün, sondern wegen der Lecks.
Nun hat die Regierung 539 Millionen Euro bereitgestellt – aber nicht, um die löchrigen Rohre zu erneuern, sondern um Wasseruhren zu installieren, damit man endlich abkassieren, dann privatisieren und schließlich den verarmten Banken wieder etwas Geld geben kann. Umweltminister Phil Hogan verkündete konziliant, dass jeder Haushalt 30.000 Liter im Jahr kostenlos erhält. Für jedes Kind unter 18 kommen nochmal 38.000 Liter hinzu.
Dem Nachrichtenportal Waterford Whispers erklärte Hogan, dass für geschlechtsreife Teenager eine weitere Freimenge von 100.000 Litern im Jahr vorgesehen sei, weil »sie bekanntermaßen gerne unter der Dusche masturbieren« und deshalb das Wasser ziemlich lange laufen lassen. Er sei ja auch mal jung gewesen, fügte Hogan hinzu. Ein Extra-Einkommen verspricht sich die Regierung von der Installation spezieller Hähne in Dublins vornehmen Vierteln. Aus ihnen soll kohlensäurehaltiges Mineralwasser fließen, damit sich die Herrschaften nach einer Runde Golf geschwind erfrischen können. Man verhandelt derzeit mit Apollinaris.
LAMBRINI-MÄDCHEN WOLLEN NUR SPASS HABEN
Herr Lambrini ist gestorben. Er hat sich zu Tode gesoffen, und irgendwie ist das auch angemessen. John Halewood, wie Herr Lambrini richtig hieß, besaß das größte unabhängige Getränkeunternehmen in Großbritannien. Seit 1978 stellt es die sprudelnde Alkoholplörre Lambrini her, von der 40 Millionen Flaschen jedes Jahr verkauft werden.
Mit seinem Billiggesöff hat Halewood reihenweise junge Leute an den Rand des Abgrunds gebracht. Eine Alison Whelan kaperte eine Personenfähre in Dartmoor, nachdem sie zwei Tage lang Lambrini gesoffen hatte. »Ich bin eine Piratin«, schrie sie, sprang an Bord des Schiffes und übernahm das Ruder. Die Fähre krachte wie bei einem Flipper-Automat in andere Schiffe, bevor Whelan die Polizei anrief und erklärte, dass sie ein Problem habe. 30 Polizeiautos und Krankenwagen rückten umgehend an. Der Lambrini-Werbespruch lautet: »Lambrini-Mädchen wollen nur Spaß haben.«
Besonders am »Suizid-Sonntag«, dem Tag nach Abschluss der Universitäts-Examen Ende Juni in Cambridge, bricht das Lambrini-Chaos aus. Einmal hatten die Organisatoren des Festes, die »Wyverns Drinking Society«, der natürlich nur Männer angehören, ein aufblasbares Schwimmbecken im Durchmesser von zwei Metern mit Gelee gefüllt. Darin fanden Ringkämpfe von Studentinnen im Bikini statt, der Gewinnerin winkten 250 Pfund.
Eine Nadia Witkowski, die im Halbfinale verloren hatte, rastete vor Wut und voller Lambrini aus. Die 23-jährige schwang die Flasche wie eine Keule, stürzte sich auf ihre Kommilitonin Hannah Ford, die aus unbekannten Gründen als Schmetterling verkleidet war, und schlug ihr die Nase blutig. Als zwei Ordner die gelierte Witkowski überwältigen wollten, versetzte sie einem einen Kopfstoß und dem anderen einen Boxhieb in den Magen. Erst eine Polizeieinheit bekam die glitschige Studentin zu fassen. Ein Sprecher der Wyvern-Trinkgesellschaft sagte: »Fräulein Witkowski wird künftig nicht mehr zu Gartenpartys eingeladen.«
Dabei entsprach ihr Benehmen durchaus der Tradition. Bei Oxfords Gegenstück zu Cambridges »Wyvern Drinking Society«, dem »Bullingdon Club«, dem früher Premierminister David Cameron, Schatzkanzler George Osborne und Londons Bürgermeister Boris Johnson angehörten, geht es ebenso lustig zu. Einmal rollten sie einen Studenten im Frack in einem mobilen Toilettenhäuschen einen Hügel hinab. Ein anderes Mal zerstörten die Studenten sämtliche 500 Fenster in der Universitätskirche. Seitdem dürfen sie ihre Treffen nicht mehr innerhalb eines Bannkreises von 25 Kilometern um die Universität abhalten. Einige Restaurants in Universitätsstädten haben inzwischen untersagt, dass Gäste ihre eigenen Getränke mitbringen und dafür Korkengeld bezahlen, weil die Studenten stets Lambrini mitbrachten und das Lokal vollkotzten.
Halewood selbst hat nie Lambrini angerührt, er hat guten Wein bevorzugt. Deshalb ist er auch nie in ein aufblasbares Schwimmbecken mit Gelee gesprungen, sondern starb standesgemäß neben dem Swimming Pool im Garten seiner Villa.
HAVARIE MIT HANGOVER
Schiffsunglücke müssen nicht immer tragisch enden. Manchmal spenden sie Freude, und noch Jahrzehnte später lässt sich die Havarie zu Geld machen. Am 5. Februar 1941 lief die SS Politician auf einen Felsen im Sund von Eriskay auf, einer Insel im Süden der Äußeren Hebriden. Das Schiff war unterwegs nach New York und hatte eine interessante Ladung an Bord: 264.000 Flaschen Whisky. Die Inselbewohner stürzten sich beherzt ins Meer, um die wertvolle Fracht zu retten.
Duncan MacInnes war damals 15. Neben dem Whisky waren Fahrräder, Zigaretten, Obstkonserven, Bier, Leinen und kistenweise linke Schuhe an Bord, sagt er. Schuhe wurden damals nie paarweise verschifft, um Diebstahl zu vermeiden. MacInnes, der an Whisky nicht interessiert war, klaute ein elektrisches Bügeleisen, was töricht war, denn auf Eriskay gab es keinen Strom.
Die erwachsenen Inselbewohner waren sehr wohl am Whisky interessiert, und weil das Schiff sieben Monate auf dem Felsen lag, bis es weggeschleppt wurde, hatten sie genügend Zeit, sich um die hochprozentige Ladung zu kümmern. McCall, der örtliche Zollbeamte, wurde zwar misstrauisch, weil die Fischer, die sonst ständig im Wirtshaus hockten, sich nicht mehr blicken ließen, aber nachdem er das Schiffswrack mit ein paar Einheimischen inspiziert hatte, verließ er es recht fröhlich und pfiff ein paar Gassenhauer vor sich hin, erinnert sich MacInnes.
Die auswärtigen Zollbeamten waren nicht so leicht zu betäuben, aber als sie schließlich eintrafen, war das Schiff bis auf die Kisten mit den linken Schuhen bereits leer. So durchstöberten sie das Moor mit langen Stäben, aber weil die 130 Inselbewohner schlau genug waren, die Whiskykisten über das ganze Moor zu verteilen, war es so, als ob die Beamten mit einem Stock in einem Heuhaufen herumstocherten, um ein paar Nadeln zu finden.
2011 Jahren wurde eine Flasche aus der Beute versteigert. Es handelte sich um Ballantine’s, nicht eben die Perle unter den Whiskys, aber sie brachte dem Verkäufer 2200 Pfund ein, so dass er sich nun ein paar anständige Flaschen kaufen kann.
Compton Mackenzie schrieb 1947 ein Buch über das Glück der Insulaner, und zwei Jahre später wurde die Geschichte verfilmt, allerdings auf der Nachbarinsel Barra, weil es dort Strom gab. Der Film hieß »Whisky Galore!«, was »reichlich Whisky« bedeutet. Die Produktionsfirma »Whisky Galore Film Limited« plant nun einen Remake des Films, diesmal in Farbe und mit internationaler Besetzung. Zu spät für Harald Juhnke. Und rechtzeitig zum Filmstart soll es auch den ersten Whisky aus Barra geben, der seit 2009 gebrannt wird.
Vor der Küste der Grafschaft Clare im Westen Irlands ist im 19. Jahrhundert ebenfalls ein Frachter gekentert. Die Bewohner hatten weniger Glück. Nachdem sie die Ladung bei Nacht an Land geschafft hatten, stellte sich heraus, dass es sich um Tausende von Akkordeons handelte. Seitdem spielt die halbe Grafschaft die Quetschkommode. Es hätte freilich schlimmer kommen können, hätte das Schiff Vuvuzelas geladen.
BEZIRKSVERORDNETE IN 3-D
In der Grafschaft Kerry im Südwesten Irlands leben merkwürdige Menschen, die einen sonderbaren Dialekt sprechen. Und stets wählen sie den Merkwürdigsten unter ihnen ins Dubliner Parlament. 14 Jahre lang war das Jackie Healy-Rae, ein Kneipier mit Gummistiefeln und Tweedmütze. Für seine Unterstützung der jeweiligen Regierung wurde er mit neuen Straßen für seinen Wahlkreis und dem Vorsitz des Umweltausschusses belohnt. Da er sich in der Großstadt aber nicht wohl fühlte, ließ er sich bei den Sitzungen des Ausschusses nur selten sehen. 2011 zog sich der damals 80-jährige aus der Politik zurück.
Da Parlamentssitze im ländlichen Irland vererbbar sind, gewann sein Sohn Michael Healy-Rae das Mandat. Ein anderer Sohn, Danny Healy-Rae, ist Bezirksverordneter in Kerry. Er stellte bei der Ratsversammlung einen interessanten Antrag. Weil Pubs – wie sein eigener – auf dem Land wegen des Fahrverbots unter Alkoholeinfluss immer mehr Kundschaft verlieren und allein lebende Menschen zum Suizid neigen, forderte er, dass die Polizei Sondergenehmigungen ausstellt, die es Einsamen gestatten, nach dem Pubbesuch betrunken nach Hause zu fahren. Allerdings sollten sie nur wenig befahrene Straßen benutzen und höchstens 30 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. »Die Menschen auf dem Land müssen wegen der Gesetze ihre Flasche Whiskey zu Hause trinken«, argumentierte er, »und dann fallen sie in tiefe Depressionen und bringen sich um.« Ein Pubbesuch könnte da Abhilfe schaffen.
Da der 3-D-Bezirksverordnete – »drink, drive, die« – nicht die einzige Knalltüte im Bezirksrat ist, wurde sein Antrag mit fünf zu drei Stimmen angenommen. Auf die Idee, sich für einen anständigen öffentlichen Nahverkehr einzusetzen, kam niemand. Die meisten Bezirksverordneten waren der Abstimmung vorsichtshalber ferngeblieben, da sie nicht mit solch törichtem Vorschlag in Verbindung gebracht werden, aber auch nicht als Spielverderber gelten wollten. Danny Healy-Raes Bruder Michael legte den Antrag auf eine Gesetzesänderung dem Parlament vor. Transportminister Leo Varadkar weigerte sich zum Entsetzen der Landeier jedoch, sich mit dem Antrag überhaupt zu befassen. Er finde es »schwierig, auf einen Vorschlag zu antworten, der die Fortschritte bei der Verkehrssicherheit« unterminiere, sagte er.
Die linke Abgeordnete Clare Daly, so höhnte eine Zeitung, habe offenbar angenommen, dass Healy-Raes Vorschlag bereits umgesetzt worden sei. Sie wurde angeblich mit Alkohol am Steuer geschnappt, weil sie an verbotener Stelle gewendet hatte. Das verkündete jedenfalls die Polizei triumphierend. Auf Gnade konnte Daly nicht hoffen. Sie hatte sich vehement für Verfahren gegen Polizisten eingesetzt, die sich von Autofahrern bestechen ließen, um deren Strafpunkte aus der Verkehrssünderkartei zu streichen. Die Rache ging jedoch nach hinten los. Daly konnte nachweisen, dass sie stocknüchtern war. Die Polizisten mussten sich entschuldigen.