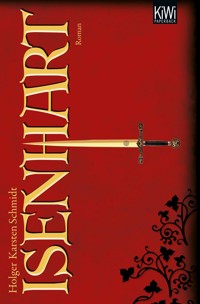
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder treibt im hohen Mittelalter sein Unwesen. Der junge Schmied Isenhart nimmt die Spur auf – und entdeckt dabei das Geheimnis seiner eigenen Existenz. Anno Domini 1171.Isenhart stirbt bei der Geburt und wird wieder zum Leben erweckt. Der wissbegierige Junge, der irgendwie »anders« ist, wächst als Sohn eines Schmieds auf der Burg Laurin bei Spira auf. Zusammen mit Konrad, dem Stammhalter des Hauses Laurin, erhält er Zugang zu einem ungeheuren Privileg: Bildung. Isenharts Welt bricht entzwei, als seine heimliche Liebschaft, die Fürstentochter Anna von Laurin, barbarisch ermordet – und ihr das Herz geraubt – wird. Der Mörder ist schnell gefasst und gerichtet. Doch dann ereignet sich ein weiterer Mord nach identischem Muster. Isenhart und Konrad machen sich auf, den Serienmörder mit den forensischen Mitteln ihrer Zeit zur Strecke zu bringen. Die Jagd führt sie bis ins ferne Iberien, in den »Basar des Wissens« von Toledo, wo freie Geister aus Morgen- und Abendland sich austauschen. Dann findet Isenhart in einem dunklen Gewölbe nie gesehene anatomische Zeichnungen des menschlichen Herzens … »Ein knallharter Thriller aus der Zeit der Kreuzzüge« Berliner Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1233
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Holger Karsten Schmidt
Isenhart
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Holger Karsten Schmidt
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Holger Karsten Schmidt
Holger Karsten Schmidt, geboren 1965 in Hamburg, ist dreifacher Grimme-Preisträger und seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands. Zuletzt wurde der Mehrteiler »Gladbeck«, für den er das Drehbuch geschrieben hat, mit dem Bayerischen und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. 2011 erschien sein Mittelalterthriller »Isenhart« bei Kiepenheuer & Witsch, ab 2017 folgten unter dem Pseudonym Gil Ribeiro die Bände der »Lost in Fuseta«-Krimireihe, die in Portugal spielt. Holger Karsten Schmidt lebt und arbeitet bei Stuttgart.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Serienmörder treibt im hohen Mittelalter sein Unwesen. Der junge Schmied Isenhart nimmt die Spur auf – und entdeckt dabei das Geheimnis seiner eigenen Existenz.
Anno Domini 1171.Isenhart stirbt bei der Geburt und wird wieder zum Leben erweckt. Der wissbegierige Junge, der irgendwie »anders« ist, wächst als Sohn eines Schmieds auf der Burg Laurin bei Spira auf. Zusammen mit Konrad, dem Stammhalter des Hauses Laurin, erhält er Zugang zu einem ungeheuren Privileg: Bildung.
Isenharts Welt bricht entzwei, als seine heimliche Liebschaft, die Fürstentochter Anna von Laurin, barbarisch ermordet – und ihr das Herz geraubt – wird. Der Mörder ist schnell gefasst und gerichtet. Doch dann ereignet sich ein weiterer Mord nach identischem Muster.
Isenhart und Konrad machen sich auf, den Serienmörder mit den forensischen Mitteln ihrer Zeit zur Strecke zu bringen. Die Jagd führt sie bis ins ferne Iberien, in den »Basar des Wissens« von Toledo, wo freie Geister aus Morgen- und Abendland sich austauschen. Dann findet Isenhart in einem dunklen Gewölbe nie gesehene anatomische Zeichnungen des menschlichen Herzens …
»Ein knallharter Thriller aus der Zeit der Kreuzzüge« Berliner Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2011, 2012 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln, unter Verwendung eines Motivs von Anyka – Fotolia.com
ISBN978-3-462-30466-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Motto
Nachwort
Dank
Meinem Vater
1.
Anno Domini 1171
Sigimund von Laurin, Fürst und Herrscher über die Ländereien derer von Laurin, hatte ihnen untersagt, jemals ein Wort über die Begebenheit zu verlieren, die sich im Winter 1171 in ihrer Mitte ereignet hatte.
Er stand in ihrer armseligen Hütte, von Hühnern und Schafen beglotzt, ein Herr mit einem ebenmäßigen Antlitz und Gewändern, die nicht nach Rauch und Mist rochen, sondern noch den Duft eines Bratens mit sich trugen. Reh vielleicht, aber diesen Geruch hatte Irmgard nur einmal in ihrem Leben aufschnappen können. Das war viele Jahre her, und so war sie sich nicht ganz sicher.
»Niemals«, befahl Sigimund von Laurin, »verlierst du oder deine Tochter auch nur ein Wort über den Fremden.«
In seiner Stimme schwang keine Drohung mit, daran konnte sie sich am besten erinnern, weil es sie am meisten beeindruckte. Der Herr stellte es einfach fest, während sein klarer Blick in ihrem ruhte. Sie und Therese beeilten sich zu nicken.
Irmgard ahnte, dass der Fremde für Sigimund von Laurin gar kein Fremder war.
Woher der Mann gekommen war, hatte Irmgard nicht sagen können. Für sie und ihre störrische Tochter Therese, die ihr bei ihren Hebammendiensten zur Hand ging und im Sommer einen armen Bauern heiraten würde, obwohl sie von Landwirtschaft so viel verstand wie eine Haselnuss, kam er sprichwörtlich aus dem Nichts.
Sie wuschen Loretta, die Tote, als es passierte. Vor der Hütte hatte sich eine Handvoll Bewohner der kleinen Siedlung versammelt, zumeist Frauen und Kinder. Einige, die in die Hütte schauen und einen Blick auf das blasse Gesicht der jungen, toten Frau erhaschen konnten, bekreuzigten sich. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten.
»Soll ich den Bastard waschen?«, fragte Therese. Die Stimme ihrer Tochter war frei von jedem Eifer.
Irmgard schüttelte den Kopf. Nur Augenblicke zuvor hatten sie den Säugling aus Lorettas totem Schoß geborgen, um auch dessen Tod festzustellen. Die Nabelschnur hatte ihn erwürgt, bevor er das Licht dieser Welt erblicken konnte. Sie hatten das Bündel auf den Haufen voller blutiger Decken geworfen, von dem sich sein blau angelaufener Kopf fast unheimlich abhob.
»Wer seid Ihr?«, hörten sie aufgeregte Stimmen von draußen.
»Kein Diener des Herrn«, erwiderte ein Mann.
Dann erstarb das Tuscheln. Jemand trat in das Licht, das die Sonne durch den Eingang in die Hütte warf, die ansonsten keine Öffnung nach draußen aufwies, sodass im Inneren ein stetes Halbdunkel herrschte. Lediglich eine kleine Feuerstelle warf tanzende Schatten an die Wände.
Irmgard und Therese schauten auf die Gestalt im Eingang. Der Mann verharrte dort, damit sich seine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnen konnten. Kurz nur, dann trat er ganz ein. Er trug einen schmutzigen grauen Umhang, der von Rissen und Mottenlöchern durchzogen war. Die nackten Füße des Mannes steckten in Ledersandalen, sein Gesicht wurde nicht von dem struppigen grauen Bart dominiert, sondern von einem Paar strahlend heller Augen. Seine Hände waren schmutzig, er war mager, aber sehnig. Irmgard spürte seine Kraft, als er an das Lager aus Stroh und Tuch trat, auf dem Loretta lag.
»Sie ist tot«, stellte er fest.
»Ja«, antwortete Irmgard, die nun ihre Fassung wiedererlangte, »was wollt Ihr?«
Der Fremde bedachte sie nur mit einem kurzen Blick. Im Nu war er bei der Feuerstelle, griff einen brennenden Scheit und hielt ihn über die Tote. Seine Augen wanderten forschend über ihr Gesicht, dann nickte er sich kaum merklich selbst zu.
»Was ist passiert?«
»Sie ist verblutet«, antwortete Therese. Sie hatte sich unwillkürlich geduckt.
»Und das Kind?«, fragte der Fremde drängend. Irmgard spürte, wie sich die kleinen Härchen auf ihrem Unterarm aufrichteten. Therese sah zum Ausgang und bemaß die Chance, ihn ungehindert zu erreichen.
»Das Kind«, sagte der Mann jetzt eindringlich. Er hatte sich zu Irmgard hinabgebeugt, sodass ihre Gesichter keine Armeslänge voneinander entfernt waren.
Irmgard deutete mit dem Kopf in die Richtung des toten Säuglings. »Tot seit der fünften Stunde. Es ist an der Nabelschnur erstickt.«
Sofort trat der Fremde zu den blutverschmierten Tüchern, in denen der tote Säugling mit der blauen Haut lag. Eilig packte er das kleine Bündel Mensch, hob es hoch und betrachtete es rasch im Schein des Scheits, den er nun fallen ließ. Trotz des fehlenden Lichts konnte Irmgard genau sehen, was sich dann ereignete.
Der Fremde hob den Kopf des toten Säuglings zu sich heran, presste seine Lippen auf die des Kindes und atmete aus. Irmgard schluckte. Was, in Gottes Namen, spielte sich da ab?
Ihre Tochter Therese huschte auf leisen Sohlen hinaus, ohne sich nach ihrer Mutter umzuschauen. Der Mann wiederholte die merkwürdige Prozedur, dann schrie der Säugling auf, und das Schreien wurde zu einem Wimmern. Irmgard glaubte, ein kurzes Lächeln über das Gesicht des Fremden gleiten zu sehen, der jetzt zu ihr trat.
»Das ist Hexerei«, brachte Irmgard hervor. Um nichts in der Welt wollte sie bei diesem Mann und dem untoten Kind bleiben. Aber ihre Knie waren weich geworden. Sie fand sich unfähig, auch nur aufzustehen.
»Er hat ein totes Kind zum Leben erweckt!«, rief draußen eine Frau, deren Stimme Irmgard ihrer Tochter zuordnete; Thereses Entsetzen war unüberhörbar. Vor der Hütte entstand Bewegung.
Den Fremden kümmerte der Aufruhr nicht. Er ging vor Irmgard in die Hocke, sein Blick nahm sie gefangen. Er hielt ihr das schreiende Bündel entgegen. »Nimm es und säug es.«
Irmgard wollte dem Mann nicht in die Augen schauen, sie warf einen Blick auf das Kind, dessen Gesichtshaut noch immer blau angelaufen war. Es war tot gewesen. Sie und ihre Tochter hatten es gesehen. Mehr noch: Sie hatten abwechselnd ihre Hand auf den Brustkorb des Säuglings gelegt und nichts von dieser kleinen, typischen Erschütterung gespürt, die das Herz üblicherweise verursachte.
Jede Faser ihres Körpers sträubte sich, dieses Kind zu berühren. »Nein!«
Alles, was sie an Abscheu empfand, hatte sie in ihre Stimme gelegt. Und jetzt gelang es Irmgard endlich, auf die Beine zu kommen. Doch die linke Hand des Fremden umschloss ihr Handgelenk und zwang sie mit der puren Kraft seines Griffes zurück aufs Lager. Eine knappe, gewaltvolle Geste, die ihre Angst verdoppelte.
Immer noch hielt er ihr den kleinen Untoten entgegen, aber sein Blick war weich geworden.
»Wer seid Ihr?«, brachte sie hervor, während ihre Augen in der Hoffnung auf Hilfe zum Eingang wanderten.
»Ich war auf dem Weg zum Grab Christi«, erwiderte der Fremde mit brüchiger Ruhe, »Hunderte habe ich fallen sehen. Hunderte sind verdurstet oder verhungert. Meine Seele ist auf dem Sprung. Dem Kind habe ich einen Teil davon eingehaucht. Das ist der Grund, weshalb es lebt. Es trägt mich nun in sich. Nimm ihn jetzt.«
Irmgard spürte das Bemühen des Fremden, sie zu beruhigen und dazu zu bewegen, den untoten Bastard von ihrer Brust trinken zu lassen.
»Hier ist der Lohn für deine Dienste«, fügte der Fremde hinzu und warf ein paar Münzen vor das Lager.
Es waren echte Pfennige, soweit Irmgard das im Halbdunkel beurteilen konnte.
»Nimm ihn zu dir. Und … gib mir dein Wort.«
Die Hebamme schüttelte den Kopf.
Der Fremde legte ihr den Bastard ohne ein Wort auf den Schoß. »Du wirst ihn behüten. Ich komme wieder. Und wenn du nicht Wort gehalten hast«, er stand auf und beugte sich zu ihr hinab, »schneid ich dir den Kopf ab und verfüttere ihn an die Schweine.«
Irmgard blickte in seine Augen. Der Fremde machte ihr nichts vor. Also nahm sie den untoten Säugling in die Arme, ihr blieb keine Wahl. Sobald der Mann weg war, konnte sie den Bastard ertränken. Oder ihn großziehen und verkaufen. Sie konnte es zum Vorteil wenden. Allein dieser Gedanke gab ihr die Kraft, dieses blutige Bündel mit dem blauen Kopf an sich zu pressen.
Der Fremde ließ endlich den Blick von ihr, er reckte den Kopf so sehr, dass seine Halsmuskeln sich spannten und die Adern hervortraten.
Dann hörte sie es auch: Hufe. Mehr als vier, Reiter näherten sich.
Der Fremde schlüpfte aus der Hütte und verschwand. Die kleine Traube aus Frauen und Kindern starrte dem Mann, der sich in das Unterholz schlug, untätig nach, bis der Wald ihn ihren Blicken entzog.
Vier Reiter sprengten heran. Drei von ihnen waren Soldritter mit Helmen und gefüttertem Wams. Sie trugen ihre Lanzen mit der scheinbaren Leichtigkeit jener, die täglich damit Umgang haben. Das Gesinde vor der Hütte wich zurück. Der vierte Reiter trug Schwert und Kettenhemd, er musste reich sein.
Walther von Ascisberg war in einem Alter, in dem man sich nicht mehr ohne gewichtigen Grund auf Reisen begab. Sein Rücken und sein Gesäß schmerzten, kein Kraut war dagegen gewachsen. Von Ascisberg musste es wissen, er hatte sie alle probiert.
»Wir suchen einen alten Mann«, sagte er mit dem rasselnden Atem, der der hörbare Tribut der letzten Tage war, »über vierzig Lenze. Er …«
»Er ist dort in den Wald, Herr«, beeilte eine Frau sich zu sagen, ihr Zeigefinger wies die Stelle, an der der Fremde verschwunden war. Einer der berittenen Begleiter warf Walther von Ascisberg einen Blick zu, dieser nickte. Die drei Männer gaben ihren schwitzenden Pferden die Sporen, die, vom Schmerz in ihren Seiten angetrieben, vorschossen, ein paar empört gackernde Hühner aufsteigen ließen und in den Wald brachen.
»Er beherrscht die dunklen Künste«, sagte eine helle Stimme. Von Ascisberg wandte sich ihr zu. Es war Therese.
»Ich weiß«, erwiderte er ebenso sachlich wie müde.
Therese war verdattert, weil die erhoffte Wirkung auf ihre Worte bei diesem Hohen Herrn ausblieb. Der Mann wendete sein Pferd und verschaffte sich freien Blick auf die Burg derer von Laurin.
»Er hat ein totes Kind zum Leben erweckt«, sagte eine andere Frau.
Von Ascisberg wendete sein Pferd abermals. Seiner zerfurchten Stirn gesellten sich Sorgenfalten hinzu, als er die Frau ansah. »Ein totes Kind zum Leben erweckt?«
Therese kam es in den Sinn, dass sie dem Tod aus Langeweile an der Seite des Bauern entgehen und stattdessen ein Leben an der Seite dieses Herrn führen könnte. Also trat sie vor ihn. »Ich habe es mit eigenen Augen gesehen – Gott ist mein Zeuge.« Dabei warf sie ihm ein einnehmendes Lächeln zu, das üblicherweise bei Männern verfing – an diesem aber wirkungslos abperlte.
»Wo ist es, Weib?«
Thereses Lächeln wurde hölzern, sie deutete in die Hütte.
Walther von Ascisberg glitt rasch von seinem Pferd, in einer einzigen, fließenden Bewegung, die die Umstehenden dem alten Mann nicht zugetraut hätten.
Der Säugling starrte vor Dreck, die Hebamme machte keinen besseren Eindruck auf ihn. Der Gestank drang durch die Nase direkt in den Kopf und beschwor Bilder vor seinem inneren Auge herauf, die Walther von Ascisberg nie mehr sehen wollte.
Eigentlich.
Er musterte die Tote und den Blutfleck, der sich vor ihrem Schoß ausgebreitet hatte. »Sie ist verblutet«, stellte er fest.
Irmgard nickte.
»Wer ist der Vater?«
Die Hebamme deutete ein Achselzucken an. Walthers gestrenger Blick traf sie.
»Letzten Frühling war sie beim Reisigsammeln im Wald«, brachte Irmgard hervor. Ein Bastard, dachte von Ascisberg. Oder auch nicht. Der Mann, der in ebendiesem Moment seiner Lunge und seinen Beinen alles abverlangte, um am Leben zu bleiben, war hier gewesen.
Von Ascisberg musterte den Säugling, dessen Gesicht seine bläuliche Verfärbung langsam verlor. »Es war tot, sagt das Gesinde?«
Die Hebamme nickte. Sie hatte ein breites, rosiges Gesicht. Mit ihrem Körperumfang war sie in der vorteilhaften Lage, dem harten Frost zu trotzen. Aber ihre Augen waren müde und ohne Glanz.
»Der Mann, was wollte er hier?«
»Das hier«, sie hob den Säugling etwas an, »das war tot.« Sie blickte auf den kleinen Jungen hinab, hin- und hergerissen zwischen Abscheu und Verblüffung.
»Und weiter?«
Die Ungeduld in der Stimme von Walther von Ascisberg war unüberhörbar. Irmgard wusste seit frühester Kindheit, welche Unannehmlichkeiten es mit sich bringen konnte, einem Herrn die Laune zu verderben.
»Es war tot«, beeilte sie sich deshalb zu sagen, »der Mann hat ihm einen Teil seiner Seele gegeben, und dann ist es aus dem Reich der Toten zurückgekommen. Gott ist mein Zeuge.« Ihre rechte Hand beschrieb etwas fahrig das Kreuz in der Luft.
»Ein Stück seiner Seele – hat er diese Worte benutzt?«
Die Hebamme nickte eifrig, um ein Haar hätte sie mit ihrem Kinn dem Kopf des Kindes einen Stoß versetzt.
Walther von Ascisberg atmete tief durch für das, was jetzt vor ihm lag. »Gib es mir und geh«, befahl er, ohne dabei die Stimme zu heben.
Irmgard zögerte, bis sie dem Blick des Mannes begegnete. Dann drückte sie ihm den Säugling in die Arme und verließ die Hütte mit eiligen Schritten und ohne sich noch einmal umzusehen.
Von Ascisberg schloss die Tür, die nur lose in den Angeln hing und durch deren Ritzen der Winterwind pfiff. Dann legte er das Neugeborene neben den Füßen seiner leblosen Mutter ab und ertappte sich dabei, mit welcher Sanftheit er dabei zu Werke ging. Mit welch unangemessener Sanftheit.
Sein Blick fiel auf die Münzen, als er sich gerade wieder aufrichten wollte. Er nahm eine davon in die Hand und rollte sie zwischen Daumen und Zeigefinger, seine Augen ließen nach, kein Wunder bei seinem Alter, er war immerhin Anfang vierzig, und so war er erleichtert, einen Lichtstrahl zu finden, der seinen Weg durch einen Spalt im Holz in die drückende Düsternis des Raums fand.
Von Ascisberg erkannte auf dem Stück Metall, das mehr oval als rund war, einen Bischofsstab. Der Fremde, der es mit seinen Künsten fertiggebracht hatte, ein totes Kind zurück unter die Lebenden zu holen, der es – jede andere Sichtweise wäre pure Blasphemie – dem Schöpfer persönlich wieder entrissen hatte, benutzte Geld der Münzpräge zu Worms. Denn nur diese versah ihre Pfennige mit dem Bischofsstab.
Er nahm eine Münze an sich, zückte den Dolch, aber besann sich sofort. Die Stichwaffe verschwand wieder an seinem Gürtel, er kniete sich neben den Säugling, raffte ein paar mit Blut besudelte Tücher zusammen und presste sie dem hilflosen kleinen Menschen mit all seiner Kraft auf Mund und Nase.
»Herr, vergib mir«, murmelte er, und als die kleinen Ärmchen sich im Todeskampf zu regen begannen, fügte er hinzu: »Herr Jesus, es geschieht um deinetwillen und dir zu Ehren.«
Das Neugeborene gab ein ersticktes Husten von sich, die Beine strampelten erst zögernd und dann immer wilder, als könnten sie für ein Quäntchen Luft sorgen, wenn sie sich nur panisch genug aufbäumten.
Walther von Ascisberg trat in der eisigen Hütte der kalte Schweiß auf die Stirn. Er hatte, man sah es ihm nicht an, allerlei Seelen von ihrem fleischlichen Gefängnis befreit. In der Schlacht bei Doryläum mit dem ausweglosen Verhältnis sieben zu eins konfrontiert, hatte er zur Verblüffung seiner Feinde und seinen Leidensgenossen zum mitreißenden Vorbild mit dem Namen des Herrn auf den Lippen eine blutige Bresche in die Linie der Muselmanen geschlagen und mit dem Zweihänder wie im göttlichen Wahn vier von ihnen enthauptet, bevor ein Streitflegel seinen Helm traf, dessen Dröhnen ihm das rechte Trommelfell zerriss und dessen Wucht ihm die Sinne raubte.
Und nun, dreiundzwanzig Jahre später, fand er sich beinahe unfähig, ein wehrloses Bündel Mensch vom Leben zum Tode zu befördern. Endlich wurden die Ellipsen, die Beine und Arme des Säuglings in der Winterluft beschrieben, langsamer. Verloren an Schwung, an Intensität.
Gleich war es so weit. Walther von Ascisberg drückte mit aller Kraft drei Finger – die Faust konnte der Mund des Neugeborenen nicht aufnehmen, sofern man ihm nicht die Kiefer brach – tief in den Rachen. Ein gegurgeltes Husten noch, dann war es vorbei, dann fielen die Ärmchen aufs Stroh und regten sich nicht mehr.
Von Ascisberg atmete schwer, packte die Tücher und warf sie zur Seite. Die Augen des Knaben waren geschlossen, aber er wusste, dass der Blick unter den Lidern gebrochen war.
Von Ascisberg erhob sich. Etwas außer Atem betrachtete er den kleinen Leichnam unter sich. Scham überkam ihn, er musste sich abwenden.
Da, ein Gurgeln!
Er fuhr herum, denn was er hörte, war bar jeglicher Vernunft. Doch von Ascisberg hatte sich getäuscht, sein Gehörsinn ihm einen Streich gespielt. Das Neugeborene war tot.
Schon wich das Blut aus seinen Adern, die Haut wurde bleich. Man konnte zusehen, wie der Tod in rasendem Tempo Zoll um Zoll Besitz von dem noch warmen Körper ergriff und alles, was er noch an Leben vorfand, in sich aufsog.
Walther von Ascisberg ritt neben seinem Diener Ruprecht den schmalen Weg hinauf zur Burg Laurin, deren Wehrturmspitze man schon erblicken konnte.
Ruprecht hielt die Zügel der beiden Pferde, die ihre getöteten Reiter trugen. Er hatte je einen Fuß und eine Hand der Erschlagenen mit einer Schnur aus Rosshaar unter dem Bauch der Pferde verbunden, sodass ihnen die Leiber ihrer Gefährten unterwegs nicht verloren gingen.
Schneeflocken schwebten im sachten Tanz mit dem Wind auf sie herab. Das Kind schrie. Von Ascisberg drückte das Bündel fester an sich, um es zu wärmen.
Er würde sich später noch oft fragen, was ihn dazu veranlasst hatte, in der Hütte neben dem Säugling noch einmal auf die Knie zu gehen.
Wieder hatte er ein Geräusch von sich gegeben, ein Geräusch, das aus seinem Mund drang, die Lippen hatten sich geöffnet und mit dem Säuseln einer Brise etwas in den Raum entlassen.
Die Seele?
Von Ascisberg kniete sich neben den zweifach Gestorbenen. Seine Nase dicht über den Säugling gebeugt, stellte er fest, dass er nach nichts roch. Dass er rein war und ihn diese Reinheit über den beißenden Gestank in dieser Hütte erhob.
Der Mann, den sie jagten, war für Walther von Ascisberg kein Fremder, ganz im Gegenteil. Und etwas von der Seele dieses Wahnsinnigen wurde nun von diesem unschuldigen Kind beherbergt, um sich vielleicht eines Tages wie ein wulstiges Geschwür Bahn zu brechen.
Aber als er der Feinheit der Gesichtszüge, der filigranen Linien der Hände und Füße des Neugeborenen gewahr wurde, begriff von Ascisberg, was für einen unvorstellbaren Frevel er begangen hatte. In einem einzigen Moment seines ansonsten untadeligen Lebens hatte er sich in einem Augenblick der Raserei die ewige Verdammnis gesichert.
Nein, er hatte kein Recht, dieses Leben zu vernichten, weil es sich irgendwann möglicherweise gegen ihn oder andere richten könnte. Aber diese Erkenntnis kam zu spät. Der Säugling war tot, und es gab nichts außer Gebeten, die er dieser Tatsache entgegenzusetzen vermochte.
Nach der Schlacht von Doryläum, als sie vor über zwanzig Jahren auf ihrem Weg ins Heilige Land von den türkischen Seldschuken vernichtend geschlagen worden waren, hatte Walther von Ascisberg für ein halbes Dutzend Freunde und Verwandte, die den Hieben der Krummsäbel zum Opfer gefallen waren, unzählige Gebete gesprochen. Nicht einer von ihnen war ins Leben zurückgekehrt. Der Herrgott hatte in dieser Nacht sein Antlitz von ihnen abgewandt. Aus Scham, wie Walther vermutete.
Gebete hatten bisher niemanden zurück ins Diesseits geholt. Aber wenn er der Hebamme Glauben schenken konnte, war das tote Kind nur durch einen Atemzug belebt worden, dadurch, dass es jemand mit einem Stück seiner Seele versorgt hatte.
Lassen wir die Seelen in Widerstreit treten, dachte von Ascisberg, bevor er dem toten Kind seine Lippen auf den Mund presste und ihm etwas von seiner Seele einhauchte.
Er setzte den Mund ab und starrte gespannt auf das Kind.
Durch dessen Körper ging ein einziger Ruck. Dann brüllte der Säugling, und von Ascisberg lächelte erschrocken – wie war das möglich?
Irmgard, die Hebamme, sollte all die Beteiligten niemals wiedersehen. Im nächsten Winter stürzte sie, brach sich den Knöchel und erfror.
2.
Sigimund von Laurin war es gewohnt, von der oberen Wehrmauer, an der er stand, die Umrisse des Ascisbergs zu sehen, der sich weithin sichtbar dem Himmel entgegenreckte, aber dichtes Schneetreiben versagte ihm diesmal den Anblick. Der Wind pfiff über das Gestein, es war kalt.
Er presste das doppelte Kuhfell an sich und warf einen Blick hinab in den Burghof, wo Ruprecht sich anschickte, zwei Gruben ins Erdreich zu treiben, bevor der Frost ihm einen Strich durch die Rechnung machen konnte.
Sigimund schaute an Walther von Ascisberg vorbei zu dem dürren Barbier, der dem Hause Laurin auch als Medicus zu Diensten war. Im Augenblick untersuchte er im Schutz des Turmaufgangs das Neugeborene, das sein alter Weggefährte mitgebracht hatte.
»Es war tot«, sagte Sigimund ohne Umschweife, wie es seine Art war.
Walther von Ascisberg konnte sein Erstaunen nicht verbergen. »Woher weißt du das?«
Ein Lächeln zog über Sigimunds Gesicht und war so schnell wieder verschwunden, dass es von Ascisberg schwerfiel zu bestimmen, ob er es überhaupt gesehen hatte.
»Das Gesinde«, erwiderte der Burgherr, »ist immer noch der verlässlichste Kurier.« Er schritt ein wenig an der Wehrmauer entlang und sah hinab zu der Quelle des metallischen Geräusches, das klar und nüchtern durch den Schnee drang. Der Pinkepank ließ den Hammer auf ein Hufeisen fahren. Wieder und wieder, unermüdlich. »Ein Untoter, der ein Stück seiner Seele in sich trägt. Ich sollte das Bündel nehmen und es über die Mauern werfen.«
»Er ist jetzt auch für ein Stück meiner Seele Unterschlupf«, erwiderte von Ascisberg. Ihre Blicke begegneten sich, während die Schneeflocken zwischen ihnen die Strömungen des Windes markierten.
»Lebt er?«, fragte von Laurin unvermittelt.
»Er hat zwei Soldritter erschlagen. Ich nehme es an, ja.«
Sigimund von Laurin war nicht verwundert über die Antwort. Er beobachtete Walther von Ascisberg, eine dürre Gestalt im Kettenhemd, die so verletzlich wirkte, dass er den Reflex verspürte, ihn vor den Kamin zu setzen – aber er widerstand dem Impuls, weil er wusste, aus welchem Stoff sein Freund gemacht war.
»Warum sollte ich das tun – den Knaben aufnehmen?«
»Deus vult«, erwiderte Walther von Ascisberg.
Sigimund von Laurin wusste nicht, ob er verärgert oder froh sein sollte, diese Worte zu hören.
Deus vult war die Parole der Katholischen Kirche, mit der sie Abertausende ins Heilige Land entsandt hatte, um das Grab des Herrn vor den Ungläubigen zu sichern, wie er sich nur zu genau erinnerte. »Gott will es« brachte den Vorteil mit sich, dass niemand, der nicht öffentlich zu brennen gedachte, widersprach.
»Der kleine Bastard war tot«, stellte Sigimund von Laurin fest, »wie kommt es, dass er die Luft atmet, die wir auch atmen? Wie kommt es, dass sein Herz schlägt? Er könnte ein Vorbote des Antichristen sein.«
Walther von Ascisberg bekreuzigte sich eilig.
Sigimund von Laurin lächelte, weil es ihm gelungen war, den Freund zu dieser Geste zu provozieren. Aber seine Belustigung war nicht frei von Unbehagen. Dem Unbehagen, seinen Worten könnte etwas Wahres anhaften.
Unten im Hof jammerte ein Kind. Von Laurin erkannte die Frau des Schmieds. Ihr Name war Ida, sie trug ihren einjährigen Sohn mit sich herum.
»Der Pinkepank soll ihn aufziehen. Sein Weib kann ihn stillen.«
Walther von Ascisberg hatte keinen Zweifel gehabt, wie sich sein Freund entscheiden würde. Er erkundigte sich nach dessen Familie und erfuhr, dass Schelm, der Älteste, zu seinem Herrn gerufen worden war.
»Ein Unfall?«
Von Laurin schüttelte den Kopf: »Gemeiner Sterb.«
Grippen und Seuchen rafften die sehr Jungen und die Alten regelmäßig dahin. Es war die gängigste Todesursache.
Der neue Stammhalter hieß Konrad, erfuhr Walther von Ascisberg, er war ein Jahr alt und konnte schon laufen. Kinder kamen und gingen, kaum hatte man sich ihre Namen eingeprägt, hatten sie den Löffel an den Nächstälteren abgegeben. Wer das zehnte Lebensjahr vollendete, so hatte Walther von Ascisberg in seinen Aufzeichnungen festgehalten, war gegen den Gemeinen Sterb gut gewappnet. Vielleicht lag es daran, dass in diesem Alter, in dem sie alle langsam flügge wurden, die vier Lebenssäfte miteinander in Einklang gerieten. Das, so rief er sich ins Gedächtnis, galt es noch zu erforschen.
Und obwohl Sigimund von Laurin schon Kinder verloren und gelernt hatte, sein Herz nicht allzu sehr an sie zu binden, um im Fall ihres Todes nicht wochenlang aus der Bahn geworfen zu werden – immerhin oblag ihm die Verantwortung für Haus, Hof und Gesinde, eine Pflicht, die keine Pause duldete –, hörte Walther von Ascisberg Zuneigung in der Stimme des Freundes, als er von seinem Sohn Konrad sprach.
»Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Bei der Sonnenwendfeier vorletztes Jahr?«, fragte von Laurin. In seinen Worten schwang keinerlei Bitterkeit mit, nur Bedauern.
Walther nickte. »Ich habe deine Gesellschaft auch vermisst«, antwortete er.
»Wo warst du?«
»Hier und da. Und Sydal auf den Fersen.«
Es war beschwerlich gewesen, aber das brachte das Reisen stets mit sich. Er erzählte von seiner Reise nach Iberien, genauer gesagt nach Toledo. Eine einzige Strapaze. Sydal hatte es dorthin verschlagen gehabt, den Grund dafür ahnte Walther, und als er Nachforschungen anstellte, stieß er auf Ablehnung und offene Bedrohung. Auf dem Rückweg hatte ihn in den Pyrenäen, wie er Sigimund berichtete, die Nachricht erreicht, dass ein gewisser Saladin Sultan von Ägypten geworden sei.
»Die Herrscher der Muselmanen kommen und gehen«, lautete Sigimunds Kommentar.
»Er hat eine Vielzahl der arabischen Stämme hinter sich geeint«, erwiderte von Ascisberg.
»Das ist allerdings eine Leistung«, gab der Burgherr zu, »vielleicht gelingt es ihm ja, ein paar Monate zu überleben, ohne vergiftet zu werden.«
Sie schwiegen einen Moment, ihre bevorzugte Disziplin. Es war ein Leichtes, jemanden zum Reden zu finden, aber ein Glücksfall, auf jemanden zu treffen, mit dem man beredt schweigen konnte. Sie hatten sich nie über diesen Umstand ausgetauscht und sollten das auch bis an ihr Lebensende versäumen. Aber unausgesprochen fühlten sie die Wertschätzung dieser Seelenverwandtschaft beim anderen.
»Ich möchte, dass er lesen und schreiben lernt«, sagte Walther von Ascisberg unvermittelt.
»Er muss nicht lesen können, um ein Feld zu bestellen.«
»Trotzdem.«
»Wozu? Ich kann selbst keines von beidem.«
»Und Konrad auch.«
Ihre Blicke begegneten sich. Sigimund von Laurin war nicht verärgert, nur irritiert.
»Konrad soll kein Mönch werden. Er soll das Wort führen und das Schwert.«
»Meinst du, lesen und schreiben wäre für ihn von Nachteil?«
»Es wäre Zeitverschwendung.«
»Die Zeit, die du den beiden für das Lesen und das Schreiben gibst, wird dir hundertfach vergolten werden, glaub mir.«
Sigimund von Laurin konnte das nicht glauben. Etwas hundertfach vergelten … »Wie soll das gehen?«
In Walther von Ascisbergs Lächeln lag keine Abschätzigkeit. »Die Zeiten nehmen ihren Lauf. Du wirst es noch erleben, dass Lesen und Schreiben und andere geistige Fähigkeiten mächtiger sein können als hundert Soldritter. Und ertragreicher als hundert Morgen. Und wenn es so weit ist, ist dein Stammhalter vorbereitet.«
Von Laurin überlegte, sah noch einmal hinaus zu der Silhouette des Ascisbergs, zu dessen Füßen Walther seine Kindheit verbracht hatte, und richtete den Blick wieder auf den Freund.
Soldrittern konnte man sich entgegenwerfen, Erde und Bäume anfassen, mit der bloßen Hände Arbeit eine ganze Landschaft verändern. Dazu brauchte man keine Buchstaben, und Wissen ließ sich nicht anfassen. Fällte Wissen vielleicht einen Baum oder – viel wichtiger – füllte es den Bauch? Nein, es war nur gut für unpraktisches Gerede.
Wozu sollte man Lesen lernen? Es gab nur ein Buch, die Heilige Schrift, und die Geistlichen besorgten das Vorlesen und Seiern. Wozu schreiben? Ein Wort war schneller gesagt als geschrieben, schreiben machte alles langsamer und komplizierter. Denn was nützte auch das gelehrteste Schreiben, wenn der Empfänger es nicht lesen konnte?
Sigimund von Laurin fand nichts Vernünftiges an dem Anliegen seines Freundes. Aber eine Freundschaft wie die zwischen ihnen war rar, Sigimund wollte sie nicht missen, und vielleicht – wer weiß – hatte Walther wie so oft recht, auch wenn Sigimund es dieses Mal nicht glauben wollte. Außerdem würde Konrad das Lesen und Schreiben nicht zum Nachteil gereichen, wenn er, Sigimund, nur darauf achtete, dass seine Kampfausbildung neben all dem nutzlosen Tand nicht zu kurz kam.
Also willigte er ein.
Der Barbier trat mit dem Säugling zu ihnen. Der Kleine war ganz still, als von Laurin sich über ihn beugte und mit Blicken den kleinen Körper bemaß.
»Er ist schwach, klein und kränklich, Herr«, sagte der grauhaarige Mann, »er wird den Winter nicht überstehen. Falls doch, muss er eiserne Härte beweisen.«
Sigimund warf von Ascisberg einen Blick zu, der dort schlotternd in seinem viel zu weiten Kettenhemd stand und keine Miene verzog. »Also gut. Der Knabe bleibt ohne Namen. Aber wenn er im Frühjahr noch lebt, dann soll er auch ›Isenhart‹ gerufen werden.«
3.
Anno Domini 1182
Isenhart, wo steckst du?«
Die Stimme seines Vaters riss Isenhart nur kurz aus seinen Gedanken. Er stand unter einer Eiche im Wald und hatte soeben eines ihrer Blätter zwischen Daumen und Zeigefinger zerquetscht.
Grünlicher Saft war dabei ausgetreten. Isenhart hob den Kopf, starrte zur Eiche empor, die ihn um ein Vielfaches überragte. Ein ebenso verwegener wie einleuchtender Gedanke, der vielleicht erklären konnte, weshalb die Bäume im Herbst ihre Blätter abwarfen, kam ihm gerade, als sein Vater ihn ein zweites Mal rief und ihn daran hinderte, den folgerichtigen Schluss zu ziehen. Isenhart wartete die dritte Aufforderung besser nicht ab und ließ die Eiche Eiche sein.
Der Pinkepank Chlodio stand neben dem rauchenden Holz, das durch eine Decke aus Erde und Gras begierig nach Luft schnappte. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, wie er zu sagen pflegte. Er trank den ganzen Tag über Bier und er züchtigte seine Frau und seine Kinder, ein ganz normaler Vater also.
Isenhart fragte sich insgeheim, ob das in hundert Jahren anders sein würde. Dann kniete er sich neben seinen zwölf Monate älteren Bruder Henrick und dichtete das Holz weiter ab, damit es sich nicht entflammte. Wenn es durchs Feuer gefressen wurde, war die Arbeit dahin.
Es gelang ihnen einigermaßen, und Chlodio gab ihnen vom Bier zu trinken, während der stechende Qualm Tränen über ihre Wangen laufen ließ.
Chlodio wies seinen Ältesten an, den Maulesel mit dem Karren herzuschaffen, um die Holzkohle, die die Glut bald geschaffen hatte, zur Esse zu transportieren.
Henrick täuschte Magenschmerzen vor, und als das nichts half, bemühte er zunächst Waldgeister, deren angebliche Umtriebe sein Vater mit einem Tritt in die Rippen quittierte, bis Henrick schließlich Chlodios persönlichen Albtraum bediente: Wölfe.
Als Kind war ihr Vater in einen Zusammenstoß mit einem Wolf verwickelt gewesen. Abends, im Schein einer Wachskerze, wenn genug Bier und Met geflossen waren, wurde er nicht müde, von dem Kampf auf Leben und Tod zu berichten, den er damals überstanden hatte, obgleich sich das Gesinde einig war, dass es ein blindes, sterbendes Tier gewesen sein musste, das – ebenso erschrocken wie Chlodio – vom Hunger ermattet kraftlos gegen ihn gestolpert war.
Nichtsdestotrotz waren ein fahrender Händler und seine beiden Kinder in der schlimmen Hungersnot vor drei Jahren – Isenhart konnte sich erinnern, wie sie im Burginneren an Lederriemen gekaut hatten, während draußen Kinder und Vieh erfroren – von einem Wolfsrudel angefallen und in Stücke gerissen worden.
Isenhart bot sich an, den Maulesel zu holen. Chlodio hatte nichts anderes erwartet, und Henrick versicherte ihm seine ewige Dankbarkeit.
Die Eselin ließ sich bereitwillig von ihm führen. Isenhart achtete darauf, sich stets vor ihr zu befinden, um sie ruhig zu halten – und aus Vorsicht. Das letzte Mal, als Henrick sie vergewaltigt hatte, waren ihre Hinterläufe nicht um eine Antwort verlegen gewesen. Seitdem hielt Henrick Abstand, und wer ihn kannte, sah, dass er ein wenig gekrümmt ging.
Sie hatten die Holzkohle in der Schmiede neben der Esse abgeladen, als Isenhart sich mit schmerzendem Rücken erhob. Der Pinkepank trat auf den Blasebalg, die Holzkohle zischte im Ofen. Henrick und er nahmen das schmutzige Erz, das sie jeden Nachmittag in einem dreißig Fuß tiefen Erdtrichter im Wald abbauten, und warfen es auf die Holzkohle.
Die Schmiede befand sich am äußersten Ende des Burghofs. Im Sommer wurde sie vom Gesinde und der Familie Laurin gemieden, aber im Winter konnten sie oftmals vor Gedränge kaum arbeiten, denn die beißenden Dämpfe, die zischend aus der Esse schossen und die Luft verpesteten, wurden als wärmende Wohltat empfunden.
Wieder kam eine Schicht Holzkohle auf das Erz. Während Walther von Ascisberg schon eine Weile über eine Methode zur Temperaturbestimmung sinnierte, war Isenhart und Henrick nur bewusst, wie unendlich und zum Zerspringen heiß der Ofen glühen musste, damit das Erz sich verflüssigte. Das wechselseitige Schichten von Holzkohle und Erz verbrannte ihnen die Haare an den Armen und raubte ihnen die Luft, die unfreiwilligen Berührungen mit dem Ofen hatten ihnen schwere Brandnarben zugefügt. Meist eiterten sie nicht, weil die Gluthitze jeden Keim zuverlässig vernichtete.
Die Unterarme des Pinkepanks waren übersät mit hellen Strichen, auf denen kein Haar mehr wuchs. Von denen auch Isenhart bereits zwei aufweisen konnte, da ihn sein Vater seit einigen Wochen in der Schmiedekunst unterwies.
Ida kam mit einem Bottich frisch gegärtem Bier zu ihnen. Sie war hochschwanger. Der Pinkepank schöpfte mit seinem Kelch, probierte und war zufrieden. Henrick und Isenhart griffen nach ihren Holzbechern und tranken gierig von dem Bier, das ihre Mutter gebraut hatte. Ihr Bier war das schmackhafteste weit und breit.
In den Jahren zuvor hatte sie zwei tote Kinder zur Welt gebracht. Chlodio war außer sich vor Zorn gewesen, hatte in ihrer Kammer – Schlaflager, Tisch, ein Stuhl – alles kurz und klein geschlagen, bis er sich schließlich mangels anderer Gegenstände, an denen er seinem Schmerz und seiner Scham freien Lauf lassen konnte, Ida zugewandt hatte.
Henrick hatte die Eselin aufgesucht, Isenhart hörte es am Wiehern des Tieres, also stellte er sich vor seine Mutter. »Fass sie nicht an«, sagte er mit einer Stimme, in der Angst und Wut sich die Waage hielten.
Der Pinkepank war für einen kurzen Augenblick fassungslos. Eher hätte er damit gerechnet, dass der Leibhaftige in ihre Stube trat. Was nicht geschah.
»Du kleiner, untoter Bastard«, schnaufte Chlodio.
Und dann bezog Isenhart die Prügel seines Lebens. Der Verlust seines Bewusstseins kam wie eine Erlösung über ihn.
Als er erwachte, beugte sich gerade ein Engel über ihn, das blonde Haar strich über sein Kinn, er konnte die blaue Färbung der Pupillen sehen. »Bin ich im Himmelreich?«, hörte er sich flüstern.
Der Engel war gleichermaßen belustigt wie bestürzt. Die Bestürzung gewann die Oberhand. »Er ist wach«, sagte der Engel, in dem er jetzt endlich Anna erkannte, die älteste Tochter des Fürsten von Laurin. Isenhart blickte von seinem Lager zur Seite. Da war ihre jüngere Schwester Sophia, die roten Haare kurz gestutzt wie bei einem Jungen. Sie streckte ihm die Zunge heraus und versuchte zu schielen.
Ein weiteres Gesicht beugte sich nun über ihn, es war das eines alten Mannes, über fünfzig Lenze hatten tiefe Furchen in sein Gesicht getrieben, das durch Barthaare halb verdeckt war.
»Stirbt er?«
Diese Stimme erkannte Isenhart, er hatte sie hin und wieder vernommen. Sie gehörte zu Sigimund von Laurin, ihrem Herrn, der sich am Eingang zu dem Krankenzimmer befand. Die Arme hingen locker herab, die ganze Gestalt befand sich nicht unter Spannung, Sigimund von Laurin stand einfach da. Und strahlte dabei eine Selbstverständlichkeit des Seins aus, die Isenhart trotz seines Dämmerzustands – oder gerade deswegen – tief beeindruckte. Ich überstehe nicht Steine noch Bäume, schien der ganze Mann auszudrücken, aber ich bin.
Etwas an diesem Gedanken spendete Isenhart Trost.
»Nein«, sagte Walther von Ascisberg, der Mann über ihm. Er betastete Isenharts Auge, die Linien verschoben sich, der Raum schrumpfte. Und dann sprang das Volumen zurück in den Raum und verursachte ihm starke Kopfschmerzen.
»Wer …«, setzte Isenhart leise an.
»Schweig«, befahl der Mann. Er sah tief in sein rechtes Auge, fuhr mit den Fingern erstaunlich sanft über das Lid. »Schließ das linke Auge.«
Isenhart zögerte.
»Das da«, sagte Walther von Ascisberg mit einer leichten Ungeduld in der Stimme und tippte mit dem Zeigefinger neben das Auge.
Isenhart war beschämt, weil der Mann annehmen musste, dass er unfähig war, zwischen links und rechts zu unterscheiden. »Ich weiß«, antwortete er deshalb. Seine Stimme erschien ihm selbst schwach.
»Ich weiß, dass du es weißt, und jetzt schließ das Auge.«
Isenhart fügte sich. Aber er hatte Probleme, das Lid über den Augapfel gleiten zu lassen. Davon abgesehen war es ein Gefühl, als fahre rohes Fleisch über Sand.
Der alte Mann führte ihm seine Hand vor Augen. »Wie weit ist der Abstand zwischen meiner Hand und meinem Gesicht?«, fragte er.
»Eine Armeslänge.«
Von Ascisberg nickte zufrieden. »Jetzt öffne das Auge wieder und schließ das andere.«
Isenhart befolgte die Anweisung.
»Ich will nicht, dass er stirbt«, sagte eines der Mädchen. Es war Anna.
»Anna will Isenhart heiraten.« Das war Sophia.
»Schweigt.« Die Mädchen verstummten, ihr Vater hatte gesprochen.
»Und wie ist der Abstand jetzt?«
»Da ist keiner«, antwortete Isenhart ebenso verblüfft wie erschrocken.
»Auf einem Auge existiert nie ein Raum«, belehrte Walther ihn, »was du eine Armeslänge nennst, basiert auf Erfahrung und Annahme – nicht auf dem, was du siehst, denn mit einem Auge erscheint der Raum als Fläche. Also: Was siehst du jetzt?«
Isenhart konzentrierte sich: »Ich sehe Flächen, die verwoben sind.«
Von Ascisberg kniff die Augen zusammen, und Isenhart ahnte die Anstrengung des Mannes, seinen Worten etwas Greifbares zu entnehmen.
Er sah zur Seite und entdeckte dort ein Flachrelief, das in das Mauergestein gehauen worden war. »So wie das«, sagte er schnell. Walther von Ascisberg warf erst dem Relief einen langen Blick zu, dann dem Jungen auf dem Lager.
»Erblindet er?«, fragte der Fürst.
»Nein, aber er nimmt den Raum jetzt anders wahr als wir«, antwortete von Ascisberg mit einer Gelassenheit in der Stimme, die dazu angetan war, Isenhart zu beruhigen. »Abstände und Maße wirken auf dem einen Auge für ihn anders.«
»Kann er damit arbeiten?«, wollte Sigimund von Laurin wissen und trat an das Lager aus Stroh heran, auf dem Isenhart lag.
Walther von Ascisberg sah zu ihm auf. »Er wird sich daran gewöhnen.«
Es war Sophia gewesen, die seine Schreie gehört und in die Kammer des Pinkepanks getreten war, um unfreiwillige Zeugin eines Bildes zu werden, das sie noch jahrelang verfolgen sollte. Die blutige Fehlgeburt in den Armen der verängstigten Frau, der verdreckte Junge am Boden und dieses Auge, das selbst den tobenden Chlodio von dem Schlag abhielt, zu dem er gerade ausgeholt hatte.
Isenhart war schon nicht mehr bei Bewusstsein. Die Wucht des letzten Fausthiebs gegen seine Schläfe hatte ihm das rechte Auge hinauskatapultiert. Es lag, nur durch die dünne Ader des Sehnervs mit ihm verbunden, eine Handbreit von seinem Kopf entfernt auf dem Boden.
Von Ascisberg hatte ihm den Augapfel mit aller Behutsamkeit zurück in die Höhle gedrückt, wie Isenhart später erfuhr.
Von da an spielten sich vor jedem seiner Augen verschiedene Dinge ab. Dem rechten Auge präsentierte sich die Welt als Relief. Anna, die er seit den zwei Tagen auf dem Krankenlager verehrte, warf ihm hin und wieder etwas zu, wenn ihre Wege sich kreuzten. Einen Stein, einen Stock, solche Dinge. Während der erste Stock ihn noch an der Stirn traf und er eine tiefere Verletzung wegen ihrer Geringschätzigkeit ihm gegenüber als wegen der Schramme empfand, die seine Stirn davontrug, begriff er sehr bald, dass es ihre Art war, ihm einen Gefallen zu erweisen.
Sophia erklärte es ihm, denn es war auch ihre Idee gewesen. Es ging darum – von Ascisberg hatte es in jener Nacht gesagt –, sich an sein verändertes, nicht zwangsläufig reduziertes Sehvermögen zu gewöhnen. Da war sie sechs Jahre alt und Isenhart beeindruckt von der Reife dieses Kindes, das ansonsten mehr Schabernack ausheckte als Henrick und er zusammen.
In der zweiten Woche fing Isenhart die Gegenstände, die Anna ihm zuwarf. Und in der Woche darauf arbeitete er an der Esse, als sei nie etwas gewesen. Mit seinem Vater behandelte er das erste Mal selbst das frisch gewonnene Eisen. Schlagzahl und Wucht der Hammerhiebe waren für ihn ein ebenso unbekanntes Feld wie die Deutung der Verfärbung des erkaltenden Metalls. Chlodio, seit dem Zwischenfall in sich gekehrt und melancholisch, brachte es ihm bei, und wenn er einen Fehler beging, begnügte sein Vater sich mit einem kräftigen Tritt gegen sein Schienbein.
»Du untoter Bastard«, sagte Isenhart bei einer Gelegenheit, »was habt Ihr damit gemeint?«
»Das habe ich nie gesagt«, erwiderte der Pinkepank und hämmerte heftiger auf das Metall, das einmal das Scharnier für das neue Burgtor werden sollte. Isenhart hatte die Lüge schon erkannt, bevor sie den Mund des Pinkepanks verließ. Und damit auch die Unmöglichkeit, jemals eine ehrliche Antwort auf seine Frage zu erhalten.
Die Verletzung verlieh ihm allerdings auch eine neue Fähigkeit: Kniff er das linke Auge zu, verhalf das Relief, das sich plötzlich aus der Fläche erhob, seinen Hieben am Amboss zu einer traumwandlerischen Zielgenauigkeit.
Kein Stock und kein Stein, den er nicht mehr fing.
Als der Herbst nahte, gebar Ida einen Sohn. Henrick, der von Esel zu Schaf gewechselt hatte – Esel sind so unruhige Tiere –, kümmerte sich zusammen mit Isenhart um den Nachwuchs, der Frieden in das Haus brachte. Selbst Chlodio lebte auf. Henrick schwor Stein und Bein, ihn lachen gesehen zu haben.
Als Sophia einmal vorbeischaute und den Kleinen, Ludwig, nach dem gerade verstorbenen Landesfürsten von Württemberg benannt, im Arm hielt und dieser zu lächeln begann, schrie sie unvermittelt auf und brach in Tränen aus. Henrick nahm den Bruder an sich, Isenhart fragte Sophia, was sie bedrückte, obwohl er kein wirkliches Interesse für die wechselhaften Gefühle der kleinen Fürstentochter empfand.
»Nichts«, sagte Sophia und verschwand. Und beides war Isenhart recht.
Erst später begriff Isenhart, wie oft Walther von Ascisberg lenkend in sein Leben eingegriffen hatte. An einem regnerischen Septembermorgen tauchte er plötzlich in der Schmiede auf, eine hagere Gestalt, das Gesicht ausgezehrt, die Augen wach und auf den Pinkepank gerichtet. »Ab jetzt kann Isenhart dir nur noch am Nachmittag zur Hand gehen«, sagte er.
Walther von Ascisberg wirkte auf den ersten Blick unscheinbar, ein Mann, den man durchaus übersehen konnte. Und doch war er in gewissem Sinne aus demselben Stoff wie Sigimund von Laurin. Egal, welchen Raum sie betraten, immer beherrschten die beiden ihn auch.
Chlodio erhob keine Widerrede, und von Ascisberg nahm Isenhart mit sich.
Isenhart spürte zum ersten Mal in seinem Leben ein Pferd, das sich unter ihm bewegte und ihn durch die Landschaft trug. »Tut das dem Pferd weh?«, fragte er.
Von Ascisberg lächelte und schüttelte dann den Kopf. Danach verdoppelte sich Isenharts Genuss.
Sie erreichten eine Lichtung, sanfter Nieselregen setzte ein.
»Du wirst«, sagte Walther von Ascisberg, »ab heute etwas erhalten, was dem Stand der Nobile vorbehalten ist: Bildung.«
Isenhart ahnte, dass das wohl eine Art Geschenk sein sollte. Er nickte ehrfürchtig und schwieg, um keinen Fehler zu begehen. Er war den Umgang mit Geschenken nicht gewohnt. Und er wusste auch nicht, was Bildung ist.
»Muss ich dafür weg?«
Walther von Ascisberg schüttelte erneut den Kopf und schmunzelte. »Du wirst die Sprache der Gelehrten lernen«, erwiderte er dann.
Sie hatten einen kleinen Fluss erreicht. Von Ascisberg saß ab, und auch Isenhart rutschte so elegant wie möglich vom Rücken des Pferdes.
»Sieh.«
Isenhart sah ein großes Rad aus Holz, das von der Strömung des Flusses in Bewegung gehalten wurde. Am Rand des Rads waren kleine Gefäße angebracht, die fünf oder sechs Kellen vom Wasser aufnahmen und es, in ihrer unweigerlichen Abwärtsbewegung, in eine hölzerne Rinne entluden. Isenharts Augen folgten dem Verlauf der Rinne. Walther von Ascisberg beobachtete jede seiner Regungen.
»Wohin wird das Wasser getragen?«
»Zu einer Siedlung, sie brauchen es zum Leben, für das Vieh, die Schmiede. Zu allem. Niemand muss jetzt mehr zum Fluss.«
Isenhart verstand. Sein Blick war auf das Rad und seine Funktionsweise geheftet. Es war ebenso einfach wie gewitzt. Er sah zu von Ascisberg. »Habt Ihr es gebaut?«
»Nur erdacht. Das Gesinde hat es gebaut.«
Isenhart durchlief ein Schauer. »Warum werfen die Bäume im Herbst ihr Laub ab?«
Walther von Ascisberg, selbst ganz versunken in den Anblick seines Werkes, versunken in der immer gleichen Bewegung und dem steten Fluss des Wassers in der Rinne, merkte auf und musterte den Jungen. »Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Gottes Wunsch, dass sie es tun.«
Isenhart nickte, aber von Ascisberg konnte ihm an der Nasenspitze ablesen, dass er sich damit nicht zufriedengeben würde, und prompt kam die Bestätigung: »Aber warum ist es Gottes Wunsch?«
»Die Wege des Herrn sind unergründlich.«
Isenhart nickte, doch sein Blick galt dem Wasserrad. Und von Ascisberg konnte es ihm nicht verdenken, denn ebenso gut hätte er gar keine Antwort geben können.
»Was ist, wenn der Fluss irgendwann kein Wasser mehr führt?«
»Der Fluss versiegt nicht.«
»Warum?«
»Ich habe noch nie von einem Fluss gehört, der versiegt wäre.«
»Und wenn doch?«
Der Junge wurde langsam anstrengend.
»Dann muss das Gesinde zu einem anderen Fluss gehen und sich sein Wasser wieder selbst holen.«
Isenhart spürte, wie seine Fragen den Unmut des Mannes neben ihm hervorriefen, und obschon er wohl einen Tag ununterbrochen hätte reden müssen, um auch nur die dringendsten Fragen zu stellen, die ihn bewegten, schwieg er daher.
So standen sie einige Augenblicke am Ufer und bemerkten am Glitzern des Wassers, dass die Sonne sich gegen den Regen durchgesetzt hatte.
Von Ascisberg selbst war im niederen Adel geboren worden, wie er zu erzählen begann. Er hätte es sich auf dem Landsitz seines Vaters bequem machen und den Knechten beim Arbeiten auf den Feldern zusehen können. Aber ihn trieb dieselbe Frage um, die er auch bei Isenhart immer lauter zu vernehmen meinte: Warum?
Warum werfen die Bäume im Herbst ihr Laub ab? Warum ändert der Mond seine Form, wachsen den Toten Nägel und Haare, fällt alles zu Boden, statt zu schweben, und warum verlieren die Menschen nach und nach ihre Zähne? Und warum, schloss Walther von Ascisberg, sollten die Bewohner einer Siedlung täglich den Weg zum Fluss auf sich nehmen, wenn man den Fluss zu der Siedlung fließen lassen kann?
»Das Wasserrad«, erkannte Isenhart.
Von Ascisberg nickte. Er erklärte ihm, wie der Unterricht, den er von nun an von Pater Hieronymus erhalten sollte, Türen für ihn aufstoßen würde, die einem Jungen aus seinem Stand für gewöhnlich zeit seines Lebens verschlossen blieben.
»Aber«, fügte von Ascisberg hinzu, »durch die Türen muss man immer noch selbst gehen.«
Isenhart wollte sich der Sinn dieser Worte im Moment nicht erschließen, aber das tat seiner zunehmenden Aufgeregtheit keinen Abbruch. In seinem Bauch war ein Kribbeln entstanden, das ihn jetzt ganz erfasst hatte. Seine Intuition sagte ihm, dass er auf der Schwelle zu einer neuen Welt stand.
Sie kehrten zu den Pferden zurück, die in der Nähe grasten.
»Es ist ein Privileg«, sagte Walther von Ascisberg.
»Was ist das?«
»Es stammt aus einer Sprache, die du jetzt lernen wirst: Latein. Es ist die Sprache der Gelehrten. ›Privileg‹ bedeutet ein Vorrecht für den Einzelnen. In diesem Fall für dich.«
Walther von Ascisberg half ihm hinauf aufs Pferd, bevor er sein eigenes bestieg. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zurück.
»Warum tut Ihr das für mich?«
»Weißt du, was ›verwandte Seelen‹ sind?«
»Nein.«
Walther von Ascisberg nickte sich selbst auf eine Weise zu, die keinen Zweifel daran ließ, dass er mit dieser Antwort gerechnet hatte.
Ihr Rückweg nahm eine gute Stunde in Anspruch, und in der erklärte er Isenhart, was es bedeutete, wenn fremde Menschen im Gleichtakt schwangen.
4.
Konrad war vom Messen besessen. Nicht vom Abmessen des Wehrturms oder der Ländereien, sondern vom Sichmessen mit anderen.
Isenhart war, als bestünde Konrads ganzes Wesen darin, seinen Platz in einer Hierarchie zu finden, die durch das Wetteifern bestimmt war. Und in dieser wie in jeder anderen Ordnung waren der Ruf und das Ansehen umso größer, je höher man in ihr rangierte.
Konrad von Laurin war ein Jahr älter als er, sein Vater hatte ihn für zwei Jahre zu einem befreundeten Fürsten geschickt, der bei Spira seine Ländereien unterhielt. Dort hatte Konrad das Reiten und Bogenschießen gelernt; Letzteres unter Protest, denn Bogenschießen war in seinen Augen etwas für Feiglinge, die auf diese Art dem ehrlichen, direkten Kampf auswichen.
Vor ihrem ersten Tag bei Vater Hieronymus steckte man die beiden zusammen. Konrad war wohlgenährt, aber Bauch und Arme trugen kein Gramm zu viel. Sigimund von Laurin stellte sie einander vor. Isenhart war voller Hoffnung, einem Gleichgesinnten zu begegnen. Der Gleichgesinnte griff seinen Arm und drehte ihn in der Länge so schmerzhaft, dass Isenhart augenblicklich zu Boden ging.
Und so ging es in einem fort. Konrad konnte schneller laufen, weiter werfen und höher klettern. Wer gewann wohl beim Armdrücken, zu dem Konrad ihn bei jeder Gelegenheit aufforderte?
Das, sagte Konrad, entspreche der natürlichen Ordnung von Herr und Knecht. Isenhart sei als Diener geboren, und ein Diener könne – und vor allem dürfe – den Herrn niemals überragen.
Am Ende des Tages fragte Isenhart sich, ob es überhaupt erstrebenswert war, eine der Türen zu durchschreiten, die sich ihm heute geöffnet hatten. Er schlich zu seinem Lager, seine Mutter wiegte das Neugeborene in den Schlaf. Der Pinkepank schnarchte, und sein Bruder Henrick fütterte zwei Hühner, die er im Austausch gegen einen Steigbügel erhalten hatte.
Isenhart nahm an, dass dem Federvieh eine eindringliche Nacht bevorstand, doch er irrte sich. Henrick hatte sich ein großes Ziel gesetzt: Er wollte Hühner züchten. Deshalb einen Hahn und eine Henne, den Nachwuchs würde er wieder kreuzen und so weiter.
»Wie ist er so?«, fragte Henrick.
»Er ist ein Schafskopf«, erwiderte Isenhart müde.
Hieronymus war ein Geistlicher, Ende zwanzig, eine hagere, fast ausgezehrte Gestalt, die nicht stillstehen konnte, sondern in der kleinen Kapelle auf und ab ging. Von links nach rechts und wieder zurück.
»Ich bin das A und das O«, zitierte er, »der Anfang und das Ende.«
»Aber das O ist in der Mitte, oder?« Konrad kniff die Augen zusammen, weil alles, was diese spindeldürre Gestalt von sich gab, keinen Sinn ergab.
»Alpha und Omega«, widersprach Isenhart leise.
Er und der Sohn von Sigimund von Laurin saßen nebeneinander auf zwei kalten Holzschemeln, sie teilten sich eine handgeschriebene Bibel, ein Buch von unschätzbarem Wert. Hieronymus hatte ihnen erklärt, dass drei Mönche zwei Jahre benötigt hätten, um es herzustellen. Während Konrad sich insgeheim fragte, wie man seine Zeit dermaßen sinnlos verplempern konnte, fuhren Isenharts Finger sanft über das Pergament.
»Alpha und Omega«, nahm Hieronymus den Faden auf, »im griechischen Alphabet der erste und der letzte Buchstabe.«
Konrad blies seine Wangen auf: »Wozu brauch ich das?«
Hieronymus verfügte über ein ausgezeichnetes Gehör. Er trat an Konrad heran.
»Um zu dienen«, brachte er schmallippig vor Ärger hervor, »und um zu herrschen. Ihr seid der Stammhalter des Hauses Laurin. Herrscher über das Gesinde, aber Untertan Gottes. Euer Leben soll dem Allmächtigen wohlgefällig sein.«
»Er kann doch gar nicht so viele Leute im Auge behalten«, meinte Konrad.
Vater Hieronymus verstand sich meisterhaft auf die Handhabung des Rohrstocks, deren Geheimnis im Wesentlichen auf der Wendigkeit des Handgelenks basierte, das ihn führte. Isenhart konnte dem Halbkreis kaum folgen, den der Stock in die Luft schnitt, bevor er zwischen Konrads Schulterblätter fuhr.
Der Sohn des Fürsten sprang auf – halb vor Schmerz, halb vor Zorn – und fand sich von Angesicht zu Angesicht dem Geistlichen gegenüber. »Wagt es noch ein einziges Mal …«, begann Konrad mit zitternder Stimme, denn er war gerade erst zwölf Jahre alt.
»Wagt was?«, unterbrach ihn Hieronymus, »was soll ich wagen?«
Isenhart begriff, dass es eine Frage der Zeit war. Von Jahren, aber derer nicht allzu viele. Vielleicht fünf oder sechs Jahre mehr, und Konrad von Laurin hätte dem Geistlichen die Hände gebrochen.
»Hinsetzen«, befahl Hieronymus.
Nach einem kurzen Zögern, das es ihm gestattete, etwas von seinem Gesicht zu wahren, kam Konrad dem Befehl des Geistlichen nach.
»Hände auf das Pult.«
Konrad kam auch dieser Anordnung nach, vor Wut bebend.
»Offenbarung des Johannes, Isenhart. Kapitel 1, Vers 17 und 18. Für jeden Fehler, den du machst, büßt der junge Herr.«
»Aber wir sollten Vers 15 und 16 lernen«, erwiderte Isenhart vorsichtig.
»Aber bis Vers 20 lesen«, entgegnete Hieronymus und beugte sich zu ihm herab. »Die Leute im Ort erzählen sich merkwürdige Dinge über dich, wusstest du das?«
Isenhart schüttelte den Kopf, ihm war schleierhaft, warum das Gesinde überhaupt Worte für ihn verschwenden sollte, den elfjährigen Sohn eines Pinkepanks.
»Dein Gedächtnis soll außergewöhnlich sein.«
»Noli timere ego sum primi«, zitierte Isenhart.
»Primus«, korrigierte Hieronymus. »Nun, mir scheint es nicht außergewöhnlich«, fügte er hinzu und ließ den Rohrstock auf Konrads Finger niedersausen. Der verzog vor Schmerz das Gesicht, zog aber die Finger nicht zurück.
»Ego sum primus«, verbesserte Isenhart sich und war bemüht, Konrads Blick auszuweichen.
Hieronymus nickte: »Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste – weiter, Isenhart.«
»Et novissimus et vivus et fui mortus …«
»Mor-tu-us«, korrigierte der Geistliche. Der Rohrstock zischte durch die Luft. Die Schmerzen, die Konrad von Laurin erleiden musste, darüber war Isenhart sich nicht minder schmerzlich im Klaren, würden ihm heimgezahlt werden. Da Konrad nicht eben die Geduld in Person war, würde das schon sehr bald nach Unterrichtsende der Fall sein.
Während er fieberhaft überlegte, wie er dem entgehen konnte, unterlief ihm der nächste Fehler: »Et ecce sum vivens in saecula saeculorum et habeo clades …«
»Cla-ves«, sagte Hieronymus mit einem leichten Lächeln. Dieses Mal schlug er so heftig zu, wie er konnte, denn üblicherweise rief das Auffrischen des Gedächtnisses mithilfe des kleinen Holzes Wehklagen hervor, was der junge Herr sich aber zu untersagen schien. Zum Bedauern des Geistlichen und der wachsenden Bewunderung Isenharts kam abermals kein Laut über Konrads Lippen.
»Et habeo cla-ves mortis et inferni.«
»Perfekt«, lobte Hieronymus und ließ den Rohrstock unerwartet ein letztes Mal auf Konrads Hände sausen, dieses Mal erwischte er die Kuppen und der junge Herr stöhnte auf, »aber nicht frei von Ironie, Isenhart. Nicht frei von Ironie.«
Konrad warf Isenhart einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes«, übersetzte der Geistliche die abgefragte Bibelstelle, »ich habe es deinetwegen ausgewählt.«
Sein Blick ruhte auf Isenhart.
»Du wirst dermaßen Prügel bekommen«, zischte Konrad.
»Wie war das?«, fragte Hieronymus.
»Ich lobte den Herrn«, antwortete Konrad von Laurin.
Hieronymus schritt erneut durch die Kapelle, während Konrad sich die malträtierten Finger rieb, die bereits anschwollen.
»Und nun du, Konrad. Dieselbe Bibelstelle.«
»Gerne«, seine Schmerzen waren schon halb vergessen. Isenhart starrte den Geistlichen ungläubig an.
»Finger ausstrecken«, befahl Hieronymus.
Isenhart kassierte vierzehn Schläge für ein Zitat, das aus 25 Wörtern bestand. Aber über seine Lippen kam kein Laut, keine Träne tropfte von seinen Wimpern.
Seine Finger waren so stark angeschwollen, dass er nicht einmal mehr eine Tür öffnen konnte und sie deshalb eine ganze Weile in den Fluss tauchte. Konrad hockte sich neben ihn und versenkte seine Finger ebenfalls in das wohltuend kalte Wasser.
»Das war keine Absicht«, sagte Konrad schuldbewusst.
»Die ersten drei Fehler schon.«
Konrad war peinlich berührt, Isenhart hatte ihn durchschaut. »Du bist ein Knecht«, rettete er sich.
Isenhart verschluckte sich fast vor Wut: »Aber meine Finger haben dieselben Schmerzen!«
Isenhart war ziemlich schlau, wurde Konrad bewusst, auf nahezu alles hatte er eine gute Antwort.
Er wollte schon fast so etwas sagen wie »tut mir leid«, aber sein Vater hatte ihm eingeschärft, dass ein Nobile sich niemals gemein mit dem Gesinde machen dürfte. Das sei der Anfang vom Ende.
»Wir können ja irgendwas zusammen machen«, sagte er deshalb in aufmunterndem Ton, »Armdrücken oder so.«
»Lass mich in Ruhe.« Isenhart zog seine Finger aus dem Wasser und ging.
Hieronymus erkrankte wenig später, sein Körper wurde an den Lenden und unter den Achseln von Abszessen heimgesucht, außerdem plagte ihn starkes Fieber. Der Barbier des Hauses Laurin, der den Aderlass wie so viele seiner Zunft als Allheilmittel praktizierte, scheiterte an der Heilung des Geistlichen. Er ließ bis zu drei Liter Blut an Stirn und Unterarm ab – natürlich nicht bei Vollmond, das brachte Unglück –, sodass Hieronymus kurzzeitig mehr tot als lebendig war.
Die Scheinheiligkeit, mit der Konrad und Isenhart Hieronymus’ womöglich bevorstehende Begegnung mit seinem Schöpfer in Worten und Gesten bedauerten, war die erste Gemeinsamkeit, die sie entdeckten.
Auf Bitte Sigimunds von Laurin entsandte Wilbrand von Mulenbrunnen, der Abt des Klosters zu Mulenbrunnen, einen jungen Gelehrten zum Hause Laurin. Sein Name war Stephan der Jüngere.
Der Medicus schien Geistliche nicht sonderlich zu schätzen – Isenhart und Konrad waren ganz seiner Meinung, und Konrad wagte den Rat, den Abszessen mit einigen gut gemeinten Rohrstockhieben zu Leibe zu rücken. Demgegenüber stand die Überzeugung des Barbiers, der Sache mit einem riskanten Aderlass am Hals zu begegnen.
Stephan der Jüngere entschied sich für keines von beidem. Nachdem er den Kranken ausgiebig untersucht hatte, verlangte er nach Wermutwasser, Kupfervitriol, ungelöschtem Kalk und Schwefel. Das Gesinde rümpfte die Nase, aber Sigimund von Laurin sorgte dafür, dass der Medicus umgehend erhielt, wonach er verlangte.
Wein und Salz hatte der junge Gelehrte selbst mitgebracht; damit rieb er die Abszesse zunächst ein, um sie auszutrocknen und Hieronymus gleichzeitig Linderung zu verschaffen.
»Wessen Lehre wendet Ihr an?«, fragte Hieronymus mit fiebrigen Augen.
»Ich behandle Euch nach den vier Säften des Galenos«, erwiderte Stephan der Jüngere, woraufhin der Geistliche erleichtert seinen Kopf auf das Strohkissen senkte.
»Die Säfte des Galenos«, sagte der Barbier, »was soll das sein? Der einzige Saft des Lebens ist Blut, und er wird mit Aderlass reguliert.«
Die Behandlung von Stephan dem Jüngeren schlug an, der junge Medicus verließ das Haus Laurin, und Vater Hieronymus nahm seinen Unterricht wieder auf. Wobei die Lehre auf den Horizont eines Geistlichen beschränkt blieb, nämlich auf Latein und das Vermögen, die Bibel zu verstehen und Teile von ihr zu rezitieren.
Hieronymus empfand zwar Dank gegenüber dem Medicus, aber insgeheim war er von der Gnade des Allmächtigen überzeugt, der sich von den Gebeten des Geistlichen hatte erweichen lassen. Gleichzeitig war Hieronymus nicht so blauäugig anzunehmen, der Schöpfer habe ihm zu Ehren seinen Weltenplan geändert. Also sollte er Gottes Werkzeug sein, nur darin konnte der Sinn seiner Genesung liegen.





























