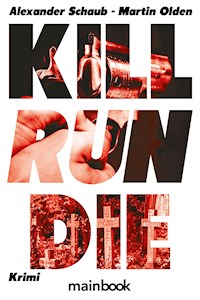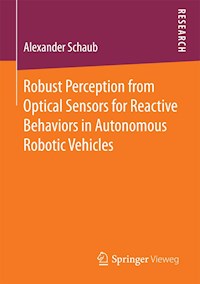Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ismael
- Sprache: Deutsch
Ein verschwundener Ehemann. Drei zerstückelte Leichen. Die Jagd auf einen Serienkiller. Doch diesmal ist alles anders. Ein zweiter Gegner, der über weitreichende Verbindungen verfügt, betritt den Spielplan. Der Frankfurter Privatdetektiv Martini und seine Freunde stoßen auf eine Gefahr, die globale Ausmaße annehmen könnte. Ihr Widersacher bedroht die gesamte Welt. Ein Wettlauf gegen eine übermächtige, antagonistische Macht beginnt. Alexander Schaub greift in seinem neuen Krimi ein aktuelles Thema auf und entwickelt aus Realität und Fiktion eine fesselnde Geschichte, die Leserinnen und Leser in ihren Bann zieht. Weitere Krimis von Alexander Schaub bei mainbook: "Der Engelmacher von Frankfurt", "Der Schatten des Engelmachers", "Die Rache des Engelmachers" und "Kill Run Die" (als Autorenduo gemeinsam mit Martin Olden).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Schaub
Ismaels Erwachen
Krimi
eISBN 978-3-948987-52-7
Copyright © 2022 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Olaf Tischer
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Das Buch
Ein harmloser Fall. Thomas Martini soll einen verschwundenen Ehemann ausfindig machen.
Noch bevor der Frankfurter Detektiv mit den Ermittlungen beginnt, legt er den Fall zu den Akten und stellt die Nachforschungen ein, denn der Auftrag ist ihm zu gefährlich. Das erste Mal in seiner Laufbahn als Detektiv.
Er übernimmt einen anderen Fall: Ehemann betrügt anscheinend seine Ehefrau.
Als er den vermeintlich untreuen Mann beschattet, stößt er auf eine Verschwörung, deren Ausmaße er sich nie hätte träumen lassen und bringt sich dabei in Lebensgefahr.
Im Hintergrund ziehen mächtige Männer die Fäden. Die Kugeln, die Martini und seinen Freunden um die Ohren fliegen, sind nichts im Vergleich zu dem, was ihre Widersacher noch in petto haben: eine globale Bedrohung von ungeahntem Ausmaß, die mit nichts zu vergleichen ist, was Martini bisher begegnet ist.
Alte, fast vergessene Freunde, müssen dem Detektiv zur Seite stehen und, gegen all seine Überzeugung, muss Martini einem Fremden vertrauen …
Der Autor
Der gebürtige Frankfurter Alexander Schaub erblickte 1969 das Licht der Welt. Bis 2014 lebte er in der Mainmetropole. Im April 2014 zog er mit seiner Traumfrau Corinna nach Hattersheim.
Über sein Schreiben sagt er: „Ich liebe Serien mit einem roten Faden und so soll es auch mit meinen Büchern werden. Die Charakterentwicklung meiner Protagonisten ist mir enorm wichtig.“
Nach der „Engelmacher“-Trilogie „Der Engelmacher von Frankfurt“, „Der Schatten des Engelmachers“ und „Die Rache des Engelmachers“ (erschienen bei mainbook) und dem Frankfurt-Krimi „Kill Run Die“ (im Duo mit Martin Olden) erscheint nun sein neuer Krimi „Ismaels Erwachen“.
Mehr Informationen über den Autor sowie anstehende Lesungen finden Sie unter: www.alexander-schaub.de
Für alle, die noch da sind.Für alle, die mit ihnen ausgeharrt haben.Für alle, die schon gehen mussten.
Inhalt
Einleitung
Teil 1 Ismael
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Teil 2 Zumtobel
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil 3 Cowidas
Kapitel 10
Kapitel 11
Zwischenspiel
Teil 4 Erwachen
Kapitel 12
Kapitel 13
Nachwort
Einleitung
Nennt mich Ismael. Nein, ihr habt nicht Moby Dick aus dem Bücherregal gezogen. Ich teile mir nur zufällig denselben Namen mit Hermann Melvilles Hauptprotagonisten. Euch wird schnell auffallen, dass meine Geschichte sich von der des anderen Ismaels unterscheidet. Ich lebe in der Gegenwart, eurer Gegenwart.
Bleiben wir kurz bei Moby Dick. Müsste ich eine Person wählen, der ich nacheifere, wäre dies Ahab. Ich jage ebenfalls einen weißen Wal: das Ewige Leben.
Was ist das denn für ein Verrückter, werdet ihr jetzt denken. Aber bevor ihr ein Urteil über mich fällt, hört euch erst an, was ich zu erzählen habe.
Ich bin nicht der Erste, der nach Unsterblichkeit strebt. Nehmen wir Dorian Gray. Er wollte die ewige Jugend. Aber im Prinzip dreht sich seine ganze Geschichte und sein Leben um Neid, Eifersucht, Rache, Eitelkeit, schlicht das, was man das Böse nennt. Ein guter Christ würde es mit einem Wort auf den Punkt bringen: Todsünden. Er verkaufte seine Seele, damit sein Bildnis für ihn alterte und hässlich wurde. Dafür blieb er jung. Dieser Pakt währte so lange, bis er seinen eigenen Anblick, das, was aus ihm geworden wäre, nicht mehr ertragen konnte. Eine schauerliche Monstrosität glotze ihn von der Leinwand herab an. Seid euch gewiss, dies wird mir nicht widerfahren.
Zu Recht werdet ihr sagen, Dorian Gray ist nur eine Romanfigur, nicht real. Das stimmt, aber er ist ein gutes Beispiel, um mich davor zu bewahren, eine Ausgeburt der Hölle zu werden.
Lasst euch in meine Welt entführen. Erlebt alles aus meiner Sicht. Ich gewähre euch einen tiefen Blick in meine Seele. Entscheidet am Ende, ob ich der Wahnsinnige oder das Genie bin, gar ein Held.
Aber wie ihr vielleicht wisst, haben einige Helden eine traurige Vorgeschichte, bevor sie zu solchen wurden. Diese ist die meinige …
Teil 1Ismael
Kapitel 1
Ismaels Erzählung, irgendwann, irgendwo …
Ich saß neben ihrem Bett. Doch ich wäre lieber am anderen Ende der Welt gewesen, als diesen Anblick ertragen zu müssen. Jede verdammte Sekunde, die verstrich, war für mich ein Kampf gegen die Tränen, ein Kampf gegen das Unausweichliche, welches ich nicht abwenden konnte. Mein Herz wog unendlich schwer, wie ich sie da liegen sah. Dünn, abgemagert, ausgezehrt. Die Krankheit hatte ihr alles Menschliche entrissen, sie zu einem Schatten ihrer selbst werden lassen. Und das Schlimmste war: Ich hätte es verhindern können.
Kleine Schweißtropfen standen auf ihrer Stirn. Liebevoll tupfte ich sie mit einem Tuch ab. Eines der wenigen Dinge, die ich noch für sie tun konnte. Sie öffnete die tiefliegenden Augen, die jeden Glanz verloren hatten. Das Feuer der Leidenschaft, das immer darin gebrannt hatte, war erloschen. Feucht und fiebrig blickten sie mich an. Sie hob unter größter Anstrengung die Hand und legte sie auf die meinen. „Sei nicht traurig“, flüsterte sie. „Ich gehe in eine bessere Welt. Und in ein paar Jahrzehnten darfst du mir folgen.“
Ich schluckte schwer, damit ich nicht in Tränen ausbrach. Sie war so tapfer. Trotz der starken Schmerzen spendete sie mir Trost oder versuchte es zumindest. Mit der linken Hand wischte ich mir über die Augen. Die Tränen waren jetzt nicht mehr zurückzuhalten. „Ich liebe dich so sehr“, schluchzte ich zwischen zwei Atemzügen. „Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Weißt du das?“ Sie legte die Hand auf meine Wange, so wie sie es getan hatte, kurz nachdem meine Eltern gestorben waren. Jetzt öffneten sich alle Schleusen. Ich weinte wie ein kleines Kind. „Du wirst wieder gesund.“ Meine Stimme war zu einem leisen Wimmern geworden. „Ich brauche dich doch in meinem Leben.“ Ich war so verzweifelt wie nie zuvor. „Verlass mich nicht!“
Jetzt weinte sie mit mir. Ob aus Mitleid oder wegen sich selbst, wusste ich nicht. So versuchten wir, uns gegenseitig Trost zu spenden, vergeblich.
Ich strich ihr zärtlich über die Stirn und streichelte ihren Kopf, die wilde Mähne war strähnig und verklebt. Warum passierte das ausgerechnet ihr? Wieder brannten Tränen in meinen Augen und bahnten sich ihren Weg. Von meinem Kinn tropften sie auf unsere gefalteten Hände, als wollten sie sie für immer miteinander verbinden.
Dann, plötzlich und ohne jede Vorwarnung, erschlaffte ihre Hand, löste sich langsam von der meinen und rutschte an meinem Arm entlang auf die zerknäulte Bettdecke. Ihre Augen blickten mich immer noch an. Die Augen, in die ich mich damals verliebt hatte, als sie mich das erste Mal angelächelt hatten. Der Geist hatte die sterbliche Hülle verlassen.
Ich nahm ihre Hand und presste sie unter lautem Weinen und Schluchzen gegen meine Wange. Sie war jetzt leblos, aber es war noch sie, die Liebe meines Lebens, die ich für immer verloren hatte.
Dann fiel mir auf, dass ihr Herz noch schlug und sie ganz flach atmete. Ich rief einen Arzt, der sich sofort um sie kümmerte.
Eine halbe Stunde später stand fest: Sie lag im Koma.
Donnerstag, 22. Januar 2015, 23:45, Offenbach - Stadthalle
„… Zugabe, Zugabe, Zugabe …“ Markus Gräger schrie sich die Seele aus dem Leib, so wie die anderen viertausend Fans in der Offenbacher Stadthalle.
„Die könne ruisch noch eins spiele“, brüllte sein Nebenmann.
„Auf jeden Fall.“ Gräger nickte heftig.
Die Heavy Metal-Band, deren Konzert er heute miterlebt hatte, war bereits zweimal zurück auf die Bühne gekommen. Ein drittes Mal wäre der Wahnsinn. Gräger blickte kurz auf die Uhr: dreiundzwanzig Uhr dreißig. Dreieinhalb Stunden. Eine erstaunliche Leistung heutzutage. Andere Bands spielten nur siebzig Minuten und verschwanden endgültig nach einer Zugabe von nur einem oder zwei Liedern. Heute hatte er vier Songs pro Zugabe gehört.
Nach einer weiteren Minute flammte das Licht an der Hallendecke auf. Die Show war endgültig vorbei. Schade, dachte Gräger. Aber er konnte zufrieden sein.
Die Zuschauer verließen langsam den Saal. Die Ordner hatten die Türen geöffnet, um kein Gedränge entstehen zu lassen. Gräger stand etwa in der Mitte der Bühne und wartete. Sollten sich die anderen hinausschieben. In zehn Minuten würde er ganz gemächlich und ohne Hast die Halle verlassen können. So hielt es der vierunddreißigjährige Frankfurter schon immer. Die Taktik hatte sich bewährt, warum ändern?
Und ja, seine Vorahnung bewahrheitete sich. Um dreiundzwanzig Uhr fünfundvierzig schlenderte er hinaus in die frostige Nachtluft. Beim Verlassen der Halle zog er den Kopf ein, obgleich der Türrahmen hoch genug war. Eine Reflexreaktion. Mit seinen ein Meter neunundneunzig hatte er sich mehr als einmal den Kopf angeschlagen. Seine blonden Haare streiften so gut wie immer den oberen Holm der Tür. Ein Freund hatte mal gesagt, er könne ihn jede Woche besuchen, um die hohen Regale abzustauben, an die er nicht herankomme.
Gräger lief zur Ampel, um die Waldstraße zu überqueren. Dann ging er nach rechts bis zur Tankstelle an der Ecke, um links in die Neusalzer Straße einzubiegen. Sein Auto stand weit weg. Das Konzert war ausverkauft gewesen und alle Parkmöglichkeiten der Umgebung erschöpft. Er hatte das Auto im angrenzenden Wohngebiet abstellen müssen. Die Neusalzer Straße war lang, zog sich hinauf bis zur Dietzenbacher Straße. Sein Wagen stand kurz hinter den Schrebergärten unter Bäumen.
Anfangs liefen noch andere Metal-Fans mit ihm die Straße entlang, allerdings hatten die anderen näher geparkt oder in einer der zahlreichen Seitenstraßen. Als er an dem Hochhaus, das sich linker Hand erhob, ankam, war er alleine. In den angrenzenden Wohnblocks waren nur noch vereinzelte Fenster erleuchtet. Die meisten Menschen schliefen bereits. Ich würde jetzt auch am liebsten in mein Bett fallen und fertig, dachte Gräger. Aber er musste noch zurück ins Frankfurter Nordend fahren.
Er war froh, als er endlich seinen alten Golf erblickte. Die Kälte der Nacht fraß sich langsam durch seine dünne Kutte und ließ ihn frösteln. Er schloss die Fahrertür auf und stieg ein. „Kalt“, flüsterte er vor sich hin und blies sich warme Luft in die Hände. Gräger startete den Motor und schaltete das Gebläse auf höchste Stufe, damit die Scheiben nicht von innen vereisten.
Den Kopf gegen die Kopfstütze gelehnt, wartete er. Die Scheiben waren bereits beschlagen, und einen Blindflug bei Nacht hielt er für eine schlechte Idee.
In dem Moment spürte er etwas Kaltes an seiner Kehle. Er wollte nach vorne zucken, aber die zischende Stimme hinter ihm hielt ihn davon ab: „Nicht bewegen. Das Messer an Ihrem Hals ist sehr scharf.“
„Was wollen Sie?“, stieß Gräger in höchster Erregung hervor. Die Müdigkeit war vergessen. „Geld? Können Sie haben.“
„Nein. Ich möchte eine kleine Spritztour machen.“
„Kein Problem. Ich fahr Sie …, wohin Sie wollen.“ Panik stieg in Gräger auf und drohte, ihm den Hals zuzuschnüren.
„Fahren Sie los. Sie sehen genug.“
„Wohin?“
„Nach Frankfurt.“
„Wo genau, damit ich …?“
„Ich leite Sie.“
Gräger hatte irgendwo gelesen, dass man einem Entführer seinen Namen sagen sollte und von der Familie erzählen, um ihm klarzumachen, dass man ein Mensch war und kein Objekt. „Mein Name ist Markus Gräger, ich wohne in Frankfurt mit meiner Frau Sophie. Wie ist Ihr Name?“
Gräger hörte ein leises Lachen von der Rückbank. „Nennen Sie mich Ismael …“
Freitag, 23. Januar, 01:22, Irgendwo …
Markus Gräger erwachte auf einer Liege. Der Kopf schmerzte. Was war geschehen? Er war entführt worden. Sein Entführer hatte ihn durch Frankfurt gelotst, hin und her. So lange, bis er völlig verwirrt war und nicht mehr wusste oder erahnen konnte, was das Ziel sein würde oder könnte. Wo hatten sie angehalten? Er wusste es nicht mehr. Da war Wasser … der Main?
Er war sich nicht sicher. Warum?
Ja. Der Schlag auf den Kopf. Daher rührten auch die Kopfschmerzen. Der Mann hatte ihn niedergeschlagen. Gräger wollte die Hand heben, um die Beule, die er am Hinterkopf fühlen konnte, zu betasten. Aber seine Hände steckten in Lederschlingen, die jede Bewegung unmöglich machten.
Was sollte das?
Was war hier los?
Er zerrte an den Schlingen. Nichts. Er wollte die Beine bewegen. Sie waren ebenfalls gefesselt. Oh Gott. Was ging hier vor? Was wollte dieser … wie hatte er sich genannt … Ismael von ihm?
Gräger sah sich jetzt zum ersten Mal um. Was war das für ein Raum? Geflieste Wände, Schränke an fast allen Seiten. Große Geräte, die ihn an einen Operationssaal erinnerten. Mehrere Computer mit Tastaturen, Mäusen, Monitoren und Apparaten, von denen er nicht wusste, welchen Zweck sie erfüllen sollten. Und als letztes fiel sein Blick auf eine Bohrmaschine mit einem gefährlich scharf aussehenden Bohrer.
Ismaels Erzählung, 23. Januar, 01:31, Irgendwo …
Auf dem Überwachungsmonitor konnte ich sehen, dass die Testperson erwacht war. Er blickte sich um und fragte sich nun, wo er war. Sollte ich ihn aufklären? Ihm erläutern, wo er sich befand?
Ich entschied mich dagegen, denn es war Zeit zu beginnen.
Als ich den Untersuchungsraum betrat, wurde ich als Erstes des beißenden Geruchs gewahr. Angst. Sie roch immer ein wenig anders, aber unverkennbar. Jeder Mensch sonderte sie ab. Ich kannte dies aus meiner beruflichen Praxis. Dieser Proband unterschied sich nicht von seinen Vorgängern.
„Sie sind wach“, begrüßte ich ihn. „Wie fühlen Sie sich?“
Als er mich erblickte, riss er die Augen auf wie ein verängstigtes Tier. „Was wollen Sie von mir?“ Er spuckte vor Aufregung.
„Ich will Ihnen helfen. Sie sollen ein besserer Mensch werden. Allen anderen überlegen.“ Ich lächelte ihn beruhigend an. Aber es hatte den gegenteiligen Effekt.
„Sie sind ja verrückt! Hilfe! Hilfe! Hilfe!“ Der Proband schrie laut. Es hallte von den Wänden wider und schmerzte mein empfindliches Gehör.
Ich griff ein Skalpell von einem der Beistelltische und näherte mich dem Operationstisch. Er schrie immer noch. „Wenn Sie nicht sofort schweigen, werde ich Ihnen die Stimmbänder durchtrennen.“
Seine Augen weiteten sich noch mehr, wenn dies überhaupt möglich war, und der Geruch nach Angst verstärkte sich um eine weitere Komponente. Urin. Er hatte eingenässt. Meine Drohung hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. „So ist es viel angenehmer.“ Ich lächelte ihn wieder an. Für einen kurzen Moment schien es, als wollten seine Augen aus den Höhlen fallen, so sehr hatte er seine Lider aufgerissen. Ein interessanter Effekt, den ich so noch nie gesehen hatte.
„Was wollen Sie von mir?“ Es klang weinerlich, und seine Tränendrüsen begannen Sekret abzusondern. Das ging wirklich schnell. Erstaunlich.
„Ich werde nur ein paar kleine Eingriffe an Ihnen vornehmen. Dann können Sie wieder gehen.“ Erneut lächelte ich ihn unverbindlich an. Wieder versuchte ich, den Probanden zu beruhigen. Es wirkte nicht. Daran musste ich dringend arbeiten.
„Sie sind ja völlig wahnsinnig. Ich bin gesund. Ich brauche keine Eingriffe.“ Er holte Luft. „Machen Sie mich sofort los!“, schrie er erneut.
„Sie strapazieren mein Gehör. Aufs Neue. Muss das sein? Keiner kann Sie hier hören. Wir sind ganz und gar alleine.“ Ich legte die Hand mit dem Skalpell auf seinen Hals. „Wollen Sie wirklich für immer verstummen?“
Wieder dieses übernatürliche Weiten der Augen. Er schüttelte den Kopf, ohne ein Wort zu sagen. „Vielen Dank.“
Ich legte das Skalpell weg und öffnete den Kleiderschrank an der rechten Seite des Raums, entnahm eine Schürze und den Sichtschutz, der meine Augen vor Splittern bewahren sollte.
Für einen Moment überlegte ich, ob ich ihn betäuben sollte, um mir erneute laute Geräusche zu ersparen. Entschied mich aber dagegen. Ich würde ihn teilweise betäuben, doch er musste wach bleiben. Ich musste sehen, ob meine Eingriffe den gewünschten Effekt erzielten.
In die Kopfhaut spritzte ich ihm ein Sedativum. Nach einer Minute stach ich mit der Spitze der Nadel erneut in seine Kopfhaut. Keine Reaktion. Sehr gut.
Ich nahm den Bohrer und setzte ihn in der Höhe des Frontallappens an, das Persönlichkeitszentrum. Die Persönlichkeit war das Wichtigste, was einen Menschen ausmachte, hinzu kam das Sozialverhalten.
„Nein! Was machen Sie da?“, schrie der Proband wieder. Das war der Nachteil, wenn sie bei Bewusstsein bleiben mussten. In weiser Voraussicht hatte ich den Kopf meiner Testperson fixiert, ansonsten wäre vielleicht der Bohrer abgerutscht und hätte irreparable Schäden anrichten können. Ich beglückwünschte mich zu dieser Entscheidung. Probanden waren schwer zu finden.
Diesmal verkniff ich mir die Drohung mit dem Skalpell und ließ den Bohrer langsam anlaufen. Er war sehr scharf und erzeugte ein sauberes Loch im vorderen Bereich des Schädels. Groß genug für meine selbst entworfene Download-Sonde. Der Name war nicht griffig genug, da musste ich mir vor der Marktreife des Produkts etwas Besseres einfallen lassen. Ich führte die Spitze mit den Fühlern in das Loch, bis sie auf die Hirnmasse stießen.
Die Download-Sonde war mit einem Spezial-Computer verbunden, der, wenn alles richtig konfiguriert war, die elektrischen Hirnwellen auslesen und abspeichern konnte.
Ich war so aufgeregt. Würde es diesmal gelingen, die Impulse zu speichern und später in mein Mensch-Maschine-Programm einzuspielen?
Der Proband verhielt sich auffallend still. Die Situation hatte mich so in ihren Bann gezogen, dass ich die Versuchsperson nicht mehr beobachtete.
Ein Fehler.
Oh nein! Er hatte die Augen verdreht und atmete nicht mehr. Nein, nein, nein! Blut sickerte unter der Download-Sonde heraus. Ich Tölpel. Die Sonde war zu tief eingesunken. Ich zog sie heraus. Die Spitze war sehr schwer und ganz langsam immer tiefer in die Hirnmasse gesunken. Irreversible Verletzungen und der Tod des Probanden waren die Folge. Oder ein Herzinfarkt. Das wäre dann bereits der Zweite der Versuchsreihe.
Ich hatte erneut versagt. Der dritte Proband war mir unter den Händen verstorben. Die Entsorgung war nun das vordringliche Problem, aber da hatte ich meinen Weg gefunden. Um Frank Sinatra zu zitieren, I did it my way. Ich lächelte vor mich hin.
Und jetzt, wie hieß es so schön, nicht nach hinten blicken. Die Vergangenheit war vergangen. Nach der Entsorgung würde ich mir das nächste Versuchsobjekt besorgen. Trotz aller Ruhe, die mir bei der Arbeit innewohnte, stand ich unter Zeitdruck.
Ismaels Erzählung, 23. Januar, 08:29, Irgendwo …
Das Beseitigen der misslungenen Experimente war gefährlich, aber notwendig. Die Probanden entsorgte ich stets an derselben Stelle, am Rande Frankfurts.
Erst ließ ich die Körperflüssigkeiten ablaufen und verklappte sie in der Sickergrube hinter meiner Werkstatt. Sickergruben waren mittlerweile verboten, aber hier bekam das niemand mit. Den Rest zerlegte ich in kleine Teile, packte sie in reißfeste Müllsäcke und ließ sie verschwinden. Bisher war noch keines meiner Testobjekte wieder aufgetaucht. Sollte irgendwann jemand die Reste finden, was sehr unwahrscheinlich war, würde ich längst ein berühmter Mann sein und in höheren Sphären agieren. Dann würde niemand mehr nachfragen, wo ein paar Leichenteile herkamen.
Mein Zuhause lag ein kleines Stück außerhalb der Großstadt Frankfurt. Es war fast ein wenig dörflich. Hier grüßte jeder jeden und bei Feiern lud man sich gegenseitig ein. Eine wahre Idylle. Wie geschaffen für einen schwer arbeitenden Forscher wie mich.
Ich schloss die Wohnungstür leise. Auf der rechten Seite des gefliesten, länglichen Raums befand sich eine Garderobe. Ich schälte mich aus der alten Lederjacke und ließ sie in das betagte Möbelstück fallen. Ich war müde. Am Ende des Flurs folgte das Wohnzimmer. Geräumig, helle Farben und gemütlich eingerichtet mit einer Ledercouch, zwei passenden Sesseln, einer Ottomane und einer Essecke. Erschöpft ließ ich mich auf die Couch fallen.
„Guten Morgen, Schatz“, vernahm ich ihre Stimme.
Maria lag, so wie immer, auf der Ottomane, ihrem Lieblingsplatz, der mit der Rückenlehne zur Tür stand. Von hier aus konnte sie den ganzen Garten überblicken, das Herumtollen der Nachbarskinder und die Vögel in den Bäumen und Sträuchern beobachten. „Du bist schon wach?“
„Immer wenn du nachts arbeitest, warte ich auf dich. Das weißt du doch.“ Sie lächelte ihr offenes, warmes und betörendes Lächeln, in das ich mich vor so vielen Jahren verliebt hatte. Dabei strahlten ihre Augen so intensiv wie ein nächtliches Sternenmeer bei absoluter Finsternis. Eine Finsternis, die nur sie erhellen konnte.
„Ich liebe dich“, flüsterte ich ihr leise zu.
Sie quittierte es mit einem erneuten, noch intensiveren Lachen. „Ich dich auch, mein kleiner Bär.“ Mein Kosename, den sie mir in unserer ersten Nacht gegeben hatte. „Wie war die Arbeit? So wie du aussiehst, sehr anstrengend.“
Maria erkannte sofort, wie es mir ging. Als habe sie einen siebten Sinn, den sie ausschließlich für mein Wohlergehen entwickelt hatte. „Ja, sehr“, antwortete ich matt. „Wieder mal ein Todesfall. Es ist frustrierend, wenn man sich bemüht und der Patient einem unter den Händen wegstirbt.“
„Das tut mir leid, mein kleiner Bär“, erwiderte sie mitfühlend. Ihre Wärme tat mir gut, liebkoste meine Seele. Ich rappelte mich müde von der Couch hoch, ging zu ihr und küsste sie auf die Stirn. „Schlaf gut“, sagte sie. „Soll ich dich zu einer bestimmten Zeit wecken?“
„Nein, das musst du nicht. Ich arbeite morgen wieder lang, also freue ich mich über jede Minute Schlaf.“
„Das verstehe ich, mein kleiner Bär. Schlaf schön und hab süße Träume.“
Die würde ich bestimmt haben.
Kapitel 2
Dienstag, 27. Januar, 10:55, Hattersheim – Okriftel
Ein kratzendes Geräusch ließ mich aufwachen. Verdammt, was war das? Wieder das Kratzen. Oh Mann, kann man hier nicht mal in Ruhe ausschlafen, dachte ich enerviert. Ich hob meine müden Lider. Die Helligkeit, die durch die Schlitze des Rollladens fiel, blendete mich. Das Kratzen kam von draußen, vor dem Rollladen.
Aufstehen oder ignorieren? Eine schwierige Entscheidung, in Anbetracht meines müden Körpers. Ich hievte mich aus dem Bett, griff den Rollladengurt und zog daran. Langsam flutete Licht in den Raum. Das Kratzen wurde von einem „Miau“ ersetzt. Der Kater der Nachbarn saß vor unserer Terrassentür, die in unseren Garten führte. Vor ein paar Wochen hatte meine Verlobte Jasmina von Linde damit begonnen, ihn zu füttern. Anfangs kam der Kater nur zögerlich zu uns. Mittlerweile hielt er die Fütterung durch Jay für sein verbrieftes Recht.
Ich blickte den Störenfried an und machte: „Gzzzz, verschwinde du Unruhegeist! Von mir bekommst du nichts.“ Die Antwort war ein weiteres, diesmal herzzerreißendes „Miau!“ Dabei legte er den Kopf schief und sah mich aus seinen aufgerissenen großen Augen an. Eigentlich hasste ich Katzen – es gab da eine Vorgeschichte aus meiner Kindheit – aber so wie er mich jetzt ansah, war ich fast versucht, ihn ebenfalls zu füttern.
Die Schafzimmertür wurde geöffnet. Jay kam herein. „Was machst du hier?“, fragte ich halb schlafend, halb den Kater verfluchend.
„Echt jetzt? Haben wir bereits Alzheimer, Herr Martini? Wir sollten mal einen Test machen. Ich habe eine Woche Urlaub, so wie jeden Januar.“
Meine rechte Hand patschte gegen meine Stirn. „Ach ja. Und gestern warst du auch zu Hause.“
„Jetzt mach ich mir wirklich Sorgen. Alles klar?“
„Ja, die Katze hat mich geweckt, das hat schwere traumatische Schäden hinterlassen.“
Sie legte eine Hand an meine Stirn. „Fieber hast du keins, oder?!?“
Ich nahm ihre Hand, küsste sie und zog sie an mich. Mit einem Meter neunundfünfzig war sie siebenunddreißig Zentimeter kleiner als ich. Um sie zu küssen, musste ich mich immer weit hinab beugen. Eine lange rotblonde Strähne kitzelte meine Nase. Ich blies sie weg, griff Jay an der Hüfte und stellte sie auf die Bettkante. Jetzt stand sie ein paar Zentimeter über mir. Besser zum Küssen.
Jay strich mir durch meine schwarze krause Mähne, in die sich die ersten grauen Strähnen einschlichen. „Du hast Glück“, sagte sie und ließ ihre Hände über meine Wangen gleiten, „dass ich auf ältere Männer stehe.“ Sie streichelte meine Schultern.
„Du bist ganz schön frech für dein Alter“, antwortete ich und küsste sie.
„Finden Sie, Herr Martini? Immerhin bin ich satte sieben Jahre jünger als Sie.“ Sie erwiderte meinen Kuss.
Ich zog ihr die Beine weg, warf sie auf das Bett, beugte mich über sie, und wir küssten uns leidenschaftlich.
In dem Moment kratzte die Katze wieder. Diesmal an der Scheibe. Ich bekam Gänsehaut. Die Stimmung, in der wir uns eben noch befunden hatten, war dahin. Am liebsten hätte ich das Vieh mit meiner Glock erschossen. Jay wand sich unter mir hervor. „Erst die Arbeit.“ Sie deutete auf den Kater. „Dann das Vergnügen.“ Ihr Finger zeigte auf meinen Schritt. Ich musste laut lachen.
Jay öffnete die Terrassentür und ließ die Katze herein. Als sie an mir vorbei trippelte, hatte ich das Gefühl, als würde sie mich überlegen angrinsen: ‚Hab gewonnen‘, schien sie zu denken. Wo war meine Waffe, wenn ich sie brauchte?
Ich schleppte mich ins Bad, erledigte das Nötigste und ging in mein Arbeitszimmer. Jay war immer noch mit der Katze zugange. Der Anrufbeantworter blinkte. Ein neuer Anruf. Gestern Abend war er noch nicht da gewesen. Ich nahm mein Mobilteil und hörte den Anruf ab.
„Hallo Herr Martini. Ich brauche dringend Ihre Hilfe! Mein Schwiegersohn ist verschwunden, und die Polizei gibt sich keine Mühe, ihn zu finden. Können Sie mich bitte zurückrufen unter …“ Es folgte die Telefonnummer des Anrufers. In der Aufregung hatte der Mann vergessen, seinen Namen zu nennen. Ich schrieb die Nummer auf meine Schreibtischunterlage. Heute Mittag würde ich ihn anrufen. Jetzt musste ich ein Hühnchen mit meiner Verlobten rupfen, die Katzen mir vorzog …
Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, was auf mich zukommt, ich hätte den Anruf versehentlich gelöscht.
27. Januar, 14:22, Hattersheim – Okriftel
Nach dem zehnten Klingeln legte ich auf.
Eine halbe Stunde später versuchte ich es ein weiteres Mal. Diesmal wurde abgehoben. Eine Frauenstimme mit Wiener Akzent meldete sich: „Praxis Professor Doktor Renz, mein Name ist Marschall, was kann ich für Sie tun?“,
Eine Arztpraxis?
„Guten Tag, Frau Marschall, mein Name ist Thomas Martini. Herr Renz hat mich kontaktiert und wollte mich sprechen. Könnten Sie mich bitte zu ihm durchstellen?“
„Der Herr Professor behandelt gerade. Ich werde ihm ausrichten, dass Sie sich gemeldet haben.“ Ein Hauch Arroganz in ihrer Stimme war unverkennbar.
„Es scheint dringend zu sein. Herr Renz hat mich gestern Nacht angerufen.“
„Der Herr Professor wird sich zu gegebener Zeit bei Ihnen melden. Danke für Ihren Anruf.“ Es klickte im Hörer. Sie hatte einfach aufgelegt. Was war das denn für eine?
Ich ignorierte meinen aufsteigenden Ärger und stürzte mich in die Schreibarbeit. Berichte tippen, Beweise auswerten und Klienten-Akten pflegen. Das Leben eines Privatdetektivs konnte sehr eintönig sein. Ich hasste die Büroarbeit. Und es war schlicht und ergreifend zu viel Arbeit für eine Person.
Seit dem sogenannten ‚Engelmacher‘-Fall rannten mir die Kunden die Tür ein. Deshalb trug ich mich bereits mehr als ein Jahr mit dem Gedanken, einen zweiten Mann einzustellen, aber ich hatte mich immer noch nicht dafür oder dagegen entschieden. Um es in Jays Fachjargon zu sagen, ich war in dieser Frage ambivalent.
Ja, meine Verlobte war eine Seelenklempnerin mit eigener Praxis an der Alten Oper, die sie sich mit zwei Kolleginnen teilte. Vor einem Jahr hatten sie Eröffnung gefeiert, das Geschäft florierte. An Verrückten herrschte kein Mangel, wie ich es zu formulieren pflegte. Jay mochte den Ausdruck Verrückte nicht. Für sie waren es Menschen mit Problemen. Was zumindest politisch korrekt klang.
Das Telefon riss mich aus meinen Betrachtungen der Lage im Hause Martini / von Linde. Ich nahm das Gespräch an: „Martini, private Ermittlungen und Personenschutz.“
„Guten Tag, Herr Martini, hier spricht Renz. Sie waren so freundlich, sich bei mir zu melden. Danke dafür.“
Der Herr Professor klang fahrig. Ich sah Jerry Lewis als der verrückte Professor vor mir. „Frau Marschall scheint das anders zu sehen.“
„Nein, nein, sie ist etwas speziell, aber die beste Sprechstundenhilfe, die ich je hatte. In Österreich zählt der akademische Titel und Titel im Allgemeinen sehr viel. Deshalb ist Sie auf den Herrn Professor erpicht. Das ist nichts Persönliches. Macht Sie bei jedem Patienten.“
Renz begann, langsamer zu sprechen. Das Reden über ein ihm vertrautes Thema hatte ihn ruhiger werden lassen. „In Ordnung. Wie kann ich Ihnen helfen?“
„Mein Schwiegersohn, Markus Gräger, ist verschwunden. Die Polizei scheint kein Interesse zu haben, ihn zu finden. Meine Tochter ist verzweifelt. Eine Tragödie. Wann können wir uns treffen?“, preschte er hektisch hervor. Die Ablenkung hatte ihn nur für ein paar Sekunden runtergeholt.
„Ich kann heute Nachmittag zu Ihnen kommen. Wann ist Ihre Sprechstunde zu Ende?“
„Um sechzehn Uhr dreißig. Adickesallee 51-53, gegenüber dem Polizeipräsidium.“
Vertrautes Terrain. „In Ordnung. Aber ich würde mich auch gerne mit Ihrer Tochter unterhalten.“
„Meine Tochter und ihr Mann wohnen in der Falkensteiner Straße, um die Ecke.“
Sehr gut. „Ich bin dann um halb fünf bei Ihnen.“
„Danke. Auf Wiederhören.“ Renz legte auf.
Stinknormaler Fall, mutmaßte ich. Der Schwiegersohn war abgehauen oder bei einer anderen, weil er sich neu verliebt hatte oder was in der Art. Das würde eine entspannte Sache werden.
27. Januar, 15:01, Frankfurt – Sachsenhausen
Kriminalhauptkommissarin Andrea Lamprecht starrte aus der Seitenscheibe des Octavia. Ihr Kollege Kriminalhauptkommissar Stefan Carstens saß am Steuer. Ich bin in einem Albtraum gefangen, dachte die Kommissarin, eine nie enden wollende Zeitschleife. Alle paar Jahre muss ich zu diesem Ort zurückkehren. Immer und immer wieder.
Sie beobachtete ihr Gesicht in dem reflektierenden Glas. Die blonden Haare waren noch kürzer als sonst, fast ein militärischer Borstenschnitt. Ihre Züge waren hart geworden. Ihr Kollege hatte es einmal verhärmt genannt. Ja, von Leid gezeichnet, das war sie seit … Sie rieb sich über die grünen Katzenaugen, um die Gedanken an damals loszuwerden. Vergeblich.
Ihr toter Freund am Boden. Ein Loch im Kopf. Sie über ihm, weinend, schreiend, verzweifelt. Kollegen und Freunde, die sie mit Gewalt von seiner Leiche wegziehen. Einem Polizisten boxt sie ins Gesicht …
Es war in Sachsenhausen passiert. Ein, zwei Kilometer Luftlinie von hier entfernt, dem Ort, der schon mehrere Male Dreh- und Angelpunkt von polizeilichen Ermittlungen geworden war, dem Monte Scherbelino. Hier hatte 2010 eine Mordserie begonnen, die ihr sowie ihren Kollegen und Freunden alles abverlangt hatte. Hier war ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass sie auf etwas Großes zusteuerten. Fast drei Jahre hatte es gedauert, den ‚Engelmacher‘ dingfest zu machen.
Was würden sie heute vorfinden?
„Hey, was ist los?“ Carstens blickte zu ihr herüber.
„Nichts.“
„Dieses Nichts kenn ich“, erwiderte er. „Sag schon. Was ist?“
„Ach …“, Lamprecht winkte ab. „Ich musste an damals denken …“
Auf Carstens Stirn, unterhalb der blonden Mähne, entstand eine steile Falte. „Zum Glück ist der Engelmacher aus dem Verkehr gezogen.“ Carstens sprach nicht gerne über den Fall. Auch er hatte einen Freund verloren.
Carstens bog von der Babenhäuser Landstraße auf den asphaltierten Waldweg zu der ehemaligen Mülldeponie. Was faszinierte Killer an diesem Ort? Der Monte, wie er im allgemeinen Frankfurter Sprachgebrauch genannt wurde, war 1989 über Nacht geschlossen worden. Da man herausgefunden hatte, dass giftige Gase aus dem Erdreich austraten. Davor war er erst eine Mülldeponie und danach eine begrünte Oase für Familien und Wochenendausflügler gewesen. Seit Ende der Neunziger Jahre wurde der Berg versiegelt und abgesichert, um ihn eines Tages der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Vage Pläne sprachen von 2020 oder 2021. Zukunftsmusik, jedoch nicht die Leiche, die heute aufgetaucht war. Sie war real.
„Mal sehen, wie viele das sind“, gab Carstens seine Gedanken zum Besten.
„Bitte? Was meinst du?“ Lamprecht konnte ihrem Kollegen nicht folgen.
„Na ja, der Franz vom Kriminal-Dauer-Dienst hat was von mehreren Säcken erzählt. Also handelt es sich wohl nicht nur um eine Person. Außer unser Killer hat sortenrein getrennt entsorgt“, feixte er.
Lamprecht knurrte vor sich hin. „Dein Ernst?“
„Ich kann nur wiedergeben, was mir gesagt …“
„Ich mein deinen miesen Humor“, unterbrach sie ihn.
Carstens atmete hörbar ein und aus. Er wusste, was in seiner Kollegin vorging. Sie war eine der besten Polizistinnen, die er kannte. Alles wurde von ihr erledigt und jeder Täter eingesperrt, ohne Wenn und Aber. Doch vor dem Überbringen einer Todesnachricht eines geliebten Menschen scheute sie sich. Die Aussicht, mehrere Leichen gleichzeitig zu finden und somit nicht nur einen Angehörigen besuchen zu müssen, brachte sie schier um den Verstand. Deshalb hatte Carstens schon vor langer Zeit diese Aufgabe in ihrem Team übernommen. Sein schwarzer Humor war die Fassade, hinter der er sich verbarg, wenn es um den Tod ging. Mittlerweile bekam er eine andere Sicht auf die Dinge, seit er mit seiner Freundin Silvia Veith zusammengezogen war.
Carstens bremste. Der Wagen stand auf dem Platz, der normalerweise von LKWs benutzt wurde. „Wo sind die alle? Sind wir die Ersten?“ Die Umgebung wirkte leer und verlassen.
Lamprecht stieg aus, lehnte den linken Ellenbogen auf das Wagendach und sah sich um. Sie waren richtig. Es gab nur einen Monte Scherbelino in Frankfurt. In diesem Moment entdeckte sie das Auto. Es stand halb verdeckt hinter Bäumen, die um den Cola-See herumstanden. Sie stieg wieder ein. „Da vorn.“ Die Kommissarin wies in die Richtung des Gewässers. Carstens nickte und fuhr los. Sie folgten dem ehemaligen Wanderweg, der sie an den Weiher brachte. Offiziell hieß er Scherbelinoweiher, wurde aber Cola-See genannt, wegen seiner braunen undurchdringlichen Farbe. Müll und Giftstoffe hatten ihm sein Aussehen verliehen. Kein Fisch war in der dunklen Brühe zu sehen, aber das sollte sich nach der Wiedereröffnung ändern. Soweit die Theorie.
Als sie näher heran kamen, sahen sie weitere Fahrzeuge, die Taucherstaffel, einen Streifenwagen, Spurensicherung, Pathologie sowie ein Auto der Stadt mit Anhänger und Ruderboot.
Am Ufer des Weihers lagen fünf Müllsäcke.
„Die Hauptakteure des Tages“, ließ Carstens verlauten.
Lamprecht verengte die Augen zu schmalen Schlitzen, aber enthielt sich jeden Kommentars. „Komm!“, forderte sie ihren Kollegen auf. Die Kommissarin steuerte auf Johann Berger, den Pathologen, zu. Der mittelgroße Mann kniete neben einem der Säcke. „Guten Tag, Joe.“, begrüßte sie ihn.
„Ob der gut wird, wissen wir noch nicht. Schauen wir erst mal, was der Weihnachtsmann beim Überfliegen des Sees verloren hat.“ Er nahm ein Skalpell aus seiner Tasche, die neben ihm stand, und schnitt in den Kunststoff. Das Behältnis war relativ klein. „Viel kann da nicht drin sein. Höchstens ein …“ Er unterbrach sich, bückte sich ein wenig weiter hinunter, um mit den behandschuhten Händen etwas Rundes herauszuziehen. „Ein Kopf. Wie ich vermutet habe.“
Hinter ihnen erklang ein Geräusch, das sie alle kannten: „Urrrggg.“ Ein junger Streifenpolizist stand vor einem Gebüsch und übergab sich.
„Hey! Du Hirni!“, hörte Lamprecht eine erboste Stimme rufen. „Du kontaminierst den Tatort! Geh gefälligst auf die andere Seite vom Weg!“ Reiner Meister, Chef der Spurensicherung, kam mit stampfenden Schritten zu ihnen. „Bescheuerter Frischling“, knurrte er vor sich hin. „Hi Andrea, hi Stefan“, sagte er flüchtig im Vorbeigehen. Er sprach mit dem Streifenführer, einem alten Hasen, Polizeihauptmeister Richter. Lamprecht kannte ihn seit 2010 und den unsäglichen ‚Engelmacher‘-Morden. Richter hatte eine ruhige Art, die Meister sofort runter brachte.
Jetzt wandten sie sich alle wieder dem Kopf zu. Das Gesicht eines Mannes glotzte sie aus toten Augen an. „Lang kann er noch nicht hier drin liegen. Drei, vier Tage“, grübelte Joe beim Betrachten seines Fundes.
Einer der beiden Taucher kam zurück an die Oberfläche und schwamm zum Ufer. Im Schlepptau einen weiteren Beutel. Das ist bestimmt kein illegal entsorgter Müll, dachte die Kommissarin. Wie viele Säcke werden wir noch finden?
Joe war aufgestanden. Der Kopf lag auf einer Plane. „Ein Mann. Mitte, Ende dreißig, helle Hautfarbe, dunkle Haare und er hat ein sauber gebohrtes Loch im Kopf.“
„Wie bitte?“ Carstens sah den Pathologen prüfend an.
Joe hob den Kopf hoch, drehte ihn und deutete auf das Loch. „Hier. Ganz sauber. Keine ausgebrochenen Ränder, keine Risse, soweit ich das sehen kann. Und nicht sehr groß. Da hat sich einer viel Mühe gegeben.“
„Ein Arzt?“, fragte Lamprecht.
„Wäre möglich. Aber der hätte das Loch wieder verschlossen, oder?“
„Ja, natürlich. Also jemand, dem eine Infektion egal war.“
„Oder eine schiefgelaufene illegale Operation in einem Hinterzimmer“, warf Carstens ein.
Joe legte den Kopf zurück auf den Boden. Verschränkte seine Pianistenhände über dem Bauchansatz, der ihm sein gemütliches Aussehen verlieh, und schien laut zu denken. „In meinem Refugium werde ich dir dein Geheimnis entreißen.“ Er blickte zu den beiden Kommissaren und grinste breit. „Sollte es irgendeinen Grund für einen medizinischen Eingriff geben, werde ich ihn finden. Verlasst euch drauf.“ Dann ging er daran, die restlichen Säcke zu öffnen. Beim vierten erlebten sie eine Überraschung. Er beinhaltete einen menschlichen Torso, der im Verhältnis zu den andern Körperteilen zu klein war.
„Mindesten zwei Leichen“, schlussfolgerte Carstens.
Der Torso wies stärkere Verwesungsspuren auf, als die anderen Körperteile, die Joe dem Kopf zugeordnet hatte.
„Korrekt“, kommentierte Joe. „Bei dem Bein da drüben“, sein Finger wies auf den dritten Fund. „Da bin ich mir nicht sicher, das könnte zu einer dritten Leiche gehören.“
Lamprechts Blick wurde starr. „Schon wieder eine Serie“, flüsterte sie vor sich hin. Bitte nicht, fügte sie in Gedanken hinzu.
„Den kriegen wir, so wie alle anderen“, versuchte Carstens der Kommissarin Mut zuzusprechen.
Sie verzog den Mund zu einem schrägen Strich. Wäre sie nicht mit ihrer privaten Situation überfordert, wäre alles viel einfacher. Bei jedem Toten musste sie an ihren Freund denken. Das wird noch eine ganze Zeit so bleiben, hatte ihre Psychologin gesagt. Lamprecht war seit einem halben Jahr in Therapie. Aber Besserung war noch nicht in Sicht. „Danke, Joe“, verabschiedete Lamprecht sich von dem Pathologen, der ihr zuzwinkerte und aufmunternd lächelte. Auch er kannte ihre verzwickte Situation.
„Gehen wir zu den Streifenhörnchen, fragen wer die Säcke entdeckt hat“, forderte Carstens seine Kollegin auf.
Der bereits ergraute Polizeihauptmeister Richter begrüßte sie höflich. „Mosche. Andrea, Stefan.“ Er reichte beiden die Hand. „Hätte nicht gedacht, dass wir uns ausgerechnet hier wiedersehen. Da haben wir einen Killer im Sack, kommt der nächste um die Ecke.“ Er runzelte die Stirn: „Schlechte Assoziation.“
Carstens verzog die Lippen zu einem Grinsen. „Nette Vorstellung, Wolfgang. Vielleicht ist der Killer in einem der Säcke. Der erste Fall von Selbstzerstückelung.“
Die beiden Männer lachten. Hätte Lamprecht nicht gewusst, was hinter dem plumpen Humor ihres Kollegen steckte, sie hätte ihn erwürgt. „Wer hat die Säcke entdeckt, Wolfgang?“
Richter wurde ernst, zog seinen altertümlichen, in Leder gebundenen Notizblock aus der Tasche und blätterte ihn durch. „Ein Heinrich Markowski. Er hat Wasserproben genommen. Steht da drüben und hätte sich vorhin fast dem Kollegen Tanner angeschlossen. Ist immer noch blass um die Nase. Die erste Leiche ist immer die schlimmste.“
„Wem sagst du das. Kann mich gut an mein erstes Mal erinnern“, nickte Carstens. „Eine Brandleiche“, fügte er hinzu. Richter runzelte die Nase und kniff die Augen zusammen. „Ich hab wochenlang nichts Gegrilltes essen können.“
„Kann ich gut verstehen.“
„Hast du Markowski befragt?“, wollte Carstens wissen.
„Ja. Personalien aufgenommen und den Hergang des Fundes. Tippe morgen das Protokoll, damit er’s unterschreiben kann.“
„Sehr gut. Wir quatschen trotzdem ein wenig mit ihm“, erwiderte Lamprecht.
„Klar. Euer Zeuge“, verabschiedete sich Richter und ging zu seinem derangierten Kollegen.
Die Kommissare gesellten sich zu dem Zeugen. Markowski war kleiner als Lamprecht, dünn, Nickelbrille, Jesus-Frisur und Kleidung, die anscheinend aus den Achtzigern übrig geblieben war. „Guten Morgen, Herr Markowski“, begrüßte Lamprecht den Mann.
Er reichte der Kommissarin die Hand. „Hallo.“ Er wirkte bestürzt und verängstigt.
Ob wir aus dem viel rausbekommen, fragte sich Lamprecht. Richter hatte das Wichtigste aufgenommen. Sie wollte zusätzliche Informationen. „Mein Name ist Andrea Lamprecht, und das ist mein Kollege Stefan Carstens von der Mordkommission. Wie haben Sie die Säcke gefunden?“
„Sack“, antwortete er einsilbig.
„Sack?“
„Einen einzigen, kein Plural“
Oh je, das kann ja heiter werden. Entweder, der ist immer so oder völlig neben der Spur oder … „Fühlen Sie sich in der Lage, mir ein paar Fragen zu beantworten?“, fragte Lamprecht.
Markowski blickte gedankenverloren zu den Säcken. „Ich habe Wasserproben genommen. Ich wollte eine von der Mitte des Sees, deshalb das Boot. Ich habe die Teleskopstange mit dem Glas für die Probe präpariert und sie tief eingetaucht. Beim Hochziehen blieb sie irgendwo hängen. Ich zog kräftig. Nach einer Weile förderte ich einen Sack zutage. Er ist eingerissen, und ich konnte hineinsehen … leider. Es war ein Bein. Ich habe sofort die Polizei gerufen.“
„Ist Ihnen beim Betreten des Geländes etwas Ungewöhnliches aufgefallen?“, wollte Lamprecht wissen. Markowski schüttelte langsam den Kopf. Er starrte immer noch die Säcke an. Aus dem bekommen wir nicht mehr raus, dachte die Kommissarin, nicht heute. „Danke, Herr Markowski. Kommen Sie klar? Brauchen Sie einen Arzt?“ Markowski verneinte.
Sie verabschiedeten sich und gingen zu Joe zurück. „Red du bitte mal mit dem Zeugen.“
Joe hob eine Augenbraue. „Der lebt doch noch?“
„Ich glaube, der kann im Moment kein Auto fahren. Eventuell braucht er einen Arzt.“
„Ist nicht mein Fachgebiet, aber ich spreche mit ihm.“
Die Kommissare sahen, wie Joe zu Markowski ging. Dann wandten sie sich Reiner Meister zu. „Was hast du gefunden?“, fragte Carstens.
Meister wirkte knurrig. „Dieser bescheuerte Jungspund“, grollte er. „Genau an der Stelle, die er sich für seinen Mageninhalt ausgesucht hat, wäre eine brauchbare Fußspur gewesen. Neben diesem Gebüsch müssen die Säcke gelegen haben. Es war relativ feucht die letzten Tage, da sind einige Abdrücke zurückgeblieben.“ Seine Augen schossen Pfeile hinüber zu Tanner. „Mal sehen, was ich retten kann. Mehr habe ich nicht. Die Säcke sind wahrscheinlich von der ‚Stange‘, nix was ihr nachverfolgen könntet. Aber im Labor sehe ich sie mir genauer an. Fingerabdrücke und DNA hat das Wasser des Sees beseitigt. Keine Chance.“
„Danke Reiner“, verabschiedete sich die Kommissarin. Sie gingen zurück zum Octavia. „Lass uns ins Büro fahren. Wir informieren den Alten.“
27. Januar, 16:30, Frankfurt – Nordend
Pünktlich kam ich in der Praxis von Professor Doktor Renz an. Auf dem Praxisschild las ich, dass er Facharzt für Kardiologie war. Ein Herzspezialist, der sich um die Herzensangelegenheit seiner Tochter sorgte. Passte.
Die Aufzugtüren glitten auf, als ich das Foyer betrat. Eine kleine schwarzhaarige Frau mit Dutt und kerzengrader Körperhaltung trat heraus. Sie lief schnurstracks auf die Tür zu, als wolle sie mich umrennen, was bei einer Körpergröße von etwa einsfünfundsechzig ein Ding der Unmöglichkeit darstellte. „Wollen Sie mich nicht vorbeilassen?“, fragte sie mich im Wiener Dialekt.
„Gerne, Frau Marschall“, antwortete ich mit leichtem Sarkasmus in der Stimme. Es wäre ein großer Zufall, wenn zwei Frauen mit demselben Dialekt in einem Gebäude arbeiten würden.
Sie hob die Brauen und sah mich prüfend an. „Sind Sie ein Patient? Der Herr Professor ist nicht mehr da“, log sie.
„Doch ist er. Denn wir sind verabredet“, grinste ich überlegen und ließ sie einfach stehen. Wegen solchen Vorzimmerdrachen trauten sich viele Menschen nicht, bei ihrem Arzt anzurufen.
„Was bilden Sie sich ein“, rief mir Frau Marschall nach, aber ich ignorierte sie, lief die Treppe in den zweiten Stock hinauf und klopfte an der Praxistür.
Keine halbe Minute später öffnete mir ein Mann die Tür. „Professor Renz?“ Er nickte. Ich war verblüfft. Renz erinnerte mich an den jungen Günter Strack. Gesicht, Größe, nur in der Leibesfülle unterschieden sie sich immens. Der Professor war schlank und sportlich, fast asketisch.
„Sie müssen Thomas Martini sein.“ Ich bejahte seine Schlussfolgerung. „Kommen Sie bitte herein.“
Er führte mich durch großzügig und vornehm eingerichtete Räumlichkeiten. Das Geschäft mit Herzensangelegenheiten schien zu florieren. „Setzen wir uns in mein Büro“, lud er mich ein. Sein Büro erinnerte mich eher an das eines Bankers oder Vorstandsvorsitzenden als an einen Arzt. Überall Leder, edles Holz, Chrom und Glas. Wir setzen uns in eine Sitzgruppe am Fenster. Sehr bequeme Ledersessel um einen Glastisch. Renz stellte zwei kleine Wasserflaschen und Gläser auf den Tisch.
„Was können Sie mir über Ihren Schwiegersohn erzählen?“, eröffnete ich das Gespräch.
Renz lehnte sich zurück und sah für eine Sekunde ins Leere. Heute Mittag war er nicht zu halten gewesen, die Worte waren aus ihm herausgesprudelt und jetzt … Er ließ sich Zeit. „Markus ist ein sehr extrovertierter Mensch“, sagte er mit Bedacht. „Er liebt das Leben und seine freie Zeit mit der Familie. Und er ist meiner Tochter ein guter Ehemann.“ Renz drehte den Kopf und blickte aus dem Fenster. „Das Glück meiner Tochter ist mir heilig. Es ist das Wichtigste auf der Welt für mich. Sie ist todunglücklich seit Markus verschwunden ist. Ich kann ihren Schmerz fast körperlich spüren.“ Ich beobachtete, wie seine Augen feucht wurden. „Ich möchte, dass Sie ihn finden, damit meine Tochter wieder glücklich ist.“
„Am Telefon erwähnten Sie, die Polizei habe kein Interesse, Herrn Gräger zu finden. Wie meinten Sie das?“
„Wir haben ihn am Sonntag vermisst gemeldet und es hat sich noch nichts getan. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts.“
„Das sind eineinhalb Tage. Da müssen Sie meinen Ex-Kollegen ein bisschen mehr Zeit geben.“
„Mir dauert es zu lange. Und Sophie ist so unglücklich“, er wandte den Blick ab.
Hatte er gerade Sophie gesagt? So wie meine erste große Liebe. Was für ein Zufall. „Was ist ihr Schwiegersohn von Beruf?“, lenkte ich das Gespräch zurück auf den Verschwundenen.
„Er ist Youtuber.“ In Renz’ Stimme schwang Abneigung mit. Oder war es schon Verachtung?
„Was hat er genau gemacht?“
„Sie kennen Youtube?“ Ich bejahte. Die Internet Videoplattform war mir wohlbekannt. Ich stöberte von Zeit zu Zeit selbst dort herum. „Er hat einen Nachrichtenkanal für junge Leute und verfasst zusätzlich Konzertberichte. Angeblich sehr erfolgreich.“ Wieder dieser Unterton. „Wissen Sie, dass Youtube im Vergleich mit den traditionellen Fernsehsendern, ARD und ZDF, annähernd die gleichen Einschaltquoten hat? Wenn man nur die Personen zwischen vierzehn und neunundvierzig nehmen würde, wären die Quoten bestimmt gleich auf. Ist auch nicht verwunderlich. In jeder Minute werden etwa vierundzwanzig Stunden Videomaterial auf die Plattform hochgeladen. Ein völliger Irrsinn in meinen Augen.“
„Wie stehen Sie zu dem Beruf Ihres Schwiegersohns?“
Er zog für den Bruchteil einer Sekunde die Oberlippe hoch. Verachtung. „Jeder macht das, was er am besten kann.“
Mehr Antwort war nicht nötig. Er hasste es. „Was hat er gelernt?“, wollte ich wissen.
„Journalismus. Arbeitete anfangs für den Frankfurter Kurier.“ Noch mehr Verachtung. Diesmal konnte ich es verstehen. Dieses Schmierblatt hatte mir in der Vergangenheit mehrfach Kopfschmerzen bereitet.
Eine Träne glitzerte in Renz’ Augenwinkel. „Soll meine Tochter Markus aushalten? Konnte meine Tochter nicht einen Mann mit einem normalen Beruf heiraten? Kein Akademiker, aber mit einem soliden Einkommen?“ Eine rhetorische Frage. „Was müssen Sie noch wissen?“, kam er zum Kern der Unterhaltung zurück.
„Wo wurde Herr Gräger zum letzten Mal gesehen und wann?“
Renz überlegte kurz. „Am Donnerstagabend ist er zu einem Konzert nach Offenbach gefahren. Zur Stadthalle. Das war gegen neunzehn Uhr. Danach ist er verschwunden.“
„Wo arbeitet er? Gibt es ehemalige Kollegen, die ihm seinen Erfolg neiden? Freunde, Verwandte, Bekannte, die mir Auskunft über ihn geben können?“
„Er nimmt seine Videos zu Hause auf. Kollegen gibt es keine. Nur ein paar Freunde, die das gleiche versuchen und noch weniger verdienen als er. Aber die Namen … Fragen Sie am besten Sophie. Auch wegen Freunden und Verwandten. Seine Eltern sind lange tot.“
„Darf ich offen reden?“ Renz kniff die Augen zusammen, bevor er nickte. „Sie sind auf das Wohl Ihrer Tochter bedacht, das ist mir klar. Aber wollen Sie wirklich, dass ich Markus wiederfinde?“