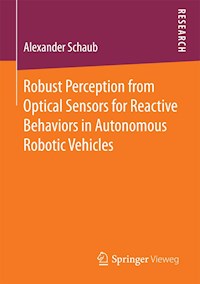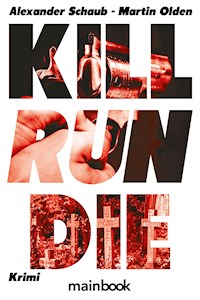
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Frankfurt werden kurz hintereinander zwei Frauen getötet. Beide auf die gleiche schreckliche Weise. Und die Kripo um Hauptkommissar Bernd Steiner, bekannt für seine rauen Methoden, hat keinen Plan, was dahinterstecken könnte. Ein Kronzeuge des BND taucht in der Mainmetropole unter. Privatdetektiv Thomas Martini erhält den Auftrag, ihn aufzuspüren. Ist der mysteriöse Mann für die Bluttaten verantwortlich? Steiner und Martini treffen bei ihren Ermittlungen aufeinander. Beide mögen sich nicht. Sind aber aufeinander angewiesen, um die Fälle aufzuklären. Zudem geraten beide auf die Abschussliste eines Gegners, dem jedes Mittel recht ist, um ein Geheimnis zu bewahren – ein Geheimnis, so düster wie die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Die bekannten Krimi-Autoren Alexander Schaub und Martin Olden legen erstmals gemeinsam einen Krimi vor – und lassen ihre angestammten Hauptfiguren Martini und Steiner, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aufeinander prallen. Ergebnis: Ein Krimi, bei dem kein Auge trocken bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Olden & Alexander Schaub
Kill Run Die
Krimi
eISBN 978-3-947612-91-8
Copyright © 2020 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung: Olaf Tischer
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Die Autoren
Martin Olden ist das Pseudonym des Journalisten und Kinderbuchautors Marc Rybicki. Er wurde 1975 in Frankfurt am Main geboren und studierte Philosophie und Amerikanistik an der Goethe-Universität. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Rybicki als Filmkritiker für das Feuilleton der „Frankfurter Neuen Presse“. Ebenso ist er als Werbe- und Hörbuchsprecher tätig.
Bei mainbook erscheint auch Martin Oldens Krimi-Reihe mit Kommissar Steiner: 1. Band: „Gekreuzigt“. 2. Band „Der 7. Patient“. 3. Band „Wo bist du?“. 4. Band „Böses Netz“. 5. Band „Mord am Mikro“. 6. Band „Die Rückkehr des Rippers“. 7. Band „Vergiftetes Land“ und die Krimi-Reihe um „Kommissar Platow“ in 15 E-Book- und 5 Taschenbuch-Bänden. Im Jahr 2013 veröffentlichte er zudem seinen ersten Thriller „Frankfurt Ripper“ Weitere Titel von Marc Rybicki sind die Kinderbücher „Mach mich ganz“, „Wer hat den Wald gebaut?“, „Wo ist der Tannenbaum?“ und „Graue Pfote, Schwarze Feder“. Autorenwebsite: www.sonnige-sendung.de
Der gebürtige Frankfurter Alexander Schaub erblickte 1969 das Licht der Welt. Bis 2014 lebte er in der Mainmetropole. Im April ´14 zog er mit seiner Traumfrau Corinna nach Hattersheim. Über zwanzig Jahre arbeitete Schaub in der IT und war für Netzwerke im Microsoft-Umfeld verantwortlich. Seit 2007 arbeitet er im technischen Support eines 3D Drucker Herstellers.
Über sein Schreiben sagt er: „Ich liebe Serien mit einem roten Faden und so soll es auch mit meinen Büchern werden. Die Charakterentwicklung meiner Protagonisten ist mir enorm wichtig.“ Bei mainbook ist seine „Engelmacher“-Trilogie erschienen: „Der Engelmacher aus Frankfurt“, „Der Schatten des Engelmachers“ und „Die Rache des Engelmachers“. Mehr Informationen über den Autor sowie anstehende Lesungen finden Sie unter:
www.alexander-schaub.de
„Einer muss hier büßen“, sagt die Stimme und das sei ich.
Fühl’ unter meinen Füßen, wie das dünne Eis bricht.
Moses Pelham – Für die Ewigkeit
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Prolog
Vor ein paar Monaten, irgendwo außerhalb Deutschlands …
Er rannte.
Er rannte so schnell wie noch nie zuvor in seinem Leben. Normalerweise rannten die Menschen vor ihm davon, aber diesmal war es umgekehrt.
Er rannte durch dichtes Gestrüpp und Astwerk. Sie waren hinter ihm, er hatte das Gefühl ihren Atem im Nacken zu spüren.
Er rannte ohne Unterlass, ohne Pause, ohne sich umzudrehen.
Bliebe er stehen, würde ihn das gleiche Schicksal erwarten wie zuvor seine Freunde. Na gut, sie waren nicht wirklich seine Freunde gewesen, aber etwas, was der Bezeichnung Freund am nächsten kam. Er konnte immer noch das dumpfe Plopp hören, mit dem die Kugel des Scharfschützen in die Stirn des Mannes neben ihm eingedrungen war. Jetzt waren sie hinter ihm her. Damit sie seine Spur nicht verloren, hatten sie Hunde vorweg geschickt.
Er stürmte zwischen zwei eng stehenden Bäumen hindurch. Ein Ast schlug ihm ins Gesicht und hinterließ eine tiefe, blutende Furche. Er nahm es nicht wahr. Er rannte weiter.
Plötzlich vernahm er das Rauschen von Wasser – ein Bach. Das war genau, was er jetzt brauchte. Seine Rettung. Sollte er das Gewässer erreichen und es durchqueren, würden die Hunde seine Spur verlieren. Dann hatte er eine reelle Chance zu entkommen.
Das Bellen war näher gekommen. Leise vernahm er das Trappeln von Füßen, Tierpfoten, die das Unterholz niedertrampelten. Wenn sie ihn erwischten, würden sie ihn zerreißen. Seinen Häschern war es egal, ob sie ihn erschossen oder ob die Hunde ihm den Garaus machten. Hauptsache, er war tot!
Nach etwa hundert Metern wich der Wald einer sandigen Böschung. Sie führte leicht nach unten zu dem Bach, den er gehört hatte. Er schaffte es nicht rechtzeitig abzubremsen, kam ins Straucheln und rutschte Richtung Wasser. Erst jetzt fiel ihm auf, dass der Bach ein reißender Fluss war. „Verdammt!“, rief er aus, als seine Füße in das eiskalte Wasser eintauchten. Im nächsten Moment schlugen die Wellen über ihm zusammen. Mit den Armen paddelnd und nach Luft ringend, kämpfte er sich zurück an die Oberfläche. Als er sie durchbrach, sah er, dass er bereits fünfzig oder hundert Meter flussabwärts getrieben worden war. Er befand sich in der Mitte des Stroms, der ihn mit sich davon schwemmte, ohne Notiz von ihm zu nehmen.
Mit seiner ganzen Kraft versuchte er, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Nach kurzer Zeit spürte er, wie die Kälte ihn steif werden ließ. Nicht mehr lange und seine Arme und Beine würden ihm den Dienst verweigern. Die Kälte kroch durch seinen ganzen Körper, langsam wie ein Raubtier, das sich anpirscht. Mit letzter Kraft bekam er einen dicken Ast zu packen, der ins Wasser hing. Er zog sich Zentimeter für Zentimeter daran hoch. Nach einer gefühlten Stunde fiel er völlig erschöpft und ausgepumpt auf den Sand des Ufers. Er atmete schwer. Gleichzeitig zitterte er vor Kälte. Seine Gliedmaßen bewegten sich unkontrolliert, aber er musste aufstehen und sich zumindest an den Rand des Waldes schleppen.
Als ihm das fast gelungen war, pfiff eine Kugel an seinem Ohr vorbei und schlug in den Baum vor ihm ein. Er ließ sich sofort fallen, robbte weiter. Dann spürte er einen harten Schlag an der linken Schulter. Eine Kugel hatte ihn getroffen. Blut sickerte aus der Wunde. Er warf sich nach vorne in einen mit Dornen bewehrten Busch. Die Äste verschlangen ihn und gaben ihm etwas Deckung.
Während er entkräftet auf dem Boden lag, fragte er sich: Ist es das wert? Eine klare Antwort: Nein! Er war nur eine Marionette in einem Spiel, das er nicht beeinflussen konnte. Andere zogen die Fäden.
Unter Aufbietung seiner letzten Kraftreserven und all seiner Willensstärke schleppte er sich ein paar hundert Meter weiter. Dann kippte er um und blieb bewusstlos liegen …
… I have constant fear that something’s always nearFear of the dark, fear of the dark
I have a phobia that someone’s always there …
Iron Maiden – Fear of the dark
Kapitel 1
Montag, 17. März 2014, 07:00, Igelsberg, Schwarzwald
Die alte Frau räumte den Gastraum auf. Sie trug auf einem Tablett Gläser, Tassen, Teller und Essensreste in die Küche, als ein Pärchen die Treppe, die zu den Fremdenzimmern führte, herunter stieg. „Grüß Gott, die Familie Meier. Wollen Sie frühstücken?“
Der Mann schüttelte den Kopf. „Nein, Frau Bischler. Wir haben ein kleines Picknick in unseren Rucksäcken. Wir wollen Richtung Nagoldtalsperre laufen und es uns dort gemütlich machen.“
„Da wünsch ich ihnen einen schönen Tag und viel Spaß“, erwiderte Frau Bischler.
Die Meiers bedankten sich und verließen das Landgasthaus Erlenhof. Sie liefen den Besenfelder Weg entlang, ließen die Nagoldstraße hinter sich. Am ersten Feldweg rechter Hand bogen sie ab in Richtung Wald. Der steinige Weg knirschte unter ihren Wanderschuhen, als sie zügig ausschritten. Nach ein paar Minuten erreichten sie den Waldrand, an dem sie ein paar hundert Meter entlang wanderten, bis sie einen Abzweig erreichten, dem sie in den Wald folgten. Am rechten Straßenrand stand ein alter grüner Lanz, der schon bessere Tage gesehen hatte. Die Bäume des Waldes waren bereits belaubt und hinderten das Sonnenlicht am Eindringen.
Sie liefen schon eine halbe Stunde, als Frau Meier sagte: „Karl, wir müssen da lang!“ Sie deutete nach rechts einen schmalen Pfad entlang.
Karl zog eine alte Wanderkarte aus der Tasche und studierte sie. „Nee, wir müssen links bleiben, Gertrud.“
„Aber ich bin mir sicher!“, erwiderte seine Frau.
„Ich hab die Karte – und nach der müssen wir hier lang.“
„Aber Karl, ich bin mir wirklich sicher. Letztes Jahr als wir …“ Sie verstummte. Zwei Wanderer kamen ihnen entgegen. Frau Meier ging dem Mann und der Frau ein paar Schritte entgegen und sprach sie ohne Umschweife an. „Grüß Gott! Können Sie uns vielleicht helfen?“ Berührungsängste kannte Frau Meier nicht.
Die Frau musterte sie aus wachen Augen. „Guten Tag. Was wollen Sie?“ Ihr Ton war nicht unfreundlich, aber auch nicht einladend. Eher kühl.
„Die Nahgoldtalsperre? Da lang oder hier auf dem Weg bleiben?“
Der Mann antwortete anstelle der dunkelhaarigen Frau. „Sie müssen auf dem Weg bleiben. In etwa einem Kilometer müssen Sie dann rechts ab.“
„Siehst du, wir müssen hier weiter“, triumphierte Herr Meier.
„Na gut, dann komm!“ An das Wandererpärchen gewandt sagte seine Frau: „Danke und schönen Tag noch.“
Mit diesen Worten verschwanden die Meiers gen Osten. Die Wanderer blickten ihnen nach, bis sie außer Sicht waren, dann lenkten sie ihre Schritte weg von dem befestigten Weg hinein in das Dickicht des Waldes. Das Unterholz war sehr dicht. Es fiel ihnen schwer, geradewegs nach Norden zu laufen. Gelegentlich zogen sie einen Kompass zurate, um ihre Richtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Nach einer weiteren halben Stunde wurde das Gestrüpp am Waldboden lichter. Sie erreichten einen Platz mit vier Bäumen, die in einem fast symmetrischen Quadrat angeordnet waren. In ihrer Mitte befand sich ein runder Holzdeckel, wie der Verschluss eines Kanals.
Der hochgewachsene Mann hob den Deckel an. Darunter kam ein dunkler Schacht zum Vorschein. Er nahm einen herumliegenden kleinen Ast und warf ihn in die Dunkelheit. Es dauerte etwa vier Sekunden, bis er auf dem Boden aufschlug. Die Frau zog ihren Rucksack ab und holte ein Seil heraus. Sie entfernte Blätter und Erde vom Rand des Schachts, bis sie einen Eisenring in Händen hielt. Sie befestigte das Seil an dem Ring, zog ein paar Mal mit aller Kraft daran, bis sie sicher war, dass es festsaß. Dann warf sie es in die Finsternis des Abgrunds.
Der Mann wickelte sich das Seil um das linke Handgelenk, dann ließ er sich in das dunkle, gähnende Loch hinabsinken. Er stützte sich mit den Füßen an der Wand ab, dabei ließ er das Seil langsam durch seine Hände gleiten. Die kleine Stirnlampe, die er sich auf den Kopf gesetzt hatte, spendete genug Licht, um die vor ihm liegende Wand zu erhellen.
Nach ein paar Minuten, etwa in fünf Metern Tiefe, wurde der Lichtstrahl von einem zweiten Metallring reflektiert. Er löste die rechte Hand vom Seil, legte sie um den Ring und zog daran. Ein leichtes Vibrieren ging durch den Erdschacht. Aus der Wand rechts unter ihm, schob sich eine Metallplattform heraus. Als das Vibrieren abebbte, war der Schacht unter ihm verschlossen. Er setzte die Beine ab, ließ das Seil los, hob den Kopf nach oben und rief: „Du kannst runter kommen!“
Kurz darauf stand seine Begleiterin neben ihm.
Die Lampe des Mannes richtete sich auf die Wand, aus der die Bodenplatte herausgeglitten war. Ein paar Sekunden irrlichterte der Strahl hin und her. Dann erfasste er ein schwarzes Viereck, eine Klappe, ungefähr zwanzigmal fünfzehn Zentimeter groß. Ein Griff in die linke Hosentasche des Mannes und eine Art Scheckkarte kam zum Vorschein. Er hielt sie vor das Viereck. Mit einem Klick sprang es auf. Eine dunkel glimmende Fläche kam zum Vorschein. Er legte seine linke Handfläche darauf. Ein weißer heller Strich entstand an seinen Fingerspitzen und fuhr die Handfläche hinunter. Unten angelangt verschwand er wieder. Für zehn Sekunden geschah nichts. Dann ging wieder ein Vibrieren durch den Schacht und die Wand vor den beiden glitt zur Seite. Sie gab den Blick auf einen hell erleuchteten Gang frei. Die beiden traten ein. Als sie etwa fünf Schritte die leicht abschüssige Röhre entlang gelaufen waren, schloss sich die Tür lautlos hinter ihnen.
Sie folgten dem Gang, von dessen Metallwänden ihre Schritte widerhallten. Es gab weder Abzweigungen noch Türen, außer am Ende des Hohlweges. Dort befand sich ein weiterer Handabdruckleser. Auch dieser gewährte ihnen Zugang. Die Tür glitt zur Seite und sie betraten einen Raum mit Schreibtischen, die durch Stellwände voneinander getrennt waren. An drei von den Tischen saßen Männer, die kurz aufsahen und sich dann wieder ihrer Arbeit widmeten. Die Neuankömmlinge wurden nicht weiter beachtet.
Die beiden wandten sich einer Tür auf der linken Seite des Raums zu. Die Frau klopfte kurz und trat ein.
In dem Raum hinter der Tür stand nur ein Schreibtisch. An ihm saß eine Person, die aufblickte, als die beiden hereinkamen. Der Mann setzte sich auf einen der beiden Besucherstühle und schlug die Beine übereinander. Dann begrüßte er die Gestalt hinter dem Schreibtisch: „Guten Morgen, Caligula.“
Montag, 17. März, 07:07, Frankfurt Flughafen
Der Flieger setzte zur Landung an. Die Räder der LH-666 berührten den Asphalt der Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens. Ein leichter Ruck ging durch die Kabine. Einige der hundertachtzig Passagiere holten hörbar Luft, so auch die junge Frau neben Robert Esslinger.
„Keine Angst, das ist normal“, sagte er, ein Lächeln im Gesicht, das ein gepflegter Pfeffer-und-Salz-Bart zierte. Die Frau nickte flüchtig. Als das Flugzeug ausrollte, war die Erleichterung auf ihrem Gesicht nicht zu übersehen. Bevor die Dame ausstieg, nickte sie Esslinger noch einmal zu, packte ihren Trolly und ließ sich mit den anderen Gästen hinaustreiben.
Robert Esslinger und der Mann neben ihm am Fenster waren die letzten beiden Fluggäste in ihrer Reihe. Hinter ihnen saßen zwei weitere Herren in dunklen Anzügen. Ansonsten war die Kabine leer. Die Gruppe hatte absichtlich gewartet, bis sie alleine an Bord war. Esslinger wollte böse Überraschungen vermeiden.
„Kommen Sie, Winter! Jetzt können wir gehen“, forderte er den Schwarzhaarigen neben sich auf und nickte den beiden Anzugträgern hinter ihnen zu. Sascha Winter blickte Esslinger aus dunklen Augen an, sagte aber nichts. Der junge Mann wirkte weder beunruhigt noch nervös. Er schien völlig ausgeglichen. Ein Wunder bei dem, was hinter ihm liegt, dachte Esslinger. Winter hatte eingewilligt in einem sehr brisanten Fall auszusagen. Jeder andere an seiner Stelle wäre panisch oder paranoid geworden – nicht Winter.
Kurz bevor sie alle aufstanden, rieb sich Sascha Winter die linke Schulter. Eine Bewegung, die Esslinger in den letzten Tagen des Öfteren bei seinem Begleiter beobachtet hatte. „Schmerzen?“, fragte er.
„Unwesentlich“, kommentierte Winter knapp, während er sich erhob.
Am Ausgang des A-320 standen die beiden Stewardessen, die sie während des Fluges überaus freundlich bedient hatten.
„Danke, dass Sie mit uns geflogen sind. Beehren Sie uns bald wieder“, verabschiedete sich die Blondine, auf deren Namensschild Maurer zu lesen war. Den ganzen Flug über war sie sehr bemüht gewesen, vor allem um Winter. Esslinger musste zugeben, dass sein Begleiter sehr attraktiv war und bestimmt auf siebzig Prozent aller Frauen anziehend wirkte. Insgeheim verglich er Winters Aussehen mit Sebastian Stan, dem Darsteller des Bucky Barnes aus den Marvel-Filmen. Wie kam er nur auf diesen Vergleich? Ja, die Leidenschaft seiner Tochter, Comicverfilmungen. Kurz blitzte ein wehmütiger Gedanke an Jennifer in ihm auf. Seine mittlerweile erwachsene Tochter, die sich von ihm abgewendet hatte, und deren Zuneigung er zurückzugewinnen versuchte.
Essinger blickte wieder zu Winter. Dieser schenkte der Stewardess ein Lächeln, das sie zum Schmelzen brachte.
„Hier ist ein Gutschein für einen kostenlosen Drink auf Ihrer nächsten Reise.“ Maurer drückte Winter ein visitenkartengroßes Stück Papier in die Hand. Esslinger entging nicht, dass die Finger der jungen Frau leicht zitterten. Winter nahm die Karte entgegen und bedankte sich. Er lächelte ihr noch ein weiteres Mal zu, bevor sie den Flieger verließen.
Sie betraten Terminal D des Rhein-Main Airports über die Ziehharmonika ähnliche Gangway. Esslinger blickte Winter an. „Ist das wirklich ein Gutschein?“ Seine Stimme strotzte vor Skepsis. Der Schwarzhaarige grinste breit und hielt seinem Begleiter das Papier hin. Darauf hatte die Stewardess ihren Namen und eine Handynummer notiert.
„Sie sind unglaublich!“, lachte Esslinger. „Passiert Ihnen das öfter?“
Winters Blick wurde nachdenklich. „Ein, zwei Mal vielleicht.“ Esslinger spürte, dass sich mehr hinter den Worten verbarg, als sein Gegenüber preisgab.
„Mir passiert so etwas nie“, meldete sich einer ihrer beiden Begleiter, die hinter ihnen liefen. „Manchen Männern fliegen die Frauen nur so zu, ob sie es wollen oder nicht. Stimmt’s Winter?“
Der Tonfall des Mannes barg einen provokativen Unterton, der Esslinger nicht entging. Er wandte sich um, blickte ihn tadelnd an, worauf der Redner sofort verstummte. An Winter gewandt sagte er dann: „Ein Wagen erwartet uns am Ausgang.“ Esslinger deutete in Richtung des Zollbereichs.
„Ich müsste noch mal auf die Toilette“, erwiderte Winter.
„Hat das nicht Zeit bis …?“
„Nein!“, unterbrach der Schwarzhaarige.
„Okay. Da vorne ist ein Wegweiser zum nächsten WC. Ich gehe aber mit.“ Als Winter protestieren wollte, fügte Esslinger hinzu: „Zur Sicherheit!“ Ihre beiden Begleiter wies er an, hier auf sie zu warten.
An der Toilette angekommen ging Esslinger voran, öffnete die Tür und inspizierte den Raum. Außer ihnen war niemand zu sehen.
„Also los, gehen Sie!“, forderte Esslinger seinen Begleiter auf. Winter verschwand in einer der Boxen. Esslinger wartete am Waschbecken.
Plötzlich hörte er ein Stöhnen wie von einem Kranken oder Verletzten. „Winter! Was ist los? Alles in Ordnung?“ Der Mann antwortete nicht. Esslinger rief ein zweites Mal. Wieder keine Antwort.
„Winter, wenn Sie nicht antworten, komm ich zu Ihnen rein!“ Als der Angesprochene immer noch nicht reagierte, ging Esslinger zu der Kabine, in der Winter verschwunden war. Er öffnete die Tür.
Was er sah, verwirrte ihn. Winter stand vollständig angezogen hinter der Tür und starrte ihn an.
„Was ist mit Ihnen? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?“
Ohne eine Erwiderung schlug Winter ihm ins Gesicht, dass er gegen die Kabinentür taumelte. Ein zweiter Schlag schleuderte Esslinger gegen die Wand. Dann legte sich Schwärze über sein Bewusstsein und er glitt in eine tiefe Ohnmacht.
17. März, 07:45, Hattersheim Okriftel
„Guten Morgen, mein Schatz.“
Die Worte drangen an mein Ohr, warm, weich und zärtlich. Wie ein alter Motor, der beim Anspringen stottert, nahm mein Hirn seine Arbeit auf. Ich hob die schweren Lider und blinzelte in den Lichtkranz, der Jays Kopf wie ein Heiligenschein umgab.
„Morgen“, krächzte meine Stimme zurück. Ich versuchte, zu schlucken, aber meine Zunge klebte wie ein alter Socken an meinem Gaumen.
Jay beugte sich zu mir herab und küsste mich zärtlich auf die Lippen. „Na, du müder Krieger. War`s wieder spät?“ Ich nickte. „Hast du den Sack endlich geschnappt?“ Wieder ein Nicken. „Dann kann ich darauf hoffen, mit meinem Verlobten wieder zusammen einschlafen zu können?“
„Ja, … kannst du.“ Meine Stimme wollte mir immer noch nicht gehorchen. Ich tastete nach der Wasserflasche neben meinem Bett und trank einen Schluck, nachdem ich sie geöffnet hatte. Danach umarmte ich Jay und zog sie zurück ins Bett.
„Hey, was soll das werden?“, fragte sie keck.
„Nach was fühlt es sich denn an?“, gab ich zurück.
Jay ließ ihr wunderschönes helles Lachen erklingen. „Ich muss arbeiten! Bei mir steht in neunzig Minuten der erste Patient auf der Matte.“
„Das ist lang genug für …“
Sie wand sich aus meinem Griff. „Und wer kommt dann völlig derangiert in seiner Praxis an?“
„Aber …“
„Nix, aber!“
„Aber, ich …“
Sie hob den Zeigefinger wie eine Mutter, die ihrem Kind sagt, dass es jetzt keine Süßigkeiten bekommt. Dann gab sie mir einen langen Kuss und stand wieder auf. „Herr Martini! Sie wissen genau, wie lang die Fahrt nach Frankfurt zur Alten Oper dauert.“
„Jaaaa, weiß ich.“ Selbst in meinen Ohren klang ich wie ein nöliger Teenie, dem die Eltern kein neues Handy kaufen wollten. Jay hatte seit Anfang des Jahres ihre Praxis für Psychotherapie in der Leerbachstraße. Es war eine Gemeinschaftspraxis, zusammen mit einer weiteren Psychotherapeutin und einer Psychologin. Bei der Einweihung hatte ich ihre beiden Kolleginnen kennengelernt. Das Ganze fühlte sich vielversprechend und stimmig an, zwischen den Frauen herrschte eine gute Chemie. Und ja, die Praxis lief gut.
„Deine Verrückten sind dir wichtiger als ich“, quengelte ich weiter.
„Zu deinem Glück weiß ich, dass das nicht dein Ernst ist.“ Dann zog sie die Stirn kraus. „Oder doch?“
Erneut versuchte ich sie zu greifen, aber sie sprang lachend ein Stück weg von mir. Meine Reflexe ließen um diese Uhrzeit sehr zu wünschen übrig. Jay warf mir einen Handkuss zu, während sie das Schlafzimmer verließ.
Ich wälzte mich aus dem Bett und ging ins Bad. Der Vierzigjährige, der mich aus dem Spiegel ansah, war niemand, den ich hätte küssen wollen. Meine schwarze Mähne stand in alle Richtungen vom Kopf ab und der Dreitagebart war bald mehr grau als schwarz. Einzig meine wasserblauen Augen wirkten wach, klar und hell. Auch wenn meine Figur sportlich wirkte, wofür ich viel trainieren musste, fühlte ich mich im Moment alles andere als agil.
Meine Selbstreflexion wurde von Jays Stimme unterbrochen. Sie steckte den Kopf zur Tür herein. „Ich geh jetzt.“ Ihr Blick glitt an meinem Körper hinunter und blieb ziemlich weit unten haften. „Wirklich schade, dass ich gehen muss“, sagte sie mit laszivem Unterton, der mich innerhalb von einer Sekunde zum Kochen brachte.
„Das Angebot steht noch.“
Sie lachte. „War das Wortspiel beabsichtigt? Egal, gib mir ´nen Kuss. Ich muss weg!“
„Jawohl, Frau von Linde.“ Ich salutierte und verabschiedete meine Verlobte, wie es sich gehörte. Dann hörte ich die Haustür zuschlagen und war alleine.
Eine halbe Stunde später kam ich aus dem Bad. Ich lief schnurstracks in die Küche, die Kaffeemaschine rief nach mir, ich konnte es genau hören.
Das Gute am Leben als Privatdetektiv war, dass ich meinen Tagesablauf selbst bestimmen konnte. Wann stehe ich auf. Wann arbeite ich. Wann faulenze ich. Wobei das letztere, Faulenzen, seit geraumer Zeit zu kurz kam. Seit den Ereignissen im letzten Jahr stand mein Telefon nicht mehr still. Hatte ich mich kurz zuvor noch gefragt, ob ich meine Detektei schließe und wieder zur Polizei gehe, was nicht wirklich eine Option war, stellte sich jetzt die Frage nach Unterstützung – brauchte ich einen zweiten Mann? Diese Entscheidung schob ich schon seit September vor mir her, war aber noch zu keiner Entscheidung gekommen. Jay lag mir schon länger in den Ohren endlich jemanden einzustellen, aber ich war ambivalent in dieser Beziehung.
Als der erste Kaffee meine Kehle hinunterrann, überlegte ich, was heute anstand. Den Bericht der gestrigen Nacht schreiben. Ehemann betrügt Frau mit Sekretärin – der Klassiker. Jörn Kostas anrufen und ihm mitteilen, dass seine Frau eine Affäre mit ihrem Personaltrainer hat – auch ein Klassiker – und so weiter und so fort.
Noch während ich über meinen Tag nachdachte, klingelte es an der Haustür. Seit wir letztes Jahr im September nach Hattersheim Okriftel in den Sterntalerweg gezogen waren, gingen die persönlichen Besuche von potenziellen Klienten zurück. Worüber ich nicht böse war. Heute schien sich wieder einmal jemand zu unserem kleinen Einfamilienhaus verirrt zu haben. Ich betätigte den Summer für das Gartentor und öffnete, die Tasse in der Hand, die Haustür. Eine Sekunde später bereute ich, die Gegensprechanlage nicht benutzt zu haben.
„Hallo Herr Martini! Marion Zinzer vom Frankfurter Kurier“, schmetterte mir die brünette, hochgewachsene Frau entgegen.
„Ich weiß, wer Sie sind, Frau Zinzer. Was wollen Sie schon wieder?“, fiel ich ihr ins Wort.
„Eine Exklusiv-Story.“ Sie hob die Hand, als ich Luft holte, um zu einer Erwiderung anzusetzen. „Bevor Sie ablehnen, mein Verlag lässt sich das was kosten. Eine nicht unerhebliche Summe.“ Sie rieb Zeigefinger und Daumen aneinander.
„Und was muss ich dafür machen?“
„Ich möchte alles über den Engelmacher und Ihre Beziehung zu ihm erfahren. Die Details, die in keiner anderen Gazette zu finden sind. Den Menschen Josef Larusso. Sie sind der unumstrittene Experte, wenn es um den Serientäter in ihm geht. Den Mann, der blonde Frauen getötet, ihnen eine Schlange in den Mund gesteckt, mit Papierflügeln wie Engel aufgebahrt hat …“
„Josef Larusso war ein Monster!“, unterbrach ich die Journalistin ein weiteres Mal. „Er hat diese Frauen nicht nur ermordet, er hat unzählige Männer und Frauen geschlachtet! Darunter Menschen, die mir nahe standen …“
Diesmal unterbrach Zinzer mich. „Deshalb möchte ich die Hintergründe beleuchten. Ich will nicht das Monster, wie Sie ihn nennen, zeigen, sondern die Person und ihre sozialen Kontakte.“
„Mir war nicht bewusst, dass Soziopathen so hoch im Kurs stehen. Und jetzt reicht’s. Verschwinden Sie! Ich habe, wie die letzten fünfmal, kein Interesse an einem Interview.“ Ich wollte die Tür effektvoll zuknallen, doch die Journalistin stellte ihren Fuß in den Rahmen.
„Herr Martini, bitte!“
„Muss ich noch deutlicher werden?“
„Ich bin dabei, eine große Serie über Serienmörder zu schreiben, aber dafür möchte ich nicht nur die Taten aufzählen und verurteilen. Sondern auch die Gesichter hinter den Bestien. Die Gesichter, die sie der Gesellschaft zeigen.“
Ich schnaufte enerviert: „Was kommt als Nächstes? Dass meine Verlobte Ihnen ebenfalls Rede und Antwort stehen soll?“
„Sehr gerne. Jasmina von Linde ist als Psychologin eine Autorität auf ihrem Gebiet. Sie hat Ihnen zweimal geholfen, Täter zu fassen …“
Mit einer Handbewegung schnitt ich Zinzer das Wort ab. „Es reicht! Jay hat bewusst keine Interviews gegeben, um den Hype um Larusso nicht noch anzufachen. Das wird sich auch für Sie nicht ändern. Meine Verlobte wird weder für Ihr Schmierblatt noch für irgendein anderes ein Interview, geschweige denn eine Expertise abgeben. Und dasselbe gilt für mich. Ende der Geschichte.“ Ich blickte die Brünette durchdringend an. Äußerlich war Marion Zinzer sehr attraktiv, keine Frage. Sie hatte bestimmt schon den einen oder anderen Gesprächspartner unter Zuhilfenahme ihrer weiblichen Reize zum Reden gebracht. Bei mir biss sie auf Granit. Die Journalistin lief mir seit fast einem Jahr nach, um ein Interview zu bekommen. Alle anderen Reporter hatten mittlerweile aufgegeben, nur diese Ziege nicht. Waren ihre Besuche und Kontaktaufnahmen anfangs selten, wurden sie in letzter Zeit immer häufiger. „Sollten Sie nicht endlich aufhören, mich und Frau von Linde zu belästigen, werde ich mich an die Polizei wenden wegen Stalking.“
„Ich glaube nicht, dass Sie damit durchkommen. Aber bitte.“ Sie zuckte die Schultern.
„Leben Sie wohl. Auf Nimmerwiedersehen!“ Ich schob Zinzers Fuß zurück und schlug die Tür zu. Diesmal knallte es laut und endgültig. Hoffentlich sehe ich die nie wieder, dachte ich, während ich in mein Arbeitszimmer ging, um mich dem unausweichlichen Papierkram zu stellen.
17. März, 12:57, Igelsberg Schwarzwald
Die Tür öffnete sich. Ein kleiner Mann mit kurzen grauen Haaren und kleinem Kugelbauch betrat das Zimmer. Caligula, der über einer Akte gesessen hatte, blickte auf. „Was gibt es, Flavius?“
Flavius druckste herum. Es war ihm anzusehen, dass das, was er zu sagen hatte, keine Begeisterungsstürme bei seinem Zuhörer auslösen würde. „Ich habe einen Anruf aus Frankfurt erhalten.“ Er schluckte schwer und schlug den Blick nieder. „Sascha Winter hat sich abgesetzt.“
Caligula fuhr sich mit beiden Händen durch die schwarzen, vollen Haare und ließ ein verzweifeltes Stöhnen hören. „Wie?“
„Was meinen Sie?“, fragte Flavius.
„Wie ist er entkommen?“, gab Caligula lauter zurück.
„Ach so, das meinen Sie. Er hat seinen Bewacher auf einer Toilette am Flughafen überwältigt. Als Lucius wieder zu sich kam, war Winter nicht mehr aufzufinden.“
„Verdammt!“ Caligula schlug mit der Faust auf den Tisch. „Wie konnte das passieren?“
Flavius zuckte die Schultern. „Es tut mir leid, aber mehr weiß ich noch nicht.“
„Dann erkundigen Sie sich gefälligst!“, schrie Caligula und schlug ein zweites Mal auf die Tischplatte.
„Ja, sofort“, antwortete der andere eingeschüchtert und wandte sich zum gehen.
„Stopp!“, rief sein Chef hinter ihm her. Der kleine Mann kam zurück in das Büro. „Lucius geht mir auf die Nerven, genauso wie …“, flüsterte Caligula vor sich hin.
„Was meinten Sie?“, fragte Flavius, da er das Gemurmel des Vorgesetzten nicht verstanden hatte.
Caligula blickte zu ihm auf. „Verständigen Sie Artemis.“
17. März, 19:22, Frankfurt Goldstein
Auf seiner Flucht, nachdem er die Herrentoilette verlassen hatte, brachte Sascha Winter das Handy eines Touristen an sich. Er rempelte einen älteren Mann an und stahl ihm das moderne Smartphone aus der Innentasche seiner Jacke.
Während er auf die Dunkelheit wartete, war er zu Fuß durch die Frankfurter Randgebiete gewandert. Griesheim, Niederrad, Goldstein und Schwanheim. Bei seinem Streifzug war ihm eine alte Schirmmütze in die Hände gefallen, welche ihm sehr gelegen kam. Er setzte sie auf und zog sie so tief ins Gesicht, dass seine Augen nicht mehr zu sehen waren. Dies musste als Verkleidung reichen. Als der Abend anbrach und der Himmel sich dunkel färbte, begab er sich auf den Weg zu seinem Ziel.
Die Dame wohnte in einem der kleinen Häuser im Boseweg in Goldstein, direkt neben der Brücke der Autobahn 5.
Winter sehnte sich danach, sie zu sehen. Ihr letzter Kontakt lag eine kleine Ewigkeit zurück.
Es war ein Einfamilienhaus, welches sich zwischen zwei größere Häuser duckte. Auf der Rückseite erstreckte sich ein kleiner Garten und eine Hecke, als Blickschutz zu den Nachbargrundstücken.
Er schlich sich von hinten an das Gebäude heran, dabei hielt er sich im Schatten der Bäume und Sträucher. Im Haus war es dunkel. Anscheinend war sie noch nicht zu Hause. Wie sollte er hineinkommen? Winter entschloss sich, nach einem versteckten Zweitschlüssel zu suchen. Vielleicht hatte er Glück. Die üblichen Verstecke, wie unter der Fußmatte oder in einem unechten hohlen Stein, erwiesen sich als Fehlschlag. Er schlich zurück in den Garten und suchte nach einer anderen Möglichkeit. In den Beeten entdeckte er Gartenstecker aus Metall, eine Sonne, ein Herz und ein Windspiel. Das war doch ein Anfang. Winter zog das Windspiel aus der Erde, weil an diesem der Metallstab am massivsten war. Notfalls konnte man damit eine Scheibe einschlagen, das würde aber zu viel Lärm machen. Er ging zur Terrassentür und setzte die Spitze des Stabes in den Spalt zwischen Tür und Rahmen. Vorsichtig hebelte er, erst oben, dann in der Mitte und zum Schluss unten, die Tür auf. Ein hässliches Knacken verkündete, dass der Weg frei war.
Sascha Winter trat ein und drückte die Tür zurück in die zerstörte Verriegelung. Das einzige laute Geräusch war das Aushebeln der Schließungen gewesen. Hoffentlich hatte es niemand mitbekommen. In Anbetracht der Tatsache, dass keine zweihundert Meter entfernt die A5 entlanglief, glaubte er nicht, dass sein Eindringen bemerkt worden war. Er schlenderte langsam durch das Haus, inspizierte es Raum für Raum. Licht schaltete er keines ein, um sich nicht zu verraten. Der Schein der Straßenlaternen reichte ihm, nachdem seine Augen sich an die spärlichen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. In der Küche im Erdgeschoss öffnete er den Kühlschrank und nahm ein Stück Käse heraus. Im Backofen fand er geschnittenes Brot. Er aß beides mit großem Appetit. Seine letzte Mahlzeit lag eine geraume Zeit zurück.
Als er fertig war, ging er in das Badezimmer, um sich die Hände zu waschen und den Käsegeruch loszuwerden. Hier konnte er Licht einschalten, weil es kein Fenster gab. Winter öffnete den Wasserhahn und griff nach der Seife, als sein Blick wie festgenagelt im Spiegel des Badschranks kleben blieb. Über der Badewanne stand ein Wäscheständer. Darauf hing … ihre Unterwäsche. Er drehte sich um und streckte ganz langsam die Hand aus. Sie zitterte. Als seine Fingerspitzen den Stoff des Stringtangas berührten, zuckten Erinnerungen wie Blitze durch sein Bewusstsein. Heißer Atem, schweißnasse Körper, Stöhnen, rhythmische Bewegungen, Schreie. Er zog die Hand zurück und wandte sich wieder dem Spiegel zu. Wie lange war das alles her? Eine Ewigkeit!
Auf einmal trieb ihn ein anderer Gedanke um: Hatte sie einen Freund? Er öffnete die Türen des Badschranks und suchte nach Rasierwasser, einer zweiten Zahnbürste, einem Männer-Deodorant oder anderen Hygieneartikeln, die Mann so brauchte. Nichts! Sehr gut.
Ein Geräusch an der Eingangstür holte ihn zurück in das Hier und Jetzt. Der Schlüssel wurde hineingesteckt und zweimal gedreht. Ein leises Quietschen folgte. Winter stellte das Wasser ab, welches immer noch lief, löschte die Beleuchtung und bewegte sich lautlos Richtung Flur.
Sie war gekommen!
Sie schaltete das Licht an, nachdem sie die Haustür ins Schloss gedrückt hatte.
Sascha Winter lehnte sich in den Türrahmen des Bads und wartete, bis sie sich zu ihm umdrehte. Die Augen der Brünetten wurden groß, als er sagte: „Überraschung, Baby!“
17. März, 20:01, Frankfurt Bockenheim
Er wurde beobachtet!
Robert Esslinger blickte sich vorsichtig um. Ja, ganz sicher. Er war zu lange im Geschäft, um diesen Stümper nicht zu bemerken. Er konnte nicht zu dem Treffen gehen. Unmöglich! Alles würde auffliegen. Jetzt griff der Notfallplan.
Er warf einen weiteren unauffälligen Blick in das Schaufenster des Ladens, vor dem er stand. Da war der Verfolger wieder, der versuchte, sich im Schatten einer Mauer zu verstecken. Anfängerfehler!
So ungeschickt sich sein Jäger auch anstellte, es war ihm bisher nicht geglückt, ihn abzuschütteln. Er lief die Leipziger Straße weiter, Richtung Adalbertstraße. Der andere setzte sich ebenfalls in Bewegung.
Wie war man ihm auf die Schliche gekommen? Oder wusste man nichts von seinen Plänen? Hatte sein Chef nur einen Verdacht und ließ ihn vorsorglich beschatten? Er war sich da nicht so sicher. Aber es gab eine einfache Möglichkeit, das herauszufinden.
Als Esslinger die Adalbertstraße erreichte, überquerte er sie an der Ampel, lief über die Gräfstraße und suchte sich dann einen Platz in dem Bistro direkt an der Bockenheimer Warte.
Die Bedienung kam. Er bestellte einen Cappuccino und einen Salatteller. Seinen unerwünschten Begleiter erblickte er vier Tische weiter. Esslinger zog das Handy aus der Tasche und wählte die Nummer seines Chefs. Nach dem zweiten Klingeln meldete er sich.
„Hallo Robert. Wie geht es dir?“, tönte die schnarrende Stimme seines Vorgesetzten aus dem Telefon.
„Lässt du mich beschatten?“, kam Esslinger ohne Begrüßung zur Sache. Er war sauer und nicht in der Stimmung, um den heißen Brei herumzureden.
„Robert! Wie kommst du darauf?“ Der zynische Unterton war unverkennbar.
„Was soll das?“
„Ich sorge mich um deine Sicherheit. Es gab Drohungen von außen, wegen unseres … Projekts. Du verstehst?“ Es klang verschwörerisch.
„Was für Drohungen?“
Der Mann am Telefon atmete tief ein und aus. „Na ja, es waren keine direkten Drohungen, nur ominöse Andeutungen.“
„Hör auf mit dem Rumgedruckse.“ Esslinger war genervt, im Moment mehr von seinem Chef, als von seinen Verfolgern.
„Der alte Haudegen ist aufmerksam geworden durch deine Abwesenheit und hat daraus seine Schlüsse gezogen. Er versucht, Winter abzugreifen, wenn du verstehst, was ich meine. So wurde es mir zugetragen.“
„Und warum lässt du mich beschatten? Bin ich Winter? Er hat mich niedergeschlagen und ist abgehauen, sollte es dir entgangen sein.“
„Ich will dich beschützen, damit …“
„Ich brauch keinen Schutz. Pfeif deinen Wachhund zurück. Sofort!“
Wieder das tiefe Atmen am anderen Ende der Leitung. „Wie du willst Robert. Aber beschwer dich nicht, wenn dir etwas zustößt.“
„Ich bin alt genug, danke“, erwiderte Esslinger und versuchte, sich die Erleichterung nicht anmerken zu lassen. „Übrigens, der Kerl ist ein absoluter Dilettant. Ich hab ihn von der ersten Sekunde an bemerkt. Schick ihn zurück in die Schule.“ Er klickte auf die Aus-Taste, ohne eine Antwort abzuwarten.
Ich brauche Hilfe von jemandem, den der Boss nicht kennt, dachte Esslinger, während er das Telefon in die Tasche steckte. Jemand, dem ich vertrauen kann.
Sein Cappuccino und der Salat waren gekommen. Er piekste das erste Salatblatt auf, da sah er, wie sein Beschatter einen Anruf erhielt. Das ging schnell. Esslinger schmunzelte bei dem Gedanken. Nachdem das Gespräch beendet war, stand der Mann auf und verschwand mit einem letzten Blick zu Esslingers Tisch.
Das wäre geschafft! Nichtsdestotrotz musste er wachsam bleiben. Sein sechster Sinn mahnte ihn dazu. Er war nicht panisch, aber eine gesunde Portion Paranoia konnte in seinem Fall hilfreich sein.
Jetzt blieb noch die Frage nach der Kontaktperson, die ihm helfen konnte und würde. Gedankenversunken blätterte er in einer alten Illustrierten, die ein Gast vor ihm liegengelassen hatte. Was für ein Schund, dachte er bei sich, mehr Bilder als Text. Kurz vor dem Ende seiner Lektüre stolperte er über den anscheinend einzigen interessanten Artikel. Er beschäftigte sich mit Ereignissen aus dem letzten Jahr und einem Serienmörder.
Da wusste Esslinger auf einmal, wen er anrufen musste.
Dienstag, 18. März, 07:45, Frankfurt Gallusviertel
Aus dem Radio plätscherte Happy, der aktuelle Chart-Hit von Pharrell Williams. Bernd Steiner summte die Melodie mit, während er seine Jeans zuknöpfte und die Frau in seinem Bett betrachtete. Sie schlief so fest wie eine Tote, war aber appetitlicher anzusehen als die Leichen, mit denen er es beinahe täglich bei seiner Arbeit zu tun bekam. Schwarze Korkenzieherlocken, grüne Katzenaugen, knackiger Körper. Ihr Name war Lorena. Angeblich. Die Schönheit stammte aus irgendeinem Nest in Italien und hatte sich in gewissen Frankfurter Kreisen den Ruf als Meisterin des Matratzensports erworben. Steiner musste zugeben, dass sie jeden Cent ihres üppigen Honorars wert war. Die Scheine steckten in einem Umschlag auf dem Nachttisch, neben einer Whisky-Flasche, zwei Gläsern und einem randvollen Aschenbecher. Steiners Blick streifte die Uhr des Radioweckers. Zeit, den Dornröschenschlaf der käuflichen Prinzessin zu beenden. Er beugte sich über ihr Puppengesicht. Ein heimtückisches Grinsen erschien unter seinem Schnauzbart. Mit Daumen und Zeigefinger presste er Lorenas Nasenflügel zusammen. Eine Mischung aus Grunzen und Keuchen drang aus ihrer Kehle. Sie schnappte nach Luft, riss die Augen auf und schlug wild um sich.
Steiner lachte rau. „Raus aus den Federn, principessa!“
Die Edel-Hure stieß eine Serie italienischer Flüche aus. „Stronzo! Du wollen mich umbringen?!?“
„Bin ich verrückt? Nen Betthasen deines Kalibers finde ich doch so schnell nicht wieder.“ Er schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen. „Aber angenommen, ich hätte dir den Hals umgedreht. Meinst du, man würde mich verdächtigen? Den Super-Bullen? Oh nein, Schätzchen. Nicht in tausend Jahren.“ Sein Zippo-Feuerzeug klickte. Eine Rauchschwade wehte durch das Schlafzimmer.
Lorena lächelte schief. „Und weil du bist grandioso, man hat dich gefeuert in München, si?“
„Hätte dir heute Nacht nicht so viel von mir erzählen sollen“, brummte Steiner. „Davon abgesehen, hat man mich in München nicht gefeuert. Ich bin nur zurück nach Frankfurt versetzt worden. Weil mein Chef und ich unterschiedliche Auffassungen hatten.“
„Naturalmente. Du mir gesagt, du hast ihn genannt eine Arschloch.“
„Selbst schuld. Er hat mich gefragt, was ich über ihn denke. Hätte ich lügen sollen? Und jetzt schwing deinen süßen Arsch aus den Federn. Mein Dienst hat vor einer Dreiviertelstunde angefangen.“
Lorena krabbelte aus dem Bett und sammelte ihre auf dem Boden verstreute Kleidung zusammen. Steiner schlug ihr mit der flachen Hand auf den prallen Hintern. Er freute sich über das klatschende Geräusch und den feuerroten Abdruck, den seine Hand auf der weißen Haut hinterließ.
Lorena stieß einen spitzen Schrei aus. „Bastardo!“
„Ich weiß, darum magst du mich“, feixte er.
Steiners Handy begann, eine Melodie zu spielen. Die Shangri-Las sangen Leader of the Pack. Bedeutete: Im Präsidium wollte man etwas von ihm. Seine Art, den Anruf entgegenzunehmen, glich dem Bellen eines wütenden Wachhundes. „Steiner! Wer stört?!?“
Während er der Stimme des Kollegen zuhörte, verengten sich seine stahlblauen Augen zu Schlitzen. „Scheiße! Ist die Spusi schon vor Ort? Rösner auch? … Der Kleine soll sich nicht in die Hosen machen. Papi kommt gleich … Herrgott, ich weiß selbst, wann mein Dienst angefangen hat! Was meinst du, was ich gerade mache, hm? Eier schaukeln? Zu deiner Information: Ich arbeite! Ermittlungen im Milieu! Verfickt kompliziert!“, blaffte Steiner und schaute Lorena beim Anziehen zu. „Ja, ich beeil mich. Rösner wird die Sache schon nicht verbocken, bis ich da bin.“ Er schmiss das Handy aufs Bett und fuhr sich durch sein dünnes, braunes Haar.
Lorena warf ihm einen besorgten Blick zu. „Schlechte Nachricht?“
„Das Übliche“, seufzte Steiner. „Vergewaltigung und Mord.“
Von Steiners Dachgeschoss-Wohnung in der Koblenzer Straße bis zum Boseweg in Goldstein benötigte ein durchschnittlicher Autofahrer etwa zwanzig Minuten. Der Hauptkommissar schaffte die Strecke in der Hälfte der Zeit. Er parkte seinen C-Klasse Mercedes hinter einer Reihe von Polizeifahrzeugen am Straßenrand und ging breitbeinig auf das Haus zu, in dem eine junge Frau missbraucht und getötet worden war.
Einige Schaulustige hatten sich vor dem Grundstück zusammengerottet. Sie wurden von uniformierten Beamten aufgefordert, sich zu entfernen. Bernd Steiner griff unter seine abgewetzte Lederjacke und fühlte die Konturen der Dienstwaffe. Am liebsten hätte er die Heckler & Koch aus dem Holster gerissen, um ein paar Kugeln über die Köpfe der Gaffer hinweg zu feuern. Der Schock würde sie vielleicht von ihrer Gier nach Sensation und Nervenkitzel heilen. Verdammte Aasgeier!
Einer der Schupos erkannte ihn und tippte sich zum Gruß an die Stirn. „Guten Morgen.“
„Ja, der Morgen war gut“, erwiderte der Ermittler, wobei er an Lorena dachte, die ihn zum Abschied umarmt hatte. „Aber ab jetzt wird`s ein Schladi.“
„Ein was?“
„Schladi. Scheiß langer Dienstag!“
Bevor Steiner das Haus betrat, zündete er sich die nächste Zigarette an und pumpte eine Ladung Nikotin in seine Lungen.
„Es geht wieder los“, sagte er leise zu sich. „Vorhang auf für eine neue Horror-Show. Wird der Scheißdreck jemals aufhören?“
Begleitet von einem Stöhnen, das nur seine Ohren hören konnten, setzte er einen Fuß über die Türschwelle.
Mitarbeiter der Spurensicherung wuselten durch die Räume, schossen Fotos, nahmen Abstriche von Schrankgriffen und Türknäufen, in der Hoffnung, einen verwertbaren Fingerabdruck zu finden. Steiner warf einen Blick in die Küche, wo Reiner Meister, Chef der Spusi, damit beschäftigt war, zwei Sektgläser zu untersuchen. Am Rand eines Glases bemerkte Steiner rote Schlieren.
„Hey, Meister!“, rief er. „Heißer Tipp: Das Rote ist kein Blut, sondern Lippenstift.“
„Danke. Darauf wäre ich ohne dich nie gekommen, Steiner“, sagte Meister ohne von seiner Arbeit aufzusehen. „Hast du vergessen, was ich dir über das Rauchen an einem Tatort gesagt habe?“
„Wen kümmert`s? In den alten Tagen hast du doch auch gequalmt wie `n Schlot.“ Vor Steiners geistigem Auge tauchten Bilder aus den 90er Jahren auf, als er bei der Frankfurter Kripo angefangen hatte, unter Führung legendärer Kriminalisten wie Manfred Gärtner oder Mike Notto.
„Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei“, entgegnete Meister. „Heute weiß ich`s besser und spare mir die Sargnägel.“
„Sieh`s positiv: Wenn ich tot umfalle, darfst du zur Abwechslung meine Leiche untersuchen.“
„Kein übler Gedanke. Dann könnten unsere Rechtsmediziner ein Gerücht überprüfen, das schon lange über dich im Umlauf ist.“
„Ach ja? Welches?“
„Dass du kein Herz hast.“
Steiner wollte zu einer Retourkutsche ansetzen, wurde aber durch eine quäkende Stimme unterbrochen, die seinen Namen rief. Das Frosch-Organ gehörte Oberkommissar Johannes Rösner. Der bebrillte Jungspund, wie immer in einen dunklen Anzug nebst Krawatte gehüllt, war seit einigen Wochen Steiners neuer Partner. Der Hauptkommissar nannte ihn Jo-Jo, weil der Vorname Johannes seiner Meinung nach nicht zum asiatischen Aussehen des Kollegen passte, der in Vietnam geboren und von deutschen Adoptiveltern aufgezogen worden war.
„Gut, dass Sie eingetroffen sind, Herr Steiner. Ihre Sachkenntnis ist vonnöten“, sagte Rösner, korrekt und monoton wie die Sprachausgabe eines Computers.
„Is` ja ganz was Neues, Jo-Jo. Hab gedacht, du wärst einer von den diplomierten Schlaumeiern, die auf die Meinung der alten Hasen keinen Wert legen.“
„Wo denken Sie hin? Sie wissen, wie sehr ich Ihre Verdienste schätze, auch wenn ich nicht mit jeder Ihrer Methoden konform gehe. Außerdem kenne ich den Wert des Sprichworts vier Augen sehen mehr als zwei.“
„Wozu brauchst du mich dann?“, fragte Steiner und tippte gegen Rösners Brillengestell. „Vier Augen hast du doch schon.“
Rösner verzog keine Miene.
Bernd Steiner schüttelte den Kopf. „Unser Chef hat mir gesagt, ich soll dir was beibringen. Merk dir eins: Humor erleichtert unsere beschissene Arbeit.“
„Ich werde es mir einprägen.“ Rösner zückte sein Notizbuch.
„Genug Small-Talk für heute. Will mir die Tote ansehen. Wo liegt sie?“
„Das Opfer liegt im Schlafzimmer, im oberen Stockwerk. Folgen Sie mir!“
Die Ermittler liefen die Treppe hinauf.
Als sie das Zimmer betraten, schlug ihnen ein scharfer Urin-Gestank entgegen. Die Ermordete hatte im Todeskampf ihre Blase auf dem Bettlaken entleert. Sie lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Futonbett. Ein seidenes Nachthemd hing in Fetzen von ihrem nackten Körper. Würgemale prangten am Hals, blaugrüne Hämatome an der Wange, den Schultern und dem Rücken. Die Beine waren weit gespreizt. Aus ihrer aufgerissenen Vagina hatte sich ein Blutschwall auf den Parkettboden ergossen. Neben der angetrockneten Lache lag das Werkzeug der grausamen Tat – der Hals einer zerbrochenen Sektflasche.
Steiner schluckte. „Verdammtes Schwein!“
„Der Tod ist durch den Bruch eines Nackenwirbels eingetreten. Einer ersten Schätzung nach zwischen ein und drei Uhr heute Nacht“, erklärte Rösner. „Unklar ist noch, ob die Verstümmelungen im Genitalbereich post mortem zugefügt worden sind. Darüber wird die rechtsmedizinische Untersuchung Aufschluss geben.“