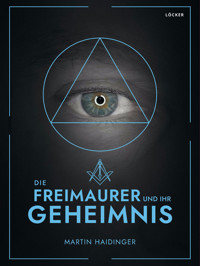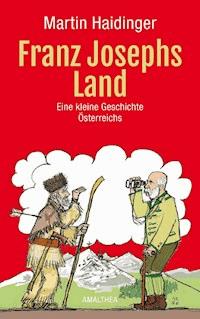Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte Österreichs aus der Sicht des "kleinen Mannes" und der hohen Politik Die Alpenrepublik ist das Land der Jedermänner und -frauen – und das nicht erst seit der Uraufführung von Hofmannsthals Festspiel-Klassiker 1920. Doch wer ist der Jedermann? Ein elastischer Diplomat oder ein gesinnungsloser Lump? Jedenfalls hat er gut lachen, denn seit der Gründung der Republik 1918 hat er's weit gebracht. Wie hat Österreich seine unglaubliche Verwandlung vom ärmsten Land Europas zu einem der reichsten der Welt geschafft? Folgen Sie Martin Haidinger bei seinem rasanten Ritt durch 100 Jahre österreichischer Geschichte: vom "Kaiserschnitt" 1918 über das "Lager-Feuer" der 30er-Jahre, den "An- und Abschluss" in der Nazizeit, den Aufbau nach 1945 samt Identitätskrisen, Betonkoalitionen und Reformen unter "K. u. K." (Klaus und Kreisky), böse Buben wie Haider bis hin zu Österreich als Auffang- und Durchgangsland für Flüchtlinge aller Art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Haidinger
Jedermanns Land
Österreichs Reise in die Gegenwart
Ich widme dieses Buch in Liebe und Dankbarkeit meiner Mutter Herthaund dem Gedenken an meinen Vater Hans Haidinger († 2005).
Sie haben mir ermöglicht, meiner Passion für die Geschichte nachzugehenund damit jene Berufe zu erlernen, die ich heute ausübe.
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2018 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagzeichnungen: © Markus Szyszkowitz
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,3/13,45 pt. Minion Pro
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-124-5
eISBN 978-3-903217-07-2
Inhalt
Am Beginn:Die Zeitmaschine
Meines Vaters Bruder
Bühnenspiele
Willkommen im Karl-Theater!
Politik
Karl Lueger (1844–1910)
Karl Marx (1818–1883)
Karl Renner (1870–1950)und Karl Seitz (1869–1950)
Karl May (1842–1912)
Karl Kraus (1874–1936)
Kaiser Karl I. (1887–1922)
Schwimmkurs im Eiswasser1918/1919
Bilanz des Grauens
Abgang der Edelmänner
Kaiserschnitt mit Zangengeburt
Koalition – »so leid es uns tat« – und ein Friedensdiktat
Tagesverfassung(en)1920–1927
Jedermanns Lager
Seipels Schilling
Selbstfindung: Der Österreichische Menschund andere Kopfgeburten
Volk in Waffen
Lager-Feuer1927–1933
Startschuss
»Hinaus mit dem Schuft!«Fake News und Lügenpresse
Roter Sinkflug, rechter Aufwind
Das Land der tristen Stimmungund des Wiener Schmähs
Demokrexit
Kleine Leute1934–1938
Der tiefe Graben
Die undichte Diktatur
Öxit
Niedertracht und Todeszonen1938–1948
Höhenflug
Entäußerung
Erniedrigung
Kunst und Kirche
Täter, Opfer und der Rest
Der letzte Akt
Kaltstart
Ost-West-Passage1948–1966
Agentenstadl
Heile Welt in Zuckerlfarben
Der Balkonstaat
Fahrt in die Vergangenheit
K. u. k. Moderne: Klaus und Kreisky1966–1983
Der Klaus-Effekt
1968 auf Österreichisch und die Geburt der Ära Kreisky
Sonnenkönig Brunos Glück und Ende
Der Ruf Europas1984–1999
Mundgeruch und böse Buben
Revitalisierte Reichsidee?
Das hässliche Entlein und die Reaktion2000–2015
Gegendemokratie
Reform, Erosion, Korruption
Reaktion
Epilog: Nord-Süd-Route2015–2018
Bildnachweis
Danksagung
Namenregister
Jeeeeedermaaaaannn!«, hallt es seit bald 100 Jahren allsommers über den Salzburger Domplatz. 1920, anlässlich der ersten Salzburger Festspiele, bringt Regisseur Max Reinhardt den »Jedermann« als Spiel vom Sterben des reichen Mannes auf diese prominente Freilichtbühne. Es ist an mittelalterliche Mysterienspiele angelehnt und vom Dichter Hugo von Hofmannsthal in Worte gesetzt worden.
Ein Kritiker attestiert der Kunst des Hauptdarstellers Alexander Moissi anerkennend »grausame Sorglosigkeit«. Als »Welttheaterschwindel« verbellt dagegen der bissige Publizist Karl Kraus die dramatischen Festspielaufführungen und beklagt sein eigenes Schicksal als Kritikus, dem »beschieden ist, nichts mitzumachen, aber alles zu erleben«. Kraus verspottet die »heilige Dreieinigkeit der Herren Reinhardt, Moissi und Hofmannsthal«, »zu deren Ehren auch wieder die Kirchenglocken läuten, die so lange nur als Mörser zu uns gesprochen haben«. Der Erste Weltkrieg liegt noch nicht lange zurück.
Der »Jedermann« ist Künder einer Welterneuerung im Geist des Barock. Er ist rückwärtsgewandt und antimodern. Trotzdem scheint es, als ob seine Figuren in vorlauter Anwandlung Kommentare zu jeder Phase österreichischer Geschichte der kommenden 100 Jahre parat hätten …
Am Beginn:Die Zeitmaschine
Jedermann:Bins nit bewußt für meinen Teil,Weiß nit, für wen du mich willst nehmen.
Ein Star bei der Arbeit: Alexander Moissi gibt 1920 den ersten Salzburger Jedermann.
Hoppala! Unversehens werde ich in eine Zeitmaschine geschubst und gleite Jahrzehnte zurück. Ohne Vorbereitung! Kaltstart. Es ist die ungewöhnlichste Reise, die sich denken lässt. Sie beginnt an einem dunklen Spätnachmittag des Jahres 2004. Mitten in Wien. Unversehens werde ich zu:
MEINES VATERS BRUDER
»Darf ich vorstellen: mein Bruder.«
»Ähhh … sind Sie sicher?
Es war nicht das erste Mal, dass mein Vater im Krankenhaus lag. Bei einem 85-Jährigen ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Leiden aller Art bemerkbar machen. So war ich aus der finsteren spitalseigenen Tiefgarage in die grell erleuchtete Oberwelt aufgetaucht, die langen Gänge entlanggewandert und hatte das Zimmer betreten, in dessen Türschildhalterung ein Zettel mit dem Namen »Johann Haidinger« steckte.
»Das ist doch sicher nicht Ihr … Bruder, Herr Haidinger.«
Sofort ahnte ich etwas. »Lassen Sie nur«, beruhigte ich die Stationsschwester und zwinkerte ihr zu. Als sie den Raum verließ, streifte mich ihr prüfender Blick – 50 Jahre Altersunterschied zwischen mir und Johann Haidinger wären doch ein bisschen viel für ein Brüderpaar gewesen …
Ich setzte mich ans Bett. »Wie geht’s dir?« Eine naheliegende Frage.
»Ah geh, das weißt du ja eh!«
So rüde pflegte mir der Papa sonst nicht zu antworten. Mein Verdacht erhärtete sich – ich war für ihn gar nicht ich. Ich war jemand anderer.
»Kalt ist es halt«, seufzte er.
»Kalt? Hier, im gut geheizten Krankenzimmer? Wie denn das?«
»Was fragst du so? Der kalte Winter! Die Mutter hat doch nicht genug …«
Und dann folgte eine persönliche Geschichte, ein Tadel für … mich? Nein, für seinen Bruder! Tatsächlich hatte mein Vater einen eineinhalb Jahre jüngeren Bruder. Da musste irgendetwas gewesen sein, in dem kalten Winter. »Welches Jahr meinst du?«
»’34. Du weißt doch – der kalte Winter 1934.«
Jetzt war es offensichtlich. Mein alter Herr war durch eine Art Spitalsschock mental abgekippt und geistig in die Kälte des Jahres 1934 zurückversetzt worden. Damals war er noch nicht 15 Jahre alt gewesen. Und ich saß hier an seinem Bett und war für ihn jener Bruder Josef, den ich als Onkel Pepi kannte und der aktuell auch schon 83 Lenze zählte. In diesen magischen Minuten war ich Johann Haidingers Bruder, der 13 Jahre alte Pepi, dem er wegen irgendwelcher kleinen Nachlässigkeiten – zumindest verbal – die Ohren langzog. Nicht zu fassen, ich saß in einer Zeitmaschine. Solch Erkenntnis ist ein bewegender Moment, vor allem, wenn er den eigenen Altvorderen betrifft. Doch ich fasste mich und fing – behutsam – an zu fragen.
Und dann ging’s los. Familiäres, Persönliches kam zutage, Erzählungen, Geschichten, Eindrücke, die ich so nie zuvor aus dem Mund meines Vaters gehört hatte. Er sprach klar, deutlich und anders als sonst, mit fast jugendlicher Stimme. Zwar wunderte er sich, dass der kleine Pepi, also ich, so dumme Fragen stellte, weil ich das ja »eh« alles wissen müsste … Trotzdem sprudelten die Geschichten vom bitterarmen Leben in der kleinen Bassenawohnung (Wasser und Klo am Gang) in der Wasnergasse in der Brigittenau (das war und ist der 20. Wiener Bezirk) und vom arbeitslosen Vater, der mit einem Lungenschuss aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen war und als Arbeiter 20 Jahre lang keine Chance auf eine fixe Beschäftigung hatte und das wenige Geld, das er zitherschlagend bei den Heurigen und in den Wirtshäusern verdiente, an Ort und Stelle gleich wieder versoff.
Von der Mutter, die den Mann und die zwei Söhne als Wäscherin in Eigenregie schlecht und recht über Wasser hielt und deren Kunden vor allem die jüdischen Familien im Haus waren.
Von den rivalisierenden »Platten«, den Kinderbanden zwischen der Brigittenau, dem Prater und der Leopoldstadt (2. Bezirk), und den Umwegen, die der Wasnergassler oft nehmen musste, um die Reviergrenzen nicht zu verletzen.
Von der Leseleidenschaft, die er entwickelte und die ihn alle (!) 91 (oder gab es gar noch mehr?) Karl-May-Bände verschlingen ließ.
Von den frühen Kinoerlebnissen, dem Stummfilm-Westernhelden Tom Mix oder dem opulenten Fritz-Lang-Filmepos »Die Nibelungen«, das vom Pepi entweiht wurde, der im Wallenstein-Kino nach der heimtückischen Ermordung Siegfrieds durch den fiesen Hagen von Tronje mitten in die ergriffene Stille des Publikums laut und deutlich seinem älteren Bruder die Frage stellte: »Hansi, ist der Tom Mix jetzt tot?« Nie wieder, so der wütende Hansi, wolle er den dummen Pepi ins Kino mitnehmen.
Von Hansis Lieblingstante, die in Kaisermühlen wohnte und die ihm für seine Besuche das Fahrgeld für die Straßenbahn zusteckte, das er lieber fürs Kino zweckentfremdete und dafür den einstündigen Fußmarsch in Kauf nahm.
All diese Basis-Geschichten waren mir an jenem Tag des Jahres 2004 aus langjähriger familiärer Erzählung zwar bereits bekannt gewesen, doch gerade aus dieser Detailkenntnis heraus konnte ich die neuen Eindrücke der Zeitmaschine deuten und die richtigen Nachfragen stellen.
Etwa eine Dreiviertelstunde dauerte die Reise ins Wien des Winters 1933/1934. Es waren bittere Momente, aber auch heitere Aspekte, die der 14 Jahre alte 85-Jährige Revue passieren ließ. Zwei Motive zogen sich durch: Er hungerte zwar nicht, aber er fror. (Hansi bekam erst mit 16 Jahren seine erste lange Hose.) Und er sprach in dieser mentalen Rückführung nicht über Politik. Überhaupt nicht. Nicht einmal der Februaraufstand von Teilen des sozialdemokratischen Schutzbundes, der auch als Bürgerkrieg des Februar 1934 bezeichnet wird, kam vor. Und das, obwohl doch seine Familie davon zumindest emotional betroffen gewesen sein musste; der arbeitslose Vater war ein naturgewachsener Sozialdemokrat, ebenso die Mutter. Bis heute ist dieser Februaraufstand in Österreich Auslöser überschäumender Emotionen und Wechselstube politischen Kleingelds.
Um nichts davon ging es bei meines Vaters rasanter Fahrt bis auf die Felgen seiner Jugend, sondern um ganz anderes: Heizen, Essen, Eltern, Sorgen, Leben. Keine wohlabgewogene, weise Rückschau, bloß eine Äußerung aus der Situation heraus, als wäre sie 1934 in ein Mikrofon gesprochen und die Aufnahme seither nicht mehr bearbeitet worden. »Unplugged« nennen es Studiomusiker, einen »eingefrorenen Posthornton« etwas poetischer gestrickte Anhänger deutscher Literatur. Mit dem entscheidenden Bonus, dass ich Fragen stellen und Einwände bringen konnte.
Wie viele Zeitzeugen (für was auch immer) habe ich als Historiker vor und nach meinem Vater befragt und als Journalist interviewt. Wie viele gewichtige und bedeutsame Persönlichkeiten waren darunter. Aber keiner von ihnen hat mich so wie er in einer Zeitmaschine mitgenommen.
Das Ganze ging mir natürlich nahe, aber vor allem dämmerte mir, wie kurz 70 Jahre Distanz sein können und dass keine Rückschau Nachgeborener auf vergangene Zeiten jemals allen Aspekten des Gewesenen, des Stattgefundenen gerecht werden kann. Was ist denn wichtig, und was nicht? Gegen selbst Erlebtes und subjektiv Empfundenes kann der geschliffenste Historiker nicht anstinken, mag er akademisch gesehen tausendmal recht haben. Und das Ausgestandene bleibt irgendwo in uns gespeichert – ein Leben lang. Andererseits kann ein Würstchen, während es in seinen Zeitumständen wie in einem Sandwich eingeklemmt ist, die Konturen weiterer Zusammenhänge im großen Würstelstand selten ermessen. Eine aussagekräftige Gesamtschau wird erst im Nachhinein möglich. Die Würstelstandsrevision (mit oder ohne Senf und Kren) nennt man dann Geschichtsschreibung.
Deshalb wird es auf dieser Reise Richtung Österreichs Gegenwart auch nicht nur um hohe Herren (und Damen), sondern um die Jedermänner und -frauen gehen, ihre Schicksale, ihre Ideen, darüber, was sie ersehnten und erlitten, woran sie sich erinnern und was sie lieber vergessen würden.
Die Zeitreise von Vater und Sohn ist übrigens ein einmaliges Ereignis geblieben. Wenige Tage danach war der alte Herr wieder daheim und klar bei Sinnen.
»Wie geht’s dir?«
»Danke, bestens. Hast du schon von der Netrebko gehört, dieser neuen jungen Opernsängerin? Diesem russischen Sopran? Die soll ja …«
Uff! Gott sei Dank! Er war zurück im Jahr 2004. Alles wieder beim Alten.
BÜHNENSPIELE
Für die Oper hatte Papa Haidinger ein großes Faible, das er auch mir vererbt hat. Vielleicht liegt das in den Psycho-Genen der alten Wiener? Lästerzungen vergleichen Österreich gerne mit einem Operettenstaat, und ein freches Sudelstückchen der 1970er-Jahre von Otto M. Zykan war gar Staatsoperette betitelt.
Theater soll zu Recht der künstlerischen Freiheit unterliegen und zuweilen nicht mit grellen Farben geizen. Derbheiten inklusive. Immerhin ist Österreich das Land der großen Scheltredner. Beginnend im 17. Jahrhundert mit den kurzweiligen Predigten eines Abraham a Sancta Clara, zieht sich diese Tradition bis in die Gegenwart zu dem schon etwas weniger kompakten Peter Handke (Publikumsbeschimpfung, 1966: »Kriegstreiber«, »Glotzaugen«, »Rotzlecker«, »Untermenschen«, »Gernegroße«, »Gauner«, »Schrumpfgermanen«, »Ohrfeigengesichter«), dem üppigen Spätwerk Thomas Bernhards in den 1970er- und 1980er-Jahren, und den redundanten Bühnenspielen der Trägerin des Literaturnobelpreises 2004, Elfriede Jelinek. Von ihren Fans in Politik und Kulturszene auf den Schild gehoben, sorgten sie für programmierte Skandale, die im Sinne dieser Eliten schöne Publicity und guten Verdienst einbrachten. Gesellschaftlichen Wandel bewirkten sie erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, als diese Art von Literatur in die Lehrpläne der Schulen Einzug gehalten hat, im Deutschunterricht nicht nur die letzten marginalen Reste des klassischen Kanons aus Goetheschillergrillparzer verdrängte, sondern auch immer mehr mit Geschichte verwechselt wurde und im einschlägigen Unterricht an die Stelle echter Quellenkunde getreten ist. Ein Missverständnis.
Denn selbst der geniale Herr Karl-Monolog (1961) von Carl Merz und Helmut Qualtinger sagt weniger über die breite Palette an tatsächlichen Lebenswelten der 1930er- und 1940er-Jahre aus als vielmehr über den Zustand der österreichischen Gesellschaft der 1960er, die belustigt bis schockiert auf diesen Text reagierte, das ganze Ausmaß seiner Doppelbödigkeit aber kaum begriff. Ganz zu schweigen von künstlerischen Aktionen der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre mit immer wiederkehrenden stereotypen Requisiten wie Hitlerbärtchen, SA-Uniformen und Holzpferden von Alfred Hrdlicka über Christoph Schlingensief bis Hubsi Kramar. Ihr Aktionismus verdient Beachtung im Rahmen kulturgeschichtlicher Abhandlungen, ist vielleicht noch aufschlussreich für elitäre Diskussionen seiner Entstehungszeit, bleibt aber für die Analyse der historischen Vorgänge, auf die er sich beziehen will, weitgehend wertlos.
Trotzdem werden wir jetzt für eine ganz schöne Zeit in einem speziellen, großen Theater verweilen, dessen Akteure nämlich tatsächlich Geschichte gemacht haben und noch machen. Seine Bühne misst knapp 840 000 Quadratkilometer, hat mittlerweile achteinhalb Millionen Mitspieler am Ort und ein paar Externisten. Sie geben das Stück eines Landes, das vor 100 Jahren aus einem ramponierten Großreich herausgebrochen wurde und mit einem hungernden Volk inmitten eines kriegsbeschädigten Europa angefangen hat. Heute besteht es aus übergewichtigen Wohlstandsbürgern und ist das zehntreichste Land der Erde. Vor 100 Jahren erlebten nur rund zwei Drittel aller Neugeborenen den 30. Geburtstag; gegenwärtig liegt die statistische Lebenserwartung der Österreicher bei 80,7 Jahren, und sie wäre noch höher, würden sich hierzulande nicht so viele frühzeitig zu Tode saufen.
Das Leib- und Magenstück dieser Bühne ist der Jedermann, eine kleinere Variante des Doktor Faust – ohne Teufelspakt, dafür mit Prass, Völlerei, Wehleidigkeit, Reue und Himmelfahrt. Eine verdächtig österreichische Melange.
Aber auch in anderer Hinsicht ist die Alpenrepublik das Land der Jedermänner und -frauen. Ihre Grenzen sind seit jeher nicht ganz dicht. Jedermann kann hier ein und aus gehen, und gerade deshalb gebiert es neben langweiligen Systemerhaltern auch immer wieder Kreative von Weltrang und zwischendurch auch einmal ideologische Narren. Manche sehen im österreichischen Jedermann des 20. Jahrhunderts einen elastischen Diplomaten, andere einen gesinnungslosen Lumpen; doch sitzt ihm hier wie da stets der Schalk im Nacken. Selbst wenn der Tod ihm winkt, ist die Lage hoffnungslos, aber nicht ernst. Er hat gut lachen, denn er hat’s im Lauf eines Jahrhunderts ganz schön zu etwas gebracht und eines der lebenswertesten Fleckchen dieser Erde geschaffen – eine schier unglaubliche Verwandlung. Wie hat er das nur hingekriegt?
Tja, offenbar waren Inszenierung und Regie doch nicht so schlecht. Obwohl sie etwas schleppend begannen, dann fatale Schwächen entwickelten, sich zwischendurch einmal in die Selbstauslöschung verabschiedeten, um dann zurückzukehren und durchzustarten. Wir werden vor allem jenes Ensemble von Geistern und Gestalten kennenlernen, das Österreich ins 20. Jahrhundert hievte und bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg trug, um dann noch Szenen der letzten Jahrzehnte zu betrachten, die viele von uns selbst erleb(t)en.
Auf der Bühne unseres Welttheaters und hinter seinen Kulissen bewegen sich jede Menge Darsteller, Hauptpersonen und Nebenfiguren, Solisten und Komparsen, Regisseure, Dramaturgen und Strippenzieher, Beleuchter und anderes Bühnenpersonal. Vorhang auf für unsere Österreich-Vorstellung der letzten 100 und mehr Jahre!
Willkommen im Karl-Theater!
Jedermann:Wir sind gute Christen und hören Predig,Geben Almosen und sind ledig.
Der größte Karl seiner Zeit: Karl Kraus, unerbittlicher Kritiker österreichischer Realitäten
Im Carl-Theater in der Wiener Praterstraße gingen von 1847 bis in die Zeit zwischen den Weltkriegen jede Menge Blockbuster über die Bühne. Johann Nestroys Revolutionsposse Freiheit in Krähwinkel hatte 1848 hier ebenso Premiere wie 1899 Johann Strauß’ Operette Wiener Blut. Sein Betreiber hieß originellerweise Carl Carl – ein Superkarl sozusagen!
Die alte Bühne ist zwar 1951 abgerissen worden, dafür eröffnen wir unser eigenes Karl-Theater. Warum wir es so nennen? Nun, neben Johann, Josef und Franz war Karl seinerzeit der gängigste männliche Vorname. Wundern Sie sich also nicht, dass ihn so viele Protagonisten des folgenden Stücks tragen. Das Spiel wird erhellen, wie die Österreicher ticken, welchen Einflüssen sie ausgesetzt sind und in welcher geistigen Verfassung sie ins 20. Jahrhundert aufbrechen.
Ehe die Herrn Karln auftreten, sei zunächst einmal ein Schnellflug über das Panorama der Politlandschaft der entwickelten Welt unternommen. In diesem Buch geht es unter anderem um:
POLITIK
Politik ist die Organisation des Zusammenlebens der Menschen. Nichts weiter. Und doch so viel mehr. Denn unter menschlichem Leben versteht man ja nicht nur den körperlichen Stoffwechsel, selbst wenn es ohne ihn nicht geht. Genau wie einzelne Individuen den Sinn ihres Lebens suchen, richten die meisten Organisatoren des Zusammenlebens den Zweck der Politik auf ein höheres Ziel hin. Solche nennt man Ideologen.
Die urtümlichste Form der Ideologie ist noch vor der Philosophie die Religion. Sie setzt den Sinn der Politik mit dem Hang hin zu Gott oder Göttern gleich, aber nicht bloß das Streben des Einzelnen, sondern vieler, möglichst aller Mitglieder einer Gemeinschaft. Deren Bekenntnis zur gemeinsamen Religion ist die Einwilligung in das friedliche Zusammenleben. Sie wird in öffentlichen Ritualen beschworen und ständig erneuert. Als wichtige Demonstration dieses Prinzips galt in Österreich früher die katholische Fronleichnamsprozession.
Wer sich dem verweigert, signalisiert, dass er es nicht gut meint mit der Gemeinschaft oder gar Böses gegen sie im Schilde führt.
Skeptisch ist man nicht nur gegen Verweigerer von innen, sondern auch gegenüber dem von außen Kommenden, dem Fremden, dessen Gesinnung man vorerst nicht überprüfen kann. Hier helfen Glaubensbekenntnisse, die sich möglichst stammesübergreifend und überregional mit Gesten und Worten als Erkennungszeichen eignen. Das Kreuzzeichen und das gesprochene Glaubensbekenntnis des Christentums stehen dabei in einer langen Kette von früheren und nachkommenden kultischen Formeln, die den Gleichklang und Gleichschritt der Gläubigen ausdrücken.
Im Islam, dessen Sitten und Gebräuche für das Österreich des 21. Jahrhunderts immer wichtiger werden, hat das Glaubensbekenntnis, die Schahāda, gar bindenden Charakter als Initiationsformel, also als Beitrittserklärung. Wenn sie der bis dahin Ungläubige laut und »in aufrichtiger Absicht« ausspricht, reiht er sich damit gültig in die Schar der Muslime ein. Und dabei geht es vorderhand nicht um eine innerliche Glaubensüberzeugung, sondern um ein Bekenntnis zu einer Gemeinschaft hier auf Erden, also um einen politischen Willensakt. »Confession« statt »Faith«, wie der englische Aufklärer Thomas Hobbes es beschreibt.
Dadurch ist im Lauf der Geschichte ein Bekenntnisdruck entstanden, der sich nach dem Ende der europäischen Religionskriege und dem Aufbruch der Aufklärung, als aus den einzelnen Gemeinschaften die viel komplexere »Gesellschaft« wird, nahtlos auf die neuen nationalen Bekenntnisse überträgt; und danach, ab dem Zeitalter der Moderne (in Österreich mit seinem Brennpunkt Wien ist das erst in den 1880er-Jahren) in Ergebenheitsübungen gegenüber sogenannten politischen »Lagern« oder Parteien gipfelt; samt Grußformeln, Glaubensbekenntnissen, Heiligenverehrung, Pilgerfahrten und Prozessionen. Sie entwickeln ihre eigene Lagermentalität und Parteimoral mit Anhängern, Eiferern und Fanatikern. Mit dem Fanatismus ist der englische Ausdruck »Fanatical Supporter«, abgekürzt »Fan«, eng verwandt. Er braucht längst keine Religion mehr, um sich zu entfalten.
Sofort kristallisieren sich in allen Lagern mehrere Typen von Parteigängern heraus: jene, die zu orthodoxem, also machtkonformem Wohlverhalten tendieren, und solche, die etwas verändern wollen oder zum Rebellentum neigen und ganz grundsätzlich auf der »anderen Seite« stehen. Musterschüler und Ketzer markieren psychologisch erklärbare Facetten menschlichen Naturells, sie sind bei Links wie Rechts zu finden. Die dritte Gruppe ist jene der notorisch Gleichgültigen, der politischen Nullgruppler. Ihre Stunde schlägt in Österreich etwa 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ironischerweise genau in jener Phase, da die 68er-Bewegung versucht, alle Lebensbereiche zu politisieren. Die Postmoderne (in Österreich wie so vieles verspätet) und die Konsumgesellschaft haben den gesellschaftlichen Druck, sich einer weltanschaulichen Gruppe unter- oder einzuordnen, aufgelöst und ins Gegenteil verkehrt, nämlich den gesellschaftlichen Hang zur Beliebigkeit: Wer etwas meint, ist out, wer an etwas glaubt, ist deppert. Dieser Zustand geht unmittelbar in die sogenannte »Politikverdrossenheit« über.
Wenn wir Heutigen allerdings in die Geschichte der letzten 100 Jahre zurückblicken wollen, müssen wir uns geistig von dieser Politikverweigerung und dem vertrauten Tandelmarkt frei wählbarer Ideologien auf Zeit und täglich wechselnder Weltanschauungen lösen. Denn die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kannte Heroen, Idole, Leitfiguren und Vorbilder, die leidenschaftlich umstritten waren, geliebt und gehasst wurden und zu denen sich Menschen massenhaft bekannten. So richtig aktionsfähig wurden die politischen Führer unter ihnen im Jänner 1907 mit der Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts für alle Männer ab 24 Jahren. Bis dahin durfte, abgestuft in »Kurien«, vor allem wählen, wer Geld besaß und Steuern zahlte, sogenannte »Steuerträger«. Deshalb hatten konservative Aristokraten und Großgrundbesitzer auf der einen und liberale Unternehmer und Industrielle auf der anderen Seite das Parlament, den »Reichsrat«, de facto für sich gepachtet.
1907 wurde alles anders. Erst das Prinzip »One man, one vote« lieferte die Grundlage dafür, dass der Wille der Massen des österreichischen Reichsteils im Parlament abgebildet wurde, wenn auch der Reichsrat nicht annähernd die Kompetenzen hatte wie das heutige Parlament in der demokratischen Republik. Die Regierung wurde vom Kaiser berufen und war nur ihm verantwortlich. Im anderen Reichsteil, dem Königreich Ungarn, galt überhaupt bis zum Schluss für den dortigen Reichstag das nach Besitz und Steuerleistung abgestufte Klassenwahlrecht. Im österreichischen Reichsrat bildeten neben den Deutschen auch die anderen Nationalitäten ihre eigenen Fraktionen und vertraten die Interessen von Tschechen, Slowenen, Südslawen (Kroaten und Serben), Polen, Ukrainern (die man damals Ruthenen nannte), Italienern, Rumänen und Juden. Einige von ihnen waren es, die den Reichsrat über weite Strecken handlungsunfähig machten, indem sie sich gegenseitig mit Schimpftiraden, Dauerreden oder bloßer Verweigerung aushebelten. Besonders die tschechischen Abgeordneten erwiesen sich, wenn ihnen etwas nicht passte, als Meister dieser sogenannten »Obstruktionspolitik«. Aber auch die anderen noblen Herren Abgeordneten beschimpften einander aufs Gröbste, wie der 1897 im Publikum sitzende amerikanische Schriftsteller Mark Twain (Stirring Times in Austria) bemerkt und protokolliert: »Schandbube, elender«, »Gassenjungen«, »Judenknecht«, »[…] die Großmutter auf dem Misthaufen erzeugt worden«, »Sie Judas«, »Bordellritter«, »Ostdeutsche Schundsau«, »Halt den Mund, elender Lausbub du«, »Ehrabschneider«, »Haderlump«, »Spitzbube«, »Bordellvater«, »polnischer Hund« …
Damit hier jedoch kein falscher Eindruck entsteht: Die Monarchie hat einige sehr vernünftige und brauchbare Gesetze gebracht, die noch lange nachwirken, so vor allem das Staatsgrundgesetz von 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, das mit einigen Zusätzen bis heute in Österreich Verfassungsrang hat. Darin sind folgende wichtige Grundrechte festgelegt: Freiheit und Freizügigkeit der Person, Gleichheit vor dem Gesetz, Unverletzlichkeit des Eigentums, Freiheit der Wissenschaft, Religions- und Versammlungsfreiheit, das Briefgeheimnis und die Meinungsfreiheit, die damals Presse- und Gewissensfreiheit genannt wird. Die Habsburgermonarchie war zwar keine Demokratie, aber ein Rechtsstaat.
Mir ist bewusst, dass das jetzt ein kleines Politik-Seminar wird, aber bleiben Sie dran! Es lohnt sich, wenn wir die Herren Karln verstehen wollen. Und die wiederum lassen uns Österreich begreifen – wenn das überhaupt möglich ist. Konzentrieren wir uns auf den österreichischen Reichsteil, den man inoffiziell nach dem Grenzfluss Leitha »Cisleithanien« nannte, der indes so amtlich wie schwammig »Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder« hieß, und blicken wir hier wieder auf diejenigen, die dann 1918 das Staatsvolk der jungen Republik bilden würden: den Großteil der deutschsprachigen Österreicher, oder – wie man damals sagte – der Deutschen der Monarchie.
Die bis dahin bedeutenden »Honoratiorenparteien« der wirtschaftsstarken konservativen und liberalen Eliten verloren bei der Reichsratswahl im Mai 1907 an Stimmen und Einfluss, und es traten jene großen drei Richtungen ins parlamentarische Rampenlicht, deren Hauptdarsteller zum Großteil aus der vormals sogenannten »Deutschen Linken« des 19. Jahrhunderts hervorgegangen waren und im jungen 20. Jahrhundert Politik machen sollten: zum einen die deutschnationalen Parteien unter der Führung von Männern wie Karl Hermann Wolf (dem ersten Karl in unserer Sammlung, der vom politischen Selbstzerstörungstrieb seines Vorläufers Georg Ritter von Schönerer profitierte), die vor allem dort viel Zuspruch erhielten, wo die Deutschen der Monarchie in einer Grenz- oder Konfliktsituation mit anderen, meistens slawischen Nationalitäten standen, also in Böhmen, Mähren, Kärnten und der Steiermark; und zum Zweiten in den Städten wie Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Brünn mit ihren antiklerikalen Bürgern, Akademikern und Studenten. Zum anderen die Sozialdemokraten, die sensationelle Zweitstärkste wurden. Und zum Dritten die Christlichsozialen, die als stärkste Kraft fast alle Wahlkreise des heutigen Österreich gewannen, darunter auch Wien. Auch wenn sich bei der folgenden Wahl 1911 die Reihenfolge umdrehte und die »Roten« an den christlichen »Schwarzen« (die von ihren Gegnern nach der Farbe der katholischen Priestersoutanen so benamst wurden) vorbeizogen, war der imposante Gründer und Chef-Karl der Schwarzen bis weit über seinen Tod 1910 hinaus eine Identifikationsfigur für seine große Anhängerschaft:
KARL LUEGER (1844–1910)
Seine Freunde nennen ihn den geborenen Volkstribun, seine Gegner charakterisieren ihn als Populisten reinsten Wassers. Vollmundig lässt er bei Wählerversammlungen sein donnerndes Organ hören und verliert dabei die Stimmung in der Menge keinen Moment aus den Augen. Der groß gewachsene Anwalt von der Wieden (heute der 4. Wiener Bezirk) mit dem charakteristischen blonden Haar und Bart (genannt »der schöne Karl«) kommt ursprünglich aus der liberalen Richtung und hat gemeinsam mit Georg Schönerer und dem Wiener Arzt Victor Adler 1882 am »Linzer Programm« mitgeschrieben. Das war ein deutschnationales und vor allem das erste große sozialpolitische Manifest Österreichs.
Da der »Rassenantisemit« Schönerer es aber bald auf scharf Antijüdisch umschrieb, verabschiedeten sich sowohl der Jude Adler als auch der Pragmatiker Karl Lueger aus der gemeinsamen deutschnationalen Bewegung und gründeten jeweils ihren eigenen Laden. Während Adler bald einen Flohzirkus politischer linker Sekten zu bändigen hatte, war es im Fall der christlichsozialen Bewegung Lueger, der sich geschmeidig deren diversen Strömungen anpasste, um 1893 der Gründer und Führer der »Christlichsozialen Partei« zu werden. Christlich nannte sie sich vor allem aus zwei Gründen: Sie richtete sich gegen die globalisierte, liberalkapitalistische Wirtschaftsordnung als deren Hauptrepräsentanten sie wiederum die »Finanzjuden«, also Unternehmer und Bankiers jüdischer Herkunft, bezeichnete, woraus sich der zweite »christliche« Aspekt ergibt. Der katholische Vordenker und Freund Luegers, Karl von Vogelsang (1818–1890), hatte das auf die Formel gebracht: »Antisemitismus ist eigentlich Anticapitalismus.«
Nun war der »schöne Karl« aber ursprünglich weder besonders antisemitisch eingestellt gewesen, noch je als besonders christkatholisch aufgefallen – eher im Gegenteil, er galt als Liberaler, manchen sogar als Linker! Als er aber erkannte, wohin der Zeitgeist in weiten Volksschichten Cisleithaniens, vor allem in der Reichshaupt- und Residenzstadt, wehte, ersann er für sich die ideale ideologische Wiener Melange, um an die Spitze der Macht in seiner Heimatstadt zu klettern: Er verrührte antiliberale und antisemitische mit antiungarischen Elementen, betonte ostentativ den »deutschen Charakter Wiens«, zugleich die Treue zum Kaiserhaus und zur Kirche, und holte als Beiwagenfahrer die größte nationale Minderheit, die Wiener Tschechen, mit ins Boot. Er nützte Wirtshausrunden und mobilisierte bereits vorhandene kleine Bezirkshelden für sich. Damit traf er den Nerv seiner Zeit und seiner Leut’, die ihn 1897 in einem »Lueger-Vaterunser« regelrecht anbeteten: »Vater Lueger, der du wohnst in Wien, gelobet sei dein Name, beschütze unser christliches Volk. Dein Wille geschehe allen christlichen Völkern dieser Erde. Verschaff uns keine Börse, sondern nur christliches Brod[sic!]. Vergieb[sic!] uns allen Schuldnern, die durch jüdische Wucherhände sind betrogen worden. Auch wir wollen ihnen vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, eines anderen Sinnes zu werden, sondern erlöse uns von dem Juden-Übel. Amen.«
Im selben Jahr wird Lueger Wiener Bürgermeister, nachdem ihm Kaiser Franz Joseph, der Bedenken gegen den Agitator hegt, mehrmals die Anerkennung verweigert hat. Erst Papst Leo XIII., auf dessen Sozialenzyklika Rerum Novarum sich der Christlichsoziale beruft, erwirkt letztlich beim Kaiser die Ernennung und macht den Weg frei für Luegers bahnbrechende Reformen und Neuerungen für Wien: die Kommunalisierung von Gas- und Elektrizitätsversorgung und der Straßenbahn, die II. Wiener Hochquellenleitung und der Bau von Krankenhäusern, Schulen und sozialen Einrichtungen. Dafür erfindet der schöne schwarze Karl auch das Prinzip der unumschränkten Einparteienherrschaft, die vom Magistratsdirektor bis zur Putzfrau alle städtischen Ämter und Funktionen einheitlich einfärbt. Eine Tradition, die in Wien bis heute fröhliche Urständ’ feiert – freilich unter anderen Vorzeichen …
Der Beginn von Luegers Amtsperiode 1897 ist überhaupt ein Schlüsseljahr: Der Kaiser muss seinen Ministerpräsidenten Badeni auf Druck der Straße entlassen, da dieser seinen Erlass zur deutsch-tschechischen Zweisprachigkeit für Beamte in Böhmen und Mähren nicht durchbringt, was wiederum die Nationalitätenkonflikte zu massenhaften Unruhen auswachsen lässt. Erstmals werden an der Uni Wien Frauen als ordentliche Hörer zugelassen. Die Gründung der Wiener Secession durch rebellische Kreative revolutioniert die Kunst. Die allerersten Autos rollen durch die Straßen. Die ersten Kinos werden eröffnet. Der Mitarbeiter der Wiener Neuen Freien Presse, Theodor Herzl, veröffentlicht sein visionäres Werk Der Judenstaat. Vor allem aber boomt in diesem Jahr die österreichische Wirtschaft.
Hätte es damals schon so schlau-beredte Wirtschaftsforscher wie heute gegeben, hätten sie in Interviews für Hochglanzmagazine und in TV-Shows cool analysiert: »Liebe Leutchen, was wollt ihr denn? Was habt ihr gegen den Kapitalismus? Die Zahlen sind doch gut!« Und tatsächlich steht die Donaumonarchie wirtschaftlich gar nicht so schlecht da. Die Industrialisierung hat endlich gegriffen, von Böhmen zieht sich südwärts ein Gürtel von Fabriken durch Cisleithanien, die Dampfmaschinen qualmen um die Wette. Wien wappnet sich mit einem Bauboom für eine Erweiterung auf prognostizierte vier (!) Millionen Einwohner.
Doch die Sache hat einen Haken, eine österreichische Besonderheit. Denn ein solches Wachstum würde zur vollen Entfaltung eine moderne, liberale Wirtschaftsordnung benötigen. In Österreich haben jedoch die Hochkonservativen das Sagen. Ihnen sitzt der Börsenkrach von 1873 noch tief in den Knochen. Sie wollen keine »internationalen Geschäftemacher« und »Spekulanten«. Die braucht man aber, um die modernen Technologien und Rohstoffe, Erdöl, Elektrizität, zu fördern und einzusetzen und um neue Industrien wie Motorenbau, Chemie, Elektrotechnik einzuführen. Das können nur Großunternehmen bewältigen. Vor 1914 entstehen bereits drei Viertel jener großen Unternehmen, die Österreich durch das 20. Jahrhundert begleiten werden, gut ein Viertel davon mit Investitionen aus dem benachbarten Deutschen Kaiserreich. Das Kapital dafür ist am besten an der Börse zu bekommen, man gründet Aktiengesellschaften. Doch die österreichischen Banken sind vorsichtig, Risikokapital bleibt knapp, AGs werden hoch besteuert.
Die hiesigen Politiker vertrauen dem Markt nicht, viele denken noch in Zünften und Berufsständen des Mittelalters, und so sieht denn auch die Arbeitswelt vor 1914 aus: Es gibt überdurchschnittlich viele Selbstständige im Gewerbe und in den Dienstleistungen. Das reicht von größeren Unternehmern bis zu den vielen kleinen Handwerksmeistern, die als Einmannbetriebe von der Hand in den Mund leben. Beide sind wohl selbstständig, aber der kleine Schuster oder Schneider ist weit vom Glanz des Kapitalismus entfernt. Diese Schere geht knapp vor 1900 weiter auf. Gelingt es einem Meister, aufzusteigen und bis zu 20 Arbeiter zu beschäftigen, kommt er in die gesellschaftliche Nähe der Unternehmer, der »Bourgeoisie«. Bleibt er hingegen kleiner Stückmeister, ist er von einem Lohnarbeiter kaum zu unterscheiden. Dazu kommt das Risiko des täglichen Arbeitslebens. Zwar wird 1897 eine Meisterkrankenkasse für schwere Krankheiten geschaffen, aber eine Pensionsversicherung für Selbstständige wird erst 1958 (!) eingeführt.
Neben dieser bangen Unsicherheit ist da noch etwas, das die kleinen Gewerbetreibenden eint: das Bekenntnis zu bürgerlichen Tugenden. Fleiß, Sparsamkeit, Anständigkeit, saubere Kleidung, Abgrenzung gegen die »Proleten« auf der einen Seite und Opposition zu den kapitalistischen Großunternehmern auf der anderen. Die katholischen unter ihnen streben nach traditioneller gesellschaftlicher Harmonie, die deutschnationalen nach einer idealisierten Volksgemeinschaft. Beide pflegen gerne alte, überkommene Bräuche und organisieren sich in zünftigen Vereinen. Sie wollen eine Politik, die sich an ihren wirtschaftlichen, ständischen Sachbedürfnissen orientiert, und an sonst gar nichts. Versponnene Ideologien liegen ihnen fern. Von der herrschenden Dynastie erwarten sie sich Schutz vor allen irdischen, von der Kirche vor allen jenseitigen Bedrohungen. Was sie neben der Beschädigung ihrer Interessen durch das liberale Großkapital am meisten fürchten, ist der Aufstand der Proleten in den Fabriken, die Revolution, der Klassenkampf. Denn durch ihn würden sie auch noch ihr kleines Eigentum verlieren.
Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen: der Mittelstand! Man nennt ihn auch Kleinbürgertum, eingekeilt zwischen Industrie und Arbeiterschaft. Er ist die Hauptzielgruppe christlichsozialer Agitation, und die entfaltet manch Trommelfeuer gegen eine spezielle Gruppe von Menschen. Wer besitzt die großen, räuberischen Firmen und Konzerne? Jüdische Industrielle. Wer führt in der gottlosen roten Arbeiterbewegung das große Wort und hetzt die Proleten gegen Besitz und Ordnung auf? Jüdische Intellektuelle. Bei wem müsst ihr was borgen, wenn ihr krank werdet oder euch auch sonst die Luft ausgeht? Bei jüdischen Banken und Geldverleihern. Wer zieht euch das Geld aus dem Sack, wenn ihr medizinisch behandelt werden oder um euer Recht kämpfen müsst? Jüdische Ärzte und Advokaten. Wer verschandelt das Stadtbild in bestimmten Wiener Bezirken? Orthodoxe Ostjuden aus Galizien. Und wer belügt euch auch noch über die Zustände? Liberale jüdische Journalisten.
Auch wenn nicht in allen diesen Berufen und Funktionen Menschen jüdischer Herkunft tatsächlich so dominant sind, wie die antisemitische Propaganda behauptet, so ist ihre Präsenz ausreichend, um die Judenfeindschaft stark zu schüren. 1914 sind ein Drittel der Wiener Gymnasiasten und ein Viertel der Studenten der Wiener Universität Juden – bei einem Bevölkerungsanteil von unter zehn Prozent. Denn auch arme Juden wissen, dass ihre Kinder nur durch höhere Bildung eine Chance haben, und da ihnen Beamtenkarrieren weitgehend verschlossen bleiben, ergreifen sie freie Berufe. Nach dem Ersten Weltkrieg werden in Wien mehr als 50 Prozent der Rechtsanwälte, Ärzte und Zahnärzte Juden sein, bei Apothekern sind es 33 Prozent.
Das befeuert den Antisemitismus der Christlichsozialen und auch anderer Parteigänger in Stadt und Land, des Greißlers, des Gastwirts oder des Mechanikermeisters. Intellektuelle Argumente sind dabei traditionell nicht willkommen, wie ein legendär gewordener Ausspruch des Wiener Gemüsehändlers und Abgeordneten Hermann Bielohlawek im Reichsrat erweist: »Schon wieder ein Buch, da hab’ i g’fressn! Ich bin ein praktischer Mann!« Bis in die 1960er-Jahre bleibt das Schimpfwort »Saujud« Bestandteil bürgerlichen Vokabulars, ob 1930 vom nachmaligen Bundeskanzler Julius Raab gegen den Sozialdemokraten Otto Bauer oder nach 1945 von Zwischenrufern aus den Reihen schwarzer Abgeordneter gegen Bruno Kreisky (SPÖ) geschleudert, obwohl doch der Nachkriegs-ÖVP antisemitische Politik fernlag. Warum dann diese Töne?
Weil, wie so vieles bei den Christlichsozialen, auch der Antisemitismus »pragmatisch«, also berechnend, eingesetzt und dort wieder fallen gelassen wird, wo er nichts einbringt oder gar kontraproduktiv ist. So beklagt 1932 der schwarze Parteiobmann von Wien, Robert Krasser: »Bei der Eroberung Wiens durch Lueger war eine der zündenden Ideen der Antisemitismus. Aus staatspolitischen Gründen ist es damit in unserer Partei bedenklich still geworden.« Schon Lueger selbst hat einmal gesagt, dass er den Antisemitismus für einen »Pöbelsport« hält, den man getrost wieder bleiben lassen könne, sobald man sein Ziel damit erreicht habe. Dieser lapidare Umgang mit dem verbalen Antisemitismus mag erklären, warum er das Dritte Reich und die Shoa überlebt und in manchen bürgerlichen Kreisen bis lange nach 1945 weiterbestanden hat. Man sei ja dabei nicht »ideologisch« motiviert, so wie die Nazis, gegen die man schließlich gekämpft hat, mag sich so mancher ÖVPler dabei gedacht haben, deshalb dürfe man ja …
Zurück in die Zeit vor 1914: Ähnlich wie in Wien verhält es sich auf dem Land. Die bäuerliche Bevölkerung ist für die ständischen Argumente genauso empfänglich und beschert den Christlichsozialen Siegesläufe, die durch die Hilfe der vielen kleinen katholischen Kapläne und Priester noch angeheizt werden. Die sind recht kritisch gegen die kirchliche Obrigkeit, also aus damaliger Sicht linkskatholisch eingestellt. Ausnahmen dieser schwarzen Dominanz sind die schon erwähnten Grenzgebiete deutscher Zunge wie Kärnten, wo die nationalen Konflikte mehr zu zählen scheinen als die sozialen, und dort, wo die katholische Kirche traditionell nichts zu melden hat, vor allem in protestantischen Gegenden. Hier gründet sich stattdessen eine nationale Agrarierpartei, der spätere »Landbund«. Mag man gemeinsam gegen die Juden sein – bei der Kirche trennen sich die Wege von Christlichsozialen und antiklerikalen Deutschnationalen.
Daneben gründet der Christlichsoziale Leopold Kunschak eine eigene Bewegung für katholische Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich dem Klassenkampf der »Roten« nicht anschließen wollen.
Nach dem Tod Luegers fällt praktisch die Sonne vom Himmel, und man fährt bei der Reichratswahl 1911 vor allem in Wien eine katastrophale Wahlniederlage ein. Wären es Kommunalwahlen gewesen, hätten jetzt die Sozialdemokraten die größte Fraktion im Gemeinderat, doch in Wien gilt noch bis 1918 das Kurienwahlrecht nach Steuerleistung, was die Christlichsozialen bis zum Ende der Monarchie in der Hauptstadt an der Macht hält. Stärkste Gruppierung in Cisleithanien wird der »Deutsche Nationalverband« – die ethnischen Konflikte überlagern mittlerweile alle anderen Themen, der hausbackene Stammtisch-Antisemitismus scheint abgenutzt. Die Deutschnationalen können das viel besser: Die überlegene, aber bedrohte deutsche Kultur müsse sich gegen Juden und Slawen schützen, denn im Unterschied zu den alten Liberalen glauben die Nationalen nicht daran, dass ein Jude ein guter Deutscher sein kann, mag er sich noch so sehr dazu bekennen. Seine »Rasse« schließt ihn aus der Volksgemeinschaft aus. Ganze Akademikerzirkel und völkische Studentenverbindungen widmen sich »rassepolitischen« Fragen. Sogar der »Alpenverein« erlässt einen »Arierparagraphen«. Von der deutschnationalen Sozialreform und dem demokratischen Programm bleibt nur mehr der Antiklerikalismus übrig, wozu sich am radikalen alldeutschen Rand eine offene Ablehnung des übernationalen Habsburgerstaates gesellt. So wie sie später in den 1970er-Jahren neomarxistisch werden, sind die Universitäten vor 1914 deutschvölkisch dominiert, ist das bürgerliche Vereinswesen der Turner und Sänger kornblumenblau beziehungsweise schwarz-weiß-rot (Farben des Wilhelminischen Deutschland) statt schwarz-gelb (Habsburgs Farben).
Den Christlichsozialen dämmert, dass ihr Pragmatismus nicht mehr ausreicht, um dagegen Politik zu machen. Fortan wird die Partei katholischer, intellektueller, fördert eigene Studentenverbindungen (die meisten davon im »Cartellverband«, kurz »CV«) und Akademikerverbände als Vorfeldorganisationen. Und weil die meisten Universitätsabsolventen im Beamtenstaat Österreich in den öffentlichen Dienst treten, werden Beamte und andere Staatsdiener wie Schullehrer eine weitere Trägerschicht der Christlichsozialen. Als publizistisches Organ hält man sich die Zeitung Reichspost mit deren Chefredakteur Friedrich Funder. Man wird von einem Aristokraten, Aloys Prinz von und zu Liechtenstein, geführt, gewinnt einen hohen Sympathisanten, Thronfolger Franz Ferdinand, entwickelt sich nach und nach zur staatstragenden und zugleich ersten ständeübergreifenden »Volkspartei«. In der Breite liegt aber auch ihre Schwäche. Eine zentral geführte Stoßkraft haben die Christlichsozialen nämlich nicht, denn sie bestehen aus fragilen Einzelteilen, Berufs- und Länderorganisationen, deren Führungspersönlichkeiten meist sehr eigensinnig sind, aber immerhin vereint in der Angst vor einem weiteren Herrn Karl. Er mag zwar längst tot sein, aber sein Gespenst geht auch in Österreich nach wie vor um:
KARL MARX (1818–1883)
Der Anwaltssohn aus Trier (damals zu Preußen gehörig) denkt nicht in Ständen, sondern in »Klassen«, nebenbei aber auch – wenn’s ihm gerade in den Kram passt – in Rassen. Seinen Rivalen Ferdinand Lassalle, den Gründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, nennt er einen »jüdischen Nigger«. »Es ist mir jetzt völlig klar, dass er, wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist, von den Negern abstammt.« Die Osteuropäer, besonders die Polen, bezeichnet Marx als »Völkerabfälle«. Gegen Juden hetzt er, obwohl selbst einer jüdischen Familie entstammend, oft und gern. Außereuropäer, ob Chinesen oder Afrikaner, verachtet er. Ein böser Bube, dieser Marx.
Als Menschenfreund oder gar Humanisten kann man ihn jedenfalls nicht bezeichnen, eher als Zyniker. Er hat wenig Interesse an moderaten sozialen Reformen für die Arbeiter der frühen Industriegesellschaft, sondern vielmehr an der grundlegenden Beseitigung der bestehenden Verhältnisse seiner Zeit. Und die sind prekär.
Dass die »soziale Frage« so brennend wurde, liegt an der Bevölkerungsexplosion Europas zwischen 1770 und 1870. Während dieser Zeit sind die althergebrachten ständischen Ehebeschränkungen (in der Praxis religiös begründete und amtlich verkündete Fortpflanzungsverbote) für Besitzlose gefallen, und die Armen, also die Menschen ohne Eigentum, bilden mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung. Trotzdem bleiben aber Empfängnisverhütung und Abtreibung offiziell streng verboten. Die eigentumslosen Arbeiter und Knechte zeugen somit immer mehr ehelichen und unehelichen Nachwuchs, der kein Erbe und damit eine trostlose Zukunft zu erwarten hat. Diese Kindermassen wandern zum Teil nach Übersee in europäische Kolonien oder in die USA aus, doch die meisten bleiben in der Heimat und vermehren sich weiter. Darf ich bekanntmachen: das Proletariat.
Es ist das Endprodukt einer langen Wiederbevölkerungsstrategie von Politik und Kirche nach den großen Pestepidemien, die Europas Einwohnerzahl von 50 Millionen im Jahr 1490 auf 460 Millionen Menschen im Jahr 1900 steigert. Die »Enterbten dieser Erde« werden zur Projektionsfläche der Mildtätigkeit empfindsamer Wohlhabender, bringen aber auch Rebellen und Revolutionäre auf die Idee, Pläne für diese Proletarier zu schmieden. Die Ideologen wissen: Wenn man im Namen der Massen die Macht übernehmen will, muss man die Geldwirtschaft in die Hand bekommen, und für dieses Ziel braucht man eine gläubige Anhängerschaft.
Da Marx kein Religionsgründer sein will – solche Zeiten sind vorbei –, tischt er die Grundlagen eines »wissenschaftlichen Sozialismus« auf, dessen Materialismus noch ausgeprägter ist als der seiner kapitalistischen Widersacher. Als Untergangsprophet des Kapitalismus hat er keine konkreten Rezepte für die Zeit danach parat, nur vage Vorstellungen und Leerformeln. Mit der Rolle der Produktion im Kommunismus beschäftigt sich dann erst Lenin, der, wie er selber sagt, die Volkswirtschaft wie ein Postamt führen will. Er verspricht, so der Vergleich des deutschen Soziologen Gunnar Heinsohn, »den Menschen für ihr Auto eine noch höhere und überdies pannensichere Geschwindigkeit, wenn man nur den Motor ausbaue«. Das entspreche einer »Heilung der Tuberkulose durch Entfernung der Lunge«.
Diese und viele andere marxistische Fehleinschätzungen werden zu Not, Hunger, Diktatur und Elend für Millionen von Menschen führen. Aber das Glück des Einzelnen ist Marx und seinen Jüngern ohnehin nicht wirklich wichtig. Der russische Kommunismuskritiker Igor Schafarewitsch ortet 1975 gar eine »Grundtendenz des Sozialismus, der der menschlichen Persönlichkeit nicht nur als Kategorie, sondern im Extrem sogar ihrer Existenz feindlich gegenübersteht«. Der Tod der Menschheit sei das Endergebnis, zu dem die Entwicklung des Sozialismus führen wird, so Schafarewitsch. Auch wenn das der düstere Befund eines selbst bei Antikommunisten umstrittenen Dissidenten sein mag, ist jedenfalls wahr, dass Marx und Genossen als radikale Materialisten jede Tangente ins Jenseits gekappt haben. Ein naheliegendes Unterfangen, da so viele Sinnsucher im 19. Jahrhundert längst die Nase voll haben von übersinnlichen Erklärungen. Transzendenz ist bei ihnen out, Gott ist tot, Kirchen lügen – knallharte Wissenschaft oder das, was man dazu erklärt, ist angesagt im Zeitalter Hegels, Nietzsches und Darwins.
Trotzdem lesen sich die Theorien des Hegel-Schülers Marx, seine »Entwicklungsgesetze« der menschlichen Geschichte wie Heilsversprechungen, an deren Ende nach der Auflösung der alten bürgerlichen die neue, die kommunistische, die klassenlose Gesellschaft steht. Sie kennt keinen Arbeitszwang mehr, jeder kann sich selbst verwirklichen. Ehe allerdings das logische, unweigerliche, unaufhaltsame Ende des Kapitalismus eintreten kann, muss das Proletariat zunächst eine Diktatur errichten, und dabei … Nun ja, wo gehobelt wird, fallen eben Späne.
Immerhin bis in diese erste, blutige Phase haben es allzu viele Regimes geschafft, die sich im 20. Jahrhundert auf Marx und seinen Freund Friedrich Engels beriefen, welche beide nicht mehr an diesem fatalen Praxistest beteiligt waren. Bis zu 100 Millionen Todesopfer hätte der Kommunismus letztlich weltweit gekostet, schätzen kritische Autoren wie der französische Historiker und Ex-Maoist Stéphane Courtois in seinem Schwarzbuch des Kommunismus (1997). Für Courtois ist Massenmord programmierter Bestandteil der kommunistischen Ideologie.