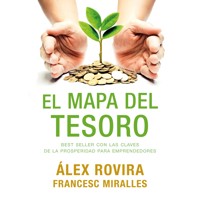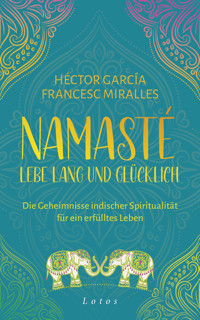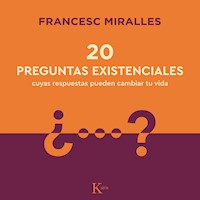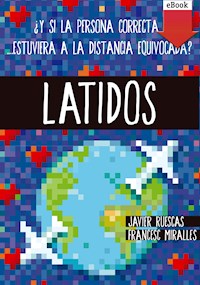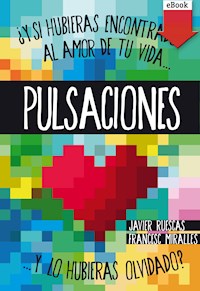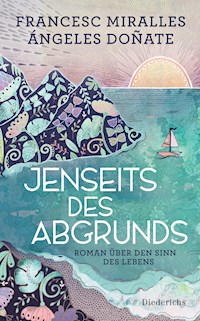
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diederichs
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Berührend und nach einer wahren Begebenheit
»Das Lied des Abgrunds zeigt uns genau den Weg, den wir verfolgen müssen, um mit der Sonne zu verschmelzen.«
Toni ist unterwegs, um die Asche seines verstorbenen Bruders Jonathan in den Bergen zu verstreuen. Auf der langen Fahrt dorthin gelangt er an eine steile Felsenklippe. Ganz in der Nähe lebt zurückgezogen Kosei-San, ein alter Japaner. Er weiß, dass viele, die dort stehen, verzweifelt sind und sich in die Tiefe stürzen wollen. Und so lädt er Toni zu einer Tasse Tee in seine Hütte ein. Toni folgt der Einladung des Alten, nicht ahnend, was ihn erwartet. Und so entspinnt sich ein wunderbarer Dialog über den Sinn des Lebens.
Eine berührende Geschichte über das Abenteuer des Lebens, basierend auf einer wahren Begebenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
»Das Lied des Abgrunds zeigt uns genau den Weg, den wir verfolgen müssen, um mit der Sonne zu verschmelzen.«
Toni ist unterwegs, um die Asche seines verstorbenen Bruders Jonathan in den Bergen zu verstreuen. Auf der langen Fahrt dorthin gelangt er an eine steile Felsenklippe. Ganz in der Nähe lebt zurückgezogen Kosei-San, ein alter Japaner. Er weiß, dass viele, die dort stehen, verzweifelt sind und sich in die Tiefe stürzen wollen. Und so lädt er Toni zu einer Tasse Tee in seine Hütte ein. Toni folgt der Einladung des Alten, nicht ahnend, was ihn erwartet. Und so entspinnt sich ein wunderbarer Dialog über den Sinn des Lebens.
Eine berührende Geschichte über das Abenteuer des Lebens, basierend auf einer wahren Begebenheit.
Die Autoren
Francesc Miralles, geb. 1968 in Barcelona, ist Journalist, Romanautor, Übersetzer und Musiker. Zahlreiche seiner Romane und Sachbücher sind internationale Bestseller.
Ángeles Doñate ist in Barcelona geboren und aufgewachsen und studierte Publizistik. Der erste ihrer Romane Der schönste Grund, Briefe zu schreiben erschien 2017. Er wurde in mehr als zehn Sprachen übersetzt und ein internationaler Erfolg.
Francesc Miralles
Ángeles DoÑate
JenseitsdesAbgrunds
Roman über den Sinn
des Lebens
Aus dem Spanischen von
Maria Hoffmann-Dartevelle
Diederichs
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Spanische Originalausgabe »Un té parar curar al alma«, Zenith, ein Imprint von Editorial Planeta, S.A., 2021
© 2019 by Francesc Miralles and Ángeles Doñate
Translation rights arranged by Sandra Bruna Agencia Literaria, S.L. through SvH Literarische Agentur
All rights reserved
Copyright © 2021 Diederichs Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: © Hannah Davies / Ikon Images / mauritius images
Satz: dtp im Verlag
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-27126-8V001
www.diederichs-verlag.de
Die dunkelste Stunde ist
die vor Tagesanbruch
englisches sprichwort
1.
EIN RÄTSEL IN EINEM RÄTSEL
An dem Nachmittag, als ich glaubte, alles sei zu Ende, ahnte ich nicht, wie nah ich am Beginn meines Lebens stand.
Ich hatte soeben meinen Bruder einäschern lassen und fuhr eine ausgestorbene Straße entlang. Auf dem Rücksitz meines Wagens stand die Urne.
Er hatte kein Testament hinterlassen, aber in seinem Tagebuch hatte er den Wunsch geäußert, man möge, wenn er eines Tages aus dem Zug des Lebens aussteigen würde, seine Asche in den Rocky Mountains verstreuen, bei einer Hütte am Fuß des Mount Moran.
Wie in dem Heft stand, das sich jetzt in den Händen der Kriminaltechniker befand, hatte er dort die einzigen Tage eines zweifelsfreien Glücks erlebt, so seine eigenen Worte. Verantwortlich für jene Oase des Lichts in seiner düsteren Seele war neben der Schönheit des Ortes anscheinend eine Frau namens Eileen gewesen.
Er hatte mir nie von ihr erzählt, allerdings war Jonathan auch nicht gerade ein Ausbund an Redseligkeit. Bei unseren seltenen Begegnungen in den letzten Jahren war er stets so geistesabwesend, als lebte er in einem inneren Exil, aus dem es kein Entkommen gab.
Das war zu seinen Lebzeiten.
Durch den Rückspiegel blickte ich auf die Messingurne mit der Inschrift, die ich mir überlegt hatte, nachdem der Angestellte des Bestattungsinstituts mir versichert hatte, das Eingravieren einer Widmung sei im Preis inbegriffen.
Lieber Bruder,
du warst mir immer ein Rätsel,
jetzt, da du aufbrichst ins größte aller Rätsel,
bist du ein Rätsel in einem Rätsel.
Ich werde dich sehr vermissen,
Toni
Der Angestellte hatte angesichts meiner Worte die Stirn gerunzelt. Vermutlich fand er sie zu nüchtern oder vollkommen absurd. Was Letzteres betraf, musste ich ihm recht geben, denn die Asche würde auf einer Wiese neben einer Hütte landen, diese leere, mit meiner Widmung versehene Urne somit zu einem sinnlosen Objekt werden, einem bloßen Behälter, der nichts mehr enthielt, nicht einmal das Gedenken an den Verstorbenen.
Da Jonathan geradezu krankhaft introvertiert war, herrschte sogar über die Ursache seines Todes Unklarheit. Laut Polizeiprotokoll war er mit über hundert Stundenkilometern aus der Kurve geflogen und gegen einen Hochspannungsmast geprallt. Er war sofort tot.
Die Autopsie hatte ergeben, dass er weder Alkohol noch Spuren irgendwelcher Betäubungsmittel im Blut hatte. Die Tatsache jedoch, dass er nicht angeschnallt war, was ihm das Leben hätte retten können, ließ die Ermittler an einen vertuschten Selbstmord denken.
Genau würde man es nie wissen.
Es war ein weiteres Rätsel in Jonathans Leben. Das letzte.
»Du hast mein Leben ruiniert, das ist dir doch klar, oder?«, sagte ich mit Blick in den Rückspiegel zur Urne. »Du hättest mich um Hilfe bitten können, du weißt doch, dass ich dir geholfen hätte. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Deinetwegen bin ich jetzt allein.«
Mir lief eine Träne über die Wange. Ich versuchte mir vorzustellen, was mein Bruder mir geantwortet hätte. Fast konnte ich seine Stimme im Innern des Ford Mustang hören.
»Gib mir nicht die Schuld für das, was du nicht getan hast. Wann hast du mich zuletzt angerufen? An Neujahr. Das ist sechs Monate her.«
»Du hast kein Recht, mir das vorzuwerfen! Warum sollte denn immer ich dich anrufen? Ich bin immer für dich da gewesen. Hast du vergessen, dass ich die Kaution für deine Wohnung bezahlt habe? Das Geld habe ich übrigens nie von dir zurückverlangt.«
»Geld … Mit Geld entschuldigst du alles«, würde er sicher antworten. »Wenn du glaubst, dass es im Leben reicht, nur die Rechnungen anderer Leute zu bezahlen, irrst du dich. Auch die monatlichen Viertausend für Papas Altersheim kamen aus deiner Tasche, aber ich war der Einzige, der ihn dort besucht hat. Und fast hättest du es nicht zu seiner Beerdigung geschafft.«
»Wirf mir das nicht vor, Jonathan, oder …« Ich nahm eine Hand vom Steuer, um mir die Tränen aus den Augen zu wischen, die mir die Sicht verschleierten. »Also, in der Endphase seines Alzheimers hat Papa gar nichts mehr begriffen. Bei meinem letzten Besuch hat er mich sogar gefragt, wer ich bin.«
»Nette Ausrede. Aber du, Toni, du wusstest, wer er war.«
Ich seufzte und versuchte, auf dieser Landstraße mitten in der Einöde ruhig zu bleiben. Es begann zu dämmern, und ein verrostetes Schild wies auf eine Raststätte in zehn Meilen Entfernung hin.
»Seit der Gründung meiner Werbeagentur habe ich nur noch geschuftet. Das weißt du. So konnte ich dir unter die Arme greifen, als du mich brauchtest. Ich habe Papas gesamte Behandlung bezahlt und dazu noch die Schulden, die er bei seinem Tod hinterlassen hat.«
»Wenn du so ein guter Mensch bist, warum bist du dann allein auf der Welt? Deine Frau hat dich ein Jahr nach der Hochzeit verlassen. Mich hast du immer als den schwierigen Bruder hingestellt, den hoffnungslosen Fall, aber pass gut auf dein eigenes Leben auf … Es bräuchte eine Überholung, und zwar eine gründliche.«
Bei der Erinnerung an den strengen Gesichtsausdruck, den mein Bruder immer aufsetzte, wenn er ernst wurde, musste ich lächeln.
»Frag mich nicht, warum Karen gegangen ist, ich weiß es nämlich bis heute nicht. Als ich sie kennengelernt habe, hauste sie in einer fünfundzwanzig Quadratmeter großen Wohnung in San Francisco, zusammen mit einer Drogenabhängigen und deren Mann, der sie misshandelte. Ich habe Karen da rausgeholt, ihr ein Zuhause gegeben. Ich habe das Geld für uns beide verdient, damit sie sich ganz ihrer Malerei widmen konnte, das war ja ihre Leidenschaft. Was wollte sie mehr?«
»Vielleicht ein bisschen von deiner Zeit, Toni. Wenn du nach Hause kamst, hast du dich dann für ihre Kunst interessiert? Hast du sie gefragt, was sie denkt oder wovon sie träumt? Mir hast du erzählt, sie sei von einem Tag auf den anderen und fast ohne eine Erklärung verschwunden. Warum hast du nicht schon früher versucht herauszufinden, ob sie irgendein Problem hat?«
»Gut, da gebe ich dir recht: In den letzten Jahren hatte ich viel um die Ohren. Das ist nun mal so, wenn man eine eigene Firma hat. Manchmal kam ich abends so spät nach Hause, dass Karen schon schlief, und am nächsten Tag stand ich auf, bevor sie aufgewacht war. Aber ich finde, das ist keine Rechtfertigung dafür, dass sie mich hat sitzen lassen. Wenn sie irgendein Problem gehabt hätte, hätte sie mich jederzeit anrufen und mir davon erzählen können, oder? Genau wie du …«
»Erstaunlich, dass dir das mit deinen vierzig Jahren noch nicht aufgefallen ist, aber den meisten Leuten fällt es schwer, um etwas zu bitten, Bruder. Vor allem, wenn jemand so beschäftigt ist wie du. Dann wollen dich die anderen nicht belästigen, besonders wenn sie dich gern haben. Deshalb schweigen sie und machen sich klein und immer kleiner. Bis sie eines Tages auf die eine oder andere Art verschwinden.«
»Es reicht, Jonathan«, sagte ich und umklammerte das Lenkrad fest, damit meine Hände nicht zu zittern begannen.
»Du glaubst, indem du unsere Rechnungen bezahlt hast, hast du deine Pflicht getan. Tatsache ist aber, dass du erst deinen Vater im Stich gelassen hast und dann deine Frau. Und mich hast du auch im Stich gelassen.«
Bevor ich vor Wut die Kontrolle über den Wagen verlor, bog ich ab und fuhr zu der ausgeschilderten Raststätte. Auf die Urne fluchend, die auf dem Rücksitz würde warten müssen, parkte ich neben einem Diner, das aus der Zeit gefallen schien.
2.
DIE RETTENDE HAND
Da ich keinen Hunger hatte, bestellte ich mir ein großes Bier, dann noch eins und kippte anschließend zwei Bourbon hinunter, um die Gedanken zu betäuben, die mich quälten.
Noch bevor ich es richtig merkte, fing ich an, Selbstgespräche zu führen wie ein Betrunkener. Ein kleiner Rest klaren Verstandes sagte mir, dass ich so nicht weiterfahren konnte, es sei denn ich wollte genauso enden wie mein Bruder.
Mühsam erhob ich mich, um zu bezahlen und im Auto meinen Rausch auszuschlafen, da legte sich eine Hand sanft auf meinen Arm.
Verwundert drehte ich mich um und stand vor einer Frau. Sie mochte um die siebzig Jahre alt sein.
»Geh noch nicht«, sagte sie lächelnd. »Ich würde dich vorher gern auf einen Kaffee einladen.«
»Ich wollte auch nicht fahren«, nuschelte ich verlegen, »… aber danke. Ja, der wird mir sicher guttun.«
Die Frau setzte sich mir gegenüber an den Tisch, an dem ich mich sinnlos betrunken hatte. Vermutlich hatte sie mich schon eine Weile beobachtet. Ich schaute sie mit einer Mischung aus Verwirrung und Beschämung an, die ihr nicht entging.
»Bitte fühl dich nicht schuldig. Jeder hat mal einen schlechten Tag.«
»Wenn es nur ein Tag wäre«, murmelte ich, während ein Kellner mit tiefen Augenringen unsere Kaffeetassen füllte. »Ich glaube, mein ganzes Leben ist ein einziger Fehler. Ein verdammter Fehler … Und jetzt ist es zu spät, ihn zu korrigieren.«
»Es ist nie zu spät!«, sagte sie und legte ihre kleine warme Hand auf meine. »Manchmal haben wir das Gefühl, das Leben hätte uns in einen zu großen Anzug gesteckt, aber dafür gibt es Schneider.«
Ich schaute sie an, ohne ganz zu begreifen, was sie meinte. Unfähig, etwas zu entgegnen, trank ich einen Schluck Kaffee. Diese Frau war nicht nur beneidenswert vital, sie schien auch alle Zeit der Welt zu haben.
Sie hob ihre Tasse, sog den Kaffeeduft ein und stellte sie wieder hin, als hätte sie gerochen, dass er noch zu heiß war. Dann nahm sie eine Brille mit altmodischem Gestell aus der Tasche, setzte sie auf und schaute mir geradewegs in die Augen.
»Solange du noch keinen Schneider gefunden hast, der dir einen Anzug nach Maß näht, könnte ich dir eine Geschichte erzählen«, sagte sie. »Vielleicht nützt sie dir etwas. Übrigens, ich heiße Rose.«
Darauf schwieg sie, als wollte sie sich vergewissern, ob sie mit meiner Aufmerksamkeit rechnen konnte. Müde nickend stimmte ich zu.
Noch vor wenigen Wochen hätte ich nur ungläubig gelacht, wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde eine halbe Stunde meiner Zeit in einem Diner mit einer Oma vertrödeln, die aussah, als sei sie einer Kekswerbung entstiegen. Und doch saß ich hier und ertrug das nervige Gerede dieser barmherzigen Samariterin, die mich mit einer Frage verwirrte:
»Was siehst du, wenn du mich anschaust?«
Nun bereute ich es, den Diner nicht verlassen zu haben, fühlte mich aber verpflichtet, aus Höflichkeit ihr Ratespiel mitzumachen.
»Ich sehe eine Frau mit weißen Haaren, die für ihr Alter jugendlich wirkt, in einem Strickpullover und …«
»Nein, nein, schau mich richtig an«, wies sie mich zurecht.
»Ich verstehe nicht.«
»Ich weiß, dass du das besser kannst. Wenn ich dich anschaue, sehe ich jemanden, der verängstigt und traurig ist, wie ein Kind, das nach einem Erdbeben allein in seinem Dorf zurückgeblieben ist. Oder irre ich mich?«
»Ich wünschte, es wäre so«, erwiderte ich halb betroffen, halb verärgert. »Wo ist Ihre Bibel? Sie schlagen mir doch jetzt bestimmt vor, ein Zeuge Jehovas oder sowas zu werden.«
Rose schaute mich tadelnd an.
»Du solltest keine Vermutungen anstellen. Das sind Filter, die dir den Blick verschleiern. Damit meine ich den achtsamen Blick auf andere, den gründlichen, tiefen Blick.«
»Ich verstehe«, sagte ich, ohne ein Wort zu begreifen. »Was für eine Geschichte wollten Sie mir denn erzählen?«
Die Frau schüttelte leicht den Kopf, als fände sie mich unmöglich.
»Seitdem es Autos gibt«, fuhr sie fort, »stand hier eine Tankstelle. Die letzten Besitzer waren meine Eltern, bevor alles von einem Konzern übernommen wurde. Mein Großvater hat hier sogar eine Autowerkstatt betrieben. An dieser Landstraße, über die so viele fahren, ohne zurückzuschauen, ist meine Familie verwurzelt. Diese Wegkreuzung ist nur ein Punkt auf der Landkarte, aber dieser Punkt ist mein Leben.« Sie seufzte, bevor sie weitersprach. »Schon als junges Mädchen habe ich im Geschäft mitgeholfen, als Kassiererin. Es machte mir Spaß, die Kunden zu bedienen, sie zu fragen, woher sie kamen und wohin sie fuhren, den Kindern einen Bonbon zu schenken und denen, die sich verfahren hatten, eine Karte der Gegend. So habe ich ihn kennengelernt.«
Rose machte eine Pause und schloss die Augen, während ihre Finger über einen doppelten Ehering strichen, der mir bisher nicht aufgefallen war.
Ich traute mich nicht, sie zu unterbrechen, und schon gar nicht, sie zum Weiterreden zu drängen.
Diese Frau befand sich auf einer sehr langen Reise, einer Reise, an der ich als blinder Passagier teilnahm.
»Ich war neunzehn Jahre alt und hatte den County noch nie verlassen, und trotzdem wusste ich es vom ersten Augenblick an … Er war es. Ich wusste, dass es weder vorher noch nachher einen anderen geben würde. Hast du so etwas schon einmal erlebt? Eine blitzartige Klarheit, die einen plötzlich durchfährt? In dem Augenblick, als er durch die Tür dieses Diner kam, blieb für mich die Welt stehen.« Sie legte den Kopf ein wenig zur Seite, als versuchte sie, eine Erinnerung aus den Tiefen ihres Gedächtnisses heraufzuholen. »Josh war Lastwagenfahrer, er fuhr eines dieser riesigen Ungetüme, die das Land von Osten nach Westen durchqueren. Er war so stattlich und gut aussehend, dass ich einfach nicht glauben konnte, dass ein mageres Ding wie ich ihm auffallen könnte. Aber Wunder geschehen.«
An der Theke war inzwischen die Hälfte der Lichter erloschen. Ich wandte den Blick kurz von meiner Gesprächspartnerin ab, um dem Kellner mit den Augenringen beim Polieren der Kaffeemaschine zuzuschauen. Bald würde er uns hinauswerfen. Der Gedanke erleichterte mich. Ich war mir sicher, dass diese Geschichte auf nichts Besonderes hinauslief.
Erneut irrte ich mich.
»Jahre später hat er mir einmal gestanden, er habe mich schon gesehen, bevor er zum Bezahlen hereingekommen sei«, fuhr sie mit bewegter Stimme fort. »Er war mehrmals an unserer Tankstelle gewesen, hatte aber nie gewagt, mich anzusprechen. Eines Nachmittags hatte er mich dabei beobachtet, wie ich meinem Vater bei einem Radwechsel half, und sich in mich verliebt. Zwischen unserer ersten Begegnung, als er mich ›Wie viel macht das?‹ gefragt hat, und dem Tag, an dem ich ihm ›Ja, ich will‹ geantwortet habe, war ein Jahr vergangen.«
»Hat er danach aufgehört, als Fernfahrer zu arbeiten?«, fragte ich.
Rose hielt kurz die Luft an und schloss die Augen.
»Eher, als ich es mir gewünscht hätte«, sagte sie schließlich. »Nachdem wir geheiratet hatten, fuhr er weiter seinen Truck, und ich wartete an der Raststätte auf ihn. Ich stellte mir vor, wir würden bald ein Kind bekommen und er würde mit dem Fahren aufhören und sich um das Geschäft kümmern. Abends, nachdem wir den Laden abgeschlossen hätten, würden wir uns vors Haus setzen und die Sterne zählen, und er würde mir von all seinen Fahrten und Strecken erzählen, und so würden die Jahre vergehen. Doch bevor mein Traum wahr wurde, vernichtete ein morscher Balken unsere Zukunft.«
»Was ist passiert?«, fragte ich betroffen.
»Es war an einem Sonntag, Josh half einem Freund, sein Dach zu reparieren, und dabei löste sich ein verrotteter Balken und fiel so unglücklich, dass …«
Rose hielt inne, als wäre die Erinnerung zu schmerzhaft.
Ich musste schlucken. Während sie schwieg, versuchte ich mir vorzustellen, wie sie wohl als verliebte Zwanzigjährige ausgesehen hatte. Bestimmt war sie eine hübsche junge Frau gewesen.
»Es muss sehr schlimm gewesen sein, so früh Witwe zu werden …«, begann ich, um etwas zu sagen.
Sie warf mir einen kurzen harten Blick zu.
»Wer hat denn von Tod gesprochen? Bis vor einem Jahr war mein Mann noch bei mir.«
Erleichtert atmete ich auf.
»Oder zumindest sein Körper. Er war vollständig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. Vielleicht«, fügte sie hinzu, »weil er sich mit seiner neuen Situation nie abgefunden hat. Wenn ich Josh ansah, spürte ich, dass er nicht da war. Sein Geist schien irgendwo in weiter Ferne zu schweben. Er hat bei uns im Haus gelebt, bis mein Vater zu alt war, um mir zu helfen, ihn zu versorgen. Da haben wir ihn in ein Pflegeheim gebracht.« Roses Gesicht verkrampfte sich kurz, als bereue sie diese Entscheidung noch immer. »Jeden Tag nach dem Aufstehen bin ich zu ihm gegangen und habe ihm einen Kuss gegeben. Ich wollte die Erste sein, die er beim Aufwachen sieht. Und jeden Abend habe ich ihm schöne Träume gewünscht. Fast fünfzig Jahre lang. Wir haben anders gelebt, als ich es mir vorgestellt hatte, aber … wir haben zusammen gelebt.«
Ich trank meine Kaffeetasse leer. Der Kellner war verschwunden, nachdem er die Theke gesäubert hatte. Im Gastraum herrschte jetzt vollkommene Stille. Plötzlich hatte ich es nicht mehr eilig. In meiner Fantasie war das Personal des Diner nach Hause gegangen und hatte uns hier drinnen vergessen.
»Ich habe die Tankstelle und das Haus verkauft«, fuhr Rose fort. »Dafür habe ich eine ordentliche Summe bekommen und mich nur noch unserem Leben zu zweit gewidmet. Morgens stand ich früh auf und wanderte durchs Dorf. Später erzählte ich Josh dann alles. Wo gerade ein Haus gebaut wurde oder ein neuer Laden aufmachte, wer geheiratet hatte und wer kürzlich von auswärts zugezogen war. Mit den Jahren hatten wir unsere eigene Form der Verständigung entwickelt. Wenn mein Mann Nein sagen wollte, bewegte er die Augenbrauen, wenn er Ja sagen wollte, lächelte er. Er war meine ganze Welt. Mich um ihn zu kümmern, ihn zu begleiten, ihm das Gefühl zu geben, dass er lebendig ist, war mein Lebensinhalt. Und ich fühlte mich unbesiegbar, kannst du dir das vorstellen? Ich hatte gelernt, schneller zu laufen als mein Schmerz, und ich war überzeugt, dass die tiefe dunkle Traurigkeit, die mich in den ersten Monaten nach dem Unfall beim Gedanken an sein Leiden erdrückt hatte, mich nie wieder einholen würde. Wenn ich das ertragen hatte, würde ich alles ertragen. Wie konnte ich nur so hochmütig sein?«
»Und dann ist die Traurigkeit zurückgekehrt«, sagte ich und wusste genau, was sie meinte.
»Ja. Sie baute sich vor mir auf und schaute mir ins Gesicht. Und zwar an dem Tag, als Joshua starb. Über ein Jahr ist das jetzt her. Alles brach über mir zusammen. Diesmal war es kein verrotteter Dachbalken, sondern ich war so erschöpft, dass ich nach dem langen Kampf kapitulierte.«
Sie nahm meine Hände, als fürchtete sie, erneut den Boden unter den Füßen zu verlieren und in einen noch tieferen Abgrund zu stürzen.
»Ich glaube, in dieser Zeit habe ich wahres Leiden kennengelernt. Ich ließ mich gehen. Ich aß fast nichts mehr und konnte nicht mehr schlafen. Ich ging nicht mal raus auf die Straße. Das Haus war zu einem Sarg geworden, in dem ich nur noch auf den Tod wartete … Aber der kam nicht so schnell, wie ich dachte, es musste also etwas Drastischeres geschehen.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte ich, ohne ihre Hände loszulassen.
»Schon seit Monaten ging es mit mir bergab, aber nun beschloss ich, wirklich in die Tiefe zu springen. Diese Entscheidung fiel eines Morgens. Nach einer weiteren schlaflosen Nacht bin ich kurz nach Tagesanbruch zur Bushaltestelle gegangen. Nicht einmal meinen Hausschlüssel habe ich mitgenommen. Nur ein Foto vom Tag unserer Hochzeit und ein bisschen Geld für meine letzte Reise. Ich wollte in aller Frühe los und so weit weg fahren wie möglich. Also stieg ich in den ersten Bus und setzte mich nach hinten auf eine Bank. Kaum hatte ich den Kopf ans Fenster gelehnt, fielen mir die Augen zu. Ich war so erschöpft, dass ich zum ersten Mal seit Wochen tief und fest schlief, obwohl mir die Morgensonne ins Gesicht schien. So ähnlich muss es zum Tode Verurteilten ergehen, denen man vor der Hinrichtung ein Festmahl serviert, das letzte in ihrem Leben.«
Während ich Roses Geschichte lauschte, vergaß ich irgendwann, dass wir allein in einem Diner saßen, in dem man uns vergessen zu haben schien, in dieser Nacht, die mein Leben verändern würde. Das ahnte ich aber noch nicht.
»Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich geschlafen habe. Es müssen viele gewesen sein, denn als ich erwachte, sah ich, dass es schon dämmerte. Der Fahrer hatte mich unwirsch mit dem Ruf geweckt, wir hätten die Endstation erreicht, bald würde die Sonne untergehen. Ich stieg aus dem Bus aus wie eine Betrunkene«, sagte sie und zwinkerte mir zu. »Fast wie du jetzt.«
»Also …«, versuchte ich mich zu verteidigen, aber ich hielt mich zurück, um sie nicht in ihrer Erzählung zu unterbrechen.
»Ich stellte fest, dass ich in irgendeinem verlorenen Dorf in den Rocky Mountains gelandet war. Ein prachtvoller Sonnenuntergang kündigte sich an, vielleicht weil es mein letzter sein sollte, und so begann ich im goldenen Abendlicht einen steilen Hang hinaufzusteigen. Nach über einer Stunde lag das Dorf weit unter mir. Der Weg verlor sich zwischen schroffen Felsen, und schließlich erreichte ich eine Felsenklippe, die etwa hundert Meter in die Tiefe reichte. Das betrachtete ich als ein Zeichen.«
»Ein Zeichen?«, fragte ich genau in dem Moment, als der Kellner mit den Augenringen gähnend wieder an der Theke auftauchte.
Wahrscheinlich hatte er in irgendeinem Nebenraum gegessen, getrunken oder beides. Er winkte zu Rose herüber. Vermutlich kannte er sie und ihre Vorliebe für Unterhaltungen mit Fremden.
Auf meinem Handy sah ich, dass es fast Mitternacht war. Einen Moment lang fürchtete ich, sie werde mich im Ungewissen lassen. Aber was ist eine Geschichte ohne Schluss? Ich kannte mich selbst nur zu gut: Sollte ich diesen Diner verlassen müssen, ohne das Ende der Geschichte zu kennen, würde ich nachts im Auto stundenlang wach liegen und mir alles Mögliche ausmalen.
»Nur noch zehn Minuten«, bat Rose den Kellner mit arglosem Lächeln.
»Fünf«, entschied er. »Ich gehe pinkeln, und dann schließe ich den Laden.«
»Mein Leben hatte keinen Sinn mehr. Ohne Familie, ohne Beschäftigung … Wer würde mich vermissen? Und wen würde ich vermissen? Je schneller ich mit allem Schluss machte, umso besser, und das Schicksal servierte mir diese Möglichkeit geradezu auf dem Silbertablett. An dieser Felsenklippe, die in der Abenddämmerung aussah wie aus einer anderen Welt, würde ich zum letzten Mal die Sonne untergehen sehen. Anschließend würde ich springen.« Rose holte tief Luft, bevor sie weitersprach. »Ich war so fest entschlossen, dass ich einen Felsvorsprung wählte, der mir wie eine Rutschbahn in den Abgrund erschien. Als ich an den Rand trat und hinunterblickte, dachte ich, gleich springt mir das Herz in Stücke, und mein ganzer Körper zog sich in sich zusammen. Um mir Mut zu machen, sagte ich mir: ›Noch einen Schritt und ich bin bei Josh, wo auch immer er sein mag‹.«
Ich hielt den Atem an.
Um ein Haar hätte ausgerechnet ich, ein Journalist, die dümmste Frage gestellt, die man stellen kann: »Bist du gesprungen?« Da sie hier vor mir saß, hatte sie es natürlich nicht getan.
»Und?«, war das Einzige, was ich herausbrachte.
Rose kostete den Spannungsmoment aus wie einen Triumph. Zum ersten Mal seit einer ganzen Weile hellte sich ihr Gesicht auf.
»Eine rettende Hand hat alles verändert.«
»Eine Hand?«, wiederholte ich verblüfft.
»Ja, die Hand von Kosei-San.«
»Das verstehe ich nicht … Wer ist Kosei-San? Wo kam er auf einmal her?«
»Er war ein Greis mit fernöstlichen Gesichtszügen und einer roten Wollmütze auf dem Kopf. Ohne mich auch nur einen Moment loszulassen, sagte er mit eindringlichem Blick: ›Ich weiß, dein Leben war sehr schwer … bis heute.‹«
3.
DER MANN AN DER KLIPPE
Ein Krampf durchfuhr meinen ganzen Körper. Ich schrie auf und öffnete gleichzeitig die Augen. Ich spürte meine Beine nicht mehr, und von der gekrümmten Lage tat mir der Rücken weh. Mit ausgetrockneter Kehle suchte ich am Boden und auf dem Rücksitz meines Wagens nach einer Flasche Wasser, aber das Einzige, was ich fand, war die Urne, die das Morgenlicht reflektierte.
»Lach nicht, Jonathan, sonst verpass ich dir eine«, fuhr ich sie an. »Hast du dich etwa nie besoffen? Allein zu trinken, ist natürlich viel trauriger … Aber daran bist du schuld, du Idiot.«
Ich wälzte mich im Auto hin und her und hatte das Gefühl, jeden Augenblick würde mir der Kopf zerspringen.
In meinem Handy suchte ich nach dem Ort am Mount Moran, wo ich das, was von meinem Bruder übrig geblieben war, verstreuen sollte. Google Maps entnahm ich, dass fast zehn Stunden Fahrt vor mir lagen, und ich war mir nicht einmal sicher, ob ich es auch nur zehn Minuten am Steuer aushalten würde.
Ich öffnete das Wagenfenster, um von der Frühlingsluft einen klaren Kopf zu bekommen. Dann schloss ich wieder die Augen und versuchte, den Kater abzuschütteln.
In meinem Alter sollte ich nicht mehr im Auto übernachten, sagte ich mir. Wie oft hatten Jonathan und ich es getan, wenn wir im Sommer an den kalifornischen Stränden nach den idealen Wellen Ausschau hielten …
Damals war ich um die zwanzig und das Leben noch eine mühelose Sache. Am Wochenende jobbten wir in einer Bar für einen Hungerlohn, unterwegs aßen wir aus Konservendosen. Mit unserem Vater, der unsere Lebensweise nicht verstand, redeten wir nicht mehr.
Unsere Taschen waren leer, aber unsere Köpfe voller Träume, und wir waren immer zusammen, erinnerte ich mich wehmütig.
Zusammen gegen die Welt. Genau genommen gegen eine Chicano-Welt, die uns zu eng geworden war. Unsere Eltern trauerten fortwährend einem Zuhause nach, das wir nicht kannten. Wir verkehrten ja mit Leuten, die »nicht mal Spanisch redeten«, wie eine Tante beklagte, die starb, ohne je ein Wort Englisch gesprochen zu haben, obwohl sie ihr halbes Leben auf dieser Seite der Grenze verbracht hatte.
Jonathan und ich … Eine Zeit lang waren wir eher Freunde als Brüder, bis unsere Wege sich trennten. Und alles, was jetzt von uns blieb, waren eine Urne voller Asche und ein menschliches Wrack.
Ich gab mir einen Ruck, stieg aus dem Auto und warf einen Blick auf die Tankstelle und den noch geschlossenen Diner. Kein Lüftchen regte sich, alles war still. Ein Schild, das eine halbe Ewigkeit auf dem Buckel zu haben schien, pries Brombeerkuchen mit Sirup an.
Nach und nach spürte ich, wie mir das Blut wieder in den Kopf stieg und damit auch das, was Rose mir noch vor wenigen Stunden erzählt hatte. Der Mann am Abgrund … Sie hatte ihn zwar nicht so genannt, aber der Journalist in mir hatte ihm diesen Titel verpasst.
Während ich versuchte, mich an seinen Namen zu erinnern, fiel mir wieder ein, dass er in dieser höllischen Nacht durch meine kurzen, flüchtigen Träume gewandert war.
Ich konnte den Gedanken an ihn einfach nicht mehr abschütteln. Da war vor allem das Gespräch, das er mit Rose geführt hatte, nachdem er ihr »die rettende Hand« gereicht hatte. Er hatte ihr erzählt, er habe in der Nähe eines Ortes namens Luckyfield gewohnt und sich eines Tages von der Welt zurückgezogen, um als Einsiedler zu leben. Er hauste in einer Hütte in der Nähe einer Klippe. Von dort beobachtete er die Felsen.
In dieser Hütte bereitete er der Fremden, die er soeben gerettet hatte, eine Tasse Tee zu und wollte im Gegenzug etwas über ihr Leben erfahren … Das war der Deal, den er ihr vorgeschlagen hatte.
Mein journalistischer Instinkt sagte mir, dass er so etwas vermutlich nicht zum ersten Mal tat. Der Mann – an dessen Namen ich mich nicht erinnern konnte – hielt sich wohl genau aus diesem Grund an seinem Beobachtungsposten auf.
Aber warum? Fühlte er sich zum Helfer berufen? War er einsam? Oder hörte er sich nur gern die Geschichten anderer Leute an?
Vielleicht war er auch schlicht und einfach verrückt.
Wie so oft in solchen Fällen führte eine Frage zur nächsten. Nach und nach wuchsen Zweifel in mir und zugleich eine Gewissheit: Der Mann am Abgrund war ein ganz besonderer Mensch. Was hatte ihn dorthin geführt?
Auf dem leeren Rastplatz, an mein Auto gelehnt, verspürte ich einen Kitzel, der mich schon seit meinen Tagen als Journalist nicht mehr befallen hatte: Hier war eine Geschichte, eine gute Geschichte, und ich wollte sie erzählen.
Als ich wieder am Steuer saß und den Zündschlüssel umdrehte, fühlte ich mich besser. Der Motor des alten Ford dröhnte und ließ die Karosserie erbeben, während ich zurück auf die Landstraße fuhr, vorbei an sanften Hügeln, die aussahen wie prähistorische Bestien, die zu dieser frühen Stunde noch schliefen.
Je höher die Sonne über der beinahe unwirklichen Landschaft aufstieg, umso deutlicher sah ich fast vergessene Szenen aus meinem Leben vor mir. Sie erschienen mir so fern, als gehörten sie der Vergangenheit eines anderen Menschen an.
Dank meiner Leichtathletikrekorde im Laufen – Flüchten war immer meine Stärke gewesen – hatte ich ein Stipendium erhalten und mein Viertel und all meine Freunde verlassen. Und nie mehr einen Blick zurückgeworfen.
Damals nahm ich mir vor, mein Journalismus-Studium bis zum Ende durchzuziehen und mit einem brillanten Abschluss zurückzukehren, damit meine Eltern stolz auf mich sein konnten.
Obwohl die Anfänge schwierig waren, liebte ich meinen Beruf über alles. Ich glaubte noch daran, dass man die Welt verändern kann. Alles war schon im Begriff, sich zu verändern. Ich würde dazu beitragen, indem ich das aufdeckte, was andere verschleierten, ich würde die zu Wort kommen lassen, die keine Stimme besaßen …
Auf meinem ersten Posten bei einer Lokalzeitung lebte ich quasi in der Redaktion, arbeitete Seite an Seite mit meinen Kollegen bis in die frühen Morgenstunden, schlecht bezahlt und übernächtigt.
Ich unterbrach meine Übung in persönlicher Archäologie, um einen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Die Urne, die auf dem Rücksitz zitterte, schien mir zu sagen:
»Sieh nur, wer du mal warst und was aus dir geworden ist… Jetzt bist du ein fetter, geschniegelter, angepasster Journalist.«
»Das wäre ich nicht, wenn du mir nicht das Leben versaut hättest, Bruderherz«, entgegnete ich, bevor ich die Privatvorführung meiner Erinnerungen fortsetzte, die mir von Mal zu Mal jämmerlicher erschienen.
Von den Kontakten, die ich damals in meinem Alltag knüpfte, profitierte ich nicht nur bei der Jagd auf Neuigkeiten, ich hatte es zudem mit einflussreichen Leuten zu tun, die mir Türen öffneten.
Drei Jahre später war ich Leiter der Wirtschaftsabteilung einer Zeitung aus San Francisco. Mehr als ein Vorstadt-Chicano als ich mir hätte träumen lassen! Doch der Preis, den ich dafür bezahlte, war hoch: Ich hatte kein Privatleben mehr, ich existierte nur noch für die Arbeit.
Wenn ich nicht da schon ein Idiot war, fing ich langsam an, einer zu werden. Ein Jahr lang besuchte ich meine Eltern kein einziges Mal. Von Zeit zu Zeit ging ich noch am Wochenende mit Jonathan zum Surfen, aber auch das hörte schließlich auf.
Nach und nach, still und leise, tat sich eine Kluft zwischen uns auf. Wir lebten in völlig unterschiedlichen Welten. Ich wurde stets von hohen Tieren eingeladen, die mich fürstlich bewirteten, damit ich über ihre Firmen und Produkte schrieb. In Jonathans Augen, der für aussichtslose Dinge kämpfte, hatte ich mich für ein Linsengericht verkauft. Er hing weiter mit seinen systemkritischen Kommilitonen von der Kunsthochschule herum, ein ewiger Student.
Schließlich schafften wir es nicht mehr, miteinander zu reden. Wir hatten nichts mehr gemeinsam. Also trafen wir uns auch nicht mehr.
Ich glaube, im Prolog zu den Blumen des Bösen schreibt Baudelaire, dass wir »jeden Tag eine Stufe in die Hölle hinabsteigen«