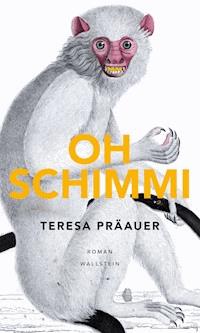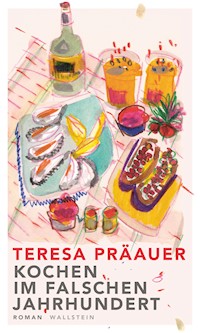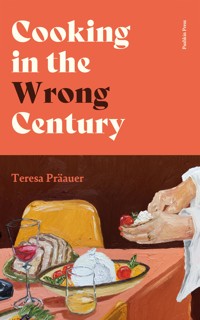Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zweite Roman der aspekte-Preisträgerin. Lustvoll, abenteuerlich und temporeich geht es um Kunst und Leben. Mach gute Kunst! Nichts Geringeres haben Johnny und Jean im Sinn, als sie sich nach dem Sommer in der Kunsthochschule wieder begegnen. Ein Sprung ins kalte Wasser steht am Beginn dieser Geschichte, und hundert Schritte sind noch zu tun für eine Weltkarriere in New York und Paris. Was dabei hilft: die Einflüsterungen der Alten Meister, gut gespitzte Buntstifte und eine Flasche Pastis. Und manchmal hilft das alles überhaupt nicht. Was, wenn man beim Anblick von Blumen an Geschlechtsteile denkt? Was, wenn einen beim Baden die Polizei verhaften will? Was, wenn die Pin-up-Girls den Magazinen davonlaufen? Wenn Europa in Flammen steht? Wenn einen der Wärter aus dem Museum wirft? Wenn der eigene Vater ein riesiger Zwerg ist? Wenn man Frauen mit französischen Vornamen liebt? Wenn man sich einen Goldzahn im Munde wünscht? Wenn die Kunst zu viele Katzen hat? Wenn der Teufel selbst unter Burn out leidet? Wenn man ohne Geld nach Zürich will? Wenn man Björk heiraten möchte? In zahlreichen Episoden erfindet Teresa Präauer das abenteuerliche Leben zweier junger Männer, die sich in der Kunst und im Leben üben. Lustvoll und schlagfertig!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Teresa Präauer
Johnny und Jean
Teresa Präauer
Johnny und Jean
Roman
Der Verlag dankt dem Land Salzburg für die Förderung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2014www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus der Stempel GaramondUmschlaggestaltung: Teresa Präauerund Wolfgang GoschBild: © Teresa PräauerDruck und Verarbeitung: Pustet, Regensburg
ISBN (Print) 978-3-8353-1556-3
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2673-6
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2674-3
Ich stelle mir vor, wie ich als junger Bub auf dem Land lebe.
Gerade ist Sommer, und wir sitzen auf der Wiese beisammen in einer Gruppe von Mädchen und – ja, schon nennen wir sie: Jungs. Die einen reden übers Fortgehen, die anderen reden übers Hierbleiben. Dann läuft einer vor zum Rand des Schwimmbeckens, alle laufen hinterher, manche springen vom Einmeterbrett, die meisten machen dabei das, was wir eine Bombe nennen: sie krachen mit angezogenen Knien ins Wasser, möglichst laut.
Ich köpfle und verliere vom Springen fast die Badehose, unter Wasser zieh ich sie schnell wieder hoch, tauche auf und schau, ob mich keiner gesehen hat. Alle klatschen und schreien, weil einer einen Salto vom Dreimeterbrett gemacht hat, den nennen sie: Jean.
Dann ist der Sommer vorbei, und wir verlieren uns, wie man so sagt, in alle Richtungen.
Ich sehe Jean erst wieder, als ich mit meinen Sachen unterm Arm in der Stadt auftauche. Ich bin nicht in die größte Stadt gegangen, sondern in die zweitgrößte. Jean ist schon vor mir hier gewesen, er hat einfach den früheren Zug genommen, und er kennt sich schon aus, er hat seine Sachen ausgebreitet und seine Schuhe unterm Tisch ausgezogen. Er legt seine Mappe auf den Tisch – nein, er hat gar keine Mappe, seine Bilder sind riesengroß, und er hat sie einfach zu einer stattlichen Rolle gerollt, die er jetzt auf den Boden legt. Ich drehe mich um und sehe, wie alle auf Jean und seine Rolle starren, und wie er jetzt ihr Band durchschneidet und die einzelnen Blätter ausbreitet: jedes so groß wie das ganze Zimmer, in dem wir uns alle befinden und schon den halben Tag darauf warten, einzeln aufgerufen zu werden.
Ich sitze mit Jean und den anderen nun unter Jeans Bilderdach, und wir rücken alle zusammen, und Jean sitzt in der Mitte und wird mit Fragen beworfen. Ich, der ich vorher noch neben Jean Platz gefunden habe, sitze jetzt fast entfernt von ihm, in die schmale Lücke zwischen uns haben sich noch drei weitere Leute gepresst, die Jean jetzt nah sein wollen. Ich denke daran, welch ein Trottel Jean gewesen ist, damals mit seiner Bombe im Schwimmbad auf dem Land, das ist doch erst wenige Wochen her, und wie großartig er jetzt ist. Ich denke auch daran, dass er nicht Jean heißt, weil bei uns dort keiner wirklich Jean geheißen hat, aber ich sage jetzt lieber nichts. Dann soll es eben so sein, Jean, hier spricht das eh auch keiner richtig aus.
Als Jean aufgerufen wird, ist er sofort aufgenommen. Er muss gar kein Gespräch mehr führen oder eine Probearbeit abliefern. Jean kann einfach heimgehen und an sein Œuvre anknüpfen. Als ich aufgerufen werde und meine Mappe auf den Tisch lege und meine Studien vom kleinen Fisch im Wasserglas hervorziehe, merke ich, dass daran etwas nicht stimmt. Ich merke es exakt jetzt.
Sie stimmen, sie sind richtig, sie sind nach der Natur, und ich bin noch ganz stolz darauf gewesen, als ich sie auf Passepartouts geklebt und in eine Mappe einsortiert habe. Eine selbstgebastelte Mappe! Ich habe mir gesagt, ja, genauso sieht ein Fisch aus, und mein Vater hat mir dabei noch anerkennend auf die Schulter geklopft. Wir haben noch gemeinsam die Farben der Passepartouts ausgesucht. Ich habe auch das Wort dafür eben erst gelernt gehabt.
In der Stadt, fast schon zu spät, muss ich erkennen, dass man hier keine kleinen Fische detailgetreu mit zarter Farbe aufs Papier tuscht. Ich stehe vor meinen Bildern, und der Fischschwarm blickt mich aus hundert Augen an, und auch er, wie alle, schüttelt enttäuscht den Kopf: Junge, wach auf!
Ein Jahr lang gehe ich geduckt durch die Straßen der Stadt. Wenn ich zum Himmel blicke, sehe ich dort Jeans ausgerolltes Bild über mir, das die Sonne verdeckt, ein ganzes Jahr. Ich schäme mich für die Fische und dafür, dass ich es nicht verstanden habe, sie daheim zu lassen in meinem Bubenzimmer. Das, was ich kann, ist jetzt nicht mehr gefragt. Ich schaue auf die Straßen und Wege vor mir und denke: Jean werde ich nie mehr einholen. Der Vorsprung ist einfach zu groß.
Ab dem nächsten Jahr bin ich auch mit dabei. Ich habe mich in den Monaten des Wartens vorbereitet, ich habe meine Bilder auf Rollen gemalt und die Fische entsorgt – oder, ehrlicherweise, sie meinen Nachbarn geschenkt. Ich besuche jetzt jeden Kurs, ich will alles lernen. Ich habe zwölf neue Arme und an jedem eine Hand, die etwas anderes macht. Ich will das Jahr aufholen, und ich sehe Jean vor mir.
Jean ist in dieser Zeit weit gekommen. Er hat schon einen Platz, auf dem sein Name steht. Hier kennt ihn jeder als Jean, und wenn man etwas nicht weiß, heißt es: Frag Jean.
Ich hab nichts gewusst, ich habe Jean gesucht und ihn nach allem fragen wollen, aber Jean ist nicht da gewesen. Ich habe mich mit Thermoskanne und Schlafsack einen Tag und eine Nacht vor die Tür gesetzt und gewartet. Jeder, der in diesen Stunden vorbeigekommen ist, hat dabei etwas über Jean gesagt, aber Jean ist weiterhin nicht hier gewesen.
Er war so schon in aller Munde. Ich glaube, ich habe dazwischen auch etwas über Jean gesagt, um mich ins Spiel zu bringen, ich habe laut seinen Namen gerufen, gewinkt und dann mit der Hand ein Telefon nachgeformt, so als stünde er auf der anderen Straßenseite, kaum noch zu sehen, und wir hätten die Verabredung, uns später noch hören zu wollen.
Ich stelle mir dann vor, wie ich mit Jean etwas Wichtiges ausgemacht habe.
Wir treffen uns am See in der Bar vom Eden au Lac – nein, ganz falsche Richtung, wir bleiben in unserer Stadt und gehen ins finsterste Lokal am Kai. Mit Jean im Eden au Lac, das soll erst viel später sein, wenn wir älter sind, und Geld keine Rolle mehr spielt.
Jetzt, stelle ich mir vor, sitzen wir im Lokal am Kai und Jean erzählt mir von seinen Geschichten.
Jean hat Affären, wie es zu seinem Namen passt, oder er behauptet, welche zu haben, und ich verschweige, dass ich noch nicht einmal jemanden geküsst habe, als es noch Mädchen gegeben hat und aus ihnen nicht schon, wie jetzt, Frauen geworden sind. Ich bemühe mich trotzdem, Jean ein guter Gesprächspartner zu sein.
Wir bestellen Alkohol, und ich stelle mir vor, Jean bestimmt, was unserer würdig ist in diesem Augenblick. Vielleicht Pastis, wenn nicht ein kleiner Schluck schon so teuer wäre? Aber mit einem Krug Wasser ergibt das eine feierliche Menge. Und noch zwei Pastis und noch zwei. Als wir betrunken nach Hause torkeln, umarmt mich Jean zum Abschied und sagt: Du bist mein Ami.
Ich bin jetzt sein Amerikaner, sein Freund. Ich stelle mir vor, ich wäre Johnny.
Ganz sicher heißt hier keiner Johnny und hätte auch dort auf dem Land keiner Johnny geheißen, aber ich mache mit diesem Namen jetzt einen Anfang in der Stadt. Johnny, der Stille, das ist zwar nicht die schönste aller Rollen, aber besser als gar keinen Namen zu haben und gar kein Gesicht. Es würde auch zu Jean passen, dass ein blasser Bewunderer mit einer Mappe voll mit verschenkten Fischbildern hinter ihm herläuft.
Jean entwickelt sein Œuvre.
Wenn auf den Straßen riesige Baucontainer stehen, klettert er hinein und gräbt im Sperrmüll. Mehrere Wochen sieht man, wo man auch hinkommt, Jean klettern und graben, überall in der Stadt. Ich sehe ihn, zufällig, mehrmals am Tag, an voneinander entfernten Ecken. Immer ist er ganz bei der Sache. Ich wage nicht, ihn anzusprechen, um ihn nicht aus seiner Tätigkeit zu reißen.
Ich bin mir sicher, Jean hat sich vervierfacht, mindestens. Ein ganzer Bautrupp an Jeans klettert und gräbt im Sekundentakt: Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak.
Manchmal wird Jean von dort vertrieben, manchmal rufen ihm die Passanten etwas nach, manchmal aber auch öffnen die Bewohner ihre Häuser, und Jean darf auf die Dachböden steigen und sehen, ob er etwas Brauchbares findet.
Die jungen Leute mit ihren zerrissenen Jeans, sagen die alten Hausbesitzerinnen dann, und manchmal stellt eine von ihnen Kuchen und Kaffee für Jean auf den Tisch.
Niemand weiß, was Jean mit den Sachen macht, die er gefunden hat. Ich kann selbst nicht arbeiten, weil ich mich ständig frage, was Jean wohl macht.
Während wir alle auf Jean warten, lernen wir einander langsam kennen. Ich bin Johnny, sage ich zu den anderen Leuten hier, und sie nennen mich Johnny.
Manchmal reden sie über Jean. Der ist sehr beschäftigt, sagen sie und berichten einander, wo er nicht dabei gewesen ist, und sagen, dass Jean nur noch eine Spukgestalt ist.
Wenn ich nachts schlafen gehe, erscheint Jean als Spukgestalt. Er zerrt mich aus dem Bett und möchte mit mir den Pastis-Abend wiederholen. Wir gehen erneut ins Lokal am Kai, ich im schwarz-weißgestreiften Pyjama, Jean bestellt wieder Gläser und einen Krug Wasser, wir rauchen, und Jean erzählt mir von einer jungen Frau. Es ist Denise, Indianername: Denise-die-dein-Herz-gebrochen-hat. Jean zeichnet sein Herz auf eine Serviette und zeigt mir die Stelle, wo es gebrochen ist. Wir nennen sie Sollbruchstelle und kitten sie mit Pastis: Pastis-der-dein-Herz-kitten-wird. Notdürftig, sagt Jean.
Ich beschließe, mir drei Lexika zu kaufen für meine nächtlichen Treffen mit Jean. Indianisch wird das erste sein. Ich hätte jetzt so gerne noch etwas zu ihm gesagt. Me, I don’t like Anise.
Dann kommt der Tag, an dem Jean ein Plakat aufhängt. Wir sollen alle zu ihm kommen, steht darauf, es findet in seinem Zimmer statt, heute Abend in einer Woche.
L’art, c’est une chaise, hat Jean darauf geschrieben, von Deleuze.
Eine Woche später läuten wir bei Jean am Hauseingang, aber es meldet sich niemand. Wir warten und gehen dann die Treppen hinauf zur Wohnung, in der sich Jeans Zimmer befindet.
Die Wohnungstür ist verbarrikadiert. Wir stehen davor, und niemand sagt etwas. Wir schauen nur.
Alles ist zugebaut. Dann nimmt endlich einer von den Leuten hier die erste Latte weg, ein anderer reißt das Absperrband durch.
Aber wir kommen nicht voran. Wir beratschlagen uns. Manche wollen heimgehen. Manche wollen Jeans Arbeit nicht zerstören. Manche sagen, wir sollen weitermachen und uns durch den Verschlag kämpfen.
Sie holen ihre Taschenmesser, Sägen, Schraubenzieher, Scheren, was eben zu finden ist. Einer baut seinen Computer auf, vielleicht ist das alles auch digital zu lösen.
Ich setze mich auf die Treppen und schaue zu.
Johnny, du kannst so schöne Zigaretten drehen, sagen die Leute, und ich habe meine Aufgabe gefunden, solange der Tabak reicht: Johnny-der-die-Zigaretten-dreht.
Wir haben alle nicht auf die Uhr geschaut, und die Leute haben einfach weitergegraben. Der Sperrmüll der Stadt war sämtlich in Jeans Wohnung gelandet. Er hat Möbelstücke, Bretter, Autoreifen, alles verschraubt und zusammengenagelt. Alles mit Lack besprüht, alles auf Hochglanz gebracht. Am Anfang haben die Leute noch vorsichtig jedes einzelne Stück vom nächsten gelöst, mittlerweile wird mit der Motorsäge gearbeitet.
Hinter den Sägenden hat sich eine Wolke aus Spänen und ein neuer Berg Schutt gebildet, ich muss mir einen eigenen Tunnel hindurchgraben, um nachzurücken. Weiter drehe ich Zigaretten, und manchmal sitzen ein paar von den Leuten mit mir herum und trinken Bier oder essen Wurstsemmeln, um wieder zu Kräften zu kommen. Bloß nicht die Holzspäne zum Brennen bringen mit den Zigaretten, sagen wir, und wir passen aufeinander auf. Es sind schöne Stunden, die vergehen, und es ist lustig, wie die Leute hier alle daran zu tun haben, Jeans Zimmer zu erreichen.
Und irgendwann sind wir dann angekommen. Sechs Tage hat Jean gebraucht, um seine Sammlung aufzubauen, von der Wohnungstür bis hinein in sein Zimmer. Er hat alles gemacht: geklebt, geschweißt, gelötet, gepinselt: gigantisch! Am siebten Tag hat er sich in seinem Zimmer auf einen riesigen Thron aus Sperrholz gesetzt, hat die letzten Barrikaden errichtet und lackiert, hat sich gesagt, es ist gut geworden, und hat ab da auf uns gewartet.
Hallo Jean, rufen die Leute von unten zu ihm hinauf, und sehen weit oben nur seine Füße baumeln in schicken Schuhen. Jean schaut herunter und lacht. Habt ihr alles mitgefilmt?
Wie, mitgefilmt? Wir haben dich gerettet!, rufen die Leute.
Ach, ihr seid solche Idioten, sagt Jean und spuckt herunter und rührt sich nicht mehr, bis nicht alle gegangen sind.
Ich hab gedacht, ihr seid alle weg, sagt Jean im Morgengrauen zu mir, als er von seinem Thron heruntergeklettert kommt. Jetzt erst sehe ich, dass er verkleidet ist. Wie ein Faun auf hohen Plateausohlen steigt er herab zu mir, langsam und stolz, mit nacktem Oberkörper, weiß geschminkt und mit großer Perücke. Dann öffnet er seine linke Hand, und eine helle, glitschige Masse von Kügelchen aus Klebstoff oder Creme kommt darin zum Vorschein. Es ist, als wäre seine Hand eine Blüte, die aufgeht, nass und frisch und geil auf den neuen Tag.
Alles umsonst, sagt Jean, und schmiert sich seinen feuchten Blütenstaub in den Schottenrock. Wenn es nicht mitgefilmt worden ist, ist es umsonst. Tant pis, ihr Arschlöcher.
Ich gehör eigentlich nicht dazu, sag ich leise.
Er fragt mich gar nicht nach meinem Namen und geht. Ich habe ein paar Mal von dir geträumt, könnte ich sagen, da ist er schon weg. Auch kein Dank dafür, dass wir ihn nicht mitsamt seinen Spänen abgefackelt haben.
Jean kennt mich nicht. Trotzdem stelle ich mir vor, er hätte im Sperrmüll nicht nur alte Möbel gefunden, sondern auch meine Bilder, die ich den Nachbarn geschenkt habe. Sie haben sie weggeschmissen, aber Jean hat sie wieder aus den Trümmern geholt: Jean-der-die-Fische-angelt.
Als ich vor einem Jahr vom Land in die Stadt gezogen bin, hat es ein großartiger Aufbruch sein sollen. Ich habe, ja!, die Jahre gezählt bis zu diesem Aufbruch. Jedes Mal zu Silvester habe ich mit einem silbernen Lackstift ein Kreuz in den Kalender gemacht – ich nenne es: ein diskretes Feuerwerk. Später sind es dann die Monate gewesen, die ich gezählt habe, und zum Schluss, da habe ich mir erlaubt, die letzten 365 Tage zu zählen. Kreuz um Kreuz.
Am Tag 365 habe ich meinen Koffer schon am frühen Morgen gepackt gehabt und eine ganze Kalenderseite bemalt in den Farben des Regenbogens. Am liebsten wäre ich schon in Anorak und Mütze beim Frühstück gesessen, damit klar ist: ich breche jetzt auf.
In meinem Koffer sind die Bilder, meine Lederjacke und meine Stiefel, die Zigaretten und das Übliche.
Der Koffer wird noch einmal geöffnet. Ein Pyjama wird hineingesteckt. Die Stiefel werden noch einmal herausgenommen und geputzt, ach, Mist. Wenn ich fort bin, muss ich sie erst wieder schmutzig machen. Die Seitenfächer des Koffers werden durchsucht:
Kind, siehst du dir so etwas an?!
Nein, das ist nur zu Recherchezwecken.
Ich werde das erste Mal nicht rot, sondern bleibe blass, gleich bin ich fort.
Gut, nur noch den Hürdenlauf bewältigen. Bevor ich gehen kann, soll ich noch vom Garten bis zu den Nachbarn laufen. Dort soll ich noch zu den Nachbarn der Nachbarn laufen. Ich soll noch im nächsten Dorf Bescheid sagen. Ich soll noch einen Abschiedsschnaps trinken im Bezirksamt. Ich kann erst den übernächsten Zug nehmen, der Bahnhofsvorsteher möchte mir noch die Jahreskarte verkaufen, damit ich immer heimkommen kann. Als der übernächste Zug einfährt, marschiert die Blasmusikkapelle auf und spielt mir den Abschiedsmarsch.
Ich steige endlich ein, und die Musiker winken mit ihren Taschentüchern in einer einstudierten Choreographie. Oh, Johnny! Hätte ich damals schon über die Wortgewalt des Hip-Hop verfügt! Und hätte ich dem Querflötisten ordentlich sein Maul gestopft! Und würde ich mich doch nicht immer aufhalten lassen!
Oder mein Hindernislauf ist so gewesen: Ich werde genötigt, ein letztes Mal meine Turnsachen anzuziehen. Es sind eine rote, sehr kurze Sporthose und ein weißes Unterhemd. Ein Stirnband und Stutzen bis zu den Knien. Ich laufe und springe, Boden, Balken, Kasten. Dann zum Reck: Aufschwung, Umschwung, Überschwung. Mit beiden Beinen landen und die Arme zur Seite strecken. Ich schwanke. Die Wertungsrichter pfeifen.
Mein Vater hält eine 3 hoch, meine Mutter eine 6, meine Schwester die 5. – Ich weiß nicht, irgendwie bin ich losgekommen. Fast ganz.
We’ll meet again, das ist so ein dummes Lied, sagt Jean in meinen Gedanken, um bloß keinen Abschiedsschmerz aufkommen zu lassen.
Wie war das, frage ich ihn, als du nach dem Sommer deinen Koffer gepackt und dich verabschiedet hast?
Ah, bof, sagt Jean, das war allen egal. Wir sind so viele Kinder gewesen, die haben nicht mal meinen Namen gewusst.
Hm, sage ich. Wenn wir uns tagsüber in der Stadt treffen, weißt du meinen Namen auch nicht. Ich hätte dich fragen wollen, ob du auch in der Nacht träumst, dass wir Freunde sind.
Johnny, sagt Jean in meinem Traum, solche dummen Träume habe ich nicht.
Dann erzählt Jean von Angélique, die er nach seinem Barrikadenwerk kennengelernt hat, als er dehydriert und mit verklebten Fingern eine Stunde an der Infusionsflasche gehangen ist.
Wie? Noch einmal: Jean hat ja eine Woche an seinem Thron aus Regalen und Brettern gearbeitet gehabt. Er hätte gewollt, dass wir unseren Weg zu ihm auf Video aufzeichnen und dass er dann als Faun und in Slow Motion zu uns herabsteigt. Eigentlich logisch, im Nachhinein betrachtet. Als das Projekt in diesem Sinne aber gescheitert gewesen ist, ist auch Jean mit seinen Kräften am Ende gewesen. So ist er im Krankenhaus gelandet bei Angélique. Wie es Jean gelingt, hier in unserer Stadt ständig auf Frauen mit französischem Vornamen zu treffen: das nenne ich Glück.
Das hat mir gleich Ideen für meine nächste Arbeit gegeben, sagt Jean.
Angélique, die Krankenschwester?
Nein, das Tropfen der Infusion.
Drip Painting, Jean?
Aber nein, ruft Jean, etwas Neues muss es sein! Wie Franz immer sagt: zeitlos-genial. Außerdem bin ich gegen die Amerikaner und ihr Painting.
Ich bin ein Amerikaner, Jean.
Johnny, dich zähle ich nicht dazu.
Angélique hat mir assistieren sollen, wie es sich gehört. Und es gehört sich eben, dass die Assistentinnen von großen Meistern der Avantgarde immer nackt sind. Angélique hat das zuerst nicht gewollt – aber für mein Œuvre, hat sie gesagt, macht sie es doch.
Oder ist es gar so gewesen, dass Angélique gesagt hat, wenn sie nicht nackt ist, ist es kein Œuvre, ja!, so ist es gewesen. Sie hat sich den weißen Kittel vom Leib gerissen, dass die Knöpfe wie im Kugelhagel auf mich eingeschossen sind, sie hat mit der linken Hand eine Blutkonserve im Plastikbeutel an ihre Brust gedrückt und mit einer ausladenden Geste der rechten zugestochen, mit dem Chirurgenmesser mitten in den Beutel hinein. Farbexplosion! – Mir wäre, ergänzt Jean, Ives-Klein-Blau statt des Blutes zwar noch einladender erschienen, aber ich habe sie auch so genommen.
Noch dort, im Krankenhaus?, frage ich.
Im Krankenhaus, sagt Jean: im Schwesternzimmer, in der Notaufnahme und in der Kantine. Wir haben in den Gängen eine rote Spur hinterlassen auf hellgrünem Linoleum. Rot auf Grün, wiederholt Jean: Komplementärkontrast! – Ich hab Angélique bei diesem Anblick natürlich sofort verlassen wollen, um dafür meinen Fotoapparat zu holen. Das hat sie falsch verstanden, und hat mir mit dem Messer in die Brust gestochen. Ganz knapp am Herzen vorbei, haben die Chirurgen gesagt.
Jean knöpft jetzt sein Hemd, das ohnehin immer weit offen steht, noch weiter auf und zeigt mir den Verband.
Er sieht damit so gut aus. Nur ein ganz zarter Kontrast ergibt sich da zwischen dem Weiß der Mullbinde und dem Elfenbeinton seiner Haut.
Jean, dein Elfenbein, sage ich.
Ivory, Johnny, spinnst du? Das ist Chamois. Oder eine Art sehr helles Beige. Gebrochenes Weiß mit sehr wenig Gelb, Sand, Muschel, Eierschale.
Okay, sage ich, Baby Powder, Corn Silk, not too much Cream. – Und diese Angélique versteht wohl nichts von Kunst?!
Weiß ist nicht nur der Kittel von Angélique gewesen, bevor er zum Schüttbild geworden ist. Weiß ist die Farbe von Papier und Leinwand.
Weiß ist der Kittel von Angélique auch wieder gewesen, nachdem sie ihn endlich in die Waschmaschine gesteckt gehabt hat, titanweiß.
Weiß ist ja eine sogenannte unbunte Farbe, aber in der Kunst um nichts weniger beliebt. Seit zum Beispiel einer einmal ein schwarzes Quadrat gemalt hat, sind auch die Galerien alle weiß. Wegen des Hell-Dunkel-Kontrasts, sagt Jean.
Deshalb sind auch die Mitarbeiter in den Galerien schwarz gekleidet, die selbst wiederum hinter weißen Pulten sitzen, gleich dort, wo man den Raum betritt. Diese Pulte sind so hoch, damit die Mitarbeiter dahinter verschwinden, denn die Hautfarbe ihrer Gesichter würde dem grafischen Prinzip von Schwarz und Weiß abträglich sein. Ist aber ein Mitarbeiter zu groß gewachsen und sein Pult zu niedrig, muss er vor seinem rotbäckigen Gesicht einen Laptop aufspannen in Weiß, Schwarz oder Silbergrau.
Eigentlich logisch, sage ich.
Total, sagt Jean.
Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll.
Kennt jemand dieses Lied? Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll: das ist der Anfang eines Liedes. Und weiter?
Ich nehme an allen Kursen teil, in denen Jean tagsüber nie ist, und habe noch immer ein weißes Blatt vor mir. Ich lenke mich damit ab, dass ich lerne, eine Leinwand mit Knochenleim zu grundieren. Das Endergebnis nach drei Tagen Arbeit: weiß. Stinkend und kreideweiß.
Wie geht das? Man hämmert die Keilrahmen zusammen, hockt sich auf den Boden und bespannt die Rahmen mit Leinwand, wobei man jeweils in der Mitte der Rahmenleisten zu tackern beginnt: Mitte oben, Mitte unten, Mitte rechts, Mitte links. Man übt sich, lese ich, in der Politik des richtigen Bespannens. Von der Mitte aus arbeitet man sich mit der Klammermaschine zu den Ecken hin und zieht stets kräftig am Stoff, um eine möglichst starke Spannung zu erreichen.
Und weiter? Man erhitzt die trockenen Kügelchen des Knochenleims im Wasserbad und löst sie auf zu einer hellen, glitschigen Masse. Man sumpft Kreide ein und rührt sie dazu, streckt das Ganze mit der rechten Menge Wasser, dann streicht man die Leinwand. Trocknen lassen, wieder streichen. Trocknen lassen, wieder streichen. Die Leinwand spannt sich dadurch noch stärker und die Poren des Stoffes schließen sich für den späteren Farbauftrag.
Sechs weiß grundierte Leinwände, sechs weiße Quadrate: so weit komme ich. Weiter nicht.
Jean pfeift auf die Politik des richtigen Bespannens. Er wirft sich in die Büsche, umarmt die Bäume, steckt seinen Kopf in Mülltonnen, legt sich auf die Straße, öffnet Kanalgitter und klettert bis zum Bauch hinein. In jeder Pose verharrt er für einige Sekunden und nennt das: Skulptur.
Noch sind wir sein einziges Publikum, aber bald wird man auf ihn aufmerksam werden – das ist weder Vorahnung noch Allwissenheit, sondern es ist einfach logisch als Ergebnis der Summe von zu erwartenden Ereignissen.