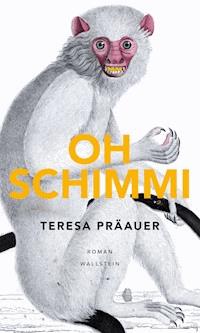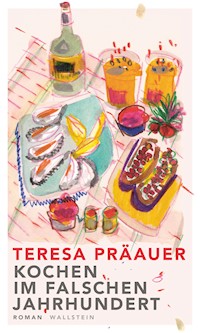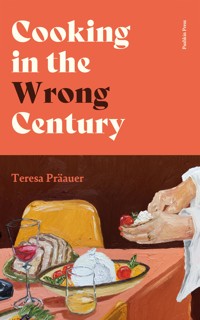Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den Romanen von Teresa Präauer sind, neben den Menschen, auch immer die Tiere zugegen: die Vögel, die Fische oder der Affe. In diesem erzählerischen Essay buchstabiert sie diese Artennähe aus und schreibt, reflektiert und unterhaltsam, über die unscharfe Grenze zwischen Mensch und Tier, die in der Kunst so häufig aufgesucht wird. Teresa Präauer beobachtet in "Tier werden" Stationen des Übergangs, der Verwandlung, des Aus-der-Art-Schlagens. Einen Auftritt in ihrem Text bekommt, wer oder was Haare hat: an Stellen, die von Schraffur überwuchert werden, von Pelz, Kunstfell oder Gras. Eine Sammlung von zotteligen Figuren hat sie hierfür zusammengetragen, von den mittelalterlichen Zeichnungen von Fabelwesen - halb Natur, halb Erfindung - über die Perchten aus den Alpen bis hin zum Perückenträger Toni Erdmann und den kostümierten Furries aus der Subkultur. All diesen künstlichen und künstlerischen Phänomenen geht die Autorin in konkreten Bildbetrachtungen und philosophischen Überlegungen nach. Die Animalisation ist bei Teresa Präauer ein Vorgang, den sie mit Blick auf Kunst, Kultur, Film und Mode beschreibt, den sie aber darüber hinaus auch auf das Schreiben und Lesen von Literatur selbst anwendet. Während wir schreiben, reizen wir die Möglichkeiten des Sprechens aus und geraten an seine menschlichen Grenzen. Während wir lesen, verwandeln wir uns, so lauten die Warnung und das Versprechen dieses erzählend-essayistischen Textes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Am offenen Fenster sitzend höre ich die Geräusche, die von draußen hereinkommen. Das Vorbeifahren der Autos, das Heulen einer Sirene, einzelne Gesprächsfetzen zwischen Passanten, die unverständlich bleiben, Pfeifen und Hundegebell, ein Rauschen, den Wind. Sogar eine Motorsäge wird angeworfen, als ginge es hier um den Wettstreit der akustischen Attraktionen. Danach ist es, für einen Moment, der gleich vorbei sein wird, still. Im Nachbarhaus beginnt ein sehr kleines Kind zu quengeln, und je länger es jammert, umso stärker verwandelt sich sein Weinen sonderbarerweise in das Singen eines Kuckucks, das die Kinderstimme bald ganz übertönt.
In einer Naturkunde von John Johnston aus dem 17. Jahrhundert, der Historia naturalis animalium, befindet sich ein Vogelwesen mit menschlichem Kopf. Es heißt »Harpyie« oder »Harpyia«, hat ein skeptisches, nicht unfreundliches Gesicht und trägt eine Frisur aus langen buschigen Locken, die, leicht hinters Ohr geschoben, bis zur Mitte des Körpers reichen – zur Mitte eines Vogelkörpers nämlich, dessen helles Gefieder zum Rücken hin dunkler und dichter wird. Kompakt wie ein kleines Hühnchen sitzt die Harpyie auf riesigen Krallen, die ebenso gut einem Greifvogel Halt geben könnten. Doch wer fragte nach der Einordnung einer solchen Spezies, da sie sich so selbstverständlich einreiht in das Kompendium der Vögel, Reptilien, Insekten, Schnecken, Fische, Säugetiere und so weiter, das Matthäus Merian um 1650 in seinem Verlag in Frankfurt herausgebracht und mit Kupferstichen aus der eigenen Werkstatt versehen hat? Denn mitten unter diesen Tieren befindet sich auch die Harpyie, statt der Arme und Hände hat sie Flügel und statt des Schnabels einen Mund, den üblichen Renaissancemund eines Gesichts im Halbprofil, kaum lächelnd.
Die gleiche Harpyie hockte oder thronte bereits einige Male davor in den zoologischen Schriften der Naturforscher und Mediziner. Um 1600 findet man sie bei Ulisse Aldrovandi unter den Vögeln der Ornithologiae libri seiner Historia animalium in einer beinah gleichen Darstellungsweise, nur etwas schauerlicher ob der hellen Pupillen und der leicht hervortretenden Augäpfel, und bereits hundert Jahre vor Johnston, ab dem Jahr 1551, in einem vergleichbaren Sammelwerk zwischen Wanderfalke und Haselhuhn in der Historia animalium des Schweizer Naturforschers Conrad Gessner. Bloß ist die Harpyie dort gröber, kein Kupferstich, sondern ein Holzschnitt, und so laufen ihre Haare und Federn in kräftigeren Strichen vom Haaransatz hinunter zur Steuerfeder. Gessner ist an die Arbeit gegangen mit dem Anspruch, alles, was bis zu jenem Zeitpunkt bekannt war an Lebewesen, vollständig zu notieren, seien es die, die er mit eigenen Augen gesehen hat, seien es solche aus der bildlichen, schriftlichen und mündlichen Überlieferung und seien es eben auch jene Fabeltiere, die in einer Aufzählung des Möglichen und Denkbaren nicht fehlen dürfen. Auf beinah tausend Tierarten ist Gessner dabei gekommen, bei Aristoteles, auf dessen gleichnamige zoologische Schriften aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. er sich unter anderem bezieht, waren es noch halb so viele. Carl von Linné rechnet Mitte des 18. Jahrhunderts bereits mit viertausend Tier- und sechstausend Pflanzenarten. Heute wir die Anzahl der Tierarten auf beinahe zehn Millionen geschätzt, wovon etwa 1,1 Millionen zu Land und zu Wasser bis dato beschrieben sind. In der Genesis des Alten Testaments wird Noah aufgefordert, alle diese Lebewesen in seiner Arche zu versammeln: »Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir am Leben bleiben; je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben.« Mit Millionen an Bord müsste Noah nun vor der Sintflut fliehen und sich auf die Reise begeben. Ohne eine Möglichkeit, weite Reisen zu unternehmen, verglich Conrad Gessner griechische, lateinische und hebräische Texte. Er bekam Erfahrungsberichte, Zeichnungen und Tierhäute zugesandt, fand neue Kategorien und Ordnungen und beschrieb die Tiere hinsichtlich Vorkommen, Erscheinung, Nahrungsvorlieben, ihres Nutzens für den Menschen und ihrer Erwähnung in Kunst und Literatur. Obwohl die Harpyie für ein bloßes Fabelwesen gehalten wird, schrieb Gessner in seinem Lexikoneintrag, sei sie doch bedenkenswert aufgrund ihrer Erwähnung in Vergils Aeneis-Epos, wo sie als Bewohnerin der Strophaden auf jene wartet, denen die Hölle ein bleiches, hungriges Tier zur Strafe schickt. Der Hortus sanitatis, ein Kräuterbuch aus dem späten 15. Jahrhundert, nennt innerhalb der Vögel auch eine Harpyie, die allerdings nicht ganz jener gleicht, der wir auf der Spur sind, denn sie trägt weder langes lockiges Haar, noch ein melancholisches Lächeln auf den Lippen. Dennoch scheint sie Gessner als Vorlage bekannt gewesen zu sein, hat sie doch einen erstaunlich ähnlichen Körperbau wie seine Harpyie und ihre Nachfolger. In jenem älteren Holzschnitt hat die Harpyie, deren griechischer Name vom Rauben, Reißen und Jagen kommt, ihre Krallen in den Körper eines auf dem Boden liegenden Menschen geschlagen, der kaum größer ist als sie selbst. Ihr mönchisches Gesicht ähnelt dem Gesicht ihres Opfers, und in der deutschen Ausgabe, dem Gart der Gesundheit, wird diese Ähnlichkeit mit ihrem Opfer folgendermaßen illustriert: Ein Vogel mit Menschenkopf steht an einem Ufer und beugt sich zum Wasser hinunter, worin sich sein Gesicht spiegelt, das zum Gesicht des Menschen geworden ist, den dieser Vogel zuvor getötet hat.
Für den Beleg ihrer Existenz genügt der Harpyie ihr Vorkommen in der frühen Literatur, für den Wahrheitsgehalt ihrer bildlichen Darstellung hat der Kupferstecher Merian in seiner Naturkunde auf Gessner zurückgegriffen, indem er dessen Vorlage kopierte und mit fein gezeichneten Details ausstattete. Denn wer in seinem Leben noch keiner Harpyie begegnet ist, der muss sich auf die Darstellung seiner Vorgänger berufen, so wie die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Forscher sich darauf verlassen mussten, was über die Löwen, Elefanten oder Einhörner in früheren Berichten zu lesen und zu sehen war. Die Zeichnungen der Künstler, die sich in ihrer bildnerischen Arbeit bereits mit dem Sezieren und anatomischen Zeichnen von Tieren beschäftigt hatten, lieferten der Forschung die Grundlage. Im Vergleichen der Bilder ließe sich so eine ganze Kulturgeschichte der Wissensübermittlung und im Speziellen des Buchdrucks erzählen. Enzyklopädisches Arbeiten ist auch ein Arbeiten mit Bildvorlagen, und wie beim Stille-Post-Spiel wird im Kopiervorgang manches übernommen, manches dazuerfunden, und manches geht verloren. Entstanden sind aus dieser Form der Überlieferung nicht nur Harpyien, sondern auch Löwen, die in den Malereien und Skulpturen des Mittelalters mit ihren flachen Schnauzen eher treuherzigen Hunden ähneln, Affen, die aufrecht gehen wie Menschen, und Menschen, die dagegen wie gekrümmte Monster aussehen. Sie sind Mischwesen in einer Welt, die erforscht und neu geordnet werden will.
Albrecht Dürers Panzernashorn, ein Bild, das später von Gessner in seine Naturkunde aufgenommen und spiegelverkehrt abgedruckt wurde, entstand selbst innerhalb eines Kopiervorgangs. Dürer, der Nashörner leibhaftig noch nie gesehen hatte, arbeitete unter Verwendung der gezeichneten Vorlage jenes Nashorns, das 1515 als erstes solches Tier von Goa nach Lissabon verschifft worden war und ein Jahr später, wieder auf Reisen geschickt, bei einem Schiffsunglück ums Leben kam. Dürers Rhinocerus sieht ein wenig wie ein großes Reptil aus, wie ein dicker Drache mit gepanzertem Körper, mit Schuppen an den Beinen, einem echsenartigen Maul samt Horn und fellbesetzten Ohren. So fantastisch es einerseits anmutet, so nah ist es andererseits doch der ersten gezeichneten Vorlage aus Lissabon, von der angenommen wird, dass sie tatsächlich vor dem lebenden Nashorn gezeichnet worden ist und so, wohl samt Beschreibungstext, in Dürers Hände geraten war, der die zusätzlichen Erläuterungen aus dem Beschreibungstext dann zeichnerisch umsetzte und mit seinem Erfahrungswissen abglich. Bei der Übertragung interpretierte Dürer einen Schnörkel in der Originalzeichnung als gedrehtes Hörnchen im Nacken des Nashorns und war damit der Urheber einer zoologischen Erfindung, die von zahlreichen Kopisten in der Folge übernommen wurde.
Aus derselben Zeit stammt übrigens ein zweiter Hornträger wider Willen: Michelangelos Skulptur von Moses mit den Hörnern auf der Stirn. Aus »coronata«, gekrönt, hatte sich durch einen Lesefehler von wenigen Buchstaben »cornuta«, gehörnt, ergeben und war in der Folge zur Wirklichkeit innerhalb der Darstellungskonvention geworden, an die sich auch Michelangelo hielt. Der Irrtum, der Schaden, das Missgeschick, poetisch angewandt, kann in der künstlerischen Fiktion mitunter auch zur Wahrheit werden. Das Einhorn wiederum, das beim Erfinder der modernen wissenschaftlichen Klassifikation, Carl von Linné, als Monoceros veterum immerhin im Kapitel der »Paradoxa« noch bis zur fünften Auflage 1747 erwähnt wird, ist aus heutiger naturwissenschaftlicher Sicht eher der Dichtung zuzuordnen. Innerhalb der Logik der bildenden Kunst und der Literatur existiert das Einhorn wie jedes andere Fabelwesen auch, wie jeder Stern, wie jedes schwarze Quadrat – als ein bald geläufiges Zeichen innerhalb eines mehr oder weniger bekannten Bildervorrats, dessen Existenz im Bild nicht erst auf seine Entsprechung in der Welt hin überprüft werden muss. Das Einhorn fungiert als Kürzel, das kopiert wird und symbolisch für etwas einsteht, etwas bedeutet oder aber eine Leerstelle markiert. Es ist ein Wesen am Rande der Sichtbarkeit oder Evidenz, am Rande der Klassifizierbarkeit, ein hübsches Monster als Verbindungsstück zwischen beobach-teter und erdachter Welt. Ein Kompositwesen aus ungleichen Elementen, die optisch dennoch leicht zusammengefügt werden können. So wie diese Menschen mit Flügeln und Krallen, Vögel mit menschlichem Gesicht, Mischwesen sind aus zwei, drei und mehreren Teilen. Es gibt eine Augenschale aus Terrakotta, etwa 520 v. Chr. entstanden, die gerade so groß ist, dass man sein Gesicht damit bedecken könnte, während man die Essensreste aus der Schale schleckte. Sie wäre dann wie eine orangefarbene Maske, deren aufgemalte rot-schwarze Augen die eigenen ersetzen würden, und die Henkel, an denen man sie seitlich hielte, wären wie Ohren oder kurze schwarze Hörner. Wenn man aufgegessen hätte, würde im Inneren der Schale eine Szene sichtbar, die Phineus aus der Argonautensage zeigt, dem die Harpyien das Essen stehlen, auf dass er ewig Hunger leide. Ganz selbstverständlich sitzen die Vorfahren unserer Harpyie auf den antiken griechischen Vasen, und ihre Nachfahren fliegen als »Wilddruden« bedrohlich durch Filme, in denen die Räuberkinder im Wald ihre Köpfe schützen, damit die fürchterlichen Harpyien sie nicht an den Haaren packen und hochreißen in die Lüfte. Die Harpyie aus Merians Kupferstich sieht, während wir durch die Bücher blättern, nicht uns an, sondern sie sieht in Richtung der Harpyien, die vor ihr und nach ihr gezeichnet worden sind. So lässt sie sich länger still beobachten, und als würde ihr Abbild sich erst langsam vor unseren Augen aufbauen, beginnen wir noch einmal unten, bei den viel zu groß geratenen Krallen, und sehen Bürzel, Steiß und Bauch, dann Brust, Rücken und Flügel. Und verharrte unser Blick tatsächlich auf der unteren Hälfte dieses Vogels, bliebe die Harpyie ganz Tier und würde erst bei weiterem Hinsehen, nun Haare, Lippen, Augen und Stirn, zum Menschen werden. Das Bild von unten nach oben zu lesen würde bedeuten, innerhalb eines einzigen Bildes eine Erzählung geschehen zu lassen, darin ähnlich dem Lesen von Texten, die von links nach rechts oder von rechts nach links und von oben nach unten sich erst erschließen. Es würde heißen, etwas nicht auf den ersten Blick zu erfassen, sondern die Ungleichzeitigkeit der einzelnen Teile als Vorgang mitzuvollziehen. Der Körper der Harpyie wäre wie ein »Cadavre exquis«, eine Art Bastard aus Mensch und Tier, entstanden auf einem Blatt Papier, das umgefaltet wird, um es dem nächsten Zeichner weiterzureichen, der nächsten Zeichnerin. Sie würde an einen unbekannten Körper, von dem nach dem Falten nur noch die Übergänge zu sehen wären, einen neuen Kopf zeichnen. Erst nach dem Auffalten würde am Ende die ganze Zeichnung sichtbar werden, zusammengesetzt aus unterschiedlichsten Gestalten, die dann wie blind zusammenpassten. Jede Faltung wäre damit eine Geste zum Zweck der Veränderung, jede Falte wäre eine Markierung des Übergangs. Die Harpyie beim Menschenkopf beginnend zu lesen und erst danach mit unseren Augen ihr Federkleid nachzuvollziehen, das wäre, als könnte man ihr zusehen bei einer Metamorphose, die hieße: Tier werden. Denn bei genauerem Hinsehen verändern die Dinge scheinbar ihr Aussehen, wandeln sich mit der Dauer und der Bewegung des Blicks.
Als wäre Betrachtung mit Berührung verwandt; und wenn wir unvermutet aufsähen von diesem Bild des Vogelmenschen, das einen Zustand innerhalb dieses Prozesses zeigt, und nun einen Schluck nähmen aus der Tasse, die auf dem Schreibtisch vor uns stünde, würde diese Tasse womöglich selbst von Pelz überwuchert, wie die Pelztasse der Künstlerin Meret Oppenheim. Pelzige Tasse, pelzige Untertasse, pelziger Löffel. Und würden wir Worte finden, die den Geschmack auf unserer nun selbst bald pelzigen Zunge beschrieben, uns zerfielen die Worte im Mund »wie modrige Pilze«, denn plötzlich wäre alles Fauna und Flora, und wir mittendrin. Und wir müssten neue Wörter finden, um sie aufzuschreiben und an diesem Projekt, das sich Literatur oder Sprache nennt, nicht zu verzweifeln wie einst Lord Chandos in seinem Brief