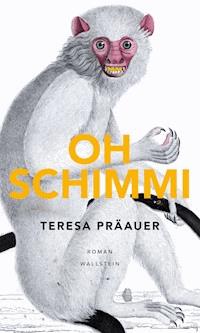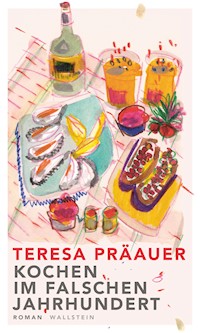Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichten entwerfen ein Panorama der Gegenwart. Bunt schillernd, scharf konturiert und auf famose Weise ein kaleidoskopisches Ganzes ergebend. Es sind Liebesgeschichten, die hier erzählt werden, es sind aber auch Geschichten über die Liebe zu den Dingen, die uns täglich umgeben. Und es sind wahre und erfundene Memoirs, die vom Snowboard-Unterricht mit Phil Collins in den Salzburger Bergen berichten oder über einen Hausbesuch von Britney Spears, von der ersten Reise nach London auf den Spuren von Jimi Hendrix, deren Beschreibung nun Erinnerungen an die Kindheit und den Vater wachruft. Und immer wieder geht es hier auch um die Literatur, die Kunst und das Internet. Maler tauchen auf, Schriftstellerinnen, Gedichte, Fernsehsendungen, YouTube-Tutorials und fünf tragisch ineinander verknotete Eichhörnchen aus Wisconsin. Teresa Präauers brillant geschriebene Geschichten entwerfen ein Panorama der Gegenwart. Bunt schillernd, scharf konturiert und auf famose Weise ein kaleidoskopisches Ganzes ergebend. Wohin immer sie ihren Blick wendet, es entstehen Bilder, die so überraschend wie einleuchtend sind, so witzig wie tiefgründig. Mit Neugier und Kenntnis blickt sie in die Welt und lädt uns ein zum wilden Denken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Teresa Präauer, geb. 1979, studierte Germanistik und bildende Kunst. Im Wallstein Verlag erschienen die Romane Für den Herrscher aus Übersee, Johnny und Jean und Oh Schimmi sowie der Großessay Tier werden. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den aspekte-Preis 2012 und den Erich-Fried-Preis 2017. Sie lebt in Wien.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2021
www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus der Fabiol
Umschlaggestaltung: Wolfgang Gosch mit Teresa Präauer
Umschlagabbildung: Installation: Teresa Präauer, Foto: Martin Stöbich
ISBN (Print) 978-3-8353-3948-4
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4672-7
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4673-4
Inhalt
Der Lauf der Dinge
Die Jahreszeit der T-Shirts
Amerika als T-Shirt
French Nails aus Amerika
Die ganze Welt
Tornado Shelter
Raumschiff Poetry
Schwarzbrot mit Butter
Zeitrechnung
Über ein Foto von Kim Kardashian
Carmen Miranda mit dem Tutti-Frutti-Hut
Ein kleines Filmchen über die Liebe
Glitzer
Jimi
Die ewige Liebe zum Vergänglichen
Zu einer Schachtel voll Andachtsbildchen
Aufbewahren & Wegwerfen
Wer sich mit Texten ins Bett legt
Über den richtigen Moment
Das O, das der Schönheit ein Loch reißt
Ein Gesicht ist eine Landschaft, eine Wange ist ein Feld
Am Fluss
Fünf Mädchen
Kinder und Krönchen
Könige im Schnee
Ein Schneemann aus Zitroneneis
Wir sind Kinder gewesen
Die erste Ausfahrt
Für immer jung
Jugend und Pose
Superhits aus Italien
Gibraltar
Ein paar Küsse
Gib nicht auf
Notausgänge
Eine Frage des Stils
Wow!
Keine Party
Jahreszeiten
Tanzen mit Stromae
Norden, Süden, Pole
Hang loose
Über Phil
Ich sehne mich nach Après-Ski
Als Britney uns besuchen kam
Im Zug
Warum?
Finden ohne Suchen
Aufgewachsen in Bibliotheken
Über ein Foto von Otto Lilienthal
An die Mondgesichter!
Auf Besuch bei einem Ehepaar
Red Heat, das Zirkuspony
Der Sonntag, an dem Black Beauty ausgebüchst ist
Hosenrolle
Im Hause Chanel
Fisimatenten mit Posamenten
Ein Wandteppich von Kiki Smith
Mützen im Rijksmuseum in Amsterdam
Grabreliefs aus Palmyra
Der Club der toten Dichter
Euros und Kenia-Schillinge
Auf der Matte mit Mady
Böse Mädchen
Auf großer Fahrt
Im Zwiebelfisch
Ein Koffer von Marcel Duchamp
Im Weltmuseum
Frohsinn
Die Phantasmen der Vormieter
Fünf ineinander verknotete Eichhörnchen in Wisconsin gerettet
Biester im Buchladen
Früh aufstehen
Die Sonne von Edvard Munch
Vom Kauf eines Hochzeitskleids
Eine Geschichte von David und Aiko
Bettlektüre
Einen Strauß binden
Tulpenmanie
Herzen, Blumen, Blicke: Über die Liebe
Immer wieder Cranach
Das Glück ist eine Bohne
Nachweis
Register
Der Lauf der Dinge
Der Lauf der Dinge im Leben zweier Menschen ist doch, verdammt nochmal, immer der gleiche: Sie treffen aufeinander, es kommt zur chemischen Reaktion, unmittelbar, und etwas dreht sich, etwas bewegt sich, etwas explodiert. Und wozu das Ganze? Ja, wozu das Ganze. Am Ende übrig bleiben Rauch und Nebel, als wäre eben der Teufel durchs Szenenbild spaziert, und wenn dann die Schwarzblende einsetzt, ist das beinah eine Erlösung. Die meisten Filme enden mit einer Schwarzblende, und das bedeutet schlicht, dass das letzte Bild mit einem harten Schnitt abtritt und mit dem darauffolgenden schwarzen Bild schon der Nachspann einsetzt. Es kann auch ein weicher Übergang sein, bei dem das Schlussbild erst allmählich abgeblendet wird und das Schwarz nur langsam in den Vordergrund tritt, doch auch dieser weiche Schnitt ist eine sogenannte Schwarzblende und bedeutet damit das Ende. Rauch, Nebel, Schwarz und Ende: Das klingt so pessimistisch wie der Satz, den man so oft zu hören bekommt: »Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.« Eine Phrase, so oft und oft wiederholt, bis endlich, endlich ihre Richtigkeit unter Beweis gestellt sein wird: Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dabei werden so viele Fragen nicht gestellt: Wo genau ist der Anfang eigentlich gewesen? Wer urteilt und verurteilt? Und was ist Scheitern?
Scheitern im Sinne von Fischli / Weiss bedeutet den Fortlauf der Dinge, das Weiterdrehen, Weiterbewegen, Explodieren. Geht ein Ding zu Bruch, setzt es erst dadurch das nächste in Gang. Das Scheitern, das Von-Anfang-an-zum-Scheitern-Verurteilte, sagt Petra, die erste Hauptfigur in dieser Geschichte, ist bei Fischli / Weiss paradoxerweise das Erfolgreiche, das den Stillstand nicht dulden will. Bei Fischli / Weiss, sagt Petra, heißt scheitern also gewinnen.
Ah, sagt David, unsere zweite Hauptfigur. Und mehr sagt er nicht, denn er denkt jetzt über die erfolgreichen Menschen aus dem Fernsehen nach, die stets beteuern, wie wichtig das Scheitern sei für den Erfolg. Und dann denkt David daran, dass dort im Fernsehen niemals ein sogenannter obdachloser Alkoholiker sitzt, um von der Wichtigkeit des Scheiterns für sein Leben zu berichten. Und dieser Gedanke löst, wie der vorangegangene, einen weiteren Gedanken in Davids Kopf aus, der zur Frage führt, ob das Bild des gescheiterten Menschen schlechthin denn unbedingt immer der obdachlose Alkoholiker sein müsse. Es ist eine selbstkritische Frage, die durch Davids Kopf segelt, fliegt, eine Gedankenkette auslöst, ein Strohfeuer entfacht: Wie denn überhaupt von einem gescheiterten Leben gesprochen werden könne, wo es seinen Anfang genommen hat und wie es enden wird. Es gurgelt in Davids Kopf, es blubbert und zischt: Ob es bis zum letzten Ende denn ein sogenanntes gescheitertes Leben sein würde und ob man so urteilen dürfe. Ob es nicht ungerecht sei in Anbetracht des Wertes eines jeden Menschen und ob er, David, nicht, wenn er von einem Scheitern hier auf Erden sprechen wollen würde, statt von obdachlosen Alkoholikern doch vielmehr von Mördern, Tyrannen und sogenannten menschenverachtenden Diktatoren sprechen müsse. Und weil das The Way Things go eine Bar in Deutschland ist, würde David gleich mit dem menschenverachtendsten Diktator beginnen, der ihm einfällt, wieder einmal einfällt, würde er, ja, würde er mit Petra, die nahe am Tresen vom The Way Things go steht, jetzt derart grundlegend über das Scheitern sprechen wollen. Oder, denkt David, wäre ein solches Gespräch an der Bar vom The Way Things go ein pseudo-radikales, ein pseudo-philosophisches, ein pseudo-menschheitsgeschichtliches? Unpassend für einen Anfang?
Können wir uns die Anfänge denn aussuchen? David hat Petra im The Way Things go kennengelernt, da hat er noch gar nicht an den menschenverachtenden Diktator gedacht, da wollte er sich bloß einen Drink an der Bar bestellen. Was heißt: einen Drink? Endlich einmal im The Way Things go, da muss David doch etwas Außergewöhnliches trinken! Und David hat, obwohl er lieber Bier getrunken hätte, einen Shooter bestellt, einen sogenannten Fireball. Er hat die Cocktailkarte beim Buchstaben F geöffnet gehabt und, diesmal ohne nachzudenken, auf den Fireball gezeigt. Immerhin ist Wodka drin, hat sich David gedacht, und ein Shooter macht einen nicht gleich zum obdachlosen Alkoholiker.
Der Barkeeper hat es sich nicht nehmen lassen, David die Zusammensetzung des Fireballs zu erläutern, laut Handlexikon der Getränke, dritte Auflage 1996, besteht der nämlich aus einem Viertelteil Wodka, einem Viertelteil Grenadine-Sirup und zwei Viertelteilen Zimtlikör, und die richtige Zubereitung geht folgendermaßen, nämlich werden die Zutaten im Shaker kurz gemixt, dann in das Shot-Glas geseiht, damit das eine explosive Mischung ergebe. Shot heißt Schuss, sagt der Barkeeper und lacht blöd, da steht Petra schon dicht hinter David, von der dieser wiederum noch nicht wissen konnte, dass sie Petra heißt. Und Petra hat sich angestellt mit dem Ziel, den Barkeeper nach dem Handlexikon der Getränke, dritte Auflage 1996, zu fragen.
David hat den fertig gemixten Shooter vom Barkeeper im Shot-Glas entgegengenommen, hat sich umgedreht, Petra ist weiter vor an den Tresen gegangen, David wollte noch einmal zurück, um die Serviette und das Glas mit den Nüsschen mit an seinen Stehtisch zu nehmen, in diesem Moment hat Petra sich wieder vom Tresen weg und ein wenig in Richtung Tanzfläche gedreht, um David Platz zu machen für seine Hand, die dann schon das Glas mit dem Fireball und das andere mit den Nüsschen gehalten hat, und da sind sie dann natürlich sowas von zusammengestoßen, nicht mit den Köpfen, Gott sei Dank, aber doch so unglücklich, dass der Fireball aus dem Shot-Glas auf Petras T-Shirt gelandet ist, sämtlich. Es sind nur 3 cl, aber 3 cl Grenadine-Sirup machen sich auf einem weißen T-Shirt doch sehr bemerkbar. Petra hat kurz gekreischt, der Barkeeper hat besorgt zu den beiden geguckt und dann den Kopf geschüttelt, und vielleicht hat er da gedacht: Das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Oder er hat gedacht: Das wird noch was mit den beiden, aber der obdachlose Alkoholiker mit seinem Fireball hat es leider sowas von blöd angestellt.
Barkeeper sehen natürlich sehr viel, wenn der Tag lang, die Nacht dunkel und die Bar, wenn auch diskret, beleuchtet ist, und sie können sich ihren analytischen Reim auf das chemische Aufeinandertreffen zweier Menschen machen, aber alles sehen sie freilich auch nicht. Denn sie sind nicht zum Schauen im The Way Things go, sondern zum Arbeiten. Sollte es jemals nichts zu arbeiten geben, gibt es aber viel zu schauen, denn eigentlich passiert in so einer Bar immer etwas. Sie ist wie ein kleiner Brandherd, wie ein Schmelztiegel, wie ein Kessel über dem Feuer. Und gibt es einmal sehr viel zu schauen, dann liegt es an den Barkeepern, ihren Gästen vor dem Nachhausewanken noch Aspirin und Kondome zu verkaufen. Wegen des sogenannten Zusatzverdienstes. Und wegen der sogenannten Kettenreaktion: Kater, Alkoholvergiftung, Geschlechtskrankheit, Schwangerschaft et cetera. Et cetera? Welche Gefahr droht denn noch nach einem Abend im The Way Things go, außer Kater, Alkoholvergiftung, Geschlechtskrankheit, Schwangerschaft? Irgendein Scheitern droht immer, sagt der Barkeeper, und er sagt es radikal, philosophisch, menschheitsgeschichtlich.
Aber so weit sind wir nicht bei David und Petra. Noch sind wir an jenem Punkt, an dem David Petra den Fireball aufs weiße T-Shirt geschüttet, der Barkeeper den Kopf geschüttelt, David den Tag über noch nicht an den menschenverachtenden Diktator gedacht hat, Petra kurz aufgeschrien hat und David ihr entsetzt aufs beschmutzte T-Shirt starrt. Mehr als »Oh mein Gott« bringt David jetzt nicht zwischen den Lippen hervor, und denkt dann sofort daran, dass man erst »Oh mein Gott« sagt, seit es in den amerikanischen Serien, die deutsch synchronisiert werden, so häufig vorkommt. Im Deutschen, denkt David, hat man vielleicht »mein Gott« gesagt oder »meine Güte«, aber nie in dieser Abfolge von drei Wörtern Oh-mein-Gott, aber jetzt fasst er sich wieder und sagt: Entschuldige, oh mein Gott. Die rote Grenadine ist eine große Katastrophe für Petras zuvor noch weißes T-Shirt, aber bloß eine halb so große Katastrophe für Petra selbst, denn, denkt sie jetzt, David, von dem sie ja noch gar nicht wissen kann, dass er David heißt, sieht doch ganz gut aus, und er hat sich soeben für sein Missgeschick entschuldigt, und schuld sind sie ja beide, Gott am allerwenigsten. Also sagt Petra: Gott kann diesmal nichts dafür. Und David denkt, dass diese Frau ganz gut aussieht, auch mit dem roten Fleck auf dem weißen T-Shirt, und dass Gott vielleicht doch etwas dafür kann, denn er hat ihn jetzt in ein Gespräch mit Petra verwickelt, deren Namen er noch nicht weiß, und deshalb sagt er jetzt: Es tut mir so leid. Ich bin David.
Petra lacht und sagt: Ich bin Petra, und hättest du deinen Saft nicht auf mein T-Shirt geleert, könntest du das jetzt auch auf meinem T-Shirt lesen. Und David sieht genauer hin und sieht, dass unter der roten Grenadine rot der Name Petra geschrieben steht. Und dann guckt er schnell wieder in Petras Augen. Der Barkeeper, der die ganze Zeit zugesehen hat, grinst und füllt zwei neue Fireballs in zwei frische Gläser und stellt sie vor David und Petra auf den Tresen. Prost, ihr zwei!
Schöner Name, sagt David jetzt, obwohl er den Namen nicht schön findet, sondern Petras Augen. Petras Augen lachen, und sie sagt: Schönes T-Shirt!, und David sagt noch einmal Oh mein Gott, weil er denkt, Petra sagt »schönes T-Shirt« im Sinne von »schöne Bescherung«, aber er nimmt sich trotzdem vor, ab jetzt nicht mehr »Oh mein Gott« zu sagen.
Gott hat die Dinge nur angeordnet und aufgebaut, sagt Petra jetzt, für das Umfallen, Anschütten, Explodieren danach kann er nichts. David fragt sich jetzt, ob er es bei Petra mit einer sogenannten strenggläubigen Christin zu tun habe, aber dann sieht er, dass sie weiterhin lacht, während sie über den Lauf der Dinge spricht. Und David hat auch nichts gegen strenggläubige Christinnen, nur würde es schwierig werden, wie man so sagt, bis zur Ehe abzuwarten. Hier macht David in seinen Gedanken einen harten Schnitt, ja, was ist da in seinem Kopf ins Rollen und Drehen geraten?
David hat sich verliebt. David hat sich verliebt, das sieht der Barkeeper, das sieht die Kellnerin, das kann sogar der DJ von seinem DJ-Pult aus sehen, und der legt jetzt eine Nummer auf: My heart is on Fire. Alle sehen es, sogar der Stehtisch sieht es!, aber David und Petra sehen es noch nicht. Sie sprechen miteinander und trinken ihren Fireball, und David gibt noch einen zweiten aus als Entschuldigung für seine Unachtsamkeit. Prost, Petra, sagt David. Und Petra sagt: Prost, David. Und dann sagt sie noch einmal: Schönes T-Shirt, und deutet auf Davids T-Shirt. Sind kleine Fische drauf, sagt David und lacht darüber, dass er etwas so Offensichtliches sagt, etwas so Redundantes, etwas so Uninformatives, aber er will jetzt auch nichts Christliches zum Thema Fische sagen. Fischli, sagt Petra, denn sie ist Schweizerin, und David lacht wieder und sagt: Ach, die Schweizer mit ihrem Dialekt! Petra sagt dann, das sei nicht Dialekt, das sei Schweizer Hochsprache, und David denkt sich, er will jetzt als Deutscher nicht an den menschenverachtenden Diktator denken, und sagt deshalb jetzt einmal nichts. Er sieht Petra einfach an und bemerkt nun doch, dass es in ihm brodelt, brennt und lodert, aber im guten Sinne, im erfolgversprechenden Sinne. Und trotzdem sagt er: Wie kann ich ausgehtechnisch nur so scheitern und einer Frau den Fireball aufs T-Shirt kippen? Das ist umständlich formuliert, aber es bringt Petra zum Lachen, nämlich erfolgversprechend zum Lachen.
Und dann sagt Petra ironisch: Schicksal. Und dann, unironisch, fragt sie, ob David das Duo Fischli / Weiss kennt, die beiden Künstler, die diesen Film gemacht haben. David guckt wissend, aber er ist unwissend. Das kann sogar der Barkeeper sehen, während er mit seinem dicken Pinsel Asche aus den Bechern bürstet in einen schwarzen Müllsack hinein. Ein Stummel glost noch, und der Barkeeper tritt gegen den Müllsack, bis das kleine Glutnest erlischt. Dann redet Petra über Fischli / Weiss, verkleidet als Pandabär und Ratte, dann über ihre Wurstarbeiten aus den achtziger Jahren und dann über den Stein auf einem anderen Stein als eine der letzten gemeinsamen Arbeiten der beiden. Findet mich das Glück?, sagt sie dann. Aber David kennt auch diese Arbeit von Fischli / Weiss nicht, deshalb hört er es als Frage, an ihn gerichtet: Findet mich das Glück? Und deshalb sagt er, ohne nachzudenken, zu Petra: Ich glaube, es findet dich. Und dann lacht Petra, und jetzt spürt auch sie, wie der Fireball durch ihre Gedanken rollt und wie er über das Blut direkt ins Herz gekullert und gekugelt ist und dort eine Reaktion nach der anderen auslöst. Wie der Feuerball aus dem Film von Fischli / Weiss, der, wie ein brennender Komet um eine Stange rotierend, zu Boden fliegt, etwa in der Mitte des Films, während die Kamera ruhig abwartet, aber auch rechtzeitig bei jedem neuen Spektakel zur Stelle ist. Beinah eine riesige, ungeschnittene Plansequenz, denkt Petra und sieht in Davids leuchtende Augen. Und dann erzählt sie David, wie der Lauf der Dinge vollzogen wird, wie am Anfang ein schwarzer Müllsack sich dreht und auf einen Reifen fällt, wie eine Leiter eine Bahn hinabwandert, wie ein Säckchen sich eine Eisenstange hinunterdreht, wie eine Flasche rollt, wie sich Schaum bewegt, wie schwarze Flüssigkeit rinnt, wie es dampft, wie brennende Kerzen Schaum in Brand setzen, der wiederum eine Zündschnur entflammt, wie eine Blase wie aus Kaugummi oder ein Kondom sich füllt, wie ein Sessel steht, nur auf zwei Beinen, und kippt, wie langsam, langwierig, eine Schüssel mit Wasser gefüllt wird, wie ein Teppich sich ausrollt, wie ein Plastikbecher, gefüllt mit Lehm oder Ähnlichem, eine schiefe Platte in vielen Bögen hinunterrollt, wie Asche aus einem Eimer geschleudert wird, wie ein Luftballon platzt und so ein Kartonring zu Boden fällt, wie ein Rollwägelchen mit Kerze oben dran ein zweites Rollwägelchen mit Feuerwerksantrieb in Gang setzt, wie Geräusche zu hören sind, als wäre es Silvester, wie die Dinge puffen, ploppen, spritzen, knallen.
Während Petra das alles erzählt, sieht David auf ihre Lippen, auf ihre Hände und auf den roten Fleck auf ihrem T-Shirt. Er bestellt noch zwei Fireballs und sagt manchmal aha und soso, und es interessiert ihn wirklich, obwohl nacherzählte Filme so langweilig sind, an Langeweile nur zu übertreffen von nacherzählten Kunstfilmen, aber bei Petra, da klingt alles anders, da klingen die Worte, als wäre es Silvester, wie ein Puffen, ein Ploppen, ein Spritzen und ein Knallen. Und er denkt jetzt, dass die beiden Künstler ihre Freude daran gehabt hätten, Petra zuzuhören und seine, Davids, schmutzigen Gedanken dabei zu lesen. Würden sich humorlose Künstler denn je als Pandabär und Ratte verkleidet und Wurstskulpturen fotografiert haben? Nein, denkt David. Und unabsichtlich ruft er es auch laut aus: Nein! – Wie, nein?, fragt Petra. Ach, sagt David, ich wollte bloß nicht, dass du aufhörst, mir den Lauf der Dinge zu schildern.
Und Petra fährt fort: Wie ein Fass rollt, wie eine Flasche umkippt, wie Eisbrocken am Boden liegen, wie eine Zeitung brennt, wie sich alles vorwärts bewegt, aber auch wieder zurück, beispielsweise eine Wippe mit einer Kerze vorn dran, damit sie sich nach oben bewegt, um eine neuerliche Zündschnur zu zünden, wie Leitern nicht nur stehen und gehen, sondern auch fallen, wie die Gegenstände also auch entgegen ihrer Zuschreibung oder ihrem Zweck gebraucht werden, Funkenflug!, wie etwas wie Benzin sich entzündet, so viele Explosionsorte! Wie etwas geschleudert wird, ein kleines Schiffchen ausschickt, wie ein Rad, das Funken sprüht und durch einen Reifen fährt eine Metallbahn entlang, dann in einem Kübel brennend untergeht. Und all das Klirren, Zischen, Brauen, Gurgeln, Knistern, Gießen, Plätschern! David denkt jetzt, während Petra spricht, eindeutig und unverblümt daran, dass er beim Barkeeper Aspirin und Kondome kaufen möchte. Wie Erde brennt wie drei Mini-Vulkane, wie all die sinnlosen Apparaturen und Mechaniken so etwas wie eine absurde Stadt aus der Zeit der Industrialisierung erschaffen, wo alles werkt und rattert und brennt, eben nicht digital, sondern mechanisch, und wie das auch mit dieser Zeit zu tun haben könnte, in der der Lauf der Dinge gedreht worden ist, einer Zeit vor dem Internet in allen Haushalten. Wie dann ein Schuhpaar wie von zwei Patschfüßen vorwärts getrieben wird und seinen Weg findet, wie nicht eine Hand die andere wäscht, sondern ein Reifen den anderen wässert und ihn so ins Rollen bringt, wie auf engem Raum alles aufgebaut worden ist, wie gefährlich das auch ist! Wie ein Fahrzeug mit Messern vorn dran als ein Panzerchen gegen das nächste Ding fährt, wie man an all die Gefahren der Kindheit denkt beim Zusehen: die ewigen Warnungen vor dem Ausschütten von Flüssigkeiten aus Trinkbechern, aus Blumenvasen, aus Tintenfässern, an Messer, Gabel, Schere, Licht, an den Krieg im Kinderzimmer. Und wie ein Teekessel wie eine Waffe sich mit Messer gegen einen Ballon richtet, wie Schaum losgetreten wird wie eine Schneelawine, wie alles vermeintlich Stabile einbricht, all diese zielgerichteten Aktionen des Scheiterns und Vorwärtskommens, wie dann aber auch wieder um den heißen Brei herumgeschlichen wird, bis etwas zuschlägt, weiterrollt, sich entzündet. Wie eine Schaufel fällt, Wasser ausgeschüttet wird, ein Luftballon Luft verliert, jämmerlich, wie ein klebriges Röllchen klebrig nach unten rollt, wie die Kamerabewegungen das einzige Indiz auf menschliche Anwesenheit innerhalb dieses Filmes sind, wie ein Luftballon mit Flüssigkeit gefüllt wird und zu Boden platscht wie ein dicker Wal, wie eine Dose rutscht und fällt und Wasser verliert, wie all der Müll präzise aufgebaut ist in monatelanger Vorbereitung, wie etwas zurückrollt, um ein Gewicht zu verlagern und ein Brett vorn anzuheben, wie am Ende Dampf ist, dann eine Schwarzblende, und im Nachspann nur noch die Geräusche zu hören sind, als Hinweis darauf: Es geht weiter, ohne dass wir zusehen können. Du kennst den Film sehr genau, sagt David. Ja, sagt Petra.
Und das ist der Moment, in dem David daran denkt, dass er jetzt sehr lange zugehört hat und deshalb, als Konsequenz daraus, Kettenreaktion, Petra küssen darf. Und Petra denkt das auch. Und sie küssen sich, und der Barkeeper freut sich, denn auch er hat ein Herz, und der DJ, Kettenreaktion, spielt jetzt Ring of Fire. Das ist zwar kein Schmusesong, aber das stört jetzt niemanden, denn Davids Kopf brennt lichterloh, sein Herz und seine Hände. Und bei Petra ist es ebenso, und sie wüsste auch nicht, was es jetzt noch zu reden gäbe. Und dann fragt David: Findet dich das Glück?, und Petra sagt, sie glaubt schon. Und dann küssen sie einander wieder, bis David sagt, er habe sein Scheitern, das Ausschütten des Fireballs auf Petras T-Shirt, zu einem Glücken, das Küssen von Petras grenadineroten Lippen, gemacht. Und dann erzählt Petra die Sache mit dem Scheitern, das bei Fischli / Weiss ein Gelingen ist, und dass Glück und Gelingen etymologisch vielleicht verwandt sind. Oh mein Gott, sagt David beglückt, und hier macht der Text einen Loop, und wir kommen an die Stelle, wo David beschlossen hat, jetzt nicht an den menschenverachtenden Diktator zu denken, jetzt, um Gottes willen, bloß nicht an den menschenverachtenden Diktator denken, aber sag einmal einem Deutschen namens David, er soll nicht an den menschenverachtenden Diktator denken. Schon ist es passiert.
Und das ist immer ein trauriger Moment in einer Reihe von vielen Momenten. Der traurigste für die Menschheit, aber auch ein trauriger, so egoistisch, persönlich und kleinlich darf David jetzt sein, für einen einzelnen Mann in einer Bar, der gerade eine Frau im Arm hält, die gerade daran denkt, dass beim Barkeeper hinterher noch Kondome gekauft werden müssen. Es ist der Moment, wo der Lauf der Dinge plötzlich stoppt. Wo die Ketten der Gespräche, Drinks und Gedanken dann eines nicht als Reaktion zur Folge haben: die sogenannte Erektion. Ja, das ist die schmutzige, traurige, kleinliche Pointe im Aufeinandertreffen zweier verliebter Menschen in einer Bar namens The Way Things go. Es ist der Moment, in dem David aufhört, Petra zu küssen. Er nimmt seine Hände von ihrem Hintern und holt eine Zigarettenschachtel aus seiner Jacke, die er über dem Hemd mit den vielen kleinen Fischli trägt. David raucht und versucht, seine akute Traurigkeit und seine augenblicklich einsetzende Unfähigkeit zur Aktion zu überspielen. Sogar der Barkeeper bemerkt jetzt diesen Moment des Stillstands, in welchem sich bloß noch der Rauch aus Davids Zigarette gegen die Decke schiebt. Ein stilles Kräuseln und Drehen von grauen Rauchschwaden.
Der Barkeeper gibt noch eine Runde Nüsschen aus. Was ist los?, fragt Petra jetzt. David ist froh, dass sie fragt, aber er will jetzt nichts sagen über den möglichen Kausalzusammenhang zwischen seinem Gedanken an den menschenverachtenden Diktator und einer Kusspause im The Way Things go. Nein, David soll jetzt nichts sagen. Auch der Barkeeper findet, dass es jetzt an der Zeit ist, einmal nichts zu sagen. Den Lauf der Dinge einmal aufzuhalten.
Es ist lange still zwischen den beiden. Dann trinken sie noch einen Fireball, rauchen noch ein, zwei Zigaretten, der DJ spielt Hintergrundmusik. Dann fasst sich David ein Herz und sagt: Oh mein Gott, obwohl er nicht an Gott glaubt, aber seltsamer- oder komischerweise ist das in diesem Moment doch das Vernünftigste, was ihm einfällt. Und Petra lacht und gibt David einen kleinen Kuss auf die Wange. Glaubst du an Gott?, fragt sie dann. Nee, bloß nicht!, ruft David, und beide lachen wieder. Nur in schwierigen Momenten, sagt David dann. Kann ich verstehen, sagt Petra.
Findet mich das Glück, sagt David dann. Ja?, fragt Petra. Findet mich das Glück, das ist so eine Frage, die erinnert mich an die Fragen bei Hiob. Ach so?, sagt Petra, und diesmal ist sie es, die wissend guckt, aber unwissend ist. David kramt sein Handy aus der Jackentasche. Warte, ich lese sie dir vor. Okay, sagt Petra. Sei ganz Ohr!, sagt David verschmitzt. Bin ich, sagt Petra und drückt sich ein bisschen fester an ihn. Also, sagt David, etwas peinlich berührt, aber doch betrunken genug, um aus der Bibel vorzulesen, die Fragen bei Hiob, Hiob 38, also, hör zu: »Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taues gezeugt? Aus wes Leib ist das Eis gegangen, und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass das Wasser verborgen wird wie unter Steinen und die Tiefe oben gefriert?« Petra hört zu und umarmt David. »Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das Band des Orion auflösen? Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit oder den Bären am Himmel samt seinen Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen, oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, dass dich die Menge des Wassers bedecke? Kannst du die Blitze auslassen, dass sie hinfahren und sprechen zu dir: Hier sind wir? Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, der die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten, wenn der Staub begossen wird, dass er zuhauf läuft und die Schollen aneinanderkleben?«
Petra umarmt David weiter und sagt nichts. Schöne Fragen, nicht?!, sagt David nach einer Pause. Und gleichzeitig sind das Fragen, die das Ende der Welt einläuten. Mit den sieben Sternen in seiner Hand. Es ist das Prinzip der Frage, dass sie eine Antwort fordert. Das sind die Kettenreaktionen, die die Sprache auslöst. Der Lauf der Wörter.
Ja, sagt Petra. Schon komisch und schön, wen man so im The Way Things go kennenlernen kann. Fast ein Wunder, ein rauchendes, stampfendes, rollendes, tobendes, stolperndes, krachendes, brennendes, rinnendes, fließendes, laufendes, plumpsendes Wunder. Kann ja fast nicht sein, dass zwei Menschen so aufeinandertreffen! Die einander zwischen Tresen und Tanzfläche so viel zu sagen haben über Gott und die Welt und dabei noch so gern Fireball trinken und Nüsschen essen! Reaktion um Reaktion, sagt der Barkeeper, der auch ein Alchemist ist. Aber gerade der arbeitsamste unter den Barkeepern möchte auch einmal nach Hause gehen, um in seinem Handlexikon weiterzuschmökern. Und so wischt er demonstrativ über die Tischplatte, räumt die Nüsschen in den Schrank und guckt fragend in die beiden halbleeren Shot-Gläser. Aber Petra und David wissen: Das ist keine Frage, die eine Antwort haben will, sondern eine, die eine Reaktion auslösen soll, nämlich jene, dass die beiden letzten Gäste des Abends nun das The Way Things go verlassen mögen.
Da war auch keine Zeit mehr für den Aspirin- oder Kondomkauf. David und Petra sind müde, aber dennoch davon überzeugt, dass die Dinge ihren Lauf nehmen werden und dass das Glück sie gefunden hat. Aber laufen die Dinge? Oder stolpern sie? Läuft eins ins andere, unausweichlich?
Taxi?, fragt Petra, draußen vor dem The Way Things go. Es ist schon fast wieder hell, und die Vögel zwitschern bereits. Soll Petra, weil es so ausnehmend schön gewesen ist mit David und ihr T-Shirt auch längst wieder trocken ist und der Fleck sich auch später noch auswaschen lassen wird und es auch sinnvoller wäre, ein T-Shirt mit dem roten Schriftzug Petra und einem roten Fleck darüber bald auszuziehen: Soll sie also aus all diesen Gründen mit David im selben Taxi nach Hause fahren und zu Ende führen, was der Barkeeper als erster von ihnen vorausgesehen und angedacht hat? Und würde es nicht bei diesem einen Mal bleiben, und würden sie danach einander wiedersehen, öfter, mehr noch, für eine lange Zeit in ihrem Leben, vielleicht bis ans Ende ihrer Tage?
Petra lacht jetzt über sich selbst bei diesem Gedanken. Und da halten plötzlich, ohne sie gerufen zu haben, gleichzeitig zwei Taxis vor dem The Way Things go, und David sieht Petra an und Petra David, und nun sind sie zu entscheidungsschwach, zu betrunken, zu schüchtern vielleicht doch, um beide ins selbe Taxi zu steigen, also steigt David in seins und Petra in ihres. Vorher waren es noch zwei Taxis ohne Fahrgast, jetzt ist das eine seines und das andere ihres, und die Taxifahrer gucken fragend auf den Rücksitz, und Petra nennt ihrem Taxifahrer ihre Adresse, und David nennt seinem Taxifahrer seine, und gleich geht es los in den neuen Morgen.
Aber einmal noch springt David aus dem Auto, springt tatsächlich wie ein Gummiball, schreit, trommelt an die Fensterscheibe, Petras Taxifahrer bleibt genervt stehen, und Petra kurbelt die Fensterscheibe nach unten, und David ruft: Ist das jetzt ein Korb? Und Petra ruft: Nein, das ist ein Ball, fang ihn auf! Und David: Morgen, im Museum? Und Petra: Ja, gut! Und David wieder: Am frühen Abend, bevor es zusperrt? Und Petra wieder: Ja, 18 Uhr, morgen, also heute, 18 Uhr, 6 Uhr abends! Und David ruft: Ja, ja, ja, ich werde dort sein, bei den Videos!, und Petra ruft: Ja, ja, ja, ich auch! Und dann setzen sich die beiden Autos in Bewegung, und beide rollen durch die Nacht, sicher, ohne Hindernisse, ohne Aufprall, ohne Unfall, ohne Explosion, und die Dinge, sie werden, nach ein bisschen Schlaf, Zähneputzen und Kaffee, ihren Lauf nehmen.
Die Jahreszeit der T-Shirts
Der Sommer ist die Jahreszeit der T-Shirts. Ihre Muster, Farben und Sprüche lassen sich nicht mehr unter der Jacke oder dem Pullover verbergen, und ein Spaziergang durch die Einkaufsstraßen der Stadt entwickelt sich, Passant um Passant, zu einem Fortsetzungsroman für jene, die nicht anders können, als alles zu lesen, was in leuchtenden Buchstaben fröhlich auf Textil prangt. Die Feststellung »Bier formte diesen schönen Körper« ist dabei noch gar nicht das Ende der Geschichte.
Im Schaufenster eines beliebten Bekleidungsgeschäfts habe ich im Vorbeigehen ein T-Shirt gesehen mit folgender Aufschrift: »Rude girls go backstage.« Freche Mädchen kommen demnach hinter die Bühne, in die Künstlergarderobe, in den Proberaum. Der Spruch ist eine verkürzte und abgewandelte Version von »Good girls go to Heaven, bad girls go everywhere« – die schlimmen Kinder kommen, anders als es ihnen früher einmal angedroht worden ist, eben nicht mehr in die Hölle. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überallhin: Belege für diesen Satz als Zitat innerhalb der Popkultur lassen sich etwa seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts finden, mitunter wird er der Hollywood-Schauspielerin Mae West als Urheberin zugeschrieben. Wenn wir nun das Quantum Selbstironie abziehen möchten, das die potenzielle Trägerin eines solchen T-Shirts durchaus aufbringen darf, bleibt der nackte Kern der Aussage übrig: Wilde Mädchen stehen nicht auf der Bühne, nein, sie verziehen sich angeblich brav hinter die Kulissen. Um dort eigentlich was zu tun? Das Catering zu testen? Den Tourbus zu reinigen? Ausgiebig MeToo-Debatten zu führen?
Und welche T-Shirt-Sprüche hat die Textilindustrie für die wilden Buben ausgewählt? Ein schneller Blick auf die einschlägigen Verkaufsplattformen im Internet fördert zahllose Möglichkeiten zutage: Für junge Männer gibt es da einmal T-Shirts mit der lakonischen Aufschrift »Bad Boy«. Wohin sie gehen, wird seltener genannt. Man möchte vermuten, dass sie sogleich und ohne Hindernis on stage gehen, es gibt aber auch die touristischere Variante: »Good boys go to heaven, bad boys go to Bangkok.« Eine andere Spielart lautet: »We ride together, we die together. Bad boys for life.« Sie fahren miteinander, sie sterben gemeinsam. Wohin der Weg sie führt, darüber wird nichts gesagt. Böse Buben, ein Leben lang. Ein anderes T-Shirt weist seinen Träger als denjenigen aus, vor dem die Mütter ihre Töchter immer schon gewarnt haben: »I’m the guy y’r mom warned you about!« Eine Warnung, die man vielleicht ernst nehmen sollte, jedenfalls, was Fragen des Modegeschmacks und des Humors anbelangt. Boys don’t cry wiederum hießen ein Album und ein Song der Pop-Band The Cure Anfang der achtziger Jahre, der Spruch wurde gern auf T-Shirts gedruckt. Es lassen sich aber auch softere Formen der Selbstbeschreibung finden: »Well, a boy’s best friend is his mother.« Wem selbst die Muttersöhnchen zu aufdringlich sind, der wählt die intellektuelle Variante, vielleicht unisex zu tragen: »Boys in books are just better.« Die Jungs aus den Büchern sind einfach besser.
Woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis, mit einem T-Shirt-Spruch derart Selbstauskunft zu geben, frage ich mich. Und was sagt sein Inhalt, massenhaft angeboten und erworben, denn über den Zustand unserer Gesellschaft, über das Verhältnis der Geschlechter, die Zuweisung von Himmel, Hölle und Bangkok aus?
Amerika als T-Shirt
»Sorry about Betsy DeVos«, »America needs lesbian farmers«, »Just another slut on birth control«. Betsy DeVos war ab dem Jahr 2017 in der Regierung von Donald Trump Bildungsministerin der Vereinigten Staaten, und eines ihrer proklamierten Ziele war es, die Förderung staatlicher Schulen abzuschaffen. Dass Amerika mehr lesbische Landwirtinnen bräuchte, ist als Replik auf eine abwertende Aussage durch den konservativen Radiomoderator Rush Limbaugh zu lesen. Und eine slut, die sich für birth control einsetzt: is definitely reclaiming a four-letter-word. Wer sich für Geburtenkontrolle einsetzt und dafür als Nutte beschimpft wird, trägt die Beschimpfung als T-Shirt-Spruch zur Schau – zur Beschämung des konservativen Gegners. Ich befinde mich im T-Shirt-Laden Raygun im East Village von Des Moines, dem hippen, gentrifizierten Viertel der Hauptstadt des Bundesstaates Iowa. Die T-Shirts mit aufgedruckten Sprüchen in allen Farben, die zeitnah auf die politischen Ereignisse in Amerika reagieren, sind ein Produkt des Mittleren Westens, das humorvoll den Patriotismus der Rednecks mit den Slogans der linken Protestkultur mixt. »Make America great again« ist als Parole auch hier ein Verkaufsschlager, allerdings illustriert mit den Porträts von Michelle und Barack Obama. »Yes, we can« hieß bekanntlich dessen Wahlspruch im Präsidentschaftswahlkampf 2008, und rückblickend liest sich dies wie der hoffnungsfrohe Beginn eines Halbsatzes, der nun, mit enttäuschendem Ausgang, weitergesprochen werden muss: »Yes, we can … make America great again.« Um sich ein vollständiges Bild von Amerika zu machen, ist es wohl nötig, den gesamten Satz zu lesen.
Ich frage mich, was hat sich verändert, seit ich im Jahr 2015 das letzte Mal hier gewesen bin? Es ist dieselbe Landschaft mit ihren grünen Hügeln und den gelben Maisfeldern, die Grant Wood in den 1920er und 1930er Jahren so naiv-sachlich und prägnant gemalt hat. Im Des Moines Art Center, einem großartigen dreiteiligen Museumsbau, von den Architekten Eliel Saarinen, I. M. Pei und Richard Meier zwischen den 1940er und 1980er Jahren gebaut und erweitert, hängt noch, wie beim letzten Besuch, Grant Woods Ölgemälde The Birthplace of Herbert Hoover. Es zeigt ein Grundstück, auf dessen Rasen zwischen Haus und Hecke ein schlankes Männlein steht, das mit der rechten Hand auf seinen Besitz zu deuten scheint. Seht, das gehört mir. Vielleicht ist es Herbert Hoover selbst, der bis eben noch angeblich unbeliebteste Präsident der amerikanischen Geschichte, der hier steht, nun deutet und einen Schatten wirft.
Noch immer fahren über solchen Rasen die gelb-grün-lackierten Mähfahrzeuge von John Deere, der hier ein Monopol zu haben scheint auf alles, was Lärm macht. Der Autor und Reiseschriftsteller Bill Bryson, selbst in Des Moines geboren, schrieb Ende der 1980er Jahre darüber so liebevoll-spöttelnd in The Lost Continent, auf Deutsch Straßen der Erinnerung. Und immer noch kutschieren die schwarz gewandeten Amish mit ihren Pferdewagen auf der rechten Spur der Landstraße zu ihren Feldern, während nebenan der Monsanto-Konzern sein gentechnisch verändertes Saatgut produziert.
Studentin Sheila hat mich zu einem kurzen Roadtrip nach Kalona eingeladen, wir sitzen hoch auf dem dunkelroten Pick-up mit four wheel drive, den hier fast alle fahren, meist eben in den Farben Rot, Schwarz oder Silbergrau, und biegen bei zwei Hinweisschildern ab, wovon das eine etwas über unsere Sünden sagt, die uns im Himmel vergeben oder für die wir zur Rechenschaft gezogen werden, und das andere verspricht auf Erden: Fresh eggs, $ 1,25. Wir steigen aus, klopfen an die Tür eines der typischen weißgetünchten, holzverkleideten Farmhäuser, und eine ältere Bäuerin in blasslilafarben-mennonitischer Kleidung samt Häubchen über dem grauen Haar öffnet uns. Wir kaufen je zwölf Eier, zählen umständlich die Pennys und Quarters zusammen, und Sheila nutzt die vorsätzlich verstreichenden Minuten, um zu erzählen, dass ihre Reisebegleiterin aus Österreich sei. Keine Reaktion in den Augen unseres Gegenübers. She speaks German, versucht es Sheila weiter. Ah, German!, plötzlich lächelt die Bäuerin und sagt einen Satz, der hier, zwischen Himmel und Eierkartons stehend, beinah mystisch klingt: So you must have come a long, long way. Die Mennoniten in Kalona sprechen in der Familie Deutsch miteinander, und wir schaffen es noch, ihr ein paar Sätze zu entlocken, die in meinen diesbezüglich unerfahrenen Ohren schwäbisch klingen. Plautdietsch wäre die korrekte Bezeichnung, lese ich später. Ihre Vorfahren kämen aus der Schweiz, sagt die Frau, und ihr Beispielsatz lautet in etwa: Buben und Mädchen, draußen im Garten ist es chilly. Ich sage darauf etwas in meinem Deutsch, doch sie versteht mich leider nicht.
Was hat sich in eurem täglichen Leben, im Alltag, verändert, seit der neue Präsident im Amt ist?, frage ich in Iowa und Chicago immer wieder die Leute, denen ich begegne. Es war doch angeblich immer schon so, die Farmer auf dem Land, die republikanisch wählten, die College-Studenten in der Stadt, die demokratisch wählten? Die progressiveren Städte an der Ost- und der Westküste, das konservativere Landesinnere? Ist das Land denn wirklich gespalten zwischen den politischen Lagern? Und was beschreiben die Statistiken über das Wahlverhalten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Wie antworten die Menschen, wenn man individuell nachfragt?
Betsy, die Verkäuferin im Western-Boots-Laden in Grinnell, wählte Hillary Clinton, der Partner eines Kollegen vom Grinnell College of Liberal Arts, an dem ich unterrichte, wiederum Trump. Vor mir auf dem Interstate Highway fährt ein dunkelblauer Ford mit dem alten Aufkleber »Bernie 2016«, direkt daneben prangt ein christliches Fischsymbol, in der Parkgarage in Des Moines parkt ein beigefarbener Mercedes mit »Gun owners for Trump« und »Hillary for prison 2016«. Ist es wirklich immer rechts versus links? Oder sind die Bruchlinien woanders zu suchen? Dort, wo vormals der Konsens vorhanden schien, die demokratischen Rituale nicht grundsätzlich infrage zu stellen? Was passiert, wenn einer, der macht, spricht und entscheidet, sich nicht mehr an die gewohnten Formen des Umgangs hält?
»Love Trumps Hate« ist einer der beliebtesten T-Shirt-Sprüche seit der Wahl zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Liebe Trumps Hass! Oder: Liebe übertrumpft Hass. Oder: Liebe, Trumpf, Hass: ein Satz wie ein Blatt Spielkarten. Welche Farbe ziehen wir aus dem Stapel?
Es ist einfach auch die Atmosphäre, die vorherrscht, sagt meine amerikanische Freundin Kathleen. Samt der immer gleichen Antwort auf die Frage, wie es einem gehe: den Umständen entsprechend. Wie war das, frage ich sie, als sie beim »Women’s March« war in D. C., am ersten Tag nach der Amtseinführung des Präsidenten? Was sagt sie zum Op-Ed, dem Gastkommentar eines Journalisten der New York Times nach dem Marsch, der die pinkfarbenen Mützen und Häubchen der Teilnehmerinnen, die Pussyhats, als niedlich und demokultur-nostalgisch belächelt? Zu den anderen Stimmen, die dem Marsch einen Mangel an Intersektionalität vorwarfen? Es war definitiv gut, dort zu sein, sagt Kathleen. Es war einfach nötig, nach der Wahl dieses starke Zeichen zu setzen. Es war eine halbe Million Menschen in Washington, siebenhunderttausend waren es in Los Angeles. Die Straßen waren voll, die Bed-and-Breakfast-Zimmer ausgebucht, in der Metro gab es diese ermutigenden Durchsagen eines Mitarbeiters: Ey, Ladys, am Tag zuvor sind definitiv nicht so viele Menschen zur Angelobung gekommen, that’s fake news, Ladies, ich weiß es, ich war gestern auch schon da. Kathleen zeigt mir auf ihrem Smartphone Fotos von einem Polizisten mit Pussyhat, von einer Organisatorin mit Kopftuch, die gerade das Mikrofon in Händen hält, von einem jungen Mann mit dem Transparent: »I’m too clumsy to be around fragile masculinity.« Zu übersetzen ist dieser Spruch in etwa mit: Ich bin zu tollpatschig für die Macho-Auswüchse einer ach-so-erschütterbaren Männlichkeit, ich habe keine Nerven für die übertriebene Zurschaustellung von Männlichkeit. Die meisten der Sprecherinnen und auftretenden Künstlerinnen, die Kathleen gesehen hat, seien schwarz gewesen, die Bürgerrechtlerin Angela Davis sprach, die ganze Veranstaltung habe sich angefühlt wie der Anfang von etwas noch Größerem. Kathleen hat ein T-Shirt davon: »Women’s March 2017« steht darauf geschrieben, dazu Datum und Ort.
Bei Walmart, dem 24-Hours-Superstore für Kinderspielzeug, Schusswaffen und Vitamintabletten, sieht die Welt der bunten Sprüche ein wenig anders aus. Neben Muttertagskarten, die in kleinen Gedichten der Frau im Hause noch immer (»I can’t believe I still have to protest this fucking shit!«, hieß es auf den Schildern und Transparenten der älteren Frauen: Ich kann nicht glauben, dass ich noch immer gegen denselben alten Scheiß protestieren muss!) die Rolle der herzensguten Arbeitsbiene zuweisen, finden sich T-Shirts in den Größen Small bis XXXL mit Sprüchen wie: »I’m not rude, I’m honest«, »I don’t use machines because I am one«, »I’m surrounded by idiots«, »My shirt is brighter than your future«, »Because America«. Die Selbstvergewisserung tönt trotzig: Ich bin nicht unhöflich, ich bin nur ehrlich. Ich benutze keine Maschinen, ich bin selbst eine. Ich bin umgeben von Idioten. Mein T-Shirt leuchtet heller als deine Zukunft. Weil es Amerika ist. Zur Auswahl gibt es außerdem noch heulende Wölfe vor amerikanischer Flagge, die Minions und die Simpsons, es gibt tanzende Würstchen mit Gesichtern darauf, und es gibt alle möglichen Katzen, die durch den Weltraum fliegen, nachdem sie vermutlich LSD zu sich genommen haben.
Die Welt als T-Shirt, denke ich mit einem Buchtitel von Beat Wyss aus den späten 1990er Jahren. Amerika lässt sich auch anhand seiner Slogans auf T-Shirts und Werbetafeln lesen, anhand seiner Aufkleber und Klosprüche, anhand der gebastelten Pappkartontafeln und Transparente, die jetzt zahlreich in den Gängen der Colleges, vor Wohnungstüren und in Stiegenhäusern zwischengeparkt werden, bis sie wieder, bald, hervorgeholt werden und zum Einsatz kommen. Noch ein paar Sätze, die ich im Vorbeigehen aufgesammelt habe: »Black lives matter«, schwarze Leben zählen, bereits im Jahr 2017, im Vorgarten eines Häuschens in Madison, Wisconsin. »I stand with my muslim neighbor«, ich halte zu meinem muslimischen Nachbarn, im Buchladen Prairie Lights in Iowa City auf einem hellblauen T-Shirt. Und soeben in Chicago, von einem Obdachlosen, der um Geld bittet, auf Pappkarton gekrakelt der Wunsch, Amerika nicht »great«, sondern wieder nett zu machen: »Make America nice again.« Weiter daneben steht ein überdimensionaler betonierter Blumentopf, auf dessen Vorsprung die Menschen sitzen – es ist ein schwüler Tag im Mai – und Eis essen. Auch der Blumentopf hält ein Schild für uns bereit: »Please do not sit on Planters«, setzt euch doch bitte nicht auf den Übertopf.
French Nails aus Amerika
Du hast starke Nägel, sagt die ältere Dame zu mir, die mir die künstlich verlängerten Gel-Nägel, bemalt mit Acryllack und beklebt mit Glitzersteinen, nun abschleift, bis die blassen Originale aus Horn endlich wieder zum Vorschein kommen. Sie spricht dabei ein Englisch, das nach einer Mischung aus MidwesternAmerican und Vietnamesisch klingt, und in dieser bunten Sprache fragt sie mich auch, wo ich mir meine Nägel denn hätte machen lassen. Ich möchte Leipzig, Hauptbahnhof, antworten, aber ich sage: Europe. Es riecht ziemlich toxisch hier bei Fashion Nails in der West Street, Ecke 6th Avenue.
Die beiden vietnamesischen Kosmetikerinnen und ihr junger Kollege bei Fashion Nails in Grinnell, einer kleinen Campusstadt im Bundesstaat Iowa, wo ich mich für ein knappes Semester im Frühjahr 2017 aufhalte, sitzen in ihrem winzigen Nagelstudio, und sie husten vor sich hin. Später werde ich deshalb noch sagen: You should turn on some air circulation. It’s not because of me, you are the ones who work here every day. Gibt es denn niemanden, der sich um die Luftzufuhr kümmert?
Zwei bis vier Kundinnen werden hier jeweils gleichzeitig bearbeitet: Alte Schellack-Nägel werden abgeschliffen, neue Nagel-Extensions angeklebt und mit Airbrush-Pistolen farbig besprüht. Diesmal sollen es bei meiner Sitznachbarin offenbar weiße Nagelspitzen in Dreiecksform werden, eine dritte Kundin will ihre Nägel pink, so wie immer, heißt es. I sometimes think of leaving my comfort zone, but then again: Es bleibt bei Pink, kein Verlassen der sogenannten Komfortzone. Man hört ihnen zu, man hält einander an den Händen. Ich tauche meine Fingerspitzen in zwei Schüsselchen, gefüllt mit Aceton, und schrecke, da es brennt auf der Haut, kurz zurück. Werden mir hier meine Finger abfallen? Meine zehn ach-so-weißen, ach-so-zarten, ach-so-privilegierten Schreibfinger? Bin ich Julia Roberts als Erin Brockovich und muss die Welt retten? Soll ich es noch einmal sagen: Ladys, ihr erstickt hier noch in diesem Dunst aus Aceton, Lack, Alkohol, Schleifstaub und Nagelbett?
Ich habe mir ein einziges Mal in meinem Leben meine Nägel verlängern und sie dann mit UV-Gel aufbauen und neonorange streichen lassen, darüber wurde teilweise goldener Flitter gestreut. Den Mittelfinger schwarz lackiert – statt »Fuck you!« zu lettern –, wurde darauf mit Acrylfarbe und einem feinen Pinselchen eine Blüte gemalt, am Ende wurde just ins Blüteninnere noch ein Glitzersteinchen geklebt. Die schrillsten Nägel wollte ich, die sie zu bieten hatten am Leipziger Hauptbahnhof, wo man sich für die gesamte Prozedur eine Stunde Zeit nehmen und in etwa fünfzig Euro berappen musste. Nagelpflegerin Rubi, damals vor vier Wochen, kam ursprünglich auch aus Vietnam, war aber in Tschechien aufgewachsen. Wenn ich noch fünf Mal zu ihr ins Nagelstudio L. A. Nails kommen würde, bekäme ich beim sechsten Mal fünf Euro Rabatt. Das stand so auf der pinkfarbenen Visitenkarte, die sie mir mitgegeben hatte, obwohl ich ihr gesagt hatte, dass ich vorhätte, diese Erfahrung nur einmal im Leben zu machen. Rubi hat das nicht glauben können. Und erst einmal angekommen in Amerika, hat mir Brenda aus dem Office of International Student Affairs gleich ein zweifelhaftes Kompliment gemacht: I love your nail polish! Da ist es natürlich längst zu spät gewesen, ein Gespräch über Ironie zu führen.
Rubis pinkfarbene Karte steckt noch in meiner Geldbörse, in der sich nun Euros mit Dollars mischen, und die hellblaue Karte von Fashion Nails aus Grinnell, IA 50112, ist hinzugekommen. Ich lege sie in der Bibliothek auf den beigefarben beschichteten Schreibtisch und vergleiche ihre Gestaltung: Auf beiden Kärtchen abgebildet, und das vereint jetzt die Kontinente, ist eine Hand, man reicht einander die Hände zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und der West Street in Grinnell, gleich gegenüber von Subway und dem Supermarkt McNally’s. Und auch hier eine weiße, zarte, privilegierte Hand mit gepflegten French Nails, und auch dort: pinkfarbene Blüten, die von jener schönen Hand gehalten werden.
Die Burling Library in Grinnell bietet zur weiterführenden Lektüre beispielsweise folgende Studie: The Managed Hand. Race, Gender, and the Body in Beauty Service Work von Miliann Kang aus dem Jahr 2010. Sie berichtet darüber, wie intime Tätigkeiten des privaten Raumes immer mehr zu öffentlichen Dienstleistungen werden und wie gerade die Arbeit im Beauty- und Pflegebereich vielfach weibliche Arbeit ist, die allerdings den Migrantinnen aus bestimmten Herkunftsländern – in den US-amerikanischen Nagelstudios sind es die Vietnamesinnen und Koreanerinnen – auch ermöglicht, innerhalb eines sehr engen Segments ihr eigenes Business zu führen.