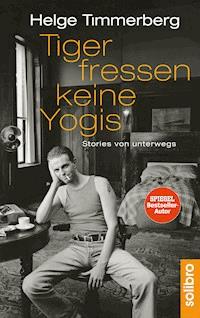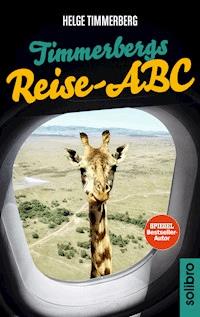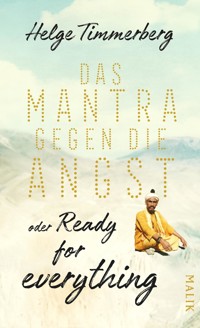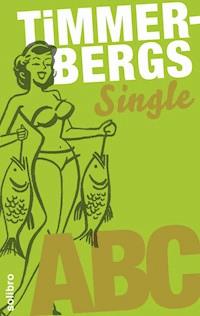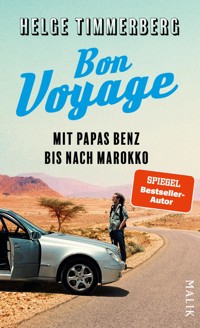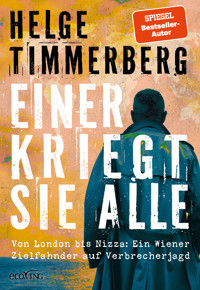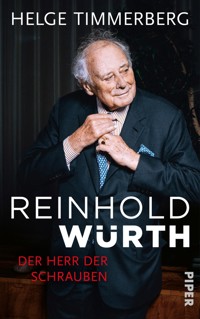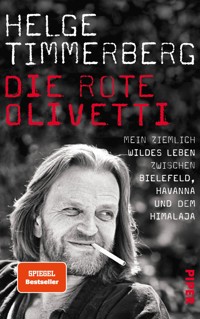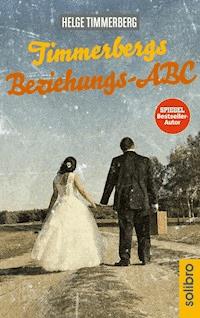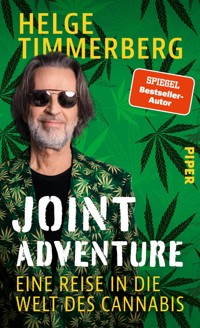
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein Körnchen Haschisch macht dich zum Weisen, das Körnchen zu viel zum Esel«, sagt ein persisches Sprichwort, und das kann Helge Timmerberg unterschreiben. Nach 50 Jahren regelmäßigen Konsums kann er Cannabis weder verherrlichen noch verteufeln. Er beschreibt einfach nur ziemlich ehrlich, wann ihm ein Joint hilft und wann er ihm schadet – und warum das niemanden etwas angeht als ihn selbst: »Ich lass mir doch nicht von Gewohnheitstrinkern das Kiffen verbieten.« Der Veteran im Krieg gegen die Marihuana-Prohibition ist nun durch die Länder gereist, die Cannabis bereits legalisiert haben. Was auf uns zukommt, wenn in Deutschland zur Abwechslung mal Pragmatismus über den erhobenen Zeigefinger triumphiert, erzählt er in diesem Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Frank Zauritz und RPdesigns / Alamy Stock Vector
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Die Cannabis-Hasser
Mein Leben als Krimineller
Malta: Danke, liebe Kreuzritter
Rüdesheim am Rhein: Gott liebt KifferInnen
Amsterdam: Die Mutter aller Coffeeshops
Weltweit: Das Märchen von der Einstiegsdroge
Tanger: »I sell hashish, I sell marihuana«
Chefchaouen: Vier große Papageien, drei kunterbunt, einer schneeweiß
Zwischen Chefchaouen und Ketama: High Mountain Taxi
Palma: Mallehuana
Thailand I: Drei Nächte in Bong-kok
Erste Nacht – Khaosan Road
Zweite Nacht – Nana
Dritte Nacht – The 420 River Cruise
Thailand II: Your Highness
Thailand III: Kiffen am River Kwai
The Atlanta
»Oriental Heritage Residence«
»Resotel River Kwai«
Thailand IV: Das Tourist-Card-Syndrom
Hollyweed I: Ein Bärchen zerkaue ich sofort
Hollyweed II: American Psycho
Hollyweed III: Kiffen für die Ukraine
Wien I: Babyhaft reine Gehirnzellen
Welt der Wissenschaft: Frohe Botschaften aus Shanghai und Bonn
Wien II: Die barmherzigen Dealer
Wien III: Der letzte Krümel
In Andrés Küche: Das Märchen von der Einstiegsdorge, Teil II
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Ein selbstsicherer Mensch ist ein totes Wesen.«
Krishna Murti
Die Cannabis-Hasser
William Randolph Hearst war vor 100 Jahren der böse Gott der US-Medien. Er besaß 25 Tageszeitungen, 24 Wochenzeitungen, zwölf Radiosender, zwei weltweite Nachrichtendienste, das Cosmopolitan-Filmstudio und eine Pistole, mit der er, Gerüchten zufolge, im November 1924 den Filmproduzenten Thomas Harper Ince versehentlich erschoss. Eigentlich galt die Kugel Charlie Chaplin, der Hearsts Geliebte erfolgreich angebaggert hatte. Und das alles geschah natürlich auf einer Jacht. Dass man hier Gerüchte als Quellen angeben muss, liegt an des Schützen Medienmacht. Seine Morgenzeitungen berichteten am nächsten Tag zwar von dem tödlichen Schuss auf John Ince, aber nicht, wer ihn abgefeuert hatte. Und schon seine Abendzeitungen ließen auch den Rest einfach weg und gaben als Todesursache einen Herzinfarkt bekannt. Wer die Tat hätte bezeugen können, tat es nicht, sondern machte stattdessen einen Karrieresprung, wie die Klatschkolumnistin Louella Parsons, die ebenfalls auf der Jacht gewesen war und danach einen Traum-Vertrag auf Lebenszeit von Hearst bekam. Und was Charlie Chaplin anging – nun ja, ein Mann, der grad dem Tod entronnen war, würde natürlich auch die Klappe halten, weil er wusste, wozu der Megaverleger William Randolph Hearst in seinem Zorn fähig war.
Das alles wäre für den Kiffer nicht unbedingt von Interesse, wenn Hearst nicht auch noch riesige Wälder und Papiermühlen besessen hätte und deshalb von den neu entwickelten Hanf-Erntemaschinen nicht sonderlich angetan war. Die Hanfpflanze galt seit Jahrhunderten als erste Adresse für die Papierherstellung, selbstverständlich verkündete auch die Urausgabe der Lutherbibel auf Hanfpapier Gottes Wort, nur für den unendlichen Papierbedarf der Moderne erwies sich die Hanfpflanze dem Holz unterlegen, weil ihre Ernte komplizierter und damit teurer war als die Papierwerdung der Bäume. Die neuen Erntemaschinen brachten das Mutterschiff des THC zurück ins Geschäft, und für einen Wald- und Holzmühlen-Besitzer vom Schlage eines William Randolph Hearst bedeutete das: Egal ob Chaplin oder Cannabis – die Konkurrenz muss weg.
Ähnliches dachte man bei dem Chemiekonzern DuPont, der im 19. Jahrhundert mit Sprengstoff angefangen hatte und in dieser Branche zum größten Lieferanten der US Army aufstieg, bevor er in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts auch an nicht explosiven Produkten zu forschen begann und schließlich Nylon erfand, was er sich patentieren ließ. Aber alles, was Nylon konnte, das konnte, bis auf die Nylonstrümpfe, die Hanfpflanze seit Jahrtausenden besser: Textilien, Planen, Segel – und am besten konnte sie Seile und Taue und war deshalb in der Schifffahrt weltweit beliebt. Wie schön es wäre, wenn der Hanf verschwände und es nur noch Nylon gäbe, hat man sich deshalb bei DuPont gefragt und natürlich auch, wie das Verschwinden zu bewerkstelligen sei.
DuPonts Banker, der auch der Banker von Hearst war, wusste Rat, denn er war zum einen der Onkel des US-Finanzministers Andrew W. Mellon und hatte zum anderen auch zu dem ehemaligen Leiter des Federal Bureau of Narcotics Harry J. Anslinger familiäre Beziehungen. Der hatte grad seinen Job verloren, weil das Alkoholverbot in den USA 1933 wieder aufgehoben worden war. Doch nachdem der Banker zusammengebracht hatte, was zusammengehört, wurde Harry J. Anslinger im Jahre 1930 zum Beauftragten der USA für Rauschmittel ernannt. Während es DuPont und Hearst nur um die Pflanze ging, hasste der nunmehr Dritte im Bunde die Blüte und ihre Güte. Aber der hasste so manches.
Wann immer ich über den Fotos von Harry J. Anslinger brüte, schaue ich in die klassische Hassfresse. Er hasste Schwarze, er hasste Mexikaner, und vor allem hasste er es, weiße Frauen mit schwarzen Männern tanzen zu sehen, denn wohin das führt, weiß jeder Rassist. Was sich auf der Tanzfläche durchmischt, das mischt sich auch im Bett. Darum hasste er auch den Jazz. Denn das Marihuana kam mit den Mexikanern und beflügelte alsbald den Jazz der Afroamerikaner, und Rassisten haben zwar nichts gegen schwarze Blues- und Gospelsänger, denn leiden und zu Gott beten dürfen die Nachkommen ihrer Sklaven gern, aber beim Jazz werden sie frech. Und noch frecher werden sie, wenn sie bekifft sind. Anslinger, der Rassist, erwies sich deshalb für Hearst und DuPont als idealer politischer Lobbyist für das Verbot von Cannabis.
Es war keine einfache Mission, der sich die Schrecklichen Drei verschrieben hatten. Die älteste Nutzpflanze der Welt war gleichzeitig auch die älteste Heilpflanze. Schon um 2800 vor Christi Geburt war der Meister Shennong eigentlich täglich in den Wiesen und Wäldern des alten China unterwegs, um Kräuter zu testen. Welche werden heilen, welche werden Gegenteiliges bewirken, und welche werden gar nichts tun, außer vielleicht gut zu schmecken? Weil Meister Shennong die Tests an sich selbst vornahm, passierte es schon mal, dass er sich an nur einem Tag 70-mal vergiftete, aber er hatte auch einen Tee gefunden, der ihm verlässlich als Gegenmittel diente. Oder war es umgekehrt, und der Wundertee fand ihn?
Man sagt, der Wind habe die Blätter eines brennenden Teestrauchs in den Topf geweht, in dem der Meister Shennong grad Wasser zum Kochen brachte. Wie dem auch sei, sein Gegenmittel wirkte tadellos, nur einmal nicht, und danach war der Meister tot. Doch bis es ihm dieses eine Mal den Magen zerriss, hatte der Urvater der chinesischen Medizin über 300 heilende Kräuter identifiziert und deren Wirkung notiert. Und Cannabis war halt auch dabei. Meister Shennong schrieb demnach schon vor 4800 Jahren dem Harz der Blüte heilende Wirkung bei Verstopfungen, Gicht, Malaria, Frauenkrankheiten und Geistesabwesenheit zu, erst etwa 1000 Jahre später, aber immer noch 1700 Jahre vor Cleopatra, erweiterten die alten Ägypter die Liste der Krankheiten, die Cannabis zu lindern vermag, um das Leiden entzündeter, faulender oder pilzbefallener Zehennägel.
Alte Chinesen, alte Ägypter, da dürfen die alten Inder nicht beiseitestehen. Sushruta gilt als Vater des Ayurveda und erster indischer Chirurg in Personalunion. Wann genau er lebte, ist nicht bekannt, aber irgendwann zwischen 1000 Jahren vor oder etwa 200 Jahren nach Christus vermuten Historiker seine Schaffenszeit. Sein Werk beschreibt 300 Operationen mit 121 Instrumenten, darunter auch ein gruseliges Sortiment an Zangen, und zur Betäubung der Armen empfahl Sushruta indischen Hanf, also Ganja, also Haschisch. Der alte Orient und seine islamischen Ärzte bestätigten im 9. und 10. Jahrhundert die schmerzstillende Wirkung der Hanfsamen und fügten ihrerseits noch deren Wohltaten bei Wurmbefall und Hautkrankheiten hinzu. Die Kreuzritter des Mittelalters, die im Orient ein und aus zu reiten pflegten, brachten das mittlerweile fast Allheilmittel zu nennende Biomedikament dann flugs nach Europa, wo immerhin die heilige Äbtissin Hildegard von Bingen – und nicht etwa eine Kräuterhexe – das heilende Potenzial der Cannabis-Blüte bei Übelkeit und Magenschmerzen entdeckte, und schon bald hieß es, Religion ist Opium für das Volk, aber Haschisch ist die Droge der Klöster.
Die Nebenwirkungen der Cannabis-Medizin verschafften den Ordensbrüdern und Klosterschwestern fromme Visionen und öffneten ihnen die Tore zum kreativen Christentum. Die heilige Hildegard von Bingen ist ja nicht nur als heilkundiges Universalgenie des Mittelalters bekannt, sondern machte sich weit über ihr Kloster und ihr Jahrhundert hinaus einen Namen als Malerin, Poetin und des Mittelalters erste Mystikerin – und das alles war legal. Dabei blieb es auch die nächsten 900 Jahre, und in den Tagen, als Harry J. Anslinger, William Randolph Hearst und DuPont ihren Kreuzzug gegen Marihuana begannen, waren in Europa über 100 verschiedene Cannabis-Medikamente in den Apotheken zu haben, in Amerika machten sie 50 Prozent aller verschriebenen Schmerzmittel aus, und auch der nicht medizinische Gebrauch war so normal und legal wie seit über 4000 Jahren. Also, wie macht man das? Wie kriegt man das hin? Wie raubt man der Menschheit das Gewohnheitsrecht auf gesunde Drogen?
Gehirnwäsche. Anders geht es nicht. Und dafür war William Randolph Hearst der beste Mann. Er wies die Armee seiner Journalisten an, jedes Gewaltverbrechen, jede Schandtat, jeden blutigen Frevel irgendwie, aber grundsätzlich mit Marihuana in Verbindung zu bringen. Seine Zeitungen erreichten täglich 40 Millionen Leser, und was die nun zum Frühstück auf den Tisch bekamen, galt selbst in der Welt der Fake News als starker Tobak.
Unter der Überschrift »Mexikanische Familie wird verrückt« berichtete der San Francisco Examiner von einer Frau und deren vier Kindern, die allesamt durch den Verzehr von Marihuana wahnsinnig geworden waren. Die Ärzte sagten, es gebe keine Hoffnung, das Leben der Kinder zu retten, und die Mutter würde für den Rest ihres Lebens verrückt bleiben. Die New York Times lässt einen Mexikaner unter Marihuana-Einfluss mit einem Schlachtmesser durch ein Krankenhaus laufen und sechs Patienten zerhacken, und Inside Detective erwies sich im Titeln als wirklich kreativ. »Marihuana-Maniac« hieß die Story, und sie ging so.
»Eines Tages nimmt Victor eine Axt und ermordet seinen Vater, seine Mutter, zwei Brüder und eine Schwester. Er raucht Marihuana.«
In Wahrheit war der Täter schizophren, und es gab, wie in den Berichten zuvor, keinerlei Beweise für Cannabis-Konsum, aber die Geschichte gehörte zu Harry J. Anslingers Standardstorys, die er von nun an jahrelang im Radio oder Fernsehen oder sonst wo öffentlich zum Besten gab, um seine These zu erhärten. »Marihuana ist eine Einbahnstraße ins Irrenhaus«, sagte Harry J. Anslinger viele, viele Male in die Mikrofone, William Randolph Hearst schüttete weiter aus seinen 25 Tages- und 24 Wochenzeitungen Marihuana-Massaker über seine Leserschaft aus, und die Täter waren entweder Mexikaner oder Schwarze. Filme zum Thema gab’s auch. Der bekannteste war Reefer Madness: Man sieht eine Gruppe hübscher weißer Mädchen, die einen Joint rauchen und dann umgehend die Schlüpfer fallen lassen, um nackt und blöde lachend zu einer Orgie zu eilen. Mit Marihuana von zu Hause weggelockt, um Prostituierte zu werden. Das war die Botschaft und der Beitrag Hollywoods zum frühen Krieg gegen die Drogen.
1937 wurde die Hanfpflanze mit Stumpf und Stiel sowie mit Blatt und Blüte in den USA verboten, und damit war bewiesen, was drei Männer vermögen, wenn jeder von ihnen eine Armee hinter sich hat. Hearst befehligte die Truppen der entweder blöden oder skrupellosen Journalisten, DuPonts Heer bestand aus Dollarnoten, und Anslingers Soldaten waren a) seine Bürokraten und b) seine Wahnvorstellungen. Der Chef der US-Rauschgift-Behörde war wirklich nicht normal. Er hatte einen Wissenschaftler gefunden, einen Experten namens Dr. Munch, dessen Studien bewiesen, dass Marihuana das Zeitempfinden verlangsamt. Damit sagte er zwar dasselbe wie die Musiker, die in der Langsamkeit besser improvisierten, aber Anslingers Wissenschaftler sah darin leider keinen Gewinn, im Gegenteil, er sah total schwarz für die Zukunft der weißen amerikanischen Jugend, denn der von Cannabis inspirierte Jazz zwinge sie in den Viervierteltakt. Und das sei ein Zeichen des Bösen.
Ist das Satire, ist das Wahnsinn, ist das Wissenschaft? Wen kümmert’s. Nachdem 1937 die Hanfpflanze mit Stumpf, Stiel und Blüte in den USA verboten worden war, gab Anslinger richtig Gas. »Wir beabsichtigen, einen unerbittlichen Krieg zu führen, gegen den verabscheuungswürdigen Geier, der mit Marihuana handelt und die Schwäche seiner Mitmenschen ausnutzt.« Ebenso unerbittlich bekriegte er die kiffenden Jazzer, deren Viervierteltakt weiße Mädchen außer Rand und Band brachte. Anslingers Bullen waren hinter Billie Holiday her, hinter Charlie Parker, Count Basie, Duke Ellington und natürlich hinter Louis Armstrong, dem ruhmreichsten Kiffer des Jazz.
Armstrong wuchs in den Straßen von New Orleans zwischen den Bordellen und Music Clubs des French Quarter auf, und einmal im Jahr flippten alle beim Karneval aus. Alle haben Marihuana geraucht. Seine Mutter war arm, sein Vater nicht da, der Junge musste über die Runden kommen und trat, sobald er zu trompeten begann, quasi überall auf, auch in Puffs, in Semi-Puffs und auf Mississippi-Dampfern. Weil durch seinen ständigen Marihuana-Konsum seine Musik anders swingte als das, was man so kannte, wird Louis Armstrong der Vater des Swing genannt und war bereits weltberühmt, als Harry J. Anslinger sein Cannabis-Verbot durchbekam. Den Musiker nervte das.
»Mir ist eine Erlaubnis zum Tragen von Waffen nicht so wichtig«, sagte Armstrong zu seinem Manager. »Ich will nur eine Erlaubnis zum Tragen von Cannabis. Du musst für mich eine Sondererlaubnis besorgen, Marihuana zu rauchen, so viel ich will, wo ich will und wann ich will. Sonst muss ich dieses Instrument ablegen.«
Heilige Trompete! Louis Armstrong ohne die Wundertüte? Das schaffte selbst Harry J. Anslinger nicht. Louis bekam zwar keine Sondererlaubnis, aber er kiffte weiter, und wenn er nicht 1971 im Alter von 70 Jahren gestorben wäre, dann würde er auch noch heute mehr oder weniger täglich kiffen. Einmal wurde er wegen Marihuana-Besitz verhaftet, aber auch ganz schnell wieder freigelassen, weil die Bullen, die im Eifer der Festnahme nicht genau hingesehen hatten, ihn erst auf der Wache erkannten. Sie waren große Fans von ihm.
Es gab nicht viele wie Armstrong, in Wahrheit gab es nur den einen, und alle anderen hatten Ende der Dreißiger- und Anfang der Vierzigerjahre in New York eine harte Zeit. 78 Prozent aller wegen Marihuana Verhafteten waren Schwarze oder Mexikaner. Nach Downtown New Orleans hatte Anslinger in Harlem einen neuen Drogensumpf entdeckt, den es auszutrocknen galt. Das nervte nicht nur Armstrong, das nervte auch den New Yorker Bürgermeister LaGuardia, der 1942 renommierte Wissenschaftler beauftragte, die Wahrheit herauszufinden, und das Ergebnis ihrer Studien besagte: Das stimmt alles nicht. Gras zu rauchen ist kein großes Problem. Es führt nicht zu Kriminalität. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Gewalt und Marihuana-Konsum.
Die Aussagen der Wissenschaftler bewirkten nichts. Warum auch? Anslinger hatte in den vergangenen Jahren 30 Wissenschaftler befragt, ob Marihuana gefährlich sei. 29 hatten mit Nein geantwortet und einer mit Ja, und das war der Irre, der die diabolische Verlangsamung der Zeit ins Feld geführt hatte. Deshalb blieb es nicht nur bei der Hatz auf Kiffer, es wurde sogar immer schlimmer. 1942 wurde auch der bis dahin noch legale medizinische Gebrauch von Cannabis verboten, und 1951 unterzeichnete Eisenhower das Rauschmittel-Gesetz, das die Höchststrafe selbst für geringfügige Marihuana-Vergehen auf 20 Jahre festlegte. Weil Harry J. Anslinger in den USA sein Werk als vollbracht ansah, weitete er nun seine Mission auf den ganzen Planeten aus. Als Abgeordneter der UN-Drogenkommission forcierte er das weltweite Verbot von Cannabis, das 1961 im Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel festgeschrieben wurde.
Nützte aber nix.
Die Beatniks kamen. Sie transportierten das Marihuana von der Musik in die Literatur. Jack Kerouac (On the Road), William S. Burroughs (Banned), J. D. Salinger (Der Fänger im Roggen) und Allen Ginsberg (Howl) kifften beim Schreiben und schrieben übers Kiffen, und ihre Leser nannte man erst Gammler und dann Hippies. Cannabis wurde in den Sechzigerjahren zur Volksdroge der Love-and-peace-Generation. Ende der guten Nachrichten. Die schlechten fokussierten sich in einer Person, die noch schlimmer war als Anslinger.
Richard Nixon.
Der bis dato kriminellste US-Präsident aller Zeiten erklärte Drogenmissbrauch zum Staatsfeind Nr. 1 und gab eine weitere Studie über die Gefährlichkeit von Marihuana in Auftrag, von der er sich Rückenwind für seine Verschärfung des Betäubungsmittelgesetzes erhoffte. Doch der »Shafer-Bericht« entsprach nicht seinen Hoffnungen. »Der gelegentliche Gebrauch von Marihuana hat keinerlei körperliche Schäden zur Folge und wahrscheinlich auch keine psychologischen« war das Fazit der Studie. Nixon tobte. Auf den erst nach seiner Präsidentschaft freigegebenen Mitschnitten seiner Telefongespräche aus dem Weißen Haus reagierte er auf die Stimmen der Wissenschaft mit folgenden Worten:
»Ich will eine verdammt starke Aussage zu Marihuana. Eine, die ihnen den Arsch aufreißt. Komisch, dass alle Arschlöcher, die Marihuana legalisieren wollen, Juden sind. Was ist in Gottes Namen los mit den Juden? Bei Gott, wir werden Marihuana schlagen, und ich will ihnen in die Fresse hauen.«
»Make love, not war«, das war sein Problem. Nixon hatte Vietnam an der Hacke und sah die neue Generation für den Krieg im Pazifismus verloren gehen. Und »Black is beautiful« fand er auch nicht besonders schön. Nixons Berater John Ehrlichman, der eine der Schlüsselfiguren der Watergate-Affäre gewesen war, gestand 1994 einem Journalisten von Harpers Bazaar die wahre Motivation von Nixons Krieg gegen die Drogen:
»Die Nixon-Kampagne 1968 und danach das Weiße Haus unter Nixon hatten zwei Feinde: die linken Kriegsgegner und die schwarzen Menschen. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Wir wussten, dass wir es nicht illegal machen konnten, gegen den Krieg zu sein oder schwarz zu sein, aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Hippies mit Marihuana und die Schwarzen mit Heroin zu assoziieren, und beides stark kriminalisierten, konnten wir diese Bevölkerungsgruppen schwächen. Wir konnten ihre Anführer festnehmen, Razzien in ihren Häusern durchführen, ihre Treffen auflösen und sie Abend für Abend in den Nachrichten diffamieren. Wussten wir, dass wir logen, was die Drogen anging? Natürlich wussten wir das.«
Und was weiß ich?
Ich sag’s mal so: Im Oktober 1970, als Nixon das neue, noch mal verschärfte Betäubungsmittelgesetz unterzeichnete und damit in seinen weltumspannenden Krieg gegen Drogen zog, begann auch ich mich an dem Krieg zu beteiligen. Auf der Gegenseite.
Mein Leben als Krimineller
Lucky zog seinen linken Stiefel aus und pisste rein, während er mit dem rechten weiter Vollgas gab. Es galt, ein Rennen zwischen zwei Bielefelder Dealern zu gewinnen. In Hamburg wartete ein Afghane mit seinem letzten Kilo Haschisch auf den Gewinner. Nachdem er sich ausgepisst hatte, entleerte Lucky den Stiefel im Fahrtwind, und das mag alles in allem ein bisschen eklig klingen, und auch der Geruch war nicht erfreulich, aber Lucky wollte das Kilo, und ich durfte derweil das Lenkrad halten. Und als wir dann als Erste bei dem Afghanen vorgefahren kamen, hörte ich Lucky sagen: »Wir sind ein gutes Team. Das können wir öfter machen.« Wie viel hätte man mir dafür aufgebrummt? War einem Dealer beim Pissen zu helfen schon Beihilfe zu einer Straftat?
Ich selbst war nie ein Dealer, das Talent war mir nicht gegeben, doch ich pflegte Freundschaften zu so vielen Dealern, wie es ging. Aber auch ein Konsument war Ende der Sechzigerjahre ein Verbrecher, und noch dazu ein versiffter. »Suchtgiftler«, die Österreicher benutzen den Begriff noch heute. Eine bemerkenswerte Kombination böser Wörter. Die Sucht. Das Gift. Der Giftler. Wir wurden wie Ratten behandelt, wir waren Schlagstock-Futter, wir waren Viren, die sich durch den Volkskörper kifften, Gammler, Hippies, Revoluzzer, nie waren wir sicher in unseren Verstecken, deren Fenster wir mit Tüchern verhängten. Die Möglichkeit, dass ein Trupp Bullen die Kifferbude stürmte und alles und jeden zusammenschlug, war jederzeit gegeben. Mir ist das zwar nie passiert, aber es hätte immer passieren können, und nur darauf kommt es an. Diese Nähe der Gefahr. Das Abenteuer. Das Charisma des heiligen Kriminellen. Ich sah mich nicht als Verbrecher, ich sah mich als Missionar. Love and peace. Ratten mit Blumen im Haar.
Wie in jedem Krieg war auch in dem Krieg gegen die Drogen jede Seite davon überzeugt, dass die anderen die Bösen sind. Wir waren die Guten, die Hobbits, die Elben, die Zwerge, die Zauberer, und die Bullen waren die Orks. Wahrscheinlich ist meine latente Feindschaft gegenüber der Polizei, obwohl sie mich auch vor Betrug, Raub, Überfall, Körperverletzung, Mord und allem Möglichen schützt, nur in dieser Übergriffigkeit begründet. Bullen mischten sich in Dinge ein, die sie nichts angehen. Bullen waren die klassischen Spaßverderber.
Aber Journalisten waren das natürlich auch.
Anfang der Siebziger trat ich ein Volontariat bei der größten Zeitung in Bielefeld an. Niemand dort durfte wissen, was ich nach Feierabend tat. Der traditionelle Journalismus war ein Beruf für Alkoholiker, davon gab’s Kollegen wie Sand am Meer, aber mich hätten sie sofort rausgeschmissen, wenn ruchbar geworden wäre, dass ich bekifft in einem unserer Redaktions-VW-Käfer durchs Weserbergland fuhr mit der »Roten Mühle« als Ziel, weil Luckys Freundin mir in dem Striptease-Schuppen sein Haschisch verkaufte, wenn er nicht da war. Luckys Freundin war darüber hinaus eine Rothaarige, der nachgesagt wurde, dass sie es gern unter der Dusche trieb. Das war der pure Wahnsinn damals, dafür beneideten wir Lucky, aber er war halt ein echter Gangster, Semi-Kriminelle wie ich bekamen solche Frauen nicht.
Weil ich in der »Roten Mühle« keine alkoholischen Getränke konsumierte, konnte ich sorgenfrei weiterfahren. THC war in diesen Jahren noch nicht im Speichel feststellbar. Ein Zungenabstrich verriet mich nicht, pusten auch nicht. Sie hätten mir auf der Wache Blut abnehmen müssen, und das macht man vielleicht mit einem dreckigen Drogenschwein, aber nicht mit einem Journalisten. Der Beruf galt damals noch als seriös. Zeitungen waren so etwas wie halbamtliche Nachrichtenblätter, was dazu führte, dass Polizisten und Journalisten fast kollegial miteinander umgingen. Wir schrieben ihre Meldungen um. Wir machten Polizeinachrichten lesbar. Dafür drückten sie ein Auge zu, wenn wir zu schnell unterwegs waren. Für die Bullen war es undenkbar, dass in einem Redaktions-Käfer, auf dessen Karosserie der Name der größten Zeitung Ostwestfalens prangte, ein Drogenfreak saß. Und was die roten Augen anging, die der übermäßige Konsum von Haschisch hin und wieder mit sich bringt, nun, man kam aus der »Roten Mühle«, haha, was erwartet man da?
Gebustet heißt verhaftet. Wir benutzten gern Anglizismen, weil Rock ’n’ Roll nun mal englischsprachig war. Dope oder Shit für Haschisch, Grass, Weed oder Mary Jane für Marihuana, es turnte, es machte high, und wenn es uns mal down brachte, hieß es Horrortrip. Schuld daran war die Überdosis. Sie produzierte die paranoide Fehleinschätzung der Lage. Nur das waren die Probleme, die aus meiner kriminellen Existenz erwuchsen, sie blieben allesamt im Reich der Wahnvorstellungen, in dem der Verfolgungswahn am häufigsten vorkam, aber nie wurden sie real, doch mental kann einem das trotzdem ganz schön auf den Geist gehen, wenn man sich nie erwischen lassen darf und immer heucheln muss. Angst oder Wut, Schuld oder Trotz, Scham oder Überheblichkeit, egal, auch scheißegal, wie ich es anpackte, um mit meiner Illegalität klarzukommen, eines blieb dabei immer gleich: das Bewusstsein, außerhalb der Gesellschaft zu stehen. Ein Outlaw zu sein. So kam ich unfall- und verhaftungsfrei durch die Siebzigerjahre.
In den Achtzigern wendete sich das Blatt. In der Arbeitswelt der Medien war man nun gut beraten, es niemand zu verraten, wenn man keine Drogen nahm, und die Bullen hatten alle Hände (und oft auch alle Nasen) voll mit Heroin und Koks zu tun. Gesellschaftlich war der Kiffer zwar noch immer nicht en vogue, aber er galt nicht mehr als gefährlich, eher als bedauernswert, karrieregebremst, unambitioniert. Mir konnte das nur recht sein. Der Unterschätzte ist im Vorteil. Bei schwierigen Interviewpartnern spielte ich gern die Inspektor-Columbo-Karte. Ich kam als Trottel und ging als Vollstrecker. Auch die Beschaffungsproblematik entspannte sich in den Achtzigerjahren. Man musste dem Nachschub nicht mehr auf dunklen Straßen oder durch stinkende Clubtoiletten hinterherjagen.
Denn siehe, Gott hatte den Hausdealer geschaffen.
Immer zu Haus, aber nicht durchgehend besuchbar. Feste Verkaufszeiten, freies Wochenende, Urlaub machten sie auch, und Weihnachten verschwanden sie zu ihrer Familie. Quasi Tante Emma illegal, auch wenn es meist Männer waren, die das psychoaktive Gemüse vertickten. Sie hatten immer irgendwas Rauchbares da, die gutsortierten drei Sorten gar. Billig, nicht ganz so billig und Qualität. Ende der guten Nachrichten. Die schlechten betreffen ihre Flexibilität.
Es kann schon mal vorkommen, dass einem am Sonntag das Haschisch ausgeht, aber was nicht vorkam, ist ein Hausdealer, der das versteht, obwohl sie nachfühlen könnten, wie es mir dann geht. Es gab auch Sadisten unter ihnen, Leute, die angebettelt werden wollten, Leute, die ihre Macht missbrauchten, Dealer im Bummelstreik, Dealen nach Vorschrift. Und manchmal wusste ich nicht, wer mir mehr auf den Keks ging: der Dealer, der Demut will, oder sein Gegenteil, der Dealer allein zu Haus, dem Liebe fehlt, Freundschaft, gute Gespräche, lange vor allem. Wenn sich so etwas von selbst ergibt, ist nichts dagegen einzuwenden, aber als ritueller Konversationszwang vor der Erledigung des eigentlichen Besuchsanliegens ist es quälend. Wann ist es nicht mehr unhöflich, endlich sein Geld auf den Tisch zu legen? Um mit diesem Buch nicht auf einen Schlag meine Hausdealer in den für mich wichtigen Städten zu vergrämen, sei darauf hingewiesen, dass es nicht nur solche und solche gibt, sondern auch andere, wie euch. Aber alle haben eine überdurchschnittliche Allgemeinbildung und einen riesigen Fernseher.
Home, sweet home in einer großen, böse bleibenden Welt. Während in Deutschland ab Mitte der Achtzigerjahre das Kiffen zwar nicht legalisiert, aber zunehmend entkriminalisiert wurde und sich niemand mehr wegen des Besitzes von ein paar Gramm vor den Bullen fürchten musste, blieb auf Reisen der Erwerb, Besitz und Konsum meiner Gewohnheitsdroge weiterhin spannend. Gott, konnten die türkischen Bullen zickig werden, wenn sie Haschisch bei mir vermuteten! Und wenn sie etwas finden sollten, startete schon für ein Gramm der Midnight Express. Jeder Haschischraucher meiner Generation kennt den Film, der auf einer wahren Geschichte beruht. Türkische Gefängnisse, sagt diese Wahrheit, sollte ich niemals von innen sehen. Dafür bin ich nicht Manns genug.
Istanbul im Winter 1985. Ein halbes Dutzend Polizisten stürmte mein Hotelzimmer und drehte darin alles um, was sich umdrehen lässt, während der Kommissar mit seiner Taschenlampe erst meine Augen ausleuchtete und dann die Zwischenräume meiner Zehen. Ich war unschuldig, ich hatte nichts dabei, aber hundertprozentig weiß man das ja nie. Wie oft hatte ich unverhofft irgendwo im Gepäck noch einen Krümel gefunden, auf dem Rucksackboden, in einer Hemdtasche, in der Jogginghose, festgeklemmt im Reißverschluss! Man findet ja auch Kugelschreiber, von denen man nichts weiß, oder kleine Münzen. Und ganz link sind diese Löcher in den Manteltaschen, die zwar die Dinge aus den Taschen verschwinden lassen, aber nicht aus dem Mantel. Sie verbleiben im Innenfutter bis ans Ende aller Tage, wenn nicht ein Bullenfinger sie vorher rausgefummelt hat. Im Winter 1985 fanden sie trotzdem nichts, heute hätte ich keine Chance.
Heute schreibe ich mit einem Laptop, und die Schreibtische, auf denen ich mit ihm arbeite, sind verkrümelt. Und wenn ich mir dann die Unterseite des Laptops anschaue, was ich selten tue, klebt da eigentlich immer genug für einen Notjoint. Ich habe es mir in all den Jahren zur Gewohnheit gemacht, mein Gepäck vor jedem Auslandsflug wie ein Bulle zu inspizieren, aber den Laptop-Check habe ich bisher jedes Mal vergessen. Unbewusst wird das der einzige Grund sein, warum ich nie mit arabischen Airlines, die auf ihren Heimatflughäfen einen Zwischenstopp einlegen, nach Indien oder Südostasien fliege. Beim Gatewechsel in Saudi-Arabien wurden schon Leute hopsgenommen, weil man unter ihren Schuhsohlen Haschischpartikel fand. Pro Sohle gab’s ein Jahr Saudi-Knast plus ein paar erfrischende Stockhiebe. Will man das? Urlaub sieht anders aus.
Die erste Regel für Kifferreisen lautet deshalb: Don’t board with dope. Die zweite Regel betrifft dann naturgemäß den Einkauf vor Ort. Egal ob auf der Straße, in der Gastronomie oder am Strand sollte der Dealer nie erfahren, in welchem Hotel man wohnt, denn was der weiß, das erfährt dann oft auch bald die Polizei. Und fürs Hotel gilt. Am besten ist ein Balkon, aber es reichen auch Fenster, die zu einem Wasserlauf rausgehen oder zu einem versauten Hinterhof für den Notfall-Weitwurf. Aber wie gesagt, das ist der Notfall, im paranoiden Regelbetrieb will man sein Dope nicht wegwerfen, sondern verstecken.
Im Zimmer kann man das vergessen. Wenn Bullen einen Anfangsverdacht haben, finden sie jedes Versteck. Darauf sind sie trainiert. Außenverstecke sind besser. Am Strand im Sand vor dem Beachbungalow. Oder dahinter. Unauffällig markiert, also keine Fahne oder Stöckchen, die wie Fahnen wirken. Am sichersten ist das Erstellen einer Schatzkarte. Die Anzahl der Schritte, die man in gerader Linie von der Terrasse Richtung Brandung gehen muss, um das Marihuana wieder auszubuddeln. Dabei sollte man auch das Wechselspiel zwischen Ebbe und Flut nicht vergessen. Einmal probierte ich sogar die Blüte einer Tropenblume als Versteck für mein Marihuana aus. Eine große Blume und wunderschön. Ist sie ein Nachtschattengewächs? Oder schließen sich ihre Blätter um meinen Schatz, wenn die Sonne untergeht? Das waren so die gängigen kriminellen Fragen im Paradies.
Eine weitere Spekulation betraf die Motivation. Was wollen Bullen, die wie aus dem Nichts plötzlich vor deinem Strandbungalow stehen? Verhaftungen oder Geld? Die Antwort wird klar, wenn man die Frage präziser stellt: Was brauchen sie? In den allermeisten Urlaubsparadiesen werden Polizisten skandalös unterbezahlt. Aus Geiz oder Kalkül. In Marokko, um ein Beispiel zu geben, weiß jedes Kind, das ein gut bezahlter Polizist ein fauler Polizist ist. Zur mühsamen Verbrecherjagd kann man ihn nur mit Erfolgsprämien inspirieren, die aber der Verbrecher zahlt. So läuft es überall, wo Korruption der unsichtbare, aber wesentliche Faktor auf den Lohnzetteln ist. Ein Erfolgsmodell, alle haben etwas davon. Der Staat behält die Kontrolle, die Bullen bekommen ihr Geld, die Kriminellen bleiben frei.
Problematisch wird es erst, wenn man auf Fanatiker trifft. Kiffer-Hasser in Uniform oder Rassisten, Nationalisten und Faschisten als Polizisten, die den ausländischen Kiffer stellvertretend für den ganzen ihnen verhassten Westen in die Pfanne hauen wollen. Die brauchen Verhaftungen. Und was der Gebustete braucht, ist außer guten Nerven eine gute Menschenkenntnis sowie eine gute Kenntnis der jeweiligen Kultur. In der verbalen wie nonverbalen Kommunikation des Gastgeberlandes sollte er weit genug bewandert sein, um zu erkennen, wem er Geld anbieten kann und wem nicht. Gerät er an den Falschen, kriegen sie ihn nicht nur wegen der Drogen, sondern auch wegen des Bestechungsversuchs dran. Und merke: Urlaubsparadiese haben höllische Gefängnisse. Weiß ich aus Filmen. Ich selbst war noch nie in einem. Nur ein einziges Mal stand eine Verhaftung zu befürchten. Oder auch nicht, je nachdem, wie man das damals auf Kuba geregelt kriegte.
Ende der Leseprobe