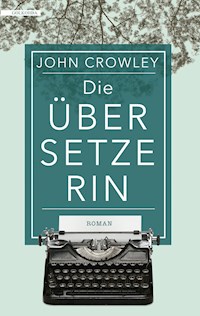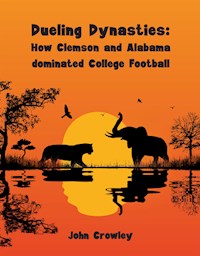Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dar Oakley ist die erste Krähe der Weltgeschichte, die einen eigenen Namen bekommt. Sie erfindet eine Sprache für das Krähenvolk, fliegt in die Anderswelt und stiehlt versehentlich die Unsterblichkeit. In zahlreichen Leben freundet sie sich mit Menschen aus verschiedenen Epochen an, erlebt Cäsars Eroberung Galliens, entdeckt mit dem Heiligen Brendan Amerika – immer auf der Suche nach der Wahrheit über Leben und Tod. Bis sie in einer Zeit, in der unsere Welt bereits in Trümmern liegt, einen Menschen findet, dem sie ihre Geschichte erzählen kann. Denn wahre Unsterblichkeit liegt in den Geschichten, die immer weiter erzählt werden ... Autor John Crowley schreibt eine epische Saga über das Reich der Krähen, die Welt der Menschen und die unsterbliche Kunst des Geschichtenerzählens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»KA – Dar Oakley in the Ruins of Ymr«
bei Saga Press, einem Imprint von Simon & Schuster, London • New York
© 2017 by John Crowley
© 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by
Golkonda Verlags GmbH & Co. KG, München • Berlin
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Redaktion: Michael Görden
Lektorat: Anne-Marie Wachs
Korrektorat: Catherine Beck
Innenillustration: Melody Newcomb
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München,
unter Verwendung von Motiven von Sonia Chaghatzbanian
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
ISBN: 978-3-946503-45-3 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-946503-46-0 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten
www.golkonda-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für H. B.,
in Dankbarkeit für viele Dinge
Die Krähen behaupten, eine einzige Krähe
könnte den Himmel zerstören.
Das ist zweifellos, beweist aber nichts
gegen den Himmel,
denn Himmel bedeuten eben:
Unmöglichkeit von Krähen.
– Franz Kafka
Prolog
Am Ende der Welt hat sich ein großer Berg aufgetürmt. Er ist nicht hoch, sondern eher lang und breit, wirkt aber groß, weil er sich als einziger in einer Ebene erhebt, wo es keine anderen Erhebungen gibt. Ringsum sind gerade Straßen und sanft hügelige Felder – vielleicht sogar ein paar Steine, aber der Berg selbst besteht nicht aus Steinen.
Er wächst immer weiter und wird noch lange so weiterwachsen, ehe sich alles setzt. Vor dem Morgengrauen bewegt sich ein gelbes Raupenfahrzeug, ausgerüstet mit einem Pflug, über seine vordere Flanke, die unter dem Gewicht bebt, weil die Substanz des Berges immer noch weich und locker ist. Beim ersten Licht ziehen schwere Lastwagen hintereinander weg auf schräg ansteigenden, extra für diesen Zweck angelegten Wegen hoch und halten an bestimmten Stellen, wo sie das Mitgebrachte in dampfenden Haufen von der Ladefläche kippen. Das Raupenfahrzeug verteilt es dann und versucht, es abzudecken.
An manchen Stellen brennt es.
Zu beiden Seiten dieses Berges erheben sich kleinere Hügel, die älter und verlassen sind und nun, von einer Grassode bedeckt, daliegen: fette schlafende Männer, die über Jahre hinweg ihre Riesenmahlzeiten verdauen. Nur die Kuppen der neueren Hügel sind noch offen, und dort türmen sich Haufen von unverschlucktem Zeug.
An den Straßen, die vom Berg abwärts und zur großen Stadt führen, befinden sich Häuser und kleine Ansammlungen von Schutzhütten. Sobald es hell genug wird, strömen die Menschen heraus und steigen über die kleineren Anhöhen zu dem großen Berg, dessen Kuppe noch offen ist wie eine große Wunde. Es sind Frauen und Kinder und ältere Menschen; sie haben Säcke und Eimer und andere Behälter dabei, um fortzutragen, was sie auf den neuen Haufen finden und was andere in den älteren und versinkenden Pulks übersehen haben. Rauch vernebelt die aufgehende Sonne.
Die Leute befinden sich noch im Anstieg, als die ersten Krähen von ihren Winterkolonien in den dichten Wäldern entlang des Flusses und auf der Flussinsel bei der Stadt herbeifliegen. In einer langen, ununterbrochenen Kette fliegen sie an den Menschen vorbei – Hunderte, dann Tausende. Ich denke, wenn die Menschen einander die Vögel beschreiben würden, dann würden sie sagen, dass die Krähen wie ein schwarzer Schal über dem Himmel hängen und ihn vom Horizont bis auf halbe Höhe bedecken. Aber die Krähen sehen sich nicht so, sie sehen sich nicht als ein Schleier oder Mantel oder als schwarzes Bärenfell, sie betrachten sich nicht als Masse, sondern als viele: Eine jede ist für sich, eine unter anderen, auf vorsichtiger Distanz, ohne die anderen zu berühren, jede einzelne in der Lage zu sehen, wohin sie alle ziehen.
Sie sehen, wie die Menschen unter ihnen sich langsam bewegen und die Lastwagen mit den starrenden Lichtern. Sie wissen, wo sie sind.
Und auch die Menschen verschwenden kaum einen Gedanken an sie. In anderen Zeiten und an anderen Orten hätten sie unter einer solchen sanft schwingenden Wolke vielleicht einen Segen ausgesprochen, hätten vielleicht ein Gebet geflüstert oder einen Reim, einen Vers oder eine Hymne; sie hätten die Schwingungen des Schwarms studiert, um etwas über die Zukunft oder das Wetter herauszufinden. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Die Plünderer ignorieren die Vögel oder verachten sie – die schwarzen Bettler. »Geflügelte Ratten« nennen sie sie. Die Kinder werfen ihnen Dinge nach oder verjagen sie von dem Hügel, bis die Älteren sie wieder zum Sammeln aufrufen. Gelegentlich jagen die Krähen einem Kind nach, weil sie denken, es hätte etwas, das auch sie wollen, oder einfach aus Spaß, denn ihre alte Vorsicht ist schon lange gewichen. Die Kinder haben in der Regel nichts, was Krähen wollen. Kinder suchen nach seltenen Dingen, und an Futter ist für die Krähen genug da. Die Lastwagen speien es tonnenweise aus, vermischt mit nicht Essbarem, aber in solcher Fülle, dass sie sich nicht einmal darum streiten müssen.
Ich pflegte sie zu beobachten. Abends oder nach einer schlaflosen Nacht stand ich oft am Fenster des Hochhauses im Krankenhausbezirk dieser Stadt, wo meine Frau in einem der oberen Stockwerke behandelt, aber nicht geheilt wurde. Ich blickte dann zu dem Berg hinüber und sah, wie die Krähen sich scharenweise von der Flussinsel erhoben und wieder zu den kahlen Bäumen zurückkehrten, doch damals begriff ich nicht, was sie taten. Vielleicht war die Krähe Dar Eichling damals dabei.
Neue Krankheiten haben sich entwickelt; ich habe eine, und auch ein paar weniger schwerwiegende als Folge davon. Debra starb nicht an dem Zustand, der sie auf der Suche nach Erleichterung in dieses Krankenhaus weit weg von zu Hause brachte, sondern an einer Seuche, die durch den Bezirk tobte, in dem sie dann lag: starb, während ich neben ihr saß, von Kopf bis Fuß in eine Art Gaze gewickelt, mit einer Maske und Handschuhen; zum Ende hin durfte ich sie nicht mehr berühren. Ich war selbst krank, tödlich krank, und nicht nur körperlich. Ich brachte sie aus der Stadt heraus zu dem alten Friedhof in dem Landstrich, in dem wir schon lange ein Haus besaßen, dieses Haus im Norden, mein Haus. Und das war so weit, wie Dar Eichling, ebenfalls krank, auf seiner eigenen Reise gelangte, fort von dem lang gestreckten Berg am Ende von Ymr.
An diesen Frühlingstagen herrscht hier ein sonderbar klares Licht, von einer Klarheit, an die ich mich in dieser Gegend der Welt nicht erinnern kann, so, als hinge eine Wolke von trockener Bergluft darüber oder würde vorbeiwehen. Der Morgenhimmel ist von einem noch klareren Blau und wirkt nicht ganz echt und trotz dieser intensiven Schönheit irgendwie unheilvoll, gezwungen, nicht vertrauenswürdig. Vermutlich ist der Grund die andauernde Verwüstung der Erde – oder die nun unaufhaltsamen Veränderungen –, aber beweisen kann ich das nicht.
Natürlich gibt es jede Menge andere Beweise. Die Bäume, die bereits grün sind, Pflanzen, die sich früher benahmen und ordentlich gediehen und die nun wuchern. So viele Vögel, die man nicht mehr sieht und auch nicht mehr hört. Die Morgendämmerung ist nicht verstummt, aber dünn besetzt. Doch es gibt nun auch Vögel hier, die es vorher nicht gab. Ich bin sicher, früher, als ich ein Junge war, gab es weder Spottdrosseln noch Goldamseln.
Aber viele Krähen, die sich morgens und abends versammelten und einander riefen.
Ich weiß, dass nichts immer gleich bleibt, dass Veränderungen ein Gesetz darstellen: aber dass nicht nur die Menschenwelt, sondern auch die Erde und das Wetter und das Leben selbst am Ende eines einzigen Lebens anders sind als am Anfang … da fühlt man, dass die Welt, die Erde mit einem stirbt. Kann das sein? Wie kann ich glauben, dass alles um mich her zerfällt, wenn ich nicht gleichzeitig glaube, dass es einst so war, wie es sein sollte, und dass ich damals am Leben war, um es zu sehen? Wie kann ich wissen, dass dem so ist?
Nun … Mein erster Gedanke – vielleicht war es nicht einmal ein Gedanke –, als ich vor einem, nein, nun fast zwei Jahren die offensichtlich sehr kranke Krähe in meinem Hinterhof sah, war bloß, dass ich sie mit einer Schaufel erschlagen sollte, aus Gnade und um den Grund für ihren Zustand von mir selbst und anderen fernzuhalten.
Ich näherte mich ihr vorsichtig – diese Schnäbel sind scharf – und hörte aus verschiedenen Richtungen die Rufe anderer Krähen, so nahebei, dass ich meinte, sie sehen zu müssen, aber das konnte ich nicht. Die kranke Krähe unternahm keinen Versuch zu fliehen und sah nicht einmal hin, als ich mich näherte. Das dachte ich damals zumindest. Ich würde lange brauchen, bis ich begriff, dass Krähen, die auf einem Wiesenstück wandern oder einander den Hof machen, niemals den Kopf wenden, um einander anzusehen, aber nicht gleichgültig oder weil sie ihre Nachbarn ignorierten. Nein. Die Augen einer Krähe stehen weit auseinander, weit genug, dass sie sehr nahe Dinge am besten mit nur einem Auge betrachten. Krähen, die nebeneinander hergehen, sehen sich daher praktisch voll an.
Jedenfalls hielt ich aus irgendeinem Grund inne, um diese Krähe hier zu betrachten – vielleicht, weil auch ich mich betrachtet fühlte. Ich war noch nie einer Krähe so nahegekommen, die nicht tot war. Ich hockte mich nieder – die Krähenstimmen (ich konnte immer noch keine Vögel sehen) wurden schärfer, der Hund bellte mit gefletschten Zähnen und zerrte heftig an dem Seil, das ihn an seine Hütte band – und alles schien nun still und stumm zu werden. Ich vergaß, dass ich Angst vor einer Infektion hatte, und beugte mich vor, um der Krähe ins Auge zu sehen: trüb, dachte ich, weil ich damals noch nicht wusste, dass Vogelaugen Innenlider haben. Auf der Wange, falls das der richtige Ausdruck ist, war ein Fleck mit weißen Federn, wie die weißen Strähnen, die manche dunkelhaarigen Menschen im Haar haben. Ihrem Schnabel entfuhr ein gemurmeltes Geräusch, wie ich es noch nie von einer Krähe gehört hatte. Und ich dachte, dass mir die Erde nach einem Jahr ohne Sinn (oh, noch viel länger) aus einer unerfindlichen Gnade heraus ein Omen gegeben hatte.
Irgendwie wusste ich, dass die Krähe nicht zulassen würde, dass ich sie berühre. Ich legte die Schaufel auf den Boden vor sie, und nach einigem Nachdenken hüpfte sie auf das Blatt, wie ein Edelmann in eine Kutsche steigt, und ich hob sie vorsichtig hoch. Ich konnte alldem noch keine Bedeutung zumessen, hatte jedoch das Gefühl, richtig gehandelt zu haben.
Ich weiß heute natürlich, dass es kein Omen war und mir dies von der Erde nur in einem allgemeinen Sinn zugedacht wurde. Später würde Eichling (denn es war ER, wie es in alten Sagen hieß) mir klarmachen, dass er aus freien Stücken in meinem Hinterhof gelandet war. Jene Krähen, die ich gehört hatte, krächzten nicht den Menschenfeind (und seinen Hund) an, um einen hilflosen Verwandten zu retten, sondern waren dabei gewesen, ihn zu hetzen und zu vertreiben. Einen kranken Fremden. Und mein Hinterhof war ein Zufluchtsort, den andere Krähen meiden würden: Andere Krähen mieden Menschen, aber er war mit ihnen vertraut, und er wusste, dass ein Hund an der Leine keine Bedrohung darstellt.
Aber er war sicher, dass er krank war und kurz vor dem Tod stand.
Ich brachte den Vogel ins Haus und senkte ihn auf der Schaufel in die Badewanne. Ich kann mich nicht erinnern, warum ich das für vernünftig hielt – vielleicht, um eine Flucht zu verhindern. Warum tun wir solche Dinge, warum halten wir es für richtig, ein einziges krankes oder verirrtes Tier zu retten, wenn die Welt voll von ihnen ist und wir ihnen vermutlich nicht einmal etwas Gutes tun? Es war nicht anders, als wenn Kinder einen einzigen Hamster oder einen Jungvogel aus dem großen Überfluss der Natur mit aller Zeremonie begraben. Ich fütterte die Krähe mit ein paar Stückchen Hühnerfleisch und Brot, zumindest legte ich es in ihre Reichweite. Sie bewegte sich nur wenig, aber immer, wenn ich ins Badezimmer kam, schien sie zu sprechen – schien tatsächlich etwas sagen zu wollen und nicht nur zu rufen oder Töne von sich zu geben. Es wurde dunkel, ich schaltete das Licht aus. Sie blieb still – ich hätte von meinem Bett aus gehört, wenn sie sich bewegt hätte, denn das war nicht weit entfernt; mein Haus ist klein. Vermutlich würde sie am Morgen tot sein.
Ich hatte Wasser vergessen. Das dämmerte mir, als ich im Morgengrauen wach wurde, und ich stand auf und brachte ihm Wasser in einer flachen Schale. Jemand, der so krank war wie dieser Vogel, würde sicher durstig sein. Er trank, legte den Kopf seitlich, um Wasser in seinen Schnabel laufen zu lassen, und hob dann den Kopf, um die Flüssigkeit in sich hinein zu schütteln. Ich saß derweil auf dem Klodeckel und beobachtete ihn. Mir war klar, dass etwas Bemerkenswertes passiert war oder passieren würde, Omen oder nicht, und ich würde warten.
Was dachte er damals bloß, dieser Eichling?
Er sagt mir heute, dass er sich an die schlimmsten Tage seiner Krankheit kaum erinnern kann, und die Geschichte, die ich erzähle – der Hinterhof, die anderen Krähen, die Schaufel, die Badewanne – müssen ihm ebenso reichen wie mir. Das Einzige, was er wusste und ich nicht, war, dass er nicht sterben würde. Es war mehr als nur ein Anfall von West-Nil-Fieber nötig, sollte es das gewesen sein.
Debra hat Krähen nie gemocht, und das war, soweit ich mich erinnern kann, das Einzige der natürlichen Welt, gegen das sie eine Abneigung hatte. Es hatte mit deren lauter Gier zu tun, und damit, dass sie die Eier von kleineren Vögeln fraßen: Für sie sahen Krähen wie Kriminelle aus. Wenn sie noch am Leben gewesen wäre, hätte man es mir sicherlich nicht erlaubt, eine Krähe ins Haus zu bringen, und bestimmt keine kranke und infizierte. Es kommt mir komisch vor, dass der Vogel in meinem Haus und in meiner Gegenwart weder Angst noch Unruhe zeigte, aber ich fand es nicht seltsam, dass er da war. Ich versuchte, es Debra zu erklären, so wie wir Dinge Toten erklären, als müssten sie immer noch besänftigt oder überzeugt werden, als hätten sie noch was zu sagen.
Nach ein paar Tagen konnte sich die Krähe auf den Wannenrand schwingen und das Porzellan mit seinen scheinbar unzulänglichen, aber tatsächlich sehr flexiblen und nützlichen Füßen umklammern. Als sie begann, sich im Haus umzusehen und lange weiße Streifen auf dem Boden und den Möbeln zu hinterlassen, öffnete ich die Fenster und verabschiedete mich. Sie flog auf die Fensterbank, aber blieb lange dort hocken, und ihr wendiger Kopf drehte sich hier- und dorthin. Ich wurde neugierig, was es mit dieser häufigen Bewegung auf sich hatte, und forschte ein wenig nach (in dem ledergebundenen Band einer alten Enzyklopädie) und erfuhr, dass Krähen, wie die meisten Vögel, die Augen nicht in den Augenhöhlen bewegen können, um den Blickwinkel zu ändern; um in eine andere Richtung zu blicken, müssen sie ihre Position wechseln. Diese scharfen, raschen Bewegungen einer Krähe sind das Gegenstück zu einem Blickwechsel.
Als klar wurde, dass der Vogel gesund war und fortfliegen konnte, wollte ich natürlich nicht, dass er mich verließ. So was passiert ständig, nicht wahr? Und vermutlich war der einzige Grund, warum er noch nicht fort war, die Tatsache, dass ich ihn weiterhin versorgte. Aber ich hatte auch von Anfang an mit ihm geredet: kleine Bemerkungen und Fragen wie: »Wie geht es uns heute?« »Fühlst du dich besser?« »Sieht nach Regen aus«, und so weiter. Ich mache das auch mit dem Hund und dem Mond; einsame alte Leute neigen zu so was. Ich hatte keine Ahnung, dass er alles verstand; immerhin scheint der Hund mich zu verstehen, doch ich weiß auch, wie wenig nur.
Aber nein. Die Krähe wollte bleiben, um sich zu unterhalten. Und als ich sicher war, dass sie mich verstand – es war leicht, dafür ein paar Tests zu entwickeln –, da wollte ich sie auch verstehen.
Ich wünschte, ich könnte eine zusammenhängende Geschichte erzählen, wie ich es schaffte, Eichlings Sprache zu lernen. Er war es, nicht ich, der wusste, dass es möglich für uns war, uns zu unterhalten, weil er es mit anderen Menschen an anderen Orten weit weg auch geschafft hatte. Als ich begann, Notizen über unsere Arbeit zu machen, schrieb ich nur auf, was er mir erzählte, und nicht, wie ich lernte, es zu hören.
Was ich schrieb und dann weiter beschrieb, war nichts anderes als eine Aufzeichnung: Krähenunterhaltung, Krähenwitze. Krähengeschichten sind so kurz wie Koans, konfuzianische Analekte; ihre Vielfältigkeit liegt in der gesprochenen Sprache, wie Zeichensprache mit Lauten. Die Übersetzung von einer Menschensprache in die andere ist kein Vergleich. Vor langer Zeit musste Eichling nach Ymr ziehen – ein Name, den er der Menschenwelt gegeben hatte –, und es war ein Weg voller falscher Abzweigungen und Sackgassen; ich musste meinen Weg nach Ka suchen, dem Reich der Krähen, um seine Geschichte zurückzubringen, aber ich wusste nie genau, ob ich richtig verstanden hatte, was ich übertrug.
Aber Sie sehen es genau hier: In jeder menschlichen Sprache reden wir über Wege und Pfade und was wir darüber bringen und tragen. Wir kommen an eine Weggabelung, ein Trennen unserer Wege, eine falsche Abzweigung. Krähen reden nie so. Doch wenn ich mich darauf nicht beziehen könnte, könnte ich vermutlich keine Geschichte und kein Leben nacherzählen. Wir sind Wesen auf einem Pfad und fragen uns ununterbrochen, was uns nach der nächsten Wegbiegung erwartet. Krähen leben in einem weiten, spurenlosen, dreidimensionalen Raum. Wenn ich auf diesen Seiten die echte Krähensprache durch menschliche Worte ersetzt habe und sich das in Bedeutung und Wirkung unterscheidet, dann nur, weil ich keine andere Wahl hatte.
An was ich mich aber sicherlich erinnere, ist die tagtägliche, ehrliche Anstrengung, zu lernen, seinerseits und meinerseits, und an unsere – nun, war es nicht Freundschaft, die ich mir in jenen Tagen verdiente, als aus dem Frühling Sommer wurde und aus dem Sommer Herbst? Natürlich könnte ich auch verrückt sein, nicht nur verwirrt. Die Krähe ist vielleicht ein Wesen, das keinerlei Sinn für mich hat, das vielleicht überhaupt nichts zu mir gesagt hat, und dies ist bloß eine Geschichte, die ich mir selbst erzählt habe. Wie dem auch sei, was Sie vor sich haben, mein imaginärer Leser – die ganze Geschichte, die ist oder sein könnte –, sie ist, was vermeintlich gesagt wurde und was ich zu hören geglaubt habe. Die Geschichte, wie Eichling die Stadt und die Stadtkrähen verließ und wie er zu mir gelangte, konnte er mir als Allererstes erzählen, das Erste, was ich verstehen und aufschreiben konnte. Und dann weiteres, und dann den Rest: Wie es anfing und wie es enden wird. Und so fängt es an.
TEIL 1
Eichling und die Ankunft von Ymr
Kapitel Eins
Noch bevor der Berg am Ende der Welt auf der Flussebene errichtet wurde, noch ehe sich dort die hoch gelegene Stadt ansiedelte, ehe die Mehrzahl der Raben in die Wälder des Hohen Nordens zog, noch vor der schwelenden, mörderischen Wut der Menschen auf Krähen, noch vor der Reise von Eichling übers Meer in Richtung Westen, noch ehe das Höchst Kostbare Ding gefunden und erneut verloren wurde, ehe die Pfade in die Lande der Toten geöffnet wurden, bevor es in Ka Namen gab, ehe Ymr existierte und daher bevor Ka sich selbst erkannte, lernte Eichling zum ersten Mal Menschen kennen.
Eichling hieß damals weder so noch irgendwie anders. Es würde noch einige Zeitalter dauern, bis jede Krähe einen Namen hatte wie jetzt; damals, nein, da brauchten sie das nicht, sie nannten diejenigen in ihrem Umfeld Vater, Bruder, Ältere Schwester, Andere Ältere Schwester; und diejenigen, die sie nicht als Verwandte erkannten oder von denen sie nicht mehr wussten, in welchem Verhältnis sie zu ihnen standen, wurden als Jene bezeichnet, als Andere, als Alle Da Drüben und so weiter. Und da sie über andere Krähen nur wenig zu sagen hatten und kaum eine Notwendigkeit bestand, über sie zu reden, wenn sie nicht anwesend waren, reichte das auch.
Aber ohne Namen kann man sich nur schlecht an Geschichten erinnern, und es ist schwer, sie weiterzuerzählen. Daher beginnen wir diese Geschichte, indem wir Eichling auch Eichling nennen.
Damals gab es nicht viele Krähen. Genauer gesagt, gab es rund um die Welt eine ganze Menge, aber nie viele zusammen an einem Ort. Da, wo Eichling aus dem Ei geschlüpft und flügge geworden war, gab es, außer in den Wintermonaten, wenn Krähen von weither sich in gemeinsamen Schlafkolonien versammelten, nie viel mehr Krähen, als jede nach Aussehen und Stimme erkennen konnte. Falls es einmal geschah, dass eine unbekannte Krähe bei ihnen auftauchte, wurde sie oder er vertrieben oder zumindest längere Zeit auf Abstand gehalten; es konnten einige Jahreszeiten vergehen, in denen ein fremdes Paar auch fremd blieb, und auch wenn es akzeptiert wurde, würde man niemals vergessen, dass sie nicht wirklich Unsereins waren.
Eichlings Eltern waren ein solches Paar. Woher sie kamen, wo ihr Heimatschwarm seine Domäne hatte, warum sie fortgezogen und hierhergekommen waren, hat Eichling nie erfahren: Denn sie vergaßen es, sobald ihnen das möglich war, weil beide hierher gehören wollten, zu den Krähen hier; schließlich verhielten sie sich gegenüber Neuankömmlingen ebenso abweisend wie alle anderen. Gleichwohl betrachtete man Eichlings ältere Brüder und Schwestern mit Misstrauen; alle waren sich sicher, man könne immer noch etwas Anderes an ihnen ausmachen, etwas, das fremd war, und so verließen die Geschwister eines nach dem anderen den Schwarm, auf der Suche nach den Brüdern und Schwestern, die vor ihnen fortgezogen waren, oder um anderswo zu Außenseitern zu werden – niemand wusste, wo, oder ob es eigentlich überhaupt ein »Woanders« oder ein »Wohin« gab.
Diese Krähen waren also nicht einfach genauso wie die Krähen auf den Wiesen und in den Wäldern hinter meinem Haus.
Aber die Domäne zwischen dem breiten, flachen Fluss und dem Wald war sehr gut geeignet für einen Schwarm, so wie er damals war. In den meisten Jahren überschwemmte der Fluss im Frühling die Ebene, wodurch die Bäume nicht so hochschossen und die Zahl der Keimlinge klein blieb. Es gab Muscheln und Fische in dem Fluss; wenn die Lachse stromaufwärts zogen, wurden sie dort von einer Bärenfamilie abgefangen, und die hinterließ reichlich Reste. Es gab Larven und Feldmäuse und behände rote Lurche und tausend andere Dinge in der Erde zu finden. Die Krähen überquerten den Fluss bis in die Vorlandhügel dieses felsigen und dicht bewaldeten Bergs, aber niemals allzu weit; noch flogen sie häufig tief in die Wälder hinein, die am Rand der Flusswiesen begannen, da, wo die Hemlock-Tannen wuchsen. Allerdings beanspruchten sie dieses Gebiet auf unbestimmte Entfernung als ihres.
Die Wälder versorgten sie mit den Kadavern von kleinen Tieren, mit Schnecken und den Eiern und Nesthockern von anderen Vögeln, wenn sie welche aufstöberten; sie fanden auch große tote Tiere, an denen sie gemeinsam mit den Raben herumpicken konnten, wenn die Wölfe sich davongemacht hatten. Es gab genug für alle, aber auch nicht viel mehr. Die Winter waren hart, und dann flogen sie auf der Suche nach Futter weiter, selbst über die Heide hinweg zum Großen See, der dunkelwärts von ihrer Domäne lag, doch den Rest des Jahres blieben sie in der Nähe der Plätze, an denen sie geboren waren und die sie als die ihren beanspruchten. Weit jenseits ihrer Reichweite gab es andere Krähen, Krähen, mit denen sie nichts zu tun hatten und die ebenfalls kaum jemals ihre Domäne verließen.
So war es immer gewesen – eine Vergangenheit, die zu lang und zu eintönig war, als dass man sich an sie hätte erinnern können, und sie wurde nur selten erwähnt. Wenn diese Krähen sich unterhielten, dann vorwiegend über das Wetter.
Und dann kamen die Menschen.
Noch lange Zeit danach, und trotz aller Vorteile, die dies mit sich brachte, denn alle gediehen und vermehrten sich wie nie zuvor, sagten alte Krähen aus diesem Schwarm oftmals: Ich wünschte, sie wären nie über den Berg gekommen und hätten nie den Fluss überquert; ich wünschte, sie wären überhaupt nie gekommen.
So etwas konnten sie äußern, denn zu dem Zeitpunkt hatten die Krähen den Trick erlernt zu denken, dass die Welt anders sein könnte, als sie es war, und daher konnten sie sich dies auch wünschen.
Das hatte Eichling erfunden. So behauptete er jedenfalls.
Das Revier von Eichlings Familie lag weit entfernt von dem der anderen; es war von den Eltern in den Anfangsjahren besetzt worden, als sie noch Außenseiter waren. Das Revier war nicht sehr ertragreich. Es ernährte seine Mutter und seinen Vater, den Bruthelfer seiner Mutter (ein melancholisches Männchen, das in sie verliebt war, seit es flügge geworden war), ihn selbst und seine beiden Schwestern. Sie waren in diesem Frühling die Nestlinge, hatten die erste Kindheit überlebt, aber ihre Federn hatten noch nicht den schimmernden Glanz der Erwachsenen; alle drei mussten noch gehütet werden, auch wenn sie das selbst abgestritten hätten. Dann war da noch ein junger Stromer, wie es Eichlings Eltern einst gewesen waren. Der hielt sich vorsichtig abseits und hatte mit dem Rest noch kaum Verbindung aufgenommen, wurde aber, vermutlich aufgrund von alten Zeiten, toleriert: Im Herbst war Eichling alt genug, um Wächter zu werden – aber nicht ganz allein; er kam nur zum Einsatz, wenn seine Mutter, sein Vater oder der Bruthelfer, die auf hoch gelegenen Ästen hockten, ihm Bescheid gaben. Den ganzen Tag über streiften alle durch ihr Revier und patrouillierten auf der Suche nach Interessantem und vermutlich Essbarem die wohlbekannten Hügel und Bäche. Bei jedem Halt stellten sie einen Posten auf, zwei oder drei von ihnen, die auf die Laute von ferneren Familien lauschten und den Himmel, die Bäume und den Boden nach Raubvögeln, Füchsen oder anderen Eindringlingen absuchten. Erst wenn Parole und Antwort erfolgt waren – Allesinordnung? Ja,soweitichdassehe –, landeten sie auf dem Boden, um zu fressen.
Eichling postierte sich gern auf einem windgeschüttelten Ast absurd hoch im höchsten Baum, wo er meilenweit nach Bedrohungen Ausschau halten konnte – falls es etwas Bedrohliches gab, was in seinem kurzen Leben noch nicht vorgekommen war. Die häufigsten Gefahren in der Nähe, die man melden musste, waren Wiesel, Füchse oder Raubvögel. Oftmals hielt er nicht wirklich Ausschau, sondern blickte nur in die Gegend; manchmal vergaß er zu fressen, wenn er an der Reihe war, weil er weit in die Ferne starrte, weit über das Revier des Schwarms hinaus, und sich fragte, was er da wohl sah, aber nicht richtig entschlüsseln konnte. Wie weit konnte eine Krähe wohl in dieser Richtung fliegen?
Er hatte die Neigung, sich an schläfrigen Nachmittagen zu verirren, wenn die anderen träge in der Herbstsonne hockten oder im Tannenwäldchen einnickten. Er war einfach verschwunden, wenn seine Mutter nach ihm rief, und zu weit entfernt, um sie noch zu hören. Sosehr er seine Familie auch liebte und immer noch Mutter und Vater folgte, so wie im Frühling, hatte er auch nie etwas dagegen, ganz allein zu sein. Wenn er sich so weit entfernte, hing er gern dem Gedanken nach, dass er in eine Gegend schaute oder an einem Ort stand, wohin noch keine Krähe aus seinem Schwarm je vorgedrungen war.
Aber richtig verirrte er sich nie, nicht solange der Punkt hinter seinem Schnabel und zwischen den Augen ihm, zuverlässig wie eine Kompassnadel – alle Krähen haben ihn –, immer den Weg nach Norden weisen würde. »Schnabelwärts« nannten sie es, und demnach auch »tagwärts« – Richtung Osten –, und »dunkelwärts« gen Westen. (Zumindest heutzutage haben Krähen seltsamerweise kein Wort für Süden. Vielleicht bedeutet dieses Gefühl in ihrem Kopf gleichzeitig Norden und Süden. Das habe ich nie herausgefunden.)
»Du würdest es mir nie glauben«, sagte Eichling eines Tages zum Stromer, »wenn ich dir erzählen würde, wie weit ich von hier aus schon geflogen bin!«
Der Stromer, der gerade am Rande des Teiches nach Larven oder Froscheiern oder sonst was suchte, gab keine Antwort.
»Ich bin da gewesen, wo es überhaupt keine Krähen gibt«, sagte Eichling. »Keine einzige außer mir.«
»So was gibt es nicht«, widersprach der Stromer.
»Ach was?«, meinte Eichling. »Dann flieg doch mal so weit wie ich.«
Der Stromer unterbrach seine Futtersuche. »Hör mir mal zu, du Küken«, sagte er leise, aber scharf. »Ich habe vor langer Zeit den Ort verlassen, wo ich großgeworden bin. Man hat mich vertrieben. Egal, warum. Und seit damals, bis zum heutigen Tag, bin ich ununterbrochen unterwegs gewesen.«
Eichling hatte ebenfalls aufgehört zu picken. Das war mehr, als der Stromer in all den Tagen, seit er sich in Nähe der Familie aufhielt, von sich gegeben hatte. »Unterwegs«, wiederholte er, wie etwas sehr Unangenehmes. »Und es gibt keinen Ort, wo es keine Krähen gibt.« Dann hackte er mit dem Schnabel auf etwas in einer ausgetrockneten Pfütze ein, das wie der Überrest eines kleinen Froschs aussah. »Hätte mir wohl besser gefallen, wenn es einen solchen Ort gäbe. Aber nein. Nirgendwo. Von hier bis zum Sonnenuntergang bin ich ständig von Krähen fortgescheucht worden. Ha, keine Krähen!« Er schüttelte den Kopf, entweder ungläubig oder um einen schlechten Geschmack im Mund zu vertreiben, und hüpfte ein Stück weiter.
»Und ich sage, es ist wahr«, rief ihm Eichling verdrießlich hinterher.
Er flog los. Tagwärts konnte man die ansteigenden Lande durch die dünnen Stämme der abgestorbenen Moorbäume erkennen sowie das kahle Sumpfgebiet, wo es nicht viel zu jagen gab. Er landete in der Krone eines Baumes, der ihm gefiel, eine ausladende Eiche nahe am Waldrand. Falls er jemals eine Partnerin finden und Junge großziehen würde, dachte er, wäre eine Astgabel in diesem Baum der ideale Nistplatz, doch er wusste auch, dass das ihre Entscheidung sein würde und nicht seine.
Falls …
Von dem schaukelnden Ast aus konnte Eichling mit seinen scharfen, klaren Augen einen großen Abschnitt des weiten, fernen Landes überblicken. In einer Meile Entfernung (obwohl Krähen damals nicht in Meilen oder anderen Maßstäben dachten) konnte er Kaninchen im Klee entdecken, weiter entfernt einen Schwarm Dohlen, der aufflog und sich dann wieder niederließ. Noch weiter entfernt, zwischen den gefalteten Flügeln der Berge, das Glitzern des Sees, von dem er gehört hatte. Am weitesten entfernt – Wolken.
Er würde gern dorthin gehen, wo der Stromer herkam – falls der die Wahrheit sagte. Er war sicher, dass ihm selbst das mehr Spaß gemacht hätte, und er wäre anschließend nicht so unwirsch und stumm geblieben. Er hätte die Krähen, denen er begegnete, für sich eingenommen, ihnen Geschichten über die Orte erzählt, die er besucht hatte und wo diese noch nie gewesen waren. Er wäre nicht so vertrieben worden wie der Stromer, und wenn er sich entschieden hätte, weiterzufliegen, dann hätten sie ihm verraten, in welche Richtung er sich wenden sollte, hin zu Plätzen, weit von anderen Krähen entfernt und voller interessanter Dinge.
Dann nahm er mit einem Auge nahe dem Stamm der Eiche in dem herabgefallenen Laub und zwischen den Schalen der alten Eicheln eine kleine Bewegung wahr. Er wusste, was es war, oder jedenfalls, was es sein konnte. So geräuschlos er nur konnte, ließ er sich auf die Stelle niederfallen und hieb zu, noch ehe er landete. Die Feldmaus, die im Laub geraschelt hatte, wollte verzweifelt losstürzen, aber Eichlings Krallen waren schon über ihr, und sein Schnabel stieß fest zu. Sorgfältig nahm er sie auseinander und fraß, was fressbar war.
Dabei hatte er völlig vergessen, worüber er nachgedacht hatte, aber als er die Maus verschlungen hatte, blühte der Gedanke mit plötzlicher Klarheit wieder in seiner Brust auf. Er blickte sich um. Aus mehreren Richtungen konnte er die Rufe seiner Familie und anderer Krähen hören, wie sie Dinge sagten, die sie immer sagten, um einander zu orten. Was würden sie denken oder tun, wenn er ihnen keine Antwort gab?
Sein Herz schlug schneller. Dann ging er tief in die Knie, hob seine Flügel in die Höhe und schlug sie kräftig nach unten, während er mit angespannten Beinen hochsprang – es war der nach oben gerichtete Sprung, den er so mühsam hatte lernen müssen, als er gerade das Nest verlassen hatte, und den er nun tagtäglich Hunderte von Malen vollzog. Doch diesmal erinnerte er sich an diese ersten Male, auch wenn er sich jetzt mit neuer Zielstrebigkeit bewegte, und als der Sprung-Flügelschlag ihn abheben ließ, strampelte er aufwärts, als wollte er mit den Füßen die Luft erklettern. Wieder und wieder schlug er mit den Flügeln, und dann war er oben – und noch ehe er aufhörte, über den Gedanken zu staunen, wie unmöglich ihm dies einst erschienen war und wie leicht er es nun fand, da war er schon weit fort und flog immer weiter.
Er flog den ganzen Tag. Hin und wieder landete er und ging eine Strecke, mit Blick auf Futtersuche und ein wenig ängstlich, weil niemand auf einem höhergelegenen Ast saß und Gefahr krähen würde, aber auch aufgeregt aus dem gleichen Grund, bis ihn ein leises Lachen in der Kehle kitzelte. Dann hob er wieder ab. Er erreichte den Großen See, den er noch nie gesehen hatte. Er hätte ihn in mehreren Abschnitten umfliegen können, doch einem Impuls folgend überquerte er ihn. Lange lag die gekräuselte Oberfläche unter ihm, bis es ihm fast zu viel wurde. Auf halber Strecke rastete er auf einer kleinen Insel in einem Hain wasserliebender Bäume und fand dort Schnecken zum Fressen. Dann flog er weiter. Auf der anderen Seite hatte er eine Entfernung von zu Hause zurückgelegt, die er vor dem Dunkelwerden nicht mehr bewältigen konnte.
Da war er also. Er war sich ganz sicher. Er hockte sich auf einen niedrigen Baum von der Art, die er bestimmt noch nie gesehen hatte, und lauschte. Er konnte den Tag hören, die paar Singvögel, die kein Schläfchen hielten, eine Drossel, eine Lerche. Ein leiser Windstoß, das Gebrüll eines Elches tief drinnen in dem düsteren Wald. Sonst nichts, und niemand von seiner Sorte zu hören oder zu sehen. Er rief, anfangs ziemlich leise, ein bloßes Woseidihr? Keine Antwort. Dann ein wenig lauter. Immer noch keine Antwort, nicht einmal das leiseste Echo auf seinen Ruf.
Es war zu weit weg für Krähen. Ihm war heiß im Kopf, seine Innenlider zuckten.
Aber um sicherzugehen, hob er wieder in Richtung Sonne ab. Zu weit war eigentlich noch nicht weit genug. Er stieg höher als nötig auf den warmen Aufwinden, die vom sonnenerhitzten Boden aufstiegen. Er fragte sich, ob es möglich sei, den Tag zu verlängern, indem er direkt auf die Sonne zuhielt und irgendwie beim Sinken unter ihr herflog. Er war so in diese Gedanken versunken und in das Gefühl in seinen angespannten Muskeln und seinem leeren Bauch, dass ihn, als sein schnabelweises Auge die Wesen unter sich auf der Erde erspähte, der Anblick so erschreckte, dass er sich unfreiwillig überschlug.
Er hatte sich gewünscht, neue Lande und andere Dinge zu sehen. Und jetzt das hier. Er richtete sich wieder gerade und nahm eine Schräglage ein. Es waren vier: Einer groß und dünnbeinig wie ein Reh oder ein Elch, aber keines von beiden, und einer sah wie ein Wolf aus – Eichling hatte noch nicht oft Wölfe gesehen, aber oft genug, um zu erkennen, dass dieses Wesen kein Wolf war. Diese beiden hier waren vierbeinig. Aber die anderen zwei standen aufrecht wie Bären, wenn sie nach Beeren auf höher gelegenen Zweigen griffen oder etwas bedrohten. Fast ausschließlich haarlos, und helles Fleisch war zu sehen, so, als seien sie gehäutet worden. Ihr Hals und die Unterarme waren von etwas umwunden, in dem sich das Abendlicht fing; es glänzte wie Eis oder Feldspat. Die vier gingen zusammen, Freunde auf eine Weise, wie Eichling es noch nie bei vier so unterschiedlichen Wesen beobachtet hatte. Die beiden Zweibeiner hielten mit den langen, schlanken Vorderbeinen Stöcke, die sie über den Schultern trugen und die so lang waren wie sie selbst. Für was die wohl waren? Eichling schwebte reglos in der Luft und versuchte, jede Einzelheit genau zu erkennen – was waren das für Felle, die um die Körpermitte flatterten? Was waren die dicken Pfoten an den Füßen? Als er einen Kreis schlug, sah er, wie einer der beiden den Stock von der Schulter nahm, ihn zum Himmel richtete, wo Eichling war, und dann deutete der andere mit seinem eher dunkelwärts.
Eichling segelte fort, weil ihn Unruhe überkam. Dunkelwärts und schwarz vor der niedrig stehenden Sonne war ein Falkenweibchen zu sehen; er erkannte die Silhouette unmittelbar, als entspräche sie einem Schattenmuster in seinem Gehirn. Sie kam auf ihn zu, die spitzen Flügel durchschnitten die Luft.
Die Krähe war über freiem Feld, zu weit von den nächsten Bäumen entfernt, doch sie fühlte sich unwiderstehlich in genau diese Richtung gezogen. Die Falkin näherte sich und stieg gleichzeitig höher. Es gab nur eine Möglichkeit, ihr zu entkommen, und die war selten erfolgreich. Man musste zulassen, dass der Raubvogel aus großer Höhe auf einen herabstieß, bereit, mit den kräftigen Krallen zuzuschlagen, und irgendwie versuchen, dem auszuweichen. Dann würde der Falke tiefer fallen und musste wieder aufsteigen, höher und höher, um erneut zuzuschlagen. So jagen Falken: Sie stürzen in rasendem Tempo von oben auf einen zu, schlagen einem mit nach unten gerichteten geballten Krallen den Kopf ein und schnappen einen dann, wenn man betäubt oder tot zu Boden fällt, auf. Selten gehen sie anders vor. Falken sind kraftvoll und aggressiv, aber nicht besonders einfallsreich. Das brauchen sie auch nicht sein. Die Beute ist es, die sich blitzschnell etwas überlegen muss.
Eichling flog in Richtung der unerreichbaren Bäume. Er spürte den Schatten über sich, war aber nicht in der Lage, sich umzudrehen und hochzuschauen, weil er dadurch an Tempo verlieren würde. Dann, als der rauschende Flügelschlag der Falkin plötzlich abbrach, erkannte er, dass sie abwärts schoss wie ein – Krähen haben dafür keinen Begriff – wie ein Pfeil, eine Gewehrkugel. Er spürte irgendwie, dass seine allerletzte Chance gekommen war, schlug einen Salto und wechselte die Richtung. Die Falkin stürzte mit gekrümmten Krallen so nahe an ihm vorbei, dass er ihre gelben Augen und den offenen Schnabel sehen und das Rauschen der Flügel spüren konnte. Sie rollte sich herum und begann, wieder zu steigen.
Der Grund, warum dieser Trick fast nie funktioniert, ist, dass Falken schneller an Höhe gewinnen als Krähen. Eichling versuchte, sich durch Flügelschläge hoch und gleichzeitig in Richtung auf die Bäume zu bewegen. Und da sah er – er würde das nie vergessen –, wie die beiden Stockträger ihre Stöcke in die Luft hielten.
Als die Falkin hoch genug war, waren auch die Bäume fast nahe genug, so, als würden sie sich ihm entgegenstrecken. Es hätte so oder so ausgehen können, aber als die Falkin sich wieder fallen ließ, stürzte sich Eichling zwischen die Stämme, verlor dabei ein paar Federn und brach sich fast den Hals, genauso glatt, wie die Falkin es getan hätte. Er war in Sicherheit. Im Gegensatz zu Eulen würde die Falkin ihm nicht in das dichte Laub folgen; sie würde aufgeben und woanders weiterjagen. Eichling keuchte mit geöffnetem Schnabel; seine Innenlider waren fast geschlossen, und das Herz pochte, als wollte es ihm aus der Brust springen. Er klammerte sich an einen Tannenstamm und machte sich sehr klein.
Die Falkin wartete vielleicht noch und blieb länger in der Luft, um elegante Flugmuster in den Himmel zu zeichnen. Diese schreckliche Hartnäckigkeit! Dar Eichling kroch tiefer in das Unterholz und merkte, wie seiner trockenen Kehle ein Schrei entfuhr, der Schrei einer Krähe um Hilfe: Kommkomm, Gefahrgefahr, nichtweit, sondernnah, die allerschlimmste Gefahr. Er wusste aber, dass Hilfe außer Reichweite war.
Jawohl, die Falkin saß jetzt auf einem kahlen Ast am Rand des Dickichts, wo er seinen Schrei ausgestoßen hatte. In dem Moment, als er sie sah, ließ sie sich fallen, wich der Tanne aus, wo Dar Eichling sich verbarg, und schlug mit den kräftigen Flügeln zu, um ihn herauszutreiben. Er wollte flüchten, wollte in der Luft sein, wohl wissend, wie unendlich dumm das wäre. Er rief weiter, inzwischen so leise wie ein Nestling, der auf den Boden gefallen ist, gerade eben so, um Kopf und Herz Stimme zu geben, aber ohne etwas zu tun oder eine Feder zu rühren. Ihre Augen spähten in das Gebüsch, groß und fahl wie die Mittagssonne, mit einer schwarzen Kugel in der Mitte – nein, sie konnte ihn sicher nicht sehen.
Nach einer Weile bewegte sie sich fort, aber wie weit? Eichling hörte auf zu rufen. Die Sonne war jetzt fast untergegangen, und er war allein an einem Ort, an dem er noch nie gewesen war. Er hatte noch nie eine Nacht außer Hörweite seiner Familie verbracht – Gutenacht, Mutter, gutenacht, Vater, gutenacht, Andere.
Und wenn es in dem Wald, in dem er sich verbarg, nun eine Eule gab?
Ein leises Rauschen wehte in der sich senkenden Dämmerung über ihn, vielleicht – sicher – nur eine Nachtbrise.
Er schlief ein, wachte aber in der Nacht immer wieder auf, um zu lauschen und in die dunklen Äste zu starren. Ringsum bewegten sich Wesen, an den Baumstämmen, auf dem Waldboden, es kratzte und raschelte – vermutlich ganz normale Tiere und keine Bedrohung für ihn – aber trotzdem … Dann kam die Dämmerung, die eine gefühlte Ewigkeit andauerte, und das rote Glühen tagwärts war schlimmer als die Dunkelheit. Erst mit der Sonne erinnerte sich Eichling an die fremdartigen Wesen, die er gesehen hatte – in der Nacht und auf der Flucht um sein Leben hatte er sie völlig vergessen.
Nun reckte er sich ein wenig in seinem Dickicht. Alles schmerzte. Die Falkin konnte nicht mehr in der Nähe sein, denn außer im Frühling, wenn alle beim ersten Licht schon unterwegs sind, um die Jungen zu füttern, jagen Falken später am Tag. Über dem Boden, soweit er es sehen konnte, lag Nebel, der sich langsam auflöste. Er verließ den Zweig, an den er sich geklammert hatte, und hüpfte nun von einem Landeplatz zum nächsten durch das Unterholz (wie war er nur so tief hier hineingelangt?), bis es sich lichtete und er wieder fliegen konnte.
Die seltsamen Wesen waren verschwunden, die Zweibeiner wie auch die Vierbeiner. Aber da, auf dem trockenen Hügel, wo sie gestanden hatten, waren die Stöcke, die sie getragen hatten, senkrecht in den Boden gesteckt. An jedem hing etwas Dünnes, Fedriges, das sich im Nebel bewegte. Es waren die Stöcke, die sie zu ihm und der Falkin hochgereckt hatten.
Er überflog die Stelle, war aber nicht gewillt, sich niederzulassen und sie näher zu untersuchen. Dann schwang er sich dunkelwärts in die Schräglage, und allmählich gewannen seine Flügel wieder an Kraft; er wollte weit fort von hier und wieder in der Nähe von anderen Krähen sein.
Damals konnte Eichling nicht wissen, noch wusste er es lange Zeit später, dass die beiden Menschen, die mit einem Hund und einem Pferd gekommen waren und beobachtet hatten, wie eine Krähe gegen einen Falken ankämpfte, ein Zeichen gesehen hatten. Er hätte auch nicht gewusst, was ein Zeichen war, und manchmal denkt er auch jetzt noch, dass er das nicht wirklich versteht. Aber er und seine Zwangslage waren für sie ein Zeichen gewesen. Das Zeichen hatte ihnen verraten: An diesem Ort, zwischen den Bergen und dem See, wirst du den Feinden entgehen, die euch aus eurer Heimat vertrieben haben. Hier könnt ihr wieder bauen, Junge großziehen, eure Toten begraben.
Sie hatten ihre Speere in den Boden gesteckt, um die Stelle, an der sie das Zeichen empfangen haben, zu markieren und dorthin zurückzukehren.
Eichling wandte sich heimwärts. Er meinte, er sei weit genug gekommen, aber bei der Rückkehr schien es ihm gar nicht mehr so weit. Noch ehe die Sonne den höchsten Punkt des Himmels erreicht hatte, hörte er von irgendwo in den Sümpfen und Wiesen, auf die er zuflog, den Ruf einer Krähe.
Niemand glaubte seine Geschichte von den Wesen, die er gesehen hatte, natürlich nicht, weil er (seinem Vater zufolge), seit er sprechen gelernt hatte, zu viele solcher Geschichten erzählt hatte, von denen nur wenige sich als wahr herausstellten. Eichling wollte nicht an den Ort zurückgehen, obwohl er sich einredete, dass er das bald tun würde; hin und wieder in der Nacht fühlte er, wie die Falkin an ihm vorbeiraste, sah die schrecklichen Krallen und erwachte mit einem Schrei. Eines Tages, als der Stromer und der Bruthelfer ihn mit dieser Geschichte aufzogen, forderte er sie lauthals heraus, mit ihm dorthin zu fliegen, falls sie sich das trauten, um den Ort zu sehen und die Wesen, die dort waren, und unter viel Gelächter und gespielter Angst und aufgesetztem Mut flogen sie mit Eichling an den Ort, wobei sie sich über die Entfernung und die Anstrengung beklagten. Sie machten auf der gleichen Seeinsel Rast, wo Eichling pausiert hatte. Der Weg dorthin hatte sich ihm fest ins Hirn geprägt.
Da waren die beiden in den Boden gerammten Stöcke.
»Seht ihr? Da, seht doch!«
Aber da das alles war und keine Wesen sich näherten, waren die beiden anderen zwar gewillt, die Geschichte zurückzutragen, wobei sie sich aber über diese wunderbaren und noch nie zuvor gesehenen Stöcke lustig machten, und das ging so lange weiter, bis sich Eichling wünschte, er hätte sie nie überredet, mit ihm dorthin zu fliegen. Er besuchte den Ort nie wieder und hoffte, obwohl er wusste, wie wahr seine Geschichte war, dass die anderen sie bald vergessen und aufhören würden »Stöckchen!« zu krähen, wann immer sie ihn sahen.
Es wurde langsam kälter. Die Familien begannen, ihre Reviere abends zu verlassen und zu den Kolonien zu ziehen, die sich im Winter immer bildeten. Auch die Nahrung wurde knapper, und es würde bald einer einzelnen Familie nicht mehr möglich sein, die vielen anderen auf der Suche nach Futter abzuwehren, wo immer man etwas fand, und das Familienrevier würde ohnehin nicht mehr genug für alle Mitglieder hergeben. So scharten sie sich zusammen und flogen überall hin, wo alle hinflogen, und kehrten abends gemeinsam zurück.
Es war eine gute Jahreszeit, zumindest bis der Winter nicht allzu hart wurde. Die Schlafkolonie wechselte ab und zu, aber ein paar Jahre lang war es eine bewaldete Insel weiter unten am Fluss gewesen, wo das Wasser breiter und das Ufer dicht mit Pappeln und verschieden Nadelbäumen bewachsen war, darunter auch einige riesige Eichen und Eschen. Immer mehr Krähen versammelten sich bei Sonnenuntergang und wenn die Wolken sich röteten; laut schnarrend ließen sie sich beim Fluss nieder oder stürzten aus dem tagwärts dunklen Himmel, aus der untergehenden Sonne oder von den Bergen her. Es gab sogar eine Schar Dohlen, die sich Nacht für Nacht am Rand ihrer Schlafkolonie einfand, alle gleichzeitig miteinander über ihre Erlebnisse schwätzend, ohne dass es jemand verstand, selbst wenn man es versucht hätte.
Das war die erste Schlafkolonie, die Eichling kennengelernt hatte, und ihm schlug das Herz höher, und er gab leise Laute von sich, wenn sich viele, viele fremde Krähen, darunter auch junge Weibchen, nach dem Abendflug neben ihm, unter oder über ihm niederließen. Sein Vater und seine Mutter waren auch irgendwo in der dichten Schar, dazu die Brüder und Schwestern von Eichling aus früheren Jahren und von weit entfernten Revieren. Sie hatten ihre eigene Gruppe, und viele von ihnen waren Stromer oder Neuankömmlinge, sodass seine eigene Familie alteingesessen wirkte; er würde den Winter über nicht viel von ihnen zu sehen bekommen. Vater verbrachte die Abende mit Krähen seines Standes, Mutter mit ihren Bekannten, und man sah sich erst im Frühling wieder.
Was für einen Lärm sie machten, wenn sie sich auf den dichten Ästen niederließen, Freunden wie Feinden etwas zuriefen, ihre Meinungen über alles und nichts von sich gaben, von einem Ast zum anderen hüpften und krächzten Oh! Du! Dabistduja! Ichbinauchhier! und Hunderte andere bedeutungslose, aber nicht nutzlose Bemerkungen. Die älteren und größeren Krähen, die lauthalsigeren und mit vielen Freunden, bahnten sich mit diesen Begrüßungen einen Weg in die Mitte des Schwarms, wo sie in den eisigen Nächten von der Masse der Krähenkörper ringsum gewärmt wurden, während die jüngeren und kleineren eher am Rand blieben. Man muss sie abhärten, dachten die Alten, sollen sie doch bei ihren Freunden bleiben. Die Jungen hüpften von Ast zu Ast und drangen so weit ins Innere vor, wie sie sich trauten, Männchen zu Weibchen, Weibchen, die Männchen riefen – junge Krähen, die sich im Frühling paaren wollten und schon auf der Suche waren. Hallo, duda! Hallo! Höhere Äste waren besser als tiefer gelegene, wenn man dort einen Platz finden konnte; die tiefer Sitzenden bekamen oft den Kot von denen über ihnen ab; sie wurden morgens wach und fanden weiße Streifen auf ihrem schwarzen Gefieder, sehr zur Belustigung der anderen.
An einem gewissen Abend war es schon fast dunkel; ein riesiger Mond ging auf, und die Größeren riefen: Nunaberruhe, Ruhe …, als im Wald auf der anderen Flussseite ein lautes Rascheln und Getöse begann, was die Krähen, die es hörten, augenblicklich verstummen ließ. Etwas Großes kam da drüben durchs Unterholz, und etwas anderes verfolgte es. Die Krähen begannen zu krächzen, was es denn sein könnte – es galt stets als beste Lösung, mögliche Verfolger anzukreischen, obwohl man später von den Überresten profitieren würde. Aber was war es? Für Wölfe war es zu früh in der Dunkelheit des Jahres …
Ein Reh, eine kleine Ricke, stürzte in das Mondlicht und hielt mit kurzen, ruckartigen Sprüngen auf den Fluss zu. Ihr folgten … waren das Wölfe? Nein, keine Wölfe. Sie waren wie Wölfe, gaben aber Laute von sich, die Wölfe beim Jagen nie machen würden. Diesen folgten zwei andere mit langen Schritten: Aufrecht auf zwei Beinen.
»Das sind sie!«, krächzte Eichling laut und rief es wieder und wieder durch das allgemeine Getöse:
»Wer? Wer?«
Eichling sah, dass die Ricke, die sich jetzt in den Fluss stürzte, einen Stock in der Flanke hatte, genau wie die, die die Zweibeiner getragen hatten – dafür waren sie also! Die wolfähnlichen Wesen stürzten dem Reh hinterher und versuchten, gleichzeitig zu schwimmen und es zu beißen; das Tier konnte kaum den Kopf über Wasser halten. Die Krähen schrien warnend oder anfeuernd oder stießen einfach nur staunende Laute aus. Eichling hüpfte von einem Ast zum anderen und rief immer wieder: Dassindsie! Dassindsie!, während die Jungvögel um ihn her vor Lachen fast von den Zweigen fielen.
Die Zweibeiner waren nun auch am Ufer angelangt und wateten wie Bären bis zum Bauch ins Wasser, ehe sie mit den Vorderarmen zu rudern begannen. Das Reh erreichte die Insel und die dortigen Schatten und war kaum noch zu sehen. Die Krähen hüpften näher und schubsten einander um die besten Plätze. Die Ricke hätte nie die Kraft aufgebracht, die steinige Böschung hochzuklettern, wenn die Wolftiere ihr nicht so dicht auf den Fersen gewesen wären – es war unmöglich auszumachen, wie viele es waren, als sie über die Felsen und moosbedeckten Stämme rannten und sprangen. Dem Reh ging nun die Kraft aus, seine Beine gaben unter ihm nach, und sie sprangen ihm an die Kehle. Nun erreichten die Zweibeiner die Insel und stiegen die Böschung hoch, und das war nun zu viel für die Krähen – viele erhoben sich in die Luft und landeten auf den Baumspitzen, um dem Geschehen so weit wie möglich zu entgehen, wie allem, das sie nicht einordnen konnten, und wer konnte diese Jäger schon einordnen?
Die Zweibeiner erreichten das Tierknäuel und zerrten mit scharfen Rufen die zähnefletschenden Wesen von der nun stillen, ergebenen Ricke. Dann stellte sich der größere Zweibeiner mit gespreizten Beinen über das Reh, packte den Hals mit den beiden blassen Händen und riss ihn auf. Blut schoss heraus, schwarz im Mondschein.
Nein, das hatte er nicht mit den Händen gemacht, sondern mit einem anderen Ding, das er wohl die ganze Zeit bei sich gehabt hatte, aber das begriff nur Eichling. Die anderen staunten nur über diesen unwahrscheinlichen Kampf in der Dunkelheit.
Dann hielten sie einen Moment inne, ihre Bruthelfer (es war klar, dass die Vierbeiner Bruthelfer waren) scharten sich um sie, wagten aber nichts weiter. Dann hoben die Zweibeiner das Reh hoch, drehten es auf die Seite und rissen mit dem Werkzeug (inzwischen war allen klar, dass sie da ein Ding hielten, es blitzte im Mondlicht auf) den Brustkorb bis zum After auf. Das glänzende Gedärm und andere Teile des Rehs glitten heraus; mit dem Werkzeug zerrte der eine Jäger die Leber heraus. Den Rest schoben sie beiseite; wie Wölfe hatten sie nur wenig Interesse daran, und die Vierbeiner kämpften um die besten Stücke.
Oben in den Bäumen breitete sich die Neuigkeit unter den Vögeln aus: Die Zweibeiner zogen das nun ausgeweidete Reh in den Fluss, wobei sein Kopf mehrmals auf den Felsen aufschlug. Dann schwammen sie mit kräftigen, einarmigen Stößen durch den flachen Fluss zum Ufer, wobei der jeweils andere Arm das Reh hielt. Ihre Tierhelfer, die zurückblieben, jappten ihnen eine Weile wütend hinterher oder wühlten weiter in dem Gedärm herum, doch dann stürzte sich einer nach dem anderen ins Wasser, um ihnen zu folgen.
Was sollten die Krähen nun tun oder auch nur denken? Es war dunkel, mitten in der Nacht, der Mond stand hoch und klein am Himmel. Krähen sehen im Mondlicht nicht sehr gut und trauen sich fast nie, bei diesen Lichtverhältnissen zu fliegen. Aber da unten lag ein solcher Reichtum an Futter, und eine jede überlegte, wie sie wohl am Morgen noch vor den anderen dorthin gelangen könnte – oder sollten sie beim ersten Licht den Fluss überqueren und nachsehen, was die Jäger zurückgelassen hatten? Sicher konnten sie nicht alles auffressen? Das hielt sie vom Schlaf ab, und sie überlegten und redeten, sie wechselten den Standort, um den Fluss zu überblicken, wo sie ein schwaches Glühen erkennen konnten, das sich keiner erklären konnte.
Am nächsten Morgen war auf der anderen Flussseite nichts von ihnen zu sehen. Man sah Rauch und roch Verbranntes (die Ältesten Krähen kannten den Geruch; Feuer waren in jenem Land in trockenen Sommern selten, aber wurden erinnert). Von dem Reh war nichts übrig geblieben, kein Fell, kein Schädel, keine Knochen, nichts. Wohin waren sie gezogen? Ein paar Jungkrähen folgten Eichling in die Morgenluft, um nachzuschauen; sie folgten der Richtung, die er an jenem ersten Tag eingeschlagen hatte – und ja, dort auf dem Moor zwischen dem Fluss und den Vorlandhügeln sahen sie sie, die Zweibeiner und auch das Reh: Seine vier Beine waren irgendwie an einen dünnen Baumstamm gebunden, von dem man die Zweige abgestreift hatte und den die Zweibeiner schaukelnd zwischen sich trugen; die Vierbeiner schnüffelten um den herabhängenden Kopf herum. Dort, auf der Anhöhe, waren noch andere von der gleichen Sorte.
Ja, da waren sie. Und genau so, wie Eichling sie beschrieben hatte, obwohl der Schwarm es bald leid war, dass er immer wieder davon erzählte. Noch war er trotz seiner Angeberei nicht die erste oder einzige Krähe, die solche Wesen gesehen hatte. Sie waren den Krähen seiner Domäne fremd, aber es hieß, dass Krähen, die zur gemeinsamen Schlafkolonie kamen, Geschichten von diesen Wesen erzählten, Dinge, die sie irgendwo von anderen Vögeln gehört hatten. Ein junges Krähenweibchen behauptete sogar, selbst welche gesehen zu haben. Sie schien das aber nicht sehr interessant zu finden. Eichling gelang es irgendwann, sich neben sie zu hocken.
»Wie heißen sie denn?«, wollte er wissen. »Was für einen Namen gibst du ihnen?«
»Namen?«, fragte sie leicht verächtlich. »Warum sollen wir ihnen denn irgendeinen Namen geben?«
»Dinge haben aber Namen.«
»Es gab keinen Grund, über sie zu reden«, erwiderte sie. »Sie waren einfach da.« Ihre Aufmerksamkeit wanderte von Eichling zu anderen Jungvögeln, aber dann schien sie sich an etwas zu erinnern und sprach ihn wieder an. »Also, was ich über sie gehört habe …«, begann sie, »ist, wie viel sie zurücklassen.«
»Zurücklassen?«
»Was sie nicht benutzen, meine ich. Und wenn du dich trauen würdest, das zu holen …« Aber dann überlegte sie es sich anders, nickte ihm höflich kurz zu und war verschwunden.
Den ganzen Winter über flogen Krähen zu zweit oder dritt, manchmal ein ganzes Dutzend, auf dem gleichen Weg, den Eichling damals genommen hatte, zu dem Ort auf der Anhöhe auf der anderen Seeseite. Bald hatten sich da weitere von den Wesen niedergelassen als die, die Eichling gesehen hatte, falls die beiden, die das Reh gefangen hatten, die gleichen waren, die die Stelle mit ihren Speeren markiert hatten. Für die Krähen sahen sie anfangs alle gleich aus, und es war schwer zu sagen, wie viele es waren – ein paar waren klein, vermutlich Junge. Sie hatten begonnen, auf der Ebene Dinge aufzubauen, die aussahen wie große Nester oder (wie manche meinten) oberirdische Höhlen, Schutzplätze, wie die Haufen von Stöcken und Blättern, unter denen Bären den ganzen Winter über schlafen, oder vielleicht wie die Steine, die Köcherfliegen zusammenkleben, um sich dazwischen zu verstecken – denn sie waren in der Tat aus Steinen und Stöcken und Lehm gebaut, geweißt wie ein Reihernest mit Kot, und die Wesen, für die die Krähen immer noch keinen Namen hatten, gingen aus und ein, sodass die Krähen nie wissen konnten, ob sich immer die gleichen hin und her bewegten, oder ob viele darin verborgen waren. Auch gab es immer mehr von diesen Wohnhöhlen oder Nestern, wann immer die Krähen nachschauten.
Aus den Löchern oben kam Rauch.
Hin und wieder hatten sie ein Reh oder einen Elch oder sogar ein Wildschwein gefangen, und ein paar von ihnen machten sich dann mit ihren Dingern darüber her; sie hackten darauf ein und schlugen erstaunlich mühelos ein Bein oder ein Rippenstück heraus und lösten dann das Fleisch in langen Streifen ab, das sie nicht immer gleich verzehrten, sondern auf eine Art Zweiggerüst hingen, das sie zusammenbanden – es war wunderbar, ihnen zuzuschauen, ihre Hände und die Dinger, die sie hielten, so schnell und geschickt! – und dann über eine Grube oder ein Loch stellten, wo sie ein Feuer anhielten, nie hoch, aber nie verglühend zu rauchigem Nichts; hin und wieder warfen sie Stöckchen oder Dung hinein, sodass Funken und Flammen hochschossen, und dann flüchteten die Krähen.
Krähen, zumindest die von damals, waren sehr vorsichtige Vögel, die von Unvertrautem leicht beunruhigt wurden. Sie konnten sich keine Dinge vorstellen, wie man sie jetzt zweifelsohne kennt; aber Krähen sind auch nüchtern und praktisch veranlagt und würden sich (in der langen Beziehung, die dieser Schwarm gerade eben begann) als sehr anpassungsfähig erweisen. Es würde nicht lange dauern, bis die neuen Wesen und ihr Verhalten ihnen vertraut sein würden, und obwohl die klugen Tiere niemals die Angst vor Feuer und vor dem Geruch und den Geräuschen der Menschen verloren, hatten die Krähen bald nichts mehr dagegen. Sie hatten noch nie zuvor gesehen, wie Feuer kontrolliert wurde, selbst die wenigen, die überhaupt wussten, was es war, aber hier war es nun, und noch vor dem Ende des Winters jagte es ihnen keine Angst mehr ein; es wurde zum Teil der Dinge, wie sie eben waren. Und genau, die Wesen ließen immer viel zurück: verrottende Kadaver am Rand der Siedlung, Eingeweide, die sie verschmähten. Krähen kennen vielleicht keine Schwerter und Speere, aber sie kannten Innereien. Falls du dich traust, es zu holen, hatte das arrogante Krähenweibchen gesagt.
»Aber warum lassen sie ihre Vierbeiner an das Fleisch und nehmen es nicht selbst?«, fragte der Stromer in einer hungrigen, eisigen Woche Eichling, als sie den Abfallhügel begutachteten. »Das ist wirklich ärgerlich.«
»Frag ich mich auch«, erwiderte Eichling.
Sie beobachteten, wie die Vierbeiner miteinander rangen und sich wieder vertrugen, kleine und große, von unterschiedlicher Farbe und Gestalt. Ob man neben ihnen fressen konnte wie neben den Wölfen, die einem keinerlei Beachtung schenkten? Oder würden sie sich mit einem anlegen? Schwer zu sagen. Besser, man hielt sich von ihnen fern und pickte nur am Rand.
Sie sahen weitere Wesen ankommen, denen für Krähen unbekannte Tiere folgten, schwer und groß wie Elche, aber mit gedrungenem Hals und träge; die Zweibeiner stießen und zerrten sie und trieben sie in einer Herde von einer Stelle zur anderen, aber sie töteten und verzehrten sie nicht, und die Krähen fragten sich: Wer dient hier eigentlich wem? Dann kam noch etwas Neues, das unmöglich für jene zu beschreiben war, die es nicht gesehen hatten – selbst diejenigen, die aus den winterkahlen Bäumen auf die Siedlung herabschauten, schienen es nicht gänzlich zu erkennen. Die eine Krähe würde sagen: Es ist ein umgestürzter Baum, der einen Berg herabrollt, eine andere: Nein, es ist wie ein Reh, das von einem umstürzenden Baum getroffen wurde und versucht, sich zu befreien, und diejenigen, die sich weigerten, es anzusehen, zuckten mit den Achseln und flogen davon. Eichling wusste es nicht zu beschreiben, aber er erkannte deutlich, für was es bestimmt war, den Zweck: Ein großes, sanftes Tier vorneweg, das an einem hölzernen Gestell zog, welches hinter ihm herkam, die Zweibeiner zogen am Kopf des Tieres oder gaben ihm ab und zu einen sanften Klaps, wiederum mit einem ihrer allgegenwärtigen Stöcke. Aber alle wollten nur eins: etwas bewegen, das zu schwer zum Tragen war. Damit schichteten sie dicke Äste, Steine und anderes um, die sie aus irgendeinem Grund brauchten.