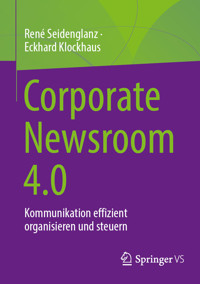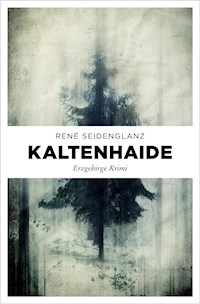
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jan und Sascha Berghaus
- Sprache: Deutsch
Authentisch, intensiv und hochspannend. Nachkriegszeit im Erzgebirge. Eine Lichtung im Wald, ein verwaister Geigenkasten – und darin ein menschliches Herz. Bald wird klar: In den Wäldern wütet ein Serienmörder. Über siebzig Jahre später taucht die damals verschwundene Geige wieder auf, und das abgelegene Bergdorf Kaltenhaide wird erneut von geheimnisvollen Morden erschüttert. Das Böse ist immer noch da, es war nie verschwunden. Außenseiterin Sascha Berghaus ist die Einzige, die das Geflecht aus Hass und Lügen durchdringen kann..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
René Seidenglanz, 1976 in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge geboren, ist Professor für Kommunikationsmanagement, studierter Publizist und Psychologe und promovierter Kommunikationswissenschaftler. Er leitet als Präsident eine Hochschule in Berlin. Nach dem Debüt »Toter Schacht« ist »Kaltenhaide« sein zweiter Kriminalroman aus dem Erzgebirge, in dem die beiden Hauptpersonen Sascha Berghaus und ihr Vater, der Professor Jan Berghaus, Geheimnisse aus der Vergangenheit und Verbrechen in der Gegenwart aufklären.
Nähere Informationen zur Buchreihe, zum Buch, zu den Handlungsorten und den historischen Hintergründen:
www.erzgebirgekrimi.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Am Romanende findet sich ein Personenverzeichnis.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Dirk Wustenhagen/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Karte: René Seidenglanz
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-781-1
Erzgebirge Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Meinem Großvater, Anton Tanzhaus(1919/Christophhammer – 2008/Grumbach, Erzg.),bei dem die Geschichte von Kaltenhaide beginnt
Und meiner Lebenspartnerin Danielle Zinn,mit der sich diese Geschichte wieder zusammenfügt
Teil I
Totes Herz
1. Elisabeth
7. April 1946
Sie wusste längst nicht mehr, wo sie war. Nur Nacht und die hohen Schatten von Bäumen ringsum. Tiefer Wald. Es ging talwärts, dann wieder bergauf. Wurzelwerk legte sich ihr in den Weg.
Immer weiter stapfte der Lange voran. Sie konnte kaum mit ihm Schritt halten. Immer weiter entfernte er sich von ihr. »Nicht so schnell!«, wollte sie ihm nachrufen, aber Rufen war verboten. Die Grenzposten könnten sie hören. Und die Grenze musste ganz nah sein. Sie durften auf keinen Fall entdeckt werden. Der Lange hatte ihr versichert, er wisse, wo die Grenzer Patrouille liefen. Deshalb diese verschlungenen Wege, deshalb der dunkle Steig. Ein Weg durch die Verborgenheit.
Die tschechischen Grenzposten durften sie auf keinen Fall entdecken. Sie würden ihr die Geigen wegnehmen, denn die Geigen waren verboten. Sie würden sie verhaften. Vielleicht würde sie in einem dunklen Verlies verschwinden, für lange Zeit. Vielleicht würden sie sie schlagen. Vielleicht würden sie sie anfassen. Vielleicht würden sie sie auch gleich umbringen. Es gab die schrecklichsten Geschichten darüber, was denjenigen passierte, die sie hier oben an der Grenze fassten. Beim Überqueren dieser unsichtbaren Linie mitten im Wald. Beim Schmuggeln.
Die Gestalt des Langen wurde undeutlich. Sein Schatten verschmolz mit dem Wald und mit der Nacht. Warte doch! Sie stolperte. Der Weg wurde noch steiler, ein Hohlweg, eingeschnitten in den Hang. Warte doch! Der Sack mit den Geigen drückte immer schwerer. Der Lange wurde noch schneller. Mit großen Schritten stapfte er durch das Unterholz. Dann rannte er, sprang zur Seite die Böschung hinauf, wurde endgültig zu einem undeutlichen Schatten.
»Warte!«, rief sie ihm nach. Doch sie erschrak sofort über das Echo ihrer Stimme. Leise sein! Die Grenzposten konnten sie hören. Erschrocken drehte sie sich um. Auch er blieb kurz stehen. Ganz kurz sah sie das Weiß seiner Augen im Dunkel aufleuchten. Dann war er zwischen den Bäumen verschwunden. Ohne ein Geräusch. Sie war jetzt auf einer kleinen Lichtung angekommen. Ob das schon die Grenze war? Direkt vor ihr baute sich eine Felsformation auf. Kannte sie diesen Ort? Wo war sie? Über ihr ein merkwürdig geformter Felsvorsprung. Wie der verzerrte Kopf eines Tieres. Ein Tierschädel, ein Schaf oder Widder mit nur einem Horn. Der Schatten des Felsens bildete sich vor dem Himmel ab.
Nein!
Sie kannte diesen Ort. Sie kannte diesen Felsen. Sie erkannte ihn wieder. Trotz der Dunkelheit … das konnte nur … das konnte nur … aber wenn es so war, dann hatte der Lange sie in die Irre geführt, dann war sie falsch. Das hier war nicht der Weg nach Kaltenhaide. Sie hätten diesen Hohlweg überhaupt nicht entlanggehen sollen … Was passierte hier? Warum?
Sie drehte sich wieder um, hektisch. Angst. Panik. Die Felsen direkt vor ihr. Dann ein Atem in ihrem Gesicht. War sie entdeckt worden?
Es war der Lange, der plötzlich direkt vor ihr stand. Sie sah, dass er grinste und dass seine Augen funkelten. Aber er war ganz still, er schien nicht einmal zu atmen. Dann spürte sie einen stechenden Schmerz, der ihre Eingeweide zerriss. Der Lange lächelte. Er hielt das große Messer hoch, betrachtete es und lächelte. Dann stach er noch einmal zu, in ihren Hals. Blut floss warm an ihr herunter. Er lächelte. Sie sackte langsam zusammen. Er schaute ihr nach und lächelte. Über ihr war noch das Stückchen Himmel, der Felsen, die Spitzen der Bäume. Dann verschwanden sie.
2. Federenko
Heute
Daniel Federenko versteht sein Geschäft. Er ist der Beste hier oben. Im ganzen Erzgebirge findet man keinen besseren Strafverteidiger, sagt man. Der Gerichtssaal ist sein Revier. Er hat alles geplant, und alles läuft wie geplant. »Gefährliche Körperverletzung«, damit kann man nicht spaßen. Seine Strategie ist einfach: Sascha hat einen Schaden. Darum geht es in der Verhandlung hier, quälend lange Stunden. Sascha hat einfach einen Schaden, eine Macke, sie ist irgendwie durchgedreht, und deshalb kann sie letztlich nichts dafür, dass sie nachts eine andere junge Frau von hinten überfallen, niedergeschlagen, in den Schnee gedrückt und noch ein paarmal mit ihren schweren Stiefeln gegen Magen, Brust und Kopf getreten hat. Das Opfer – sie heißt Cindy Kupfer – hat eine gebrochene Nase, einen angebrochenen Kiefer, zwei ausgeschlagene Zähne und Hämatome am ganzen Körper davongetragen. Der Angriff war absolut brutal.
Normalerweise fläzen sich in solchen Fällen stiernackige Glatzköpfe mit dicken Fäusten auf der Anklagebank. Doch heute sitzt nur ein schmales, blasses Mädchen neben Federenko. Die Tochter eines Professors – das ist ungewöhnlich. Und dann auch noch ihr Aussehen! Diese schwarze Kleidung, die schwarz gefärbten Haare, die dunkle Schminke im Gesicht, die Piercings in Lippe und Wange und diese Tätowierungen. Saschas linke Hand ist vollständig schwarz vom Handgelenk bis zu den Fingerkuppen, und auf dem Handrücken prangt ein gestochener Totenkopf. Weiter den linken Arm hinauf wachsen verwelkte Blüten und schwarze Ranken mit Dornen über Schulter und Hals hinauf und hinter den Ohren entlang, wo die Haare ausrasiert sind.
Sascha sieht die ganze Zeit nach unten und schweigt.
Sie soll auch nichts sagen. So hat es ihr Federenko befohlen. Sie redet viel zu leise. Sie stottert, wenn sie aufgeregt ist. Sie verhaspelt sich. Sie spricht ihre Sätze nicht zu Ende. Sie sieht ihr Gegenüber nicht an, wenn sie spricht. Das ist alles nicht gut, sagt Federenko. Das wirkt nicht glaubwürdig. Und im schlimmsten Fall sagt sie noch etwas Falsches. Deshalb ist es am besten, sie sagt gar nichts. Sie macht keine Aussage, sie macht überhaupt nichts. Wenn das Stillhalten zu schlimm wird, soll sie die Finger ganz fest zusammendrücken, sich auf ihre Hände konzentrieren. Zum Beispiel auf den Totenkopf auf ihrem Handrücken, funkelnde Brillanten in seinen Augenhöhlen. Der Totenkopf grinst.
Es gibt einen Zeugen, das ist immer schlecht. Dieser Zeuge heißt Benjamin Bräunig, und er ist vielleicht achtzehn oder neunzehn, vielleicht auch zwanzig Jahre alt. Er wirkt aber deutlich jünger. Sein fülliger, unbeholfener Körper, das leicht aufgedunsene Gesicht, nur dünner Flaum über dem Mund, wo bei Gleichaltrigen schon ein dunkler Schatten liegt, lassen ihn eher wie einen großen Jungen wirken. Benjamin Bräunig ist ein Freund von Cindy Kupfer. Besser: Er wäre gerne der Freund von Cindy Kupfer. Vor allem aber: Benjamin hat Sascha gesehen, als sie auf Cindy eindrosch. Er hat sie erkannt. Denn leider ist Sascha so schrecklich auffällig.
Außerdem gibt es noch den Abdruck der Stiefelsohle in Cindy Kupfers Gesicht. Alles war ganz blutig, die hart gefrorene Schneewehe rot bekleckert, Blutspritzer überall. Ein wenig von dem Blut klebte noch auf Saschas Stiefeln, obwohl sie sie geputzt hatte. Sogar mehrfach. Sie hing an diesen Stiefeln. Deshalb hatte sie viel Mühe darauf verwendet. Sascha hätte sie wegwerfen sollen! Hätte aber auch nicht viel gebracht. Sie war ja beobachtet worden. Und sie hatte ein Motiv.
Cindy, Benjamin und noch ein Dritter, sie hatten Sascha zuvor überfallen.
»Weil sie es verdient hat, die blöde Schlampe!«, schreit Cindy plötzlich auf, und ihre Zahnlücke wird sichtbar. Sie ist aufgestanden und stützt sich mit beiden Armen fest auf dem Tisch vor ihr ab. Ihr Anwalt, der Vertreter der Nebenklage, hustet auffällig.
»Wir hätten ihr die Scheißnase brechen sollen oder ihr hässliches Gesicht zerkratzen.«
Dieser Überfall hatte einen Grund. Es ging um den »Toten Schacht« und die Leichen, die man dort unten tief im Berg seinerzeit gefunden hatte. Saschas Vater, Jan Berghaus, hatte die Geschichte ausgegraben. Eine Geschichte, die in die siebziger Jahre und die DDR zurückreichte.
Der Großvater von Benjamin hing in der Sache drin. Er hatte Angst, entdeckt zu werden. Also schickte er seinen Enkel und dessen Clique vor. Sie sollten Sascha angreifen, stellvertretend für ihren Vater. Und die machten das gerne. Aber Sascha ließ sich nicht vertreiben. Am Ende hatte sie einen Mörder gefunden, jemand ganz anderen. Jemanden, der sich jahrzehntelang versteckt gehalten hatte. Und Sascha war von diesem Irren in aller Öffentlichkeit angegriffen worden, mitten auf der großen Bergparade, direkt auf dem Marktplatz der Stadt, zwischen Tausenden Einheimischen und Touristen. Federenko muss das nicht weiter ausführen, jeder hier kennt die Geschichte.
Sascha ist beobachtet worden, es gibt Beweise, und es gibt ein Motiv: Sascha hat irgendwann brutal zurückgeschlagen. Federenko glaubt ohnehin nicht, dass er Saschas Täterschaft widerlegen kann.
Deshalb ist es wichtig, dass Sascha einen Schaden hat. Federenko hat ein Gutachten anfertigen lassen. Der Gutachter hat Sascha einmal kurz gesehen. Eine Kapazität, sagt man, und genauso teuer sind die wenigen bedruckten Seiten, die er mit ausladendem Schwung unterschrieben hat. Das dramatische Ende dieser Geschichte um den »Toten Schacht«: Ein traumatisches Erlebnis sei das gewesen. Psychisch hoch belastend, zumal Sascha ohnehin hochlabil sei. Depression. Bipolare Störung. Autistische Züge. Einen ganzen Komplex von Schäden will er diagnostiziert haben.
Aber das ist nicht alles. Um zu belegen, dass Sascha einen Schaden hat, muss Federenko außerdem ihre Kindheit und ihre Jugend sezieren, und er seziert sie in diesem Saal und vor den Zuschauerreihen bis ins kleinste Detail. Überall finden sich Ursachen, die schließlich bis zu dieser gefährlichen Körperverletzung führten. Beide Eltern sind Professoren. Saschas Mutter ist Wirtschaftswissenschaftlerin, ihr Vater Soziologe, beide an großen Universitäten. Die Mutter, Nikola, ist eine international gefragte Expertin, die sich ihrer Karriere widmete und für ihre verschrobene Tochter nur wenig Interesse hatte. Die Eltern sind seit sieben Jahren geschieden (»Scheidungskind!«).
Auch Saschas Vater Jan habe sich nie wirklich um seine Tochter gekümmert. Ein Einzelgänger, der mit seinen Kollegen, seinen Nachbarn und eigentlich mit jedem in seiner Umgebung im Streit liegt. Er ist vor fast zwei Jahren in seine Geburtsstadt Annaberg im Erzgebirge zurückgekehrt. Er hat ein regionalgeschichtliches Magazin gegründet und schreibt darin über alte Erzählungen wie die vom »Toten Schacht«. Er hat die gemeinsame Wohnung in der Universitätsstadt verkauft. Sascha war zu der Zeit im Ausland. Als sie zurückkam, stand sie auf der Straße. Ihr Zimmer war weg, ihre Sachen irgendwo eingelagert. Berghaus kaufte sich ein altes Haus – ach was, eine Ruine – und versucht seitdem, sie wieder bewohnbar zu machen. Auch Sascha lebt jetzt dort. Auf einem staubigen Dachboden.
Quälend langsam wird die Anatomie von Saschas Seelenleben ausgebreitet, beleuchtet. Sascha starrt nach unten, drückt ihre Hände zusammen, sieht dem Totenkopf beim Grinsen zu.
»Mobbing«, sagt Federenko, als sich der Verhandlungstag dem Ende entgegenneigt. Das ist seine letzte Karte, und er ist sicher, diese Karte sticht. Er setzt ein ernstes Gesicht auf. Er atmet tief ein und sieht die Richterin an. »Was macht das mit jemandem, wenn er sein Leben lang gedemütigt wird?«
Wenn Federenko spricht, dann rollt er das »R« dramatisch und sagt »je« statt »e«. Man hört immer noch, dass er vor über zwanzig Jahren von der Wolga mit seiner russlanddeutschen Familie hierhergekommen ist.
Ellie Koppatz wird aufgerufen. Eine ehemalige Klassenkameradin von Sascha.
Mobbing.
Federenko sieht, wie Sascha anfängt zu zittern. Sie wollte das nicht. Sie hat ihn angefleht, Ellie nicht aufzurufen. Aber es muss sein. Es ist wichtig. Es ist ein zentraler Baustein.
Ellie berichtet freimütig darüber, wie die Klasse Sascha gequält hat.
Federenko findet Ellie großartig. Weil sie es ganz offen zugibt.
»Sie war halt immer so komisch … Klar war sie die Außenseiterin … Klar hat sie keiner gemocht … Alle haben sie gemieden … Es war leicht, auf ihr herumzutrampeln, weil sie allein war … Heute würde ich das nicht mehr machen. Damals waren wir halt alle noch nicht so erwachsen … Heute tut mir das natürlich sehr leid …« Ellie lächelt, schlägt schüchtern die langen Wimpern herunter, sieht hübsch aus, und alle im Saal haben Mitleid mit ihr.
Federenko triumphiert. Was zu beweisen war, denkt er. Sascha hat einen Schaden. Scheidungskind, vernachlässigt, gedemütigt. Jahrelanges Mobbing in der Schule. Keine Freunde, Zurückweisungen. Mobbing. Noch mal »Mobbing!«. Dann dieser Fall, Morde, die Presse berichtet. Sascha ein Opfer. Wieder Demütigung. Und zuletzt Cindy und ihre Clique, die Sascha überfallen haben. »Demütigung!«, ruft Federenko in den Saal. Es ist jetzt ganz still.
Sascha hat einen Schaden. Punkt.
Deshalb muss hier nach Jugendstrafrecht verhandelt werden. Punkt. Sascha ist unter einundzwanzig. Das ist viel günstiger für seine Mandantin. Im allgemeinen Strafrecht würde Sascha mindestens ein halbes Jahr für gefährliche Körperverletzung kriegen.
Federenko sieht die Richterin an und weiß, dass er sie auf seiner Seite hat. Sie ist mit ihm einig, dass Sascha in ihrer Entwicklung verzögert ist. Sie komme mit anderen einfach nicht klar, wisse nicht, wie man mit anderen umgehen müsse (Ansätze von Autismus!). Es fehle ihr hier eindeutig an (sozialer!) Reife. Die Jugendgerichtshilfe bestätigt das alles zum Abschluss noch einmal und empfiehlt die Anwendung des Jugendstrafrechts.
Federenko wischt sich fettige Strähnen von der Stirn.
Nur noch eine Sache fehlt, dann ist die Sache gelaufen.
3. Ein Schatten
7. April 1946
Ihr Blut war warm, und er kostete davon. Warm. Er hatte noch ein paarmal auf sie eingestochen. Etwas in ihr wehrte sich noch. Sie war noch nicht tot, aber ihr Körper wusste schon, dass es bald vorbei war. Sie röchelte, sie spuckte Blut aus. Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Er leckte seine Finger ab, an denen ihr Blut klebte, und sah ihr dabei zu, wie sie langsam starb. Ihr Atem wurde leiser, das Röcheln versiegte. Diese Verzweiflung, mit der sie sich ans Leben klammerte, während es vorüberging. Er beobachtete sie, wie sie ihn fixierte. Genoss die Gewissheit, dass er das Letzte sein würde, was sie in ihrem Leben sah.
Es war noch ein bisschen Atem da, ganz leise. Dann musste er seine Ohren ganz fest an ihre Lippen pressen. Ja, da war immer noch ein bisschen Leben. Die Augen immer noch aufgerissen, voller Entsetzen. Dieses Entsetzen würde das Letzte sein, was sie fühlte. Und er war das letzte Bild, der letzte Gedanke, das letzte Gefühl in ihrem Leben. Er hatte vollständig Besitz von ihr ergriffen. Er war jetzt ihr ganzes Leben. Sie gehörte ganz und gar ihm. Er lauschte noch eine Weile diesem leisen Atem. Dabei lächelte er und wurde ganz ruhig. Genoss diesen langen Moment.
Erst dann setzte er einen kräftigen Schnitt an ihrer Kehle an. Er schnitt so tief, dass er den Kopf beinahe vollständig vom Körper trennte. Das Blut schoss heraus, weil das verzweifelte Herz immer noch eine Weile weiterpumpte. Weil es sich immer noch gegen das Unvermeidliche wehrte.
Er lauschte. Der Wald war ganz still. Ihre Augen waren immer noch offen, das Entsetzen in ihrem Gesicht war für immer konserviert. Sie gehörte ihm. Ihm hatte ihr Leben gehört, und nun besaß er sie auch über den Tod hinaus.
Das Herz. Das wunderbare Herz. Wie es seine letzten verzweifelten Schläge tat. Dein Herz. Nur ein paar Schläge noch, dann endlich war es stumm.
Er knüpfte ihre Bluse auf, betrachtete ihre Brüste, die voller Einstiche waren. Dabei erlebte er jeden dieser Stiche noch einmal. Jeden Stich in ihr volles, wohlgeformtes Fleisch, mit dem er ihr Stück für Stück das Leben nahm. Er atmete schwer und heftig. Gab sich dem Hochgefühl hin. Strich mit seinen Fingern über ihren entblößten Oberkörper. Überall war Blut, immer noch warm. Er kostete davon. Er kostete von ihr. Nach und nach wurde sie sein.
Dann nahm er ein großes Messer und öffnete ihre Brust. Hebelte mit dem Messer eine Rippe auf, die ihr Herz schützte. Schnitt den Herzbeutel auf. Griff in sie hinein und hob ihr Herz vorsichtig heraus. Mit dem Messer trennte er die Venen, die Arterie und die Aorta ab. Er ging präzise vor, behände, zügig. Jeden dieser Handgriffe hatte er schon so unzählige Male durchgeführt. Er schnitt das Herz aus ihrem Körper heraus. So wie er es schon unzählige Male zuvor getan hatte. Umfasste es mit beiden Händen und hob es empor. Ein gewaltiger Strom von Glück und Macht durchfloss ihn.
Er nahm sie jetzt vollständig in Besitz.
»Du bist mein. Ich habe dein Leben. Ich habe deinen Tod. Ich habe deinen Körper. Ich habe dein Herz. Und jetzt habe ich auch deine Ewigkeit. Du gehörst für immer mir.«
4. Sascha
Pause. Die Verhandlung wird in einer Stunde fortgesetzt.
Federenko hat Sascha seine Packung Zigarillos überlassen. Sascha saugt Rauch ein, kaut auf der schweren Tabakwolke herum, schluckt sie herunter. Ihre Finger sind ganz taub, das ganze Blut ist inzwischen aus ihnen gewichen, so fest hat sie die ganze Zeit zugedrückt. Sie zittert immer noch.
»Demütigung.« Wenn sie vorher keinen Schaden hatte, dann hat sie jetzt einen, denkt Sascha. Alles ist wieder da. Alles, woran sie nie wieder denken wollte. Einfach nicht mehr daran denken.
Nur Federenko triumphiert und klopft ihr vertraut auf die Schulter. »Läuft«, säuselt er, grinst und verschwindet auf der Toilette am Ende des Flurs.
Nicht mehr daran denken, nur ein bisschen durchdrehen. Diese Cindy verprügeln und sich gut dabei fühlen. Diese Cindy hassen. Sie zusammenschlagen. Sich gut dabei fühlen. Das war alles.
Stattdessen musste sie alles noch einmal durchexerzieren, was Federenko als die wesentlichen Stationen ihres verpfuschten Lebens betrachtete. »Strategie«, sagte er. »Die Strafe maximal reduzieren.« »Läuft!« Sascha fragt sich, ob das hier nicht die viel schlimmere Strafe ist.
Ellie wiederzusehen, das war das Schlimmste. Sascha zittert. Sascha hat Ellie zwei Jahre nicht gesehen – seit sie Abitur gemacht hat, und trotzdem zittert sie noch. Ellie war der Fixpunkt. Ellie hat die anderen angestachelt. Ellie hat gesagt: »Jeder hier hasst dich.« Ellie hat gesagt: »Warum bringst du dich nicht einfach um?« Ellie hat gesagt: »Dann machen wir Party hier und kotzen auf deinen leeren Stuhl.« Sascha hat nie verstanden, warum. Sie hat es nur ertragen, all die Jahre. Und jetzt soll gerade das ihr nutzen?
Plötzlich steht Ellie vor ihr. Und dann lächelt sie auch noch, mustert sie. »Das ist ja schön, dich zu sehen«, säuselt sie. »Du siehst anders aus.« Und dann: »Ich wusste ja gar nicht, dass … dass es dir so schlecht ging, damals … dass es dir so schlecht geht.« Sie probiert eine mitfühlende Miene, dann wendet sie sich ab, tippt etwas in ihr Smartphone und grinst.
Sascha zittert, und das ist das Allerschlimmste.
Weil sie wieder schwach ist.
Weil die Zeit nicht geholfen hat. Weil die ganze Zeit seit damals umsonst vergangen ist. Weil ihre Verwandlung in etwas anderes, ihre Tarnung unter all der schwarzen Farbe – weil das alles nichts geholfen hat.
Weil Cindy zusammenzuschlagen nichts bewirkt hat.
Weil sie immer noch zittert, wenn Ellie ihr gegenübersteht.
Weil all die Demütigungen wieder da sind.
Sascha pustet Rauch aus. Auf dem Flur vor dem Verhandlungsraum vermischen sich Anwälte, Zeugen und Angeklagte. Gäste schnattern. Der Flur ist eine lange Halle mit den hohen Fenstern eines Fabrikgebäudes. Blau gestrichene, rissig gewordene Türen führen in die einzelnen Verhandlungsräume.
»Kann ich eine schnorren?«, fragt jemand anders. Sascha saugt noch einmal Rauch ein. Sie dreht sich langsam um. Dort steht ein unglaublich dürrer Junge mit eingefallenem, grauem Gesicht. Er ist kaum älter als Sascha, aber er sieht älter aus, verbraucht. Sascha hält ihm Federenkos Zigarillopackung hin, er zieht sich hastig einen heraus, so als hätte er Angst, sie könne es sich doch noch anders überlegen. Er lässt das Feuerzeug aufblitzen und steckt den Zigarillo hastig in seinen Mund. Dann hustet er. »Boah, die sind stark.« Auf seinem Handgelenk klebt ein unglaublich schlecht gestochenes Tattoo, eine grüne Schlange oder ein Wurm mit Hütchen. Die Farben sind verwischt, ausgewaschen. »Hab ich selbst gemacht«, sagt er stolz.
»Hm.«
»Und du?« Er tippt auf Saschas Handrücken.
»Hab ich mir in den USA stechen lassen.«
»Echt? Angeberin!«
»Ist aber so.«
»Hm. Zeig mal.« Er schiebt ihren Ärmel etwas hoch, dort, wo der Arm vollkommen schwarz von Farbe überzogen ist, dann zupft er an ihrem Kragen, wo die schwarze Fläche in Mustern ausläuft und seitlich den Hals hinaufwandert. »Krass!«
»Lass das!«
»Schon gut. Schon gut. Trotzdem krass.«
»Hm.«
»Tommy«, sagt er und hält ihr die Hand hin.
»Sascha«, sagt Sascha und zieht an ihrem Zigarillo.
»Hab Crystal geschmuggelt, von den Tschechen über die Grenze rüber. Haben mich erwischt. Scheiße. Ich hätte es mir irgendwo reinstecken sollen. In den Arsch oder so. Hatte ich aber Schiss davor, wenn das Zeug platzt oder so. Ist ’ner Freundin von mir passiert. Scheiße, so was. Hammse mich erwischt, gleich hinter der Grenze. Zum Glück hatte ich da nicht so viel dabei. Bin gerade drei Schritte hüben gewesen. Da standense.«
»Okay.«
»Und du?«
»Und ich?«
»Na, weswegen bist du hier?«
»Gefährliche Körperverletzung.«
Tommy sieht das schmale Mädchen verwundert an. »Krass!«, sagt er anerkennend.
»Alexandra Berghaus« wird aufgerufen. »Das bin ich«, sagt Sascha. »Alexandra« sagt sonst nur ihre Mutter zu ihr. Ihre Mutter mag die Koseform Sascha nicht. Sascha kann den Namen Alexandra nicht ausstehen. Sie kann ihre Mutter nicht ausstehen.
Nur noch eine Sache muss Sascha gleich tun. Federenko hat ihr jedes Wort genau eingeschärft. Sie muss sich selbst demütigen. Sascha schnipst den abgebrannten Zigarillo weg. Ihre Hände zittern.
5. Ein Besucher
8. April 1946
Als die Morgendämmerung kam, war alles längst vergangen, was sich nachts auf der Lichtung unter der Felsformation abgespielt hatte. Es war ein eiliger Besucher, der jetzt die kleine Lichtung überquerte. Die Dämmerung war gefährlich, man konnte ihn entdecken. Der Besucher auf der Lichtung war ebenfalls jemand von denen, die über die Grenze hinüber nach Sachsen, nach Kaltenhaide wollten, die ein Bündel auf dem Rücken trugen mit Dingen, die ihnen einst gehörten, Dingen, die sie zurücklassen mussten und die herüberzuholen streng verboten war.
Alles war in Auflösung in dieser Zeit, der ganze Wald und die ganze Nacht waren voller schwarzer Gestalten mit Bündeln auf dem Rücken. Oben an der Grenze liefen sie Patrouille. Er war fast schon zu spät. Die Dämmerung brach an. Ein Eichelhäher schreckte über ihm auf und flog laut krächzend davon. Es schallte durch den ganzen Wald bis hinüber auf die andere Talseite. Vor allem: Es schallte bis hinüber zur Grenze. Verflucht, dachte er, und seine Angst davor, es nicht mehr auf die andere Seite zu schaffen, wuchs. Er war viel zu spät, es hatte alles zu lange gedauert heute Nacht. Er war dem Pfad gefolgt, der hinauf zur Grenze führte. Auf einer kleinen Lichtung blieb er stehen. Er hatte eigentlich keine Zeit, stehen zu bleiben, aber der eilige Marsch den Berg hinauf hatte ihm die Kraft geraubt und den Atem. Er musste einfach kurz haltmachen, Atem holen. Er stützte sich ab und sah sich um. In der Mitte der Lichtung war ein Baumstumpf, auf dem etwas lag. Er trat näher heran, immer noch schwer atmend. Es war eine dunkle Kiste, ein Kasten. Es war ein Geigenkasten. Der Eichelhäher krächzte wieder. Der Besucher auf der Lichtung erschrak erneut. War da noch jemand? Die Dämmerung, er musste weiter. Er brauchte nur noch einen kurzen Atemzug.
Er war viel zu spät heute. Die Dämmerung brach schon an. Doch in der Stadt vorhin war es stockdunkel, kein Licht brannte dort. Er musste sich bis hinunter zu seinem Haus vorantasten. Das war ungewohnt. Obwohl er glaubte, jede Straße zu kennen, hatte er sich verlaufen. Denn die Stadt Preßnitz war fast völlig verlassen. Fast alle Einwohner waren vertrieben worden. Sein Haus war verschlossen, jemand hatte einen schweren Riegel an der Tür angebracht. Denn es war ja nicht mehr sein Haus. Sie hatten es ihm weggenommen, und er durfte nicht mehr zurück. Die Fenster waren vernagelt, sie waren gründlich gewesen. Er musste über den Hof, die Hintertür eintreten, nur nicht zu laut. Tschechische Grenzposten und Polizei konnten noch irgendwo sein. Drinnen war alles durcheinander, alle Schränke waren aufgebrochen, die Regale zerwühlt. Alles, was er im Schein einer Kerze sehen konnte, war Durcheinander. Er hatte eilig ein paar Sachen zusammengerafft, er wählte nicht aus. Eine teure Spitzendecke, Erbstück seiner Mutter, ein paar Bücher, das Jesusgemälde aus dem Flur, das seine Frau so liebte. Mehr fand er nicht wieder.
Doch schon jetzt war es zu spät. Die Dämmerung brach an.
Das Bündel mit Hausrat drückte schwer auf seinen Rücken. Der Besucher trat noch etwas näher heran und betrachtete den Geigenkasten. Es war ein sehr fein gearbeiteter Kasten und gleichzeitig stabil. Er war für eine teure Geige gemacht. Der Besucher öffnete ihn sorgfältig und schaute ins Innere. Das Innere war voller Blut. Es füllte den gesamten Boden des Kastens aus. Und in dem Blut lag ein Klumpen aus Fleisch. Es war ein Herz, ein menschliches Herz. Der Besucher tastete ungläubig. Das Herz war noch warm. Es hatte vor Kurzem noch geschlagen. Jetzt erst erschrak er.
Er sprang entsetzt zurück. Er drehte sich panisch um. Fort hier! Nur fort! Er stolperte. Der Eichelhäher krächzte und verriet, dass noch jemand ganz in der Nähe war. Fort hier! Er musste über die Grenze, schnell, bevor es noch heller wurde und die Grenzposten ihn entdeckten. Er packte sein Bündel. Er zitterte vor Entsetzen. Doch er musste weiter. Fort! Und er musste das hier vergessen, schnell. Er durfte nicht mehr daran denken, dass hier mitten im Wald auf einem Baumstumpf ein Geigenkasten lag – mit einem Herzen darin, das man jemandem eben erst herausgeschnitten hatte.
6. Berghaus
»Ich komme wegen der Geige!«, sagt die junge Frau mit fester Stimme. Trotzdem versteht Jan Berghaus sie kaum.
»Was für eine Geige?«, ruft er aufgebracht. Er hat keine Zeit für so was. Für Besuch.
Es ist laut um ihn herum. Das ganze Haus dröhnt. Im Keller wird gebohrt. Es geht um die Wasserrohre, alles verschlissen. Muss raus. So hat es ein gelangweilter Bauleiter gesagt, auf die Uhr gesehen, weil noch eine andere Baustelle wartet. Seitdem bohren sie, schlagen die Wände auf. Überall ist Staub. Ein junger, dicker Lehrling mit feistem, schweißnassem Gesicht schleppt die alten, verrosteten Rohre mühsam aus dem Keller herauf. Er wirft sie achtlos in den Flur. Die wenigen altertümlichen Fliesen auf dem Boden, die noch nicht zerbrochen waren, zerbrechen. Berghaus dreht sich um, schreit in das schwitzende Gesicht, das keine Miene verzieht. Dann schreit er in das Gesicht desjenigen, der heute die Aufsicht hat. Der sieht ihn unbeeindruckt an und sagt, dass die alten Fliesen doch sowieso rausmüssen.
»Nein, müssen sie nicht!«, schreit Berghaus. Der andere zuckt mit den Schultern und beißt in eine Käsestulle.
Die junge Frau bleibt ungerührt stehen und setzt noch einmal an: »Wir waren verabredet«, sagt sie. »Martha«, sagt sie, »Martha König.«
»Davon weiß ich nichts!«, ruft Berghaus aufgebracht. »Ich bin nicht verabredet. Sie sehen doch, was hier für ein Chaos herrscht.«
Sie stehen im Türrahmen im Staub. Von unten setzt erneut ein lautes Bohren ein.
Seit beinahe zwei Jahren ist das Haus eine Baustelle. Nur ein einziges Mal in seinem Leben hat Berghaus etwas Unüberlegtes getan. Abstand zum Universitätsbetrieb gewinnen, zu den Eifrigen, zu den Teamplayern, die sich plötzlich dort vermehrten. Hierherziehen. Ein Magazin über die Geschichte der Region herausgeben. Ein Arbeitszimmer oben einrichten, mit Blick auf den Garten, in dem eine große Linde steht. So dachte er es sich. Und stattdessen? Das Haus ist eine einzige schmutzige Baustelle. Das Magazin hat nur ein einziges Mal eine größere Leserschaft erreicht, als es um den Leichenfund im »Toten Schacht« ging. Doch der Preis dafür war gewesen, dass ihn jemand hier im Haus überfallen hatte, dass er sich lächerlich gemacht hatte in der Stadt und am Ende zusammengebrochen und im Krankenhaus gelandet war.
Jetzt ist Berghaus krankgeschrieben und wehrt die Versuche seiner Ärzte, daran etwas zu ändern, konsequent ab. Eine neue Ausgabe des »Gebirgsboten« gab es seitdem nicht mehr. Berghaus hat ein paar halbherzige Recherchen angestellt – besser gesagt: Sascha hat recherchiert und Texte entworfen. Er hat sie dann in ein paar Ordnern oben im Wohnzimmer abgelegt, dem einzigen Raum im Haus, in dem der Staub nicht millimeterhoch liegt. Sie müssten nur sortiert werden. Aber er verzettelt sich. Er sieht die Struktur nicht, die all diesen Unterlagen innewohnt.
Strukturen sehen, das ist das, was Berghaus sein ganzes Leben lang getan hat. Strukturen in der Gesellschaft, das war sein Job als Professor. Darüber hat er irgendwann einmal promoviert, Muster, Zusammenhänge. »Systemtheorie« nennt sich das. Eine Lehre der Ordnung. Eine Lehre, die alles Menschliche und Individuelle am liebsten ganz hinwegdefinieren würde. Doch Berghaus hat schon lange nichts mehr publiziert. Bei diesem Fall um den »Toten Schacht« sind seine Strukturen gescheitert. Er ist einfach zu keinem Ergebnis gekommen. Die Muster versagten in einem Durcheinander von menschlichem Kram: Gefühlen wie Hass, Verlust oder sogar Liebe. Seitdem hat Berghaus nichts mehr geschrieben. Seitdem verstauben seine lustlos zusammengetragenen Akten. Seitdem lässt er seine Krankenscheine immer wieder verlängern und wehrt Versuche der Universität ab, ihn irgendwie wieder in den Lehrbetrieb zu integrieren.
Stattdessen bewacht er ein Haus mit Gewölben aus dem 16. Jahrhundert und Keramikfliesen aus dem späten 19. Jahrhundert, die gerade zerschlagen werden. Nur ein einziges Mal in seinem Leben hat Berghaus etwas Unüberlegtes getan. Dieses Haus zu kaufen war der Ursprung von all dem Chaos. Das Dach ist undicht, der Putz bröckelt, die Wände sind feucht, die Fenster sind undicht, die Wasserleitungen verstopft.
»Abreißen und neu bauen«, sagt der Bauleiter ungerührt und beißt noch mal in seine Käsestulle. Das Haus ist ein einziges Chaos.
Eine gelbe Katze schlüpft von draußen ins Haus, Lola aus der Hausnummer fünf, das weiß Berghaus inzwischen. Der Lärm scheint sie nicht zu stören. Sie schleicht regelmäßig ins Haus, macht ihr Geschäft in einer Ecke im Flur und spaziert wieder hinaus. Berghaus hat aufgegeben, das Tier immer wieder zu vertreiben. Sie weicht jedes Mal ungerührt seinen Fußtritten aus und ist am nächsten Tag wieder da. Zu allen anderen unangenehmen Gerüchen im Haus gesellt sich deshalb auch noch der von Katzendreck.
Der Dicke kommt wieder aus dem Keller, er bleibt auf der obersten Stufe stehen und schnauft. Diesmal hat er irgendein über und über mit Rost überwuchertes Ventil in der Hand.
»Wagen Sie es nicht!«, schreit Berghaus, doch der Dicke lässt das Teil vor Schreck auf die Fliesen fallen. Es scheppert, und der Fußboden zerbricht. »Raus!«, schreit Berghaus. »Ich will Sie hier nicht mehr sehen!«
»Moment mal!«, ruft der Bauleiter und schluckt den Bissen seiner Stulle hinunter. »So geht das aber nicht.«
»Doch, so geht das! Das ist mein Haus. Und der geht jetzt. Der ist zu blöd für jeden Handgriff.«
»Aber ich habe hier die Aufsicht.«
»Sie sind zu blöd, hier die Aufsicht zu führen! Haben Sie überhaupt irgendeine Ahnung von dem, was Sie hier tun? Oder sind Sie einfach nur irgendein Stümper, der mir für den ganzen Pfusch hier das Geld aus der Tasche zieht?«
»So nicht!«, ruft der andere und wedelt mit dem Zeigefinger.
Berghaus schüttelt den Kopf, packt den Dicken, zerrt ihn an seinem Chef vorbei nach draußen und versetzt ihm einen Tritt.
Die junge Frau sieht dem Ganzen aufmerksam zu. Sie steht immer noch da. Sie sieht zu, wie der Dicke an die gegenüberliegende Wand prallt.
»Sie stehen ja immer noch da!«, blafft Berghaus sie an.
»Ja. Weil wir verabredet waren!«
Berghaus ist gerade überzeugt davon, dass niemand so wenig in diesen staubigen Hausflur passt wie diese junge Frau. Martha König sieht wie eine russische Prinzessin aus – oder eine Figur aus einem Film. »Doktor Schiwago« vielleicht – wo es zarte Frauen mit großen Gesten, Pelzmützen und weit schwingenden Mänteln gibt. Auch Martha König trägt eine Kappe aus Pelz, aus der ein langer geflochtener Zopf brauner Haare herausfällt. Sie hat einen Rock aus schwerem, dunklem Stoff an und braune Stiefel mit Absätzen. Unter dem langen Mantel mit Pelzkragen schaut eine weiße Rüschenbluse hervor, die am Hals mit einer dünnen schwarzen Schleife lose zusammengebunden ist. Nur die eigenartige Tasche aus blauem Funktionsstoff, die sie sich auf den Rücken geschnallt hat, passt nicht zur ihrem mondänen Auftritt.
Die Geige! Martha König hat recht. Sie sind verabredet.
»Na schön. Kommen Sie!«, sagt er immer noch unwirsch.
Er steigt hinauf ins Wohnzimmer und bedeutet ihr, ihm zu folgen. Oben ist es nur wenig leiser als im Flur. Die Bohrgeräusche dringen durch alle Wände. Berghaus wirft sich in einen der Sessel. Martha König bleibt unsicher mitten im Raum stehen. Sie knöpft ihren Mantel auf. Dann nimmt sie den Rucksack herunter, zieht den Reißverschluss auf und holt vorsichtig eine Geige heraus.
»Ich habe noch gar keinen richtigen Geigenkasten«, entschuldigt sie sich. »Sie war ein Geschenk meines Bruders Nathan.«
»Happy Birthday, kleine Schwester«, steht auf der Karte, auf der ein großer Notenschlüssel und eine »20« prangen.
»Aha«, sagt Berghaus und schaut an ihr vorbei. Die Wände vibrieren. Ob der dicke Lehrling zurückgekommen ist?
»Nathan ist … Er ist vor zwei Wochen gestorben. Er hatte einen Unfall mit seinem Wagen. Von der Straße abgekommen, oben an der Grenze, in der Nähe von Kaltenhaide. Er hat dort oben in einem Ferienhaus gelebt, das meiner Familie gehört …«
»Oh!«, sagt Berghaus teilnahmslos. »Das ist traurig.«
»Es ist eine Hellmer«, sagt Martha und zeigt auf die Geige. »Johann Georg Hellmer, Prag, aus einer böhmischen Geigenbauerdynastie. Vielleicht aber auch eine wirklich gute Kopie, etwa um 1900. Aber in jedem Fall ist sie wunderschön gearbeitet. Mitteljährige Fichte, geflammter Ahorn, der braune Öllack, sehen Sie, wie edel das wirkt. Und das hier ist etwas ganz Besonderes, hier, an der Rückwand, dieses durchgehende Loch für die A-Saite. Das ist ganz typisch für Hellmer …«
Berghaus versteht nicht, was sie sagt. Was will sie denn?
»Ist so was denn teuer?«
»Wenn es ein Original ist, eine original Hellmer aus dem 18. Jahrhundert, aus Prag, dann kann sie fünfzigtausend Euro wert sein. Vielleicht auch mehr. Und selbst wenn es nur eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert ist, bezahlt man sicher auch sechstausend, achttausend oder gar zehntausend dafür.«
»Dann sollten Sie einen Fachmann fragen, der die Geige untersucht. Dann wissen Sie, ob sie wirklich so wertvoll ist.« Was will sie denn von ihm?
»Sollte ich«, sagt sie nachdenklich. »Aber darum geht es nicht.«
Unten an der Tür poltert es. Sascha steigt die Stufen hinauf, die unter ihren schweren Stiefeln knarren.
»Und?«, fragt Berghaus.
»Geht schon«, knurrt Sascha.
Berghaus versucht, ihr Gesicht zu lesen, aber das kann er nicht.
»Gefährliche Körperverletzung. Muss aber nur Sozialstunden machen und Therapie.«
»Hm«, sagt Berghaus.
»Federenko behauptet, er hätte auch einen Freispruch herausgeholt. Aber dafür hätte ich mich entschuldigen müssen.«
»Entschuldigen?«
»Ja, bei Cindy Kupfer.«
»Aha.«
»Aber ich entschuldige mich nicht«, sagt Sascha mit fester Stimme. »Es tut mir nicht leid, was ich getan habe. Sie hat mich angegriffen und ich habe mich gerächt. Endlich habe ich auch mal zurückgeschlagen. Und das tut richtig gut. Cindy Kupfer mit dem zerschlagenen Gesicht und der Zahnlücke. Hoffentlich bleibt sie hässlich. Hoffentlich bleibt sie für immer ein Freak!«
Martha König hört Sascha mit zunehmendem Entsetzen zu.
»Aber du bist trotzdem nur zu Sozialstunden verurteilt worden?«, fragt Berghaus.
»Ja, weil ich ja offensichtlich einen Schaden habe.«
»Hm.«
Sascha wirft sich in den abgewetzten Sessel, der Berghaus gegenübersteht, und zündet sich einen erloschenen Zigarillostummel aus Federenkos Packung an. Erst jetzt merkt sie, dass Besuch da ist.
Martha sieht Sascha entsetzt an.
»Das ist ja hübsch!«, sagt Sascha und weist mit dem angekokelten Zigarillo auf Marthas Rüschenbluse und die schwarze Schleife. Sie pustet einen Schwall Rauch in Marthas Richtung. Martha hustet und dreht sich angeekelt weg.
»Also es geht um die Geige«, wiederholt Martha, bemüht, sich auf Berghaus zu konzentrieren und Sascha zu ignorieren.
Das sagte sie schon. Der Bohrer setzt wieder an. Sascha sieht müde aus, denkt Berghaus. Dann sieht er Martha an und hört den Bohrer und weiß schon, dass ihm gleich alles wieder zu viel wird. Zu viel Geräusch! Zu viel Information. Sascha sieht müde aus. Oder traurig? Oder irgendwie erstarrt? Gefasst? Trotzig? Das ist schwer. Wie war das? Sozialstunden? Therapie? Er sollte sie fragen, aber da steht noch diese russische Prinzessin mitten im Raum. Berghaus dreht ungeduldig die Daumen ineinander. Die Sache mit ihrem Bruder. Natürlich. Er sollte jetzt irgendetwas Mitfühlendes sagen oder wenigstens so tun. Wenigstens mitleidig dreinschauen. Berghaus entscheidet sich für Letzteres. Doch sein Gesicht verformt sich nur zu einer eigenartig schiefen, eingefrorenen Grimasse.
Unten fällt wieder etwas Metallisches zu Boden, aber Berghaus bleibt sitzen und konzentriert sich auf seinen Gesichtsausdruck. Sozialstunden. Geige. Zu viele Informationen gleichzeitig.
Martha König studiert seit einem Jahr Musik in Leipzig. Sie stammt aus einer Musikerfamilie, Musiker seit mehreren Generationen. Orchestermusiker, reisende Musiker, Sologeiger, Alleinunterhalter, Musiklehrer, Kapellmeister. Nur ihr Vater und ihr Großvater waren aus der Art geschlagen und Steuerberater geworden. Die Geige war in Familienbesitz. Auch das ist noch nichts Besonderes. Die Geige gehörte einer Großtante, der Schwester von Marthas Großvater. Sie hieß Elisabeth König. Die Familie lebte jenseits der Grenze auf der böhmischen Seite des Erzgebirges. Dort gab es eine Stadt namens Preßnitz, die berühmt war für ihre Musiktradition, für ihre Damenkapellen, die in ganz Europa herumreisten, für ihre Musikschule, die irgendwann einmal auch von einem Direktor mit Namen König geleitet wurde. Die Stadt gibt es heute nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden fast alle Einwohner vertrieben. Später wurde die Stadt abgerissen. Heute ist dort nur noch ein riesiger Stausee. Martha hat ein Foto von Elisabeth. Martha sieht ihr ähnlich, oder vielleicht will sie ihr ähnlich sehen. Eine groß gewachsene Frau mit Pelzkappe, aus der ein langer, dicker Zopf heraushängt. Stolz hält sie eine Geige unter das Kinn geklemmt und wirft sich in Pose.
»Sehen Sie …« Martha tippt auf das Bild. »Es ist ihre Geige. Diese besondere Form. Und dann ist da noch etwas. Als sie noch ganz klein war, hat meine Großtante ihren Namen eingeritzt, winzig klein, aber man kann ihn lesen. ›Elisabeth‹ in einer krakeligen Kinderschrift.«
Berghaus sieht nur halb hin. Estrich, denkt er stattdessen. »Estrich neu und die alten Fliesen im Flur rausreißen.« So hatte es der Bauleiter vorgeschlagen. Was ist mit Sascha? Er hat einfach keine Nerven dazu, sich Geschichten von einer alten Geige anzuhören.
»Frau König«, setzt Berghaus an. »Das ist ja alles irgendwie … Und das mit Ihrem Bruder tut mir natürlich leid, aber was –«
»Sie haben doch dieses Magazin, das sich mit Geschichte beschäftigt. Ich habe diese Geschichte über das Liebespaar gelesen, die man im ›Toten Schacht‹ gefunden hat.«
»Na ja, schon. Zurzeit kümmert sich vor allem meine Tochter um das Redaktionelle.«
»Oh«, sagt Martha und sieht Sascha abfällig an. Dann streichelt sie die Geige. »Ich dachte, Sie könnten sich die Geschichte einmal ansehen.«
»Die Geschichte der Geige?«
»Nach dem Krieg, 1945 und 1946, da sind sie alle vertrieben worden. Sie mussten binnen eines Tages ihre Häuser und das Land verlassen. Sudetendeutsche. Sie durften nichts mitnehmen. Nicht einmal die Geigen …«
Berghaus wird ungeduldig. Er verliert die Fassung. »Frau König, ich verstehe noch immer nicht, was wir damit zu tun haben. Sudentendeutsche, Vertreibung. Darüber ist hundertfach – ach, was sage ich –, tausendfach geschrieben worden. Schauen Sie nur mal ins Internet. Jedes ehemalige Dorf hat dort eine eigene Homepage, auf der Sie alte Fotos finden, Geschichten. Das ist doch auserzählt. Außerdem lebt doch heute kaum noch einer der Vertriebenen. Das interessiert doch keinen mehr.«
Martha sieht ihn enttäuscht an. »Sie sind damals verschwunden.«
»Wer?«
»Elisabeth und die Geige. Die Leute durften ja nichts mitnehmen. Elisabeth wollte die Geigen ihrer Familie nachts über die Grenze schmuggeln. Sie wollte sie auf keinen Fall dort lassen. In dieser Nacht sind sie verschwunden – Elisabeth und die Geigen. Man hat nach ihr gesucht, nichts. Spurlos verschwunden. Und jetzt taucht auf einmal diese Geige wieder auf. Nach über siebzig Jahren.«
»Wo hat dein Bruder denn die Geige gefunden?« Saschas Zigarillo ist abgebrannt. Im Wohnzimmer ist Nebel.
Martha sieht Sascha misstrauisch an, sie hustet noch einmal, bevor sie antwortet. »Ich weiß es nicht. Die Geige lag in seiner Wohnung, mit dieser Karte. Es sollte eine Überraschung sein, und das war es auch. Keiner von uns weiß, woher er die Geige hat. Keiner weiß, wo sie die ganze Zeit gewesen ist. Jetzt ist er tot, und ich kann ihn nicht mehr fragen …« Tränen rinnen über Marthas Wangen. Sie sucht nach einem Taschentuch.
Berghaus schaut seine Tochter ratlos an. Das überfordert ihn. Saschas Hände zittern ein bisschen, weil der Zigarillostummel viel zu kurz war, und sie hat immer noch keine neuen Zigaretten. Sie antwortet ihm mit einem ebenso ratlosen Blick.
»Haben Sie vielleicht ein Taschentuch?«, fragt Martha schließlich, als ihre Wangen schon ganz nass sind und ihr Mascara verläuft. Berghaus sieht sich umständlich im Wohnzimmer um und schüttelt dann bedauernd den Kopf.
»Ich dachte einfach«, schnieft Martha, »man könnte mehr über sie herausfinden, vielleicht sogar ihre Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, als Andenken an Elisabeth und an meinen Bruder. Ich habe Ihr Magazin gesehen, und ich dachte … Vielleicht wenigstens das …« Dann bricht alles aus ihr heraus. Tränen laufen. Farbstriemen laufen über ihr Gesicht. Sie wischt Tränenwasser mit dem Handrücken weg. Tränenwasser mit Make-up tropft auf ihre Rüschenbluse. Umständlich packt sie die Geige wieder ein. Dann dreht sie sich um und geht.
Der Bohrer setzt aus. Plötzlich ist es ganz still im Haus.
7. Sascha
»Und, wie geht es dir jetzt?«, fragt Berghaus und sieht kurz in die Richtung, in die Martha verschwunden ist.
»Geht schon. Es war ja Federenkos Strategie«, flüstert Sascha.
»Also hat es funktioniert.«
»Ja, hat großartig funktioniert. Ganz großartig.«
Sascha ist aufgestanden. Sie geht nach draußen und dann die Treppe nach oben. Sascha reißt den Verschlag zum Dachboden auf. Sie läuft hinein, an all den Sachen vorbei, die ihr gehören. Der Dachboden, auf dem sie lebt und auf dem sie sich verkriecht. Wo sie sich sicher fühlt, weil dort ihre Amulette hängen, ihre Sammlung toter Dinge. Staubflocken springen hoch und tanzen im Licht, das durch die Dachluken fällt. Eine ausgestopfte Krähe baumelt von der Decke, ihre Federn sind zerzaust. Ein paar Totenköpfe aus Plastik. Fotos von toten Tieren am Straßenrand. Fotos von zwei nicht verwesten Leichen, die man im »Toten Schacht« gefunden hat. Eine Galerie mit Bildern verfallener Häuser, mit Grabsteinen, toten Ästen, knorrigen Baumkronen ohne Leben in Schwarz-Weiß.
»Demütigung«. Seine Strategie, sie als Opfer darzustellen, als mitleiderregend, als schwach. Die Leute haben es ihm abgekauft, die Richterin auch. Am Ende hat sogar der Staatsanwalt ein mitleidiges Lächeln für Sascha übrig gehabt.
Sascha presst ihr Gesicht gegen eine der Dachluken. Es kommt alles wieder hoch. »Demütigung«, hat Federenko geschrien und sich gefreut. Seine großartige Strategie. Sie wäre fast aufgegangen. Ist sie aber nicht. Und genau das ist gut so.
Sascha merkt, wie ihr Tränen die Wangen hinunterrinnen. Ganz unten sieht sie Martha König, die ganz langsam die Gasse hinaufgeht. Sascha hat ihr nicht wirklich zugehört. Eine Geige. Ihr Bruder ist gestorben. Martha König bleibt stehen, dann sieht sie sich noch einmal um, betrachtet das Haus. Ihre Augen sind verwaschen und schwarz von der verschmierten Wimperntusche. Martha hat sie oben im Dachgiebel entdeckt. Sie sieht Sascha erschrocken an, dann dreht sie sich um und läuft davon.
Sascha sieht ihr so lange nach, bis Martha hinter einer Straßenbiegung verschwunden ist, und fragt sich, ob es Martha König gerade schlechter geht als ihr selbst. Der Gedanke hilft ein bisschen.
8. Sascha
Hier in der letzten Reihe sitzt außer Sascha nur noch eine zweite Person, ein Schatten. Ganz am anderen Ende und ganz allein. Dieser Schatten beobachtet die Bühne, regungslos. Sascha achtet nicht weiter auf ihn. Auch Sascha beobachtet die Bühne, ebenfalls regungslos.
Das Theater ist fast leer. Nur die ersten beiden Reihen sind eng besetzt, ab der dritten wird es spärlicher. Das Theater ist ein kleines Palästchen in Grün. Grün gestrichene Wände, grüne Polster auf den Klappsitzen. Rundum Säulchen in Weiß, ein geschwungener Rang in Weiß und Gold. Ein paar Kapitälchen. Ein Palästchen, vor über einhundert Jahren an den Rand einer Gründerzeitzeile geklebt. Ein paar Annaberger Kaufleute und Fabrikanten hatten sich zusammengetan, etwas Hochkultur ins Gebirge zu bringen. Operetten gingen schon damals am besten. Leichter Stoff, fröhliche, eingängige Melodien füllten das Haus.
Das heute ist schwerer Stoff. Geigen, irgendetwas Modernes. Das heute ist etwas nur für Kenner, für Musiker, für Freunde. Freunde der vier jungen Frauen, die mit Geigen auf der Bühne stehen. Sascha kennt sich mit solcher Musik nicht aus. Sie ist zu leise, zu zart. Sascha hört sonst nur harte Töne und schwere Bässe. Sascha ist nicht wegen der Musik hier.
»Was machst du denn hier?«, hat Ulrike gefragt, fröhlich dazu gelacht und Sascha umarmt.
Sascha war nach dem letzten Klingelton und im verlöschenden Licht in den Saal geschlichen. Sie hatte Ulrike nicht bemerkt, die atemlos direkt hinter ihr durch den noch halb offenen Türspalt geschlüpft war. Ulrike ist eine Bekannte oder Freundin oder so etwas, auf jeden Fall jemand, die ein ehrliches Interesse daran hat, dass es Sascha nicht dreckig geht.
»Puh«, keuchte Ulrike und ließ Sascha los. »Gerade noch rechtzeitig. Fast wäre ich zu spät …« Dann hielt sie kurz inne und sagte: »Schön, dass du da bist! Komm doch mit nach vorn, der Künstlerkreisel ist auch da. Wir sitzen alle in der ersten Reihe.«
Ulrike ist wegen Magdalena hier, ihrer Tochter. Magdalena spielt mit drei Freundinnen in einem Streicherquartett. Sie spielen schon seit Jahren zusammen. Sie kennen sich aus der hiesigen Musikschule. Heute studiert Magdalena Musik in Leipzig und kommt nur noch selten her. Ulrike will das bisschen Zeit nutzen, um ihre Tochter zu sehen. Magdalena steht vorn ganz links, ganz in Schwarz, und sieht in den Zuschauerraum, sie sieht jeden an, der in den ersten Reihen sitzt, und lächelt zuversichtlich.
»Vielleicht gehe ich gleich wieder«, hat sich Sascha entschuldigt. Ulrike neigte nachsichtig den Kopf, »schließ dich doch nicht immer so aus, Sascha«, und schlich eilig nach vorn.
Martha steht direkt neben Magdalena. Ihretwegen ist Sascha hier. Sie will beobachten, wie es ihr geht, weil sich dieser Gedanke nicht aus ihrem Kopf vertreiben lässt, dass sie etwas miteinander verbindet. Weil sie beide sich angesehen haben und weinten.
Martha trägt ein langes, schwarzes Kleid aus Samt, hochgeschlossen, oben Spitze. Ihr Haar ist hochgesteckt. Ohrringe glitzern und ein Armreif. Sie hat die Geige zwischen Schulter und Kinn geklemmt. Es ist die Geige von Elisabeth. Ihre Augen sind gesenkt, glitzern, und von hier hinten aus kann Sascha nicht genau erkennen, ob es Tränen sind. Aber ihr Gesicht wirkt blass, fahrig – und trotzdem wirkt es so unglaublich elegant. Entrückt. Sascha achtet nicht auf die Töne, die aus der Geige kommen. Sie beobachtet die Bühne, sie sieht die Geige und das Glitzern in Marthas Augen. Sascha sitzt regungslos in der letzten Reihe. Irgendwelche Töne. Elisabeths Geige.
Sascha ist bis zum Schluss geblieben. Nachdem der letzte Ton verklungen ist und dann auch der Applaus, nimmt Magdalena das Mikrofon vom Ständer und schaut den Raum mit festem Blick an. »Das heute war besonders schwer für uns«, sagt sie mit kräftiger Stimme, und alles Rascheln im Raum verstummt. »Die meisten von euch wissen ja, dass Marthas Bruder bei einem Autounfall gestorben ist.«
Magdalena nimmt Marthas Hand. Martha schaut nicht auf, sie sieht nur die Geige an.
»Die Geige«, sagt Magdalena. »Die Geige hat ihrer Familie gehört, und sie war verschwunden. Ihr Bruder Nathan hat sie wiedergefunden. Er hat sie ihr zum Geburtstag geschenkt. Es war sein letztes Geschenk.«
Magdalena hält Marthas Hand fest und sieht sich im Zuschauerraum um. Es ist ganz still. Alle schweigen und schauen gebannt auf die Bühne. Martha hat die Geige immer noch unter ihr Kinn geklemmt. Jetzt aber kann sogar Sascha die Tränen erkennen.
Magdalena nickt den Leuten zu, unten wird ausgeatmet. »Das heute war für dich, Nathan«, ruft sie. »Das war für dich, wo immer du bist! Für dich, Nathan!«
Wieder Applaus. Überall stehen Leute auf und klatschen. Aus dem Zuschauerraum gehen Leute nach vorn, sie steigen auf die Bühne. Einige umarmen Martha. Magdalena umarmt Martha, alle vier Geigerinnen umarmen sich untereinander. Es sind zehn, dann fünfzehn, dann zwanzig auf der Bühne, bis Martha nicht mehr zu sehen ist. Sascha versteht nicht, wie so viele Menschen so viel Zuneigung geben können. Regungslos beobachtet sie die Bühne. Der Schatten auf der anderen Seite ihrer Reihe ist verschwunden. Plötzlich vermisst Sascha diesen Schatten, ihren einzigen Verbündeten hier, der auch nicht dazugehört.
Auch draußen auf der Galerie ist Martha von Menschen umgeben, die sie umarmen und stützen. Erst auf der Straße löst sich die Traube langsam auf. Sascha zündet sich eine Zigarette an.
Martha hat sich einen schwarzen, langen Mantel mit einem dicken, schwarzen Pelzkragen übergeworfen. Jeder umarmt sie noch einmal, bevor Martha den Geigenkasten umklammert, sich von der Gruppe löst und langsam die lange Treppe hinaufgeht, die den steilen Hang direkt neben dem Theater überwindet. Sascha wirft die Zigarette weg und folgt ihr. Saschas schwere Stiefel schlagen gegen die Stufen. Martha dreht sich um. Sie erschrickt, als sie Sascha erkennt.
Den Schatten an ihrer Seite bemerkt sie erst, als er sie von der Seite packt. Martha schreit auf. Der Schatten schlägt ihr ins Gesicht, als sie noch einmal schreit. Er will die Geige! Martha soll die Geige loslassen. Der Schatten zerrt an ihren Händen. Martha schreit und lässt die Geige nicht los. Irgendetwas kracht, Holz oder Knochen, Marthas Mantel zerreißt. Der Schatten zerrt sie nach oben, schlägt sie noch mal ins Gesicht. Martha fällt regungslos zur Seite, ihr Kopf schlägt auf den Stufen auf. Den Geigenkasten hält sie weiter umklammert.
Das Ganze hat nur ein paar Sekunden gedauert. Erst dann hat Sascha begriffen, was passiert. Sie springt die Stufen nach oben. Der Schatten sieht sie an. Sie bemerkt das Weiß in seinen Augen, das Sascha fixiert. Der Schatten sieht, dass Martha auf den Geigenkasten gefallen ist. Sascha kniet nieder. Marthas Gesicht ist blutüberströmt. Ein dicker Blutstriemen läuft aus ihrer Nase, und ein anderer tropft aus ihrem Mund. Sie wimmert. Sie zieht ganz langsam den Geigenkasten unter sich hervor und schiebt ihn in Saschas Richtung.
Unten an der Treppe ist Lärm. Der Schatten springt zur Seite und verschwindet im Gebüsch. Marthas Freunde haben ihr Schreien gehört. Sie sind unten an der Treppe, und dann stürmen sie herauf. Vorn ist ein langer, drahtiger Junge in einem zu großen gelben Mantel. Magdalena folgt ihm. Sascha steht langsam auf. Sie hat den Geigenkasten in der Hand. Er ist in der Mitte durchgebrochen, das Griffbrett der Geige und lose Saiten ragen heraus. Der Junge hat sie erreicht. Er stößt sie zur Seite. Sascha fällt hin. Er wirft sich auf sie, presst ihren Kopf gegen die Stufen und drückt ihren Hals zu. Magdalena hat indes Martha an sich gezogen, stützt sie ab, und Marthas Blut läuft über Magdalenas Kleid. Sie haben irgendetwas, um die Blutung zu stoppen. Taschentücher, einen Schal.
»Was machst du hier?«, schreit sie Sascha an.
Sascha röchelt, sie bekommt kaum Luft.
»Warst du das?«, schreit Magdalena. »Hast du sie verfolgt? Warst du das, du Freak?«
Sascha kriegt kaum Luft und kann nichts sagen.
»Die war im Theater«, sagt einer.
»Saß ganz hinten«, ein anderer. »Hatte sich versteckt.«
»War draußen auf der Straße. Hat uns beobachtet.«
»Eine Stalkerin.«
»Das ist doch dieses Gruftimädchen, das gerade vor Gericht stand … gefährliche Körperverletzung.«
»Das ist Sascha«, sagt Magdalena. »Meine Mutter ist vernarrt in sie. Frag mich nicht, warum.«
Sascha kann nichts sagen.
Jemand hat einen Krankenwagen gerufen. Blaulicht flackert unten auf der Straße.
Martha schaut langsam hoch, sie sieht die zerbrochene Geige und dann Sascha, die von ihrem Freund zu Boden gedrückt wird.
»Sie war es nicht!«, flüstert Martha. »Es war jemand anders. Sie hat nichts –«
Der Griff lockert sich, und Sascha bekommt wieder Luft. Der Junge ist aufgesprungen und hat Sascha losgelassen. Zwei Sanitäter beugen sich über Martha. Ihre Freunde schauen besorgt. Auf Sascha achten sie nicht mehr.
Martha kann aufstehen. Die beiden Sanitäter stützen sie. Sie humpelt die Treppe hinunter. Die anderen folgen. Blaulicht. Dann ist Sascha allein auf der Treppe. Sie keucht noch ein bisschen, und ihre Nase blutet. Vermutlich ist auch ihr Make-up schon wieder total verschmiert. Vermutlich sieht sie schon wieder scheiße aus. Die Zigaretten sind auch weg. Scheißabend. Scheißtag. Schon wieder.
»Die Geige«, denkt Sascha. Jemand wollte unbedingt die Geige. Der Schatten. Und er wollte sichergehen, dass es die richtige ist. Deshalb war er im Theater. Irgendetwas ist mit dieser Geige. Irgendetwas muss da sein …
9. Elisabeth
11. Juni 1945 / Preßnitz, böhmisches Erzgebirge
Es war diese Geige. Darum ging es! Elisabeth streichelte sorgfältig über das Holz, es fühlte sich für sie an wie Samt. Sie strich zart die Saiten entlang, die einen so wundervollen Klang erzeugten. Das hier war die wertvollste Geige im ganzen Haus. Etwa hundertfünfzig Jahre alt, ein Meisterstück aus der Prager Manufaktur Hellmer. Eine Konzertgeige, die über Generationen weitergegeben worden war. Eine Geige, die Elisabeth nach Wien, Triest, Zürich, Sankt Petersburg, nach London und Brüssel begleitet hatte. Überall dort hatte sie einst gespielt. Jetzt ging es darum, diese Geige zu retten. Und alle anderen Instrumente auch.
Die anderen Instrumente gehörten der berühmten Musikschule der Bergstadt Preßnitz im böhmischen Erzgebirge. Hier oben, in einem kalten, flachen Hochtal im Erzgebirge, war über Generationen etwas Einzigartiges entstanden. Eine kleine eigene Welt aus Musik. Als die Bergwerke und die kargen Böden ringsum nicht mehr genug abwarfen, schulterten die Preßnitzer ihre Instrumente und zogen aus ihrem Gebirge hinaus, zunächst durch Böhmen und Sachsen, dann immer weiter. Sie wurden immer besser. Sie eroberten neue Länder, sogar andere Kontinente, und sie eroberten Tanzsäle, Salons und Casinos luxuriöser Hotels und Konzerthallen. Schließlich wurde kurz vor der Jahrhundertwende die Städtische Musikschule gegründet. Das bescheidene zweistöckige Gebäude mit dem hohen Dach, das neben der Kirche auf einer Anhöhe stand, wurde der Bedeutung dieser Einrichtung gar nicht gerecht. Das große Prager Konservatorium führte die Oberaufsicht. Ein paar tausend Schüler waren durch dieses Haus gegangen. Alle wichtigen Instrumentengattungen wurden unterrichtet. Wenn die Fenster offen standen, drang die Musik hinaus in die Gassen der Stadt. Die ganze Stadt war voller Musik. Es gab Schülerorchester im Musikpavillon im Stadtpark, es gab die großen Absolventenkonzerte im besten Hotel der Stadt.
Das alles war auch Elisabeths Geschichte. Es war die Geschichte ihrer Familie. Einer Familie von Musikern und Musiklehrern. Elisabets Vater Emil hatte dieses Haus lange als Direktor geleitet. Vor drei Jahren war er überraschend gestorben. Seitdem saß Elisabeth hier oben im Direktorenzimmer und versuchte, die Musikschule durch den Krieg und die schwierigen Wochen seit Kriegsende zu manövrieren. Es war gut, dass ihr Vater das alles nicht mehr erlebte. Es war gut, dass er nicht mehr mitansehen musste, wie hier alles zusammenbrach.
Es war ein kalter Sommer. Das Direktorenzimmer war der einzig warme Raum. Doch das Feuer brannte schlecht, das Holz war zu feucht. Es rauchte und stank. Elisabeth hatte keine Ahnung davon, im Wald Feuerholz zu sammeln und Feuer zu machen. Sie betrachtete die Blasen an ihren Händen. Ihre Hände waren es gewohnt, ein Instrument zu spielen. Sie waren es gewohnt, die Hände von Theaterintendanten und von männlichen Verehrern zu drücken.
»Dann verbrenn doch die Geigen!«, hatte Glowna gesagt. »Das ganze Haus ist voll nutzlosem Holz. Das brennt wie Zunder.«
»Die Geigen?« Elisabeth hatte ihn entsetzt angesehen. Die Geigen waren das Wertvollste überhaupt.
Glowna zuckte mit den Schultern. Heute brauchte man keine Geigen, keine Noten, keine Musikschule mehr. Niemand wusste, wie es weitergehen sollte. Der Krieg war vorbei. Das war die einzige Gewissheit. Seit Kriegsende hatten die Tschechen wieder die Kontrolle über Preßnitz und über das ganze Sudetenland übernommen. Keine einzige deutsche Schule durfte ihre Pforten öffnen. Deutsch, das war für die Tschechen nur noch eines, die Sprache der Nazis, die Sprache der Täter. Das ließen sie die Leute in Preßnitz spüren. Alle mussten in der Öffentlichkeit ein weißes Armband mit einem schwarzen »N« für »Nĕmec« – Deutscher – tragen. Ab acht Uhr abends galt eine Ausgangssperre. Ein tschechischer Gemeindediener zog regelmäßig mit seiner Trommel durch die Straßen der Stadt und verkündete Befehle und Verbote. Und immer schloss er mit dem gleichen Satz: »Zuwiderhandlungen werden mit dem Tode bestraft!«
»Aber Musik hat keine Sprache«, wandte Elisabeth mutig ein. »Musik ist ihre eigene Sprache.«
Glowna sah Elisabeth verständnislos an. Glowna war im Kreis Preßnitz so etwas wie ein Schulrat. Wer wusste in diesen Zeiten schon so genau, wer wofür zuständig war. »Die Schule wird geschlossen. Sofort«, wiederholte er ungerührt. Er klopfte zweimal auf den großen Schreibtisch ihres Vaters und ging.
Jetzt ging es also nur noch um die Instrumente. Die Schule sollte weiterleben, in den Instrumenten, in den Noten und in ihren Schülern. Bis zu dem Moment, an dem sie wieder öffnen durfte. Diese ganze kleine Welt aus Musik, für die auch ihr Vater gelebt hatte, durfte nicht untergehen. Deshalb war Elisabeth heute hier. Deshalb war das Direktorenzimmer geheizt, deshalb knisterte das Feuer und stank. Jeder Schüler sollte ein genaues Abgangszeugnis mit erlerntem Instrument und Kenntnisstand erhalten. Damit man später wieder daran anknüpfen konnte. Soweit möglich, sollten sie eines der Instrumente mit nach Hause nehmen – leihweise natürlich.
»Zwölf Uhr«, stand auf dem Aushang, den Elisabeth unten auf die Anschlagtafel neben das Schulportal gehängt hatte. »Ausgabe der Abgangszeugnisse und der Übungsinstrumente.« Die Glocke im Rathausturm schlug zwölfmal. Das Feuer prasselte, niemand kam. Halb eins. Elisabeth stand auf, ging zum Fenster und schaute hinaus. Der Weg, der zur Schule hinaufführte, war leer. Ein Uhr. Die Rathausglocke schlug wieder.
Zwei Uhr. Endlich klopfte es zaghaft an der Tür. Eine Frau mit einem Jungen an der Hand trat vorsichtig ein. Die beiden durchschritten ehrfürchtig den Raum und ließen sich auf die bereitgestellten Stühle auf der anderen Seite des schweren, dunklen Schreibtisches fallen. Erstaunt schauten sie sich um.
»Hier sieht es ja wie immer aus!«, brach es aus der Frau heraus. »Hier hat sich überhaupt nichts verändert!« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Elisabeth überreichte ihr feierlich eine Geige. »Bitte schön, Frau Schuster«, sagte sie. »Und sorgen Sie dafür, dass der kleine Alfred immer fleißig übt. Er ist so talentiert.« Zum Beweis legte Elisabeth das Abgangszeugnis vor die beiden und nickte anerkennend.
Daraufhin brach die Frau vollends in Tränen aus. »Ja gewiss«, schluchzte sie. »Vielleicht lenkt ihn das ein bisschen ab von alldem. Von seinem Vater gibt es seit zwei Jahren kein Lebenszeichen. Wahrscheinlich ist er in Russland gefallen …«
Frau Schuster blieb einfach sitzen, als es wieder an der Tür klopfte und eine Familie eintrat. Eine Mutter, drei Kinder, Großmutter, Großvater. Jeder der Erwachsenen schleppte einen abgewetzten Reisekoffer mit sich herum. Sie sahen erschöpft und abgekämpft aus. Der Großvater schlug zitternd seinen Gehstock am Türrahmen ab, Staubkrümel fielen zu Boden. Dann stellten alle die Koffer in die Ecke und ließen sich erschöpft darauffallen. Elisabeth, Frau Schuster und ihr Sohn sahen die Neuankömmlinge gespannt an. Die atmeten schwer, streckten die Beine aus und schüttelten den Kopf.
»Wer von den Kindern bekommt denn das Zeugnis?«, fragte Elisabeth ungeduldig. Der Großvater schüttelte den Kopf.
»Sie sind nicht wegen eines Zeugnisses hier?«
»Wir wissen einfach net, wohin. Vielleicht können wir hier bleiben? Wir kommen aus Kupferberg.«
»Kupferberg?« Elisabeth blickte erschrocken auf.
Die kleine Bergstadt lag oberhalb von Preßnitz direkt auf dem Erzgebirgskamm. Man schaute von dort oben direkt hinunter ins Egertal und weit nach Böhmen hinein. Vor ein paar Tagen war sie von tschechischen Soldaten gestürmt worden.
»Sie standen einfach auf dem Marktplatz«, seufzte der Großvater. »Getrommelt haben sie. Alle mussten raus. Innerhalb von einer Stunde. Alle raus. Kaum einer durfte bleiben. Und wer in der NSDAP war oder wen sie dafür hielten, den haben sie zusammengeschlagen. Zwei sind tot liegen geblieben. Uns haben sie nur das Notwendigste gelassen, ein bisschen Bettzeug und das, was wir am Leib tragen. Seit drei Tagen sind wir unterwegs. Wir wissen einfach net, wo wir bleiben können …«
»Seit drei Tagen schon«, setzte schließlich auch die Mutter hinzu. »An der Grenze nach Oberwiesenthal, da haben uns die Russen zurückgejagt. Wir haben im Wald übernachtet. Aber es ist kalt draußen. Drei Tage. Und jetzt können wir einfach net mehr. Vielleicht können wir hier …?«