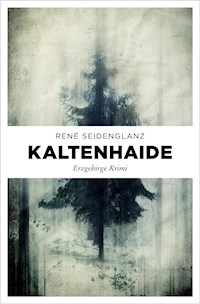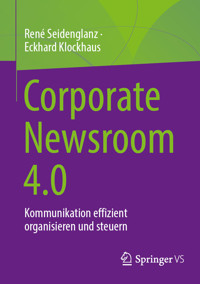Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jan und Sascha Berghaus
- Sprache: Deutsch
Hochspannung im Erzgebirge. In einem stillgelegten Bergwerk im Erzgebirge werden zwei Leichen gefunden. Es handelt sich um ein Paar, das 1972 spurlos verschwand – Angehörige einer Dynastie von Textilfabrikanten, die in der DDR enteignet wurde. Sind sie Opfer der Staatssicherheit geworden? Oder waren sie in kriminelle Machenschaften verwickelt? Es gab Gerüchte damals. Viele Gerüchte. Journalist Jan Berghaus gräbt den Fall wieder aus – und plötzlich sterben Menschen, die mit den beiden Toten zu tun hatten. Ist der Mörder von damals zurückgekehrt?ls zurückgekehrt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Seidenglanz, 1976 in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge geboren, ist Professor für Kommunikationsmanagement in Berlin, studierter Publizist und Psychologe und promovierter Kommunikationswissenschaftler. Er lehrte an der Universität Leipzig und wechselte 2008 an eine Berliner Wirtschaftshochschule. Als Vizepräsident ist er Mitglied der Hochschulleitung.
Nähere Informationen zum Buch und Hintergründe:www.erzgebirgekrimi.de
Mit Sascha Tatorte entdecken, neuen Spuren folgen:www.instagram.com/saschas.attic
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2019 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Lothar Strüh eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-564-0 Erzgebirge Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Prolog
Die Nacht war mehlig und feucht. Leise sein. Niemand durfte sie bemerken. Die Wolken am Himmel hingen tief und warfen ein wenig Licht von der Stadt auf der anderen Talseite hier herüber. Dennoch war der Weg unter ihnen nur schemenhaft zu erkennen. Ein hellgraues Band neben den dunkelgrauen Feldern links und rechts. Pockennarbig von kleinen Halden durchzogen, mit Bäumen bestanden und ganz schwarz. Kein Geräusch außer dem ihrer Schritte. Manchmal stolperten sie. Der Weg bestand aus groben Betonplatten, für die schweren Landmaschinen verlegt, die die Felder ringsum bearbeiteten. Tagsüber. Die Platten waren ausgefahren und an vielen Stellen zerbrochen. Jens und Matthias konnten die tiefen Löcher und Risse kaum erkennen. Aber die Taschenlampe anzuschalten verbot sich. Oben am Hang standen die Häuser einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung, schnell hochgezogene Baracken mit zugigen, kleinen Wohnungen. In einer brannte noch Licht.
Sie kannten sich aus der staatlich organisierten Traditionspflege. Bergmännisches Brauchtum. In ihren schicken, bergmännischen Paradeuniformen durch die Erzgebirgsstädte. Bergparade. Marschieren und Musik. Vorneweg die Kapelle. »Glück auf, der Steiger kommt«. Vor allem dieses Lied wurde gespielt. Neben den Märschen bergmännische Geschichte mit großer Ernsthaftigkeit, außerdem viel Alkohol. Einige aus ihrer Gruppe waren selbst noch in den Berg eingefahren, in die Wismut-Bergwerke, wo man Uran förderte für Atomkraftwerke und für Atombomben.
Zwei von ihnen taten das immer noch. Diese beiden waren die stolzesten unter ihnen. Viele aus der Gruppe sahen die Welt unter Tage nur von den abgesperrten, sorgfältig ausgeleuchteten und sicherheitsüberprüften Pfaden aus, die durch ein paar Schaubergwerke führten. Einige hatten sich zusammengetan, um selbst ein altes Bergwerk wieder herzurichten. Dort war alles generalstabsmäßig organisiert. Alles wurde genau dokumentiert, jeder Meter weiter in den Berg abgesichert, vermessen. Die Wände abgestützt, Kabel verlegt. Neonröhren. Jeder weitere Schritt forderte endlos lange Vorbereitungen. Es ging quälend langsam voran. Im Dunkel vor ihnen lagen viele hundert Meter unerkundete Gänge, die auf ihre Entdeckung warteten. Stattdessen bauten sie Stützen ein, verlegten Stromkabel, hängten Lampen auf.
Ihnen war das immer zu wenig gewesen. Von Kindheit an waren sie fasziniert von dem Schauder, den die tiefen, unbekannten Gänge des Gebirges bei dem auslösten, der sie zum ersten Mal seit vielen hundert Jahren betrat.
»Sind wir denn noch immer nicht da? Hier müsste es doch irgendwo sein. Mist, es ist zu dunkel.« Matthias stöhnte auf. Er musste zudem die Seile und die Strickleiter tragen.
»Sei still, verflucht!«, flüsterte Jens, auch wenn sie im Umkreis von vielen hundert Metern allein waren. Aber man konnte nie wissen. »Dort vorne nach links und dann hundert Schritte in Richtung Anhöhe. Da liegt ein großer Haufen Bauschutt. Der Schacht ist direkt dahinter.«
Matthias nickte. »Kein Wunder, dass wir so lange vergeblich gesucht haben.«
Jens blieb stehen und versuchte, unter den drei Pockennarben auf dem Feld linker Hand die richtige Halde auszumachen, die ihm als Orientierung diente.
»Hier?«, fragte Matthias.
»Ja.«
Jens stieg eine niedrige Böschung hinauf und zog Matthias am Jackensaum hinter sich her.
»Du glaubst nicht, was ich alles wegräumen musste. Ziemliche Drecksarbeit.«
»Ich hätte dir helfen können.«
»Nee, nee, den wollte ich alleine finden. Der ist jetzt meiner.« Jens grinste breit. Matthias konnte es selbst im Dunkeln sehen.
»Wer hätte gedacht, dass der Eingang zum Toten Schacht unter dieser Müllkippe liegt. Wir sind die Felder so oft abgelaufen, haben sie nach den alten Karten ausgemessen, und das Ding lag die ganze Zeit direkt vor unserer Nase.«
Der Tote Schacht. Vor etwa fünfhundert Jahren war die Gegend hier erschlossen worden, auf der Suche nach Silber hatten sie den Berg durchwühlt. Glücksritter. Meist arme Hunde, die kaum genug zum Leben hatten. Die vielen kleinen Halden, überwuchert und baumbestanden, überzogen die Felder wie Pockennarben und zeugten noch heute davon. Der Tote Schacht gehörte zu einem dieser Bergwerke. Lange Zeit war es eines der ergiebigsten im hiesigen Revier gewesen. Der Tote Schacht war als Wetterschacht angelegt worden. Mit hölzernen Aufbauten versehen, sollte er die Tiefe der Stollen mit Frischluft versorgen. Die kreuzförmig angeordneten, hoch aufragenden, senkrechten Bretter leiteten den Wind hinunter, egal, aus welcher Richtung er wehte. Dort unten, im Schein schummriger Fackeln, dünner Grubenlichter, im Rauch von Feuer, konnten die Bergleute ohne Nachschub an Sauerstoff schnell ersticken. Der Atem des Berggeistes. Doch das Silber versiegte, die Grube wurde geschlossen, der Schacht blieb unnütz zurück. Daher sein Name: Toter Schacht.
»Wir sind so oft um diesen Müllhaufen herumgelaufen«, sagte Matthias, »in jeder Senke haben wir herumgegraben. Wie hast du es herausgefunden?«
»Ich habe in den Unterlagen der LPG nachgesehen, die das alles hier bewirtschaftet. Was für eine Heidenarbeit. Dann endlich die richtige Geschichte: 1971 wäre ein Kind beinahe in ein unbekanntes Loch gestürzt, da hat man den Schacht wiederentdeckt und einen hohen Zaun rundherum gezogen. Und ein paar Jahre später haben sie ihn verschlossen. Ich habe eine Notiz gefunden, dass man starke Betonpfeiler hier rausgeschafft hat, und da war der Ort genau beschrieben. Da wusste ich, dass ich gefunden habe, was ich suche.«
Die beiden gingen jetzt einen schmalen Trampelpfad zwischen den Pockennarben entlang.
Dann blieb Jens stehen. Sie waren angekommen. In der Dunkelheit waren scharfkantige Begrenzungen auszumachen. Abgeworfene Betonteile, allesamt zerborsten, große Steine. Jens ließ die Taschenlampe aufflackern. Nur kurz, damit sie keiner bemerkte. Im Schein des Lichts zeigten sich genauere Konturen. Links ein zerrissener Kinderwagen, rechts das Gehäuse eines Fernsehgerätes, altes, schmutziges Spielzeug. Ein Plüschhase mit fehlendem Knopfauge und hängenden gelben Ohren. Mehrere rostige Fässer. Viel Asche dazwischen, hier und da sprossen Birken aus dem Haufen heraus. Eine wilde Müllhalde war um den Schacht herumgewachsen. Über der Öffnung im Boden lagen ein paar Betonpfeiler, sie waren in den wenigen Jahren porös geworden und brachen bereits. Mit einer Eisenstange hatte Jens eine Öffnung hineinschlagen können, so groß, dass sich ein Mensch gerade so hindurchzwängen konnte. Doch um selbst hinunterzusteigen, brauchte er einen Begleiter. Allein, das war selbst für ihn zu riskant.
»Leuchte mal kurz hier rüber!«
Sie banden das Sicherungsseil um einen der Betonpfeiler, dann ließen sie die Strickleiter hinunter. Jens setzte seinen Bergarbeiterhelm auf, schlang das Seil um seinen Leib und zwängte sich durch den Spalt hindurch. Matthias hielt das Seil. Ein Schritt nach dem anderen, Stück für Stück tiefer, ganz langsam. Vorsichtig. Kaum war sein Kopf vollständig im Schacht verschwunden, knipste er die Grubenlampe an.
Großartig! Er konnte sehen, dass der Schacht weit in die Tiefe führte. An den Wänden erkannte er die Spuren der Schlägel, mit denen sich die Bergleute vor fünfhundert Jahren in die Tiefe gehauen hatten. Sein Herz hämmerte vor Aufregung. Das erste Mal seit fünfhundert Jahren ließ sich ein Mensch hier herunter. Nämlich er. Er schaute nach unten. In der Tiefe konnte er nur Wasser sehen. Sein Puls stieg noch höher, und sein Körper zitterte. Er hoffte inständig, dass das Wasser nicht über die Stollendecke reichte, dass das Grubenfeld nicht überflutet war und er dort unten noch das alte Gangsystem erkunden könnte.
Jens stieg weiter hinunter. Die Strickleiter reichte bis kurz über die Wasseroberfläche. Hier war es zu Ende.
»Und? Wie ist es?«, schallte es von oben.
»Ich weiß noch nicht. Warte mal.«
Unten angekommen. Nur Wasser und kein Hinweis, wie tief der Schacht noch reichte.
»Und jetzt?«
»Wasser!«
»Nur Wasser? Und der Stollen?«
Jens schaute nach oben, seine Grubenlampe blendete Matthias, der die Augen zukniff.
»Scheiße!«
»Alles überflutet, oder was?«
»Scheiße, Scheiße, Scheiße!«
Zum Heulen. Ein halbes Jahr Suche. Für ein Loch mit Wasser. Ein paar Schlägelspuren an den Wänden. Wie tief ging es noch hinunter? Jens leuchtete in die Brühe hinein. Kein Grund zu sehen. Das Wasser war trübe.
»Verdammte Scheiße!«
Er schlug wütend mit der flachen Hand gegen die Wände des Schachtes. Hier war Ende. Er hing über der trüben Wasseroberfläche, und sein Abenteuer war vorbei. Wenn er wenigstens hätte sehen können, wie tief es noch hinunterging. Vielleicht war er ja kurz vor der Sohle des Stollens. Aber auch das würde nichts nutzen. Alles war überflutet.
Jens leuchtete noch ein letztes Mal mit seiner Lampe hinunter. Der Strahl traf jetzt gerade auf die trübe Wasseroberfläche und drang ein Stück weit ein.
Was war das?
Etwas Langes, Helles. Reichte einmal quer von einer Wand fast bis zur anderen.
Und zwei dunkle Kugeln nebeneinander. Kaputte Fußbälle vielleicht. Altes Spielzeug, das von der Müllhalde oben in den Schacht gefallen war. Tolles Abenteuer! Eine dreckige Brühe voller Müll.
Oder?
Man könnte meinen, dass…
Jens beugte sich noch weiter hinunter. Streckte sich. Dumm, dass die Strickleiter nicht weiter reichte.
Matthias sollte das Seil noch etwas weiter herunterlassen. Jens drückte sich mit den Füßen gegen die Strickleiter, stützte sich mit den Armen an der gegenüberliegenden Wand ab, das Seil um seinen Bauch geschlungen. Jetzt hing er fast waagerecht.
Was ist das? Ist das…?
In diesem Moment verloren seine Hände den Halt an der glitschigen Wand. Er rutschte ab. Seine Beine schnellten nach oben, sein Oberkörper kippte nach unten. Er tauchte kopfüber ins Wasser ein. Tauchte unter.
Das lange Weiße war direkt vor seinen Augen, es schwebte im Wasser, und jetzt fing es an, sich zu bewegen.
Was war das?
Wellenförmig kreiste es nach oben und nach unten. Und am Ende war eine Hand. Und sie griff nach ihm. Jens riss den Mund auf zum Schrei und schluckte Wasser. Es schmeckte bitter und faulig, und es brannte in seiner Kehle. Und eine Sekunde bevor es um ihn herum ganz trübe und dunkel wurde, blickte Jens in ein Gesicht. Das Gesicht einer Frau. Ein Auge starrte ihn an.
Während ihre Hand nach ihm griff.
Er schluckte Wasser, seine Arme schlugen wild umher. Etwas zog ihn nach unten, und dann wusste er nicht mehr, wo unten war. Unter Wasser konnte er nicht schreien. Aber er musste schreien, und jedes Mal schluckte er bitteres, schmutziges Wasser. Es füllte seinen Hals, lief in seine Lungen. Kroch in ihn hinein. Wasser und Schlamm. Anstatt Luft zum Schreien.
Irgendwie kam er hoch. Das Seil um seinen Leib spannte sich. Das Licht seiner Grubenlampe tanzte wild an den Wänden des Schachtes herum.
Dann wieder Luft. »Matth… Ma… Hilf mir! Matthias. Es ist… Da ist… Hilf! Ich kann nicht…« Er kippte wieder nach vorn. Er schluckte wieder Wasser.
Dann wieder nach oben.
»Jens? Jens! Was ist?« Matthias oben mit der Taschenlampe, erschrocken, leuchtete ihm direkt ins Gesicht. Jens sah nur noch Sterne. Und ein Gesicht, das sich eingebrannt hatte in seinen Blick. Weiß, wie aus Kreide. Mund, Nase, schwarze Haare. Und ein totes Auge, das ihn anstarrte.
Er ruderte und schlug um sich, und auf einmal hatte er Haare zwischen den Fingern, lange Haare, die sich in seinen Händen verfingen.
Angst und Ekel, Panik. Bilder. Gesicht. Links und rechts und Wasser und Dunkelheit. Lichtblitze der Taschenlampe oben. Und dann merkte er, dass es zwei waren. Zwei Bälle. Zwei. Köpfe.
Zwei Körper. Vier Hände, vier Arme.
Es waren zwei.
Irgendwann bekam er das Seil auch mit den Händen zu fassen. Irgendwann war er wieder oben. Er schrie. Er schrie seine ganze Angst hinaus, doch der stechende Blick verfolgte ihn. Und sie starrte ihn an. Ihr Auge war im Nachthimmel, auf der Müllkippe, auf den pockennarbigen Feldern, auf seinen eigenen Händen. Lichtblitze und Kreise. Und ein Gesicht. Augen, die ihn anstarrten. Jens sprang auf, stieß Matthias weg, der ihn festhalten wollte. Rannte zurück zum Weg. Schrie. Gesicht. Augen.
Drüben, auf der gegenüberliegenden Talseite, leuchteten orange Straßenlaternen unbeeindruckt weiter. Kein Geräusch drang von der Stadt herüber. Hoch auf einer Terrasse über der Talsohle begannen die Häuser, gruppierten sich um den dunklen Schatten einer gewaltigen Kirche und zogen sich bis zum Bergkamm hinauf.
Aus der Mitte der Stadt löste sich ein flackerndes Blaulicht. Dann noch eines und schließlich ein drittes. Kein Geräusch drang über den tiefen Talgrund herüber.
Teil I
Tiefes Wasser
1
»Zwei also. Ein Mann und eine Frau.« Berghaus schlägt die dünne Akte zu, die Albrecht ihm zusammengestellt hat. Eine ganze Woche hat er dafür gebraucht, und das ist alles?
»Das ist alles, Albrecht?«
»Ja«, sagt Albrecht knapp. »Ist alles. Habe doch gleich gesagt, das bringt nicht viel.«
»Albrecht, ich verstehe das nicht. Sie sind eine Woche weg gewesen. Dafür? Ich verstehe es wirklich nicht!«
Albrecht zuckt gleichgültig mit den Schultern.
Berghaus wedelt mit der Akte, schüttelt den Kopf, aber er sagt nichts mehr dazu. »Gut. Ich schaue es mir später an.« Dann wendet sich Berghaus wieder seinem Monitor zu und tippt umständlich auf der Tastatur herum.
Joachim Albrecht zuckt noch einmal mit den Schultern. Eine Woche Arbeit für einen Beitrag, den er am liebsten verhindert hätte. Weil das nichts bringt. Aber was hat er hier schon zu sagen. Er arbeitet ja nur für den da. Bislang dachte er, der »Gebirgsbote« solle wissenschaftlich fundiert, präzise, systematisch informieren. Ein Wissensspeicher für kommende Generationen, die nach verschüttetem Wissen suchen. So hatte es ihm Professor Berghaus lange erklärt, in seiner kalten, dozierenden Art. »Schreiben Sie es sich auf, Albrecht, das ist der Anspruch, den wir haben.«
Und jetzt?
»Personalisierung, es geht um Personalisierung. Sie wissen das ja nicht, aber die meisten Medien nutzen Personalisierung, um die Beziehung zwischen Leser und Text zu intensivieren. Ich sag es mal mit Ihren Worten: Es muss menscheln.«
Personalisierung, Menscheln. Auf einmal. Plötzlich ist ein fünfundzwanzig Jahre alter Fall für das Magazin interessant. Weil es da um Menschen geht. 1987, fünfundzwanzig Jahre liegt es zurück, dass in einem alten Bergbauschacht nahe der Stadt zwei Leichen gefunden wurden. »Es ist ein Jubiläum«, sagt Berghaus. »Das ist ein Anlass!« Es ist ein Ehepaar, eng umschlungen. Man kann eine Lebensgeschichte erzählen. Und eine Liebesgeschichte.
Joachim Albrecht hat früher in einer der großen Textilfabriken gearbeitet, die nach der Wende schnell zusammengebrochen sind. Seitdem hangelte er sich von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur nächsten. Er arbeitete an Chroniken zu Stadt- oder Dorfjubiläen mit, fünfhundert Jahre, siebenhundertfünfzig Jahre, danach in Projekten, die Kinder (die sich für Musik, Technik, Computerspiele, aber nie und nimmer für die Geschichte ihrer Region interessierten) für die Geschichte ihrer Region interessieren sollten. Dann trottete eine missmutige Herde hinter ihm her. Den Hampelmann hat er gemacht, die Kinder tanzten grölend um ihn herum, während er ihnen stotternd Jahreszahlen aufsagte.
Daher war Albrecht froh, als das Angebot kam, für ein regionalgeschichtliches Magazin zu arbeiten. Ein Professor habe sich hier niedergelassen und wolle sich mit der Geschichte des Oberen Erzgebirges beschäftigen. Er suche einen Mitarbeiter für Recherchen, für kleinere Texte, jemanden, der sich mit Geschichte auskenne. Für die paar Jahre bis zur Rente, hatte sich Albrecht gedacht, wäre das eine ruhige Stelle. Ein bisschen Zeit in den Archiven verbringen, ein wenig in alten Unterlagen blättern– und vor allem, Ruhe vor diesen Bälgern haben. Eine angenehme, ruhige Stelle, mit einem netten älteren Wissenschaftler, etwas verschroben vielleicht, der in seine Forschungen vertieft wäre und mit dem sich ansonsten angenehm plaudern ließe. So dachte er. Heute blickt Albrecht wehmütig auf die Zeiten zurück, als er sich von kleinen Kindern auslachen ließ. Heute kennt er Professor Berghaus besser. Und er kann ihn nicht leiden. Nein, er hasst ihn!
Da sitzt er wieder und tippt umständlich auf der Tastatur. Seit anderthalb Jahren arbeitet Albrecht inzwischen für ihn, und er kennt gerade einmal sein Fachgebiet: Soziologie. Jan Berghaus, zweiundfünfzig Jahre, mittelgroß, mittelschwer, ein leicht aufgedunsenes Gesicht, graue Haare mit tiefen Geheimratsecken. Immer ein kariertes Sakko mit grünem Einstecktuch, khakifarbene oder graue Hose, braune Schuhe, irgendein Hemd, das ihm leicht über dem Bauch spannt, immer Krawatte. Anders hat Albrecht ihn noch nie gesehen.
Warum Berghaus dieses Magazin gegründet hat? Albrecht weiß es nicht. Eine Spielerei vielleicht, ab und an ist Berghaus noch an der Universität und hält Vorlesungen– schrecklich schlechte, aber damit scheint er sein Geld zu verdienen.
Warum Berghaus überhaupt in seine Geburtsstadt zurückgekehrt ist und sich ein altes Haus in einer verwinkelten Gasse kaufte? Warum er sich rarmacht an seiner schicken Universität in der schicken Metropole? Es gab da wohl einen Vorfall mit einer Studentin, keiner weiß etwas Genaues, nur Gerüchte. Vielleicht hat er die Fassung verloren und seine Hände nicht bei sich behalten können? Hat er zugepackt, ihr unter den Rock gegriffen? Hat er seine rissigen Lippen gegen ein junges Gesicht gedrückt? Hatte er eine Affäre? Hat er gute Noten gegen Gefälligkeiten getauscht? Albrecht will ihm das gerne zutrauen. Wahrscheinlich tut Berghaus nur so korrekt, wahrscheinlich steigt er in Wahrheit Zwanzigjährigen nach, weil er sich etwas auf seinen Titel einbildet.
Und Persönliches? Berghaus war verheiratet, jetzt aber ist er geschieden. Kinder? Offensichtlich zwei. Die Tochter ist ein paarmal hier im Laden gewesen. Genauso unangenehm wie ihr Vater. So ein blasses, dünnes Mädchen. Wie eine Krähe, schwarz angezogen, zerrissene Strumpfhosen. Ganz schrecklich tätowiert. Die Augen sind dick schwarz umrandet. So was ist die Tochter von einem Professor. Nie und nimmer hätte er seine Tochter so herumlaufen lassen, seine Enkel ebenso wenig. Kriegt kaum ein »Guten Tag« heraus, schaut die Menschen nicht an, wenn sie spricht. Genau wie ihr Vater, der schaut einem auch nie in die Augen.
Wenn Berghaus mit Albrecht spricht, dann gibt er Anweisungen, fasst Aufgaben zusammen. Albrecht redet gerne, er möchte wissen, wer gerade mit wem und wann und überhaupt. Aber mit dem da kann man nicht reden. Albrecht hatte schon nach zwei Tagen das Gefühl, Selbstgespräche zu führen, weil Berghaus für alles, was Albrecht erzählte– oder erzählen wollte: seine Frau, seine drei Kinder, die Enkel, das Haus in der oberen Stadt–, nicht einmal ein Nicken übrig hatte. Berghaus doziert, er kontrolliert, immerzu. Der Arsch.
»Herr Albrecht, können Sie mir bitte zeigen, was Sie heute gemacht haben?– Wir gehen das jetzt noch mal von Anfang an durch.– Was haben Sie denn die letzten zwei Stunden getan?– Und dafür haben Sie zwei Stunden gebraucht?– Verstehen Sie überhaupt, was ich von Ihnen will?– Sind Sie begriffsstutzig?– Soll ich es Ihnen noch einmal erklären?«
Nein, soll er nicht! Berghaus macht ihn wahnsinnig. Jedes verdammte Detail muss er durchsehen, nachsehen, abstimmen. Alles will er erklären, belehren. Und noch ein Jahr bis zur Rente. Ein Jahr kann endlos lang sein. Er hätte bei den Kindern bleiben sollen. Ein Jahr mit schreienden Kindern– es wäre ihm lieber gewesen, als noch einen Tag mit diesem schrecklichen Menschen zubringen zu müssen.
Warum hört er nicht auf?
Würde er ja gerne. Aber was soll er denn machen? Seine alte Stelle hat jetzt eine resolute alte Dame mit rotem, zum Dutt gebundenem Haar und rotem Gesicht. Sie komme gut mit den Kindern klar, erzählt sie. Sie habe nicht viel Ahnung von Geschichte, aber darum gehe es ja auch nicht. Ein paar lustige Anekdoten, Gruselgeschichten oder Sagen, das wollten die Kinder hören. Dann gäben sie Ruhe. Alle seien zufrieden. Dahin kann er nicht zurück. Er könnte in den vorzeitigen Ruhestand gehen– aber diese Einbußen. Sagt seine Frau. Komm mir bloß nicht auf die Idee, sagt seine Frau.
Also hält er durch. Erträgt die Belehrungen. Ärgert sich. Ballt die Fäuste. Versteht irgendwann, hier geht es darum, präzise zu formulieren, analytisch zu schreiben, genaue Jahresangaben, chronologische Listen. Versteht, dass es nicht darum geht, viele Leser anzusprechen. Alles sehr rational. Kalt, könnte man sagen.
Und jetzt plötzlich das.
Ohne Erklärung so einen Beitrag, der nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun hat, was der Gebirgsbote bislang veröffentlicht hat. Nüchterne Analysen, Jahrestafeln, Niederschriften von Chroniken. Plötzlich eine traurige Liebesgeschichte.
»Ich verstehe es immer noch nicht.«
Berghaus schaut kurz hinter dem Monitor hervor.
»Was?«
»Der Artikel, er passt nicht ins Heft. Wir haben bislang noch nie so etwas gemacht.«
»Albrecht, soll ich es Ihnen noch einmal erklären, was ich mit Personalisierung gemeint habe? Ich dachte, das sei klar.«
Albrecht ballt die rechte Faust. Diesmal will er sich Berghaus’ Belehrungen nicht gefallen lassen, denn er weiß, dass er recht hat.
»Sie widersprechen sich selbst! Sie haben klar gesagt, was dieses Magazin will und was nicht. Wir wollen nur reine Fachtexte veröffentlichen, keine Geschichten aus dem Boulevard. Das sind Ihre Worte. Ich habe sie oft genug wiederholen müssen. Es geht nicht darum, mehr Leser zu gewinnen. Es geht nicht um ›Personalisierung‹.«
Berghaus schaut vom Monitor auf und ihm in die Augen. Eine Weile sagt er nichts.
Denn Albrecht hat recht. Genau das hat er ihm immer wieder gesagt. Keine emotionalen, tränenreichen Storys. Sondern Fachtexte. Fachtexte. Fachtexte. Bisher stimmte das. Das Magazin überlebt dank vielfältiger Fördertöpfe, die Berghaus anzapft. Zuallererst ist es ein Projekt der Europäischen Union. Regionalförderung in einer Ziel-1- oder Konvergenzregion. Man musste nur die richtigen Kriterien finden. Und da sich der Gebirgsbote mit dem gesamten Erzgebirge, also auch mit dessen tschechischem Teil beschäftigt und in einer tschechischen Übersetzung erscheint, kann Berghaus zusätzliche Fördermittel anzapfen. Die Stelle von Albrecht wird außerdem von der hiesigen Arbeitsagentur gefördert. Für das lange leer stehende Ladenbüro in einem inzwischen ausgestorbenen Teil einer ehemaligen Einkaufsstraße schießt die Stadtverwaltung etwas zu. Bevor der Gebirgsbote hier eingezogen ist, haben sich mehrere Boutiquen, eine Schneiderei, eine Videothek, ein Sexshop und zuletzt ein kleines Café versucht. Bislang finanzierte er sich allein dadurch, dass es ihn gab.
Was Albrecht nicht weiß: Damit ist es vorbei. Künftig muss der Gebirgsbote nachweisen, dass er zu etwas nutze ist, und das heißt: Er muss nachweisen, dass er gelesen wird. Aber die Verkaufszahlen sind ebenso erbärmlich wie die Klicks im Internet. Die Geldgeber wollen Beweise dafür sehen, dass der Gebirgsbote das einlöst, was Berghaus vollmundig in die Anträge schreibt: historisches Bewusstsein schaffen, und zwar in weiteren Teilen der deutschen und tschechischen Bevölkerung. Ansonsten läuft die Förderung aus, bald schon.
»Albrecht, ich erkläre es Ihnen: Oswald Barthel. Sie kennen doch die Geschichte. Oder etwa nicht?«
Albrecht schüttelt den Kopf.
»Ich dachte, Sie würden sich schon so lange mit Regionalgeschichte beschäftigen, Herr Albrecht.« Jetzt schüttelt Berghaus streng den Kopf und sieht Albrecht verächtlich an. »Das ist doch wirklich Allgemeingut. Wenn Sie den Fall kennen würden, dann würden Sie die historischen Parallelen erkennen.«
Albrecht wird abends die Frau anrufen, die seine frühere Stelle übernommen hat und den Kindern interessante Geschichten statt Jahreszahlen erzählt.
Oswald Barthel? Natürlich. Was für eine schöne Geschichte. Die kann man den Kindern ganz besonders gut erzählen, weil sie ein bisschen gruselig ist, aber auch ein wenig märchenhaft, weil da ein Liebespaar drin vorkommt. Und die kennst du nicht, Joachim?
Oswald Barthel war ein Bergmann im nahen Saubergrevier. Jeden Morgen fuhr sein Trupp in den Berg ein. Doch der Berg war gefährlich. Die Stollen waren eng, und wenn man nicht für genügend Frischluft sorgte, dann konnte der Atem des Berges jeden dort unten ersticken. Wenn sie die Stollen nicht richtig abstützten, dann konnten sie einstürzen. Wasser konnte plötzlich einbrechen und alle ertränken. Der Berg wehrte sich dagegen, dass sie ihm seine Schätze entrissen. Eines Tages kamen Oswald Barthel und seine Kameraden nicht mehr zurück. Die herbeigeeilten Retter mit ihren einfachen Werkzeugen standen machtlos vor dem eingestürzten Stollen. 1508 war das. Der Berg hatte sich Oswald Barthel genommen und gab ihn nicht wieder her. Vorerst nicht. Doch der Berg hatte noch viel Erz herzugeben, und neue Generationen von Bergleuten schlugen neue Gänge in ihn hinein. Sechzig Jahre später trafen sie auf den alten Stollen. Er war teilweise überflutet. In einer Mulde fanden sie ihn. Oswald Barthel lag so da, als wäre er eben eingeschlafen. Man konnte seine Gesichtszüge erkennen, auch die Kleidung war vollständig erhalten. Arsenhaltiges Wasser soll alles konserviert haben. Die Beerdigung war ein großes Ereignis. Die Leichenpredigt ist bis heute in den Kirchenbüchern erhalten geblieben. Der Pfarrer sagte, er selbst in seinem einunddreißigsten Jahr halte die Gedächtnispredigt für einen, der dreißig Jahre vor seiner Geburt gestorben sei. Am Grab stand eine uralte Frau. Ganz in Schwarz und mit einem schwarzen Schleier. Sechzig Jahre zuvor hatte Oswald ihr die Ehe versprochen, am Sonntag nach dem Unglück sollte Hochzeit gehalten werden. Der Brautkranz war schon geflochten. Sie blieb ihrem Verlobten immer treu. Jetzt stand sie am Grab, den Brautkranz in den Händen, und sah ihren Geliebten genauso jung und frisch, wie er sie vor sechzig Jahren verlassen hatte. Genau so, wie sie sich an ihn erinnerte. Nur wenige Tage später folgte sie ihm nach. Und so sind die beiden nach so langem Warten endlich wieder vereint. Auf ewig. Tief im Berg halten sie nun ihre Hochzeit.
»Die lange Schicht« heißt die Geschichte, die sich um die wenigen historischen Fakten gesponnen hat.
»Verstehen Sie jetzt, Albrecht? Die beiden Leichen, die man vor fünfundzwanzig Jahren im Toten Schacht gefunden hat, waren ebenfalls nicht verwest. Nachdem sie fünfzehn Jahre dort gelegen hatten.« Berghaus ist aufgestanden und stolziert einmal quer durch den Raum zum Schaufenster. Die Straße draußen ist leer. »Die Idee ist also ein historischer Vergleich. Für den aktuellen Fall könnte man Parallelen ziehen.«
»Ah ja. Jaja.«
»Eine vergleichende Analyse der beiden Fälle. Eine chemische Analyse. Eine Prüfung der historischen Fakten der Oswald-Barthel-Geschichte. Spezifische Eigenschaften des Wassers, historische Hintergründe des Falles… Ein Fachtext! Ich brauche Literatur zum Thema. Verwesen von Leichen, chemische Prozesse, Konservierung. Schauen Sie im Katalog der Universitätsbibliothek, was Sie finden können. Sie haben doch meinen Account? Ja? Dann können Sie auch gleich bestellen. Ich bin nächste Woche wieder dort und hole mir die Sachen dann ab. Und damit ich sehe, dass Sie wirklich richtig bestellt haben, drucken Sie mir bitte die Bestätigungen aus, ja? Ich möchte nicht umsonst in die Bibliothek gehen. Sie haben doch meinen Account?«
Albrecht dreht sich wütend weg.
Was mache ich mir hier vor?, denkt Berghaus dabei. Die Sache ist genau fünfundzwanzig Jahre her. Man kennt die Geschichte in der Gegend. Es gibt Gerüchte, warum sich die beiden umgebracht haben. Es gibt auch sonst Gerüchte über sie. Die Familie ist bekannt, besitzt einen der größten Betriebe in der Stadt. Das soll dem Gebirgsboten neue Leser bringen
2
Berghaus schlägt die Akte auf, die Albrecht ihm zusammengestellt hat. Sie ist dünn, und dennoch hat er eine ganze Woche dafür gebraucht. Ein Foto liegt oben. Und sofort bereut er, nicht bis nach dem Essen gewartet zu haben. Es ist ein Foto der beiden Toten. Berghaus schlägt die Akte eilig wieder zu. Schluckt. Schaut sich im Lokal um. An der gegenüberliegenden Wand sitzt ein junges Pärchen. Links am Fenster zum Hof vier ältere Damen in grauer Kleidung. Funktionskleidung und Funktionsschuhe. Touristen also. Die Gegend hat ja Landschaft. Und Sehenswürdigkeiten.
Berghaus rückt die Akte wieder gerade, nein, sie liegt immer noch nicht parallel zur Tischkante. Noch einmal stößt er mit dem Mittelfinger dagegen. Parallel. Er atmet tief ein und schlägt den Aktendeckel wieder auf. Er schluckt noch einmal. Das Foto der beiden. Ein Mann und eine Frau. Ihre Haut ist schneeweiß. Sie leuchtet fast. Auch auf dem ausgebleichten Fotopapier. Wie zwei Statuen aus Marmor, aber ohne Struktur, ohne Maserung. Oder wie poliertes Holz. Oder weiß lackierte Puppen. Es sind genau fünfzehn Fotografien, die die beiden Toten zeigen, genau so, wie man sie aus dem Schacht geborgen hat. Ein Mann und eine Frau. Auf dem ersten Bild hat man sie auf eine helle Decke gelegt. Er liegt oben.
Sein Körper ist gerade, folgt einer unsichtbaren Linie. Die Arme rechts und links am Körper anliegend, parallel an beiden Seiten. Nur der Kopf des Mannes ist leicht zur Seite gedreht. Es beginnt dort, wo ihre rechte Wange ist, und reicht bis zu ihrem Hals hinunter. Berghaus hält das Foto näher ans Licht. An ihrer rechten Seite ist das Gesicht der Frau eingedrückt, und wie ein Puzzlestein hat sich der Schädel des Mannes in sie eingefügt. Er hat blonde Haare, die an seinem Schädel kleben, als wären sie mit Farbe aufgemalt.
Ihr Körper sieht hingegen völlig anders aus. Sie wächst wie eine Pflanze um den Mann herum, umschlingt ihn, umgreift ihn. Ihr Leib liegt quer unter seinem. Die rechte Hand hat sich in seine Hüfte gekrallt. Seine Jacke ist dort deutlich eingedrückt, hat an dieser Stelle sogar kleine Risse bekommen. Sie hält ihn fest gepackt– oder sie umarmt ihn. Der linke Arm hingegen holt weit aus, greift hinaus in den Raum, weg von dieser verwachsenen Einheit. Weist anderswo hin, so als wollte sie etwas von draußen, außerhalb dieser Symbiose zweier Körper, zu fassen bekommen. Der Arm ist in der Mitte zerbrochen.
In der Akte liest Berghaus, der Finder habe im Wasser heftig um sich geschlagen.
Hinter seinem blond bemalten Hinterkopf schaut ihr Gesicht hervor– Wangen, Stirn, Kinn, Nase. Bleich, weiß, glatt. Ihr Teint ist wie Porzellan. Ihre Züge sind sehr scharf, die Konturen klar. Ihre Haare sind dunkel, kräftig, noch immer leicht gelockt, und nur mühsam gezähmt. Ihr linkes Auge ist noch halb geöffnet, milchig und leer. Die Pupille ist hinter einem dichten Schleier aus Moder verborgen, wächsern und verfault. Zwischen den Augenlidern schwimmt nur noch eine unscharfe graue Masse.
Dieses Auge wirkt am befremdlichsten auf ihn. Ihr Auge ist das Einzige, das ihm sagt, dass es sich auf dem Bild nicht um eine Schaufensterpuppe oder eine Statue, sondern wirklich um eine tote Frau handelt.
Auf den anderen Bildern liegen die Körper getrennt. Einzeln auf metallisch hellem Untergrund. Allein wirkt ihr verdrehter Leib verloren, und dennoch lässt sich die Form des Mannes in dem von ihr umschlossenen leeren Raum erahnen. Sein Körper ist immer noch die gleiche gerade Linie. Nur der Kopf ist leicht zur Seite geneigt. Und sein Gesicht…
Berghaus schluckt heftig, tastet nach einem Wasserglas, doch das Wasser kommt ihm wieder hoch.
Da ist kein Gesicht. All seine Konturen sind in ihrer Seite geblieben, als man die beiden getrennt hat. Es ließ sich nicht herauslösen, steht in der Akte. Wo zuvor einmal Wangen waren, hängen Fetzen aus Haut und Knorpel wie zerknülltes Papier. Dazwischen statt Nase, Augen, Kinn– all dem, was ein menschliches Gesicht ausmacht– nur ein großes Loch, das den Blick auf die Schädelknochen freigibt. Die Zähne blecken hervor, der Ansatz des Nasenbeins, alles merkwürdig verformt. So als hätte eine Kraft selbst Zahnreihe und Knochen eingedellt und nach hinten gedrückt.
Das ist zu viel für ihn, Berghaus drückt angewidert seine Augen zusammen, tastet nach dem Bild und schiebt es ganz hinten in die Akte. Als er seine Augen wieder öffnet, steht die Wirtin vor ihm und wartet ungeduldig auf seine Bestellung.
»Später«, presst er mit gurgelnder Stimme hervor. »Später.« Und schluckt Speichel herunter.
Sie hieß Martina Sandorn, geboren 1946. Studierte einige Jahre Lehramt für Deutsch und Geschichte, arbeitete zudem als Wäscherin, wurde dann aber in der Buchhaltung der Firma Wimpel tätig. Warum ein Studium, um dann in der Buchhaltung zu arbeiten oder gar als Wäscherin? Was für ein merkwürdiger Lebenslauf für die damalige Zeit, als Lebensläufe gemeinhin viel geradliniger verliefen. Sechsundzwanzig war sie, als sie gestorben ist. Einundvierzig wäre sie im Jahr 1987 gewesen, als man ihre Leiche fand. Der Tod hat ihre Jugend konserviert. In der Akte steht auch sein Name. Hans Sandorn, ihr Ehemann. Geboren 1940 in Chemnitz, Posamentenfacharbeiter, ebenfalls bei der Firma Wimpel angestellt. Sechs Jahre älter als seine Frau. Mit zweiunddreißig Jahren gestorben.
Den Zeitraum ihres Todes hat die Polizei rekonstruieren können. Im Juni 1972 waren sie zusammen in einen Urlaub an die Ostsee gefahren. Am Sonntag, dem 11.Juni, kamen sie nachmittags in Warnemünde an. Eine lange Zugfahrt hatten sie hinter sich. Hans Sandorn hat das Anmeldeformular im Ferienheim ausgefüllt. Es liegt der Akte bei. Seine große, ausladende Unterschrift geht quer über das linierte Papier. Eine Woche sollte dieser Urlaub dauern. Am Sonntag, den 18.Juni, hätten sie zurück im Erzgebirge sein sollen. Sie kamen nicht. Martinas Mutter, Klara Wimpel, versuchte am Sonntagabend, in Warnemünde anzurufen. Es gelang ihr nicht. Bis tief in die Nacht hinein nicht.
Am Montag, dem 19.Juni, erschienen Martina und Hans Sandorn nicht zur Arbeit.
Am Montagmorgen öffnete eine Putzfrau das Zimmer von Hans und Martina Sandorn. Zwei lederne Koffer standen auf dem Bett. In einem waren Hans Sandorns Kleidung und Unterwäsche noch sorgfältig zusammengefaltet. Der andere, größere, war leer. Im Kleiderschrank hingen Hemden von ihm, eine Jacke, eine dunkelgrüne Cordhose. Rasierpinsel und Rasierschaum im Bad. Eine Zahnbürste. Nur Geldbörse und Ausweis fehlten. Ein untrügliches Zeichen. Ihr Gepäck fehlte ganz.
Am Nachmittag des 19.Juni drang Klara Wimpel endlich nach Warnemünde durch. Am Abend erstattete sie Vermisstenanzeige. Da hatte die Volkspolizei bereits die Ermittlungen aufgenommen.
Die Grenztruppen waren alarmiert, suchten die Strände ab nach Resten einer Überfahrt, nach Teilen einer Hülle, in denen man ein Faltboot oder ein Surfbrett hätte transportieren können, nach zurückgelassenen Gepäckstücken. Den Eltern teilte man das nicht mit. Verdacht auf Republikflucht. Die beiden wären nicht die Ersten gewesen, die den gefährlichen und häufig tödlichen Weg über die Ostsee hinüber nach Dänemark gewagt hatten.
In den Jahren nach dem Mauerbau 1961 war ihre Zahl stetig angestiegen. Fünfundvierzig Kilometer entfernt von Warnemünde lag die Südspitze Dänemarks. Im Jahr zuvor war einer vom nahen Kühlungsborn aus fünfundzwanzig Stunden lang über die Ostsee geschwommen. Bis nach Fehmarn. Viele andere wurden abgetrieben. Wenn sie Glück hatten, wurden sie rechtzeitig von einem dänischen Fischkutter aufgelesen. Hatten sie Pech, ertranken sie oder wurden von der Küstenwache der DDR-Grenztruppen entdeckt. Die sechste Grenzbrigade betrieb siebzig Beobachtungstürme, mobile Kommandos mit Suchscheinwerfern, die fast zwanzig Kilometer weit auf das Meer strahlten.
Wann hatte man die beiden zuletzt gesehen? Nachdem Hans Sandorn seine große, runde Unterschrift auf dem Anmeldeformular hinterlassen hatte, waren sie niemandem mehr aufgefallen. Man kümmerte sich nicht sonderlich um die Urlaubsgäste, und die Zimmer wurden nur ein einziges Mal– und zwar nach der Abreise– gereinigt. Hatten sie im großen Verpflegungssaal gefrühstückt? Nein. Das wurde vom Küchenpersonal genau registriert. Jedes Frühstück war nummeriert. Verdächtig war das nicht. Manche Gäste kauften sich ein paar Brötchen im örtlichen Konsumgeschäft. Nicht jeder wollte die knapp gehaltenen Frühstückszeiten von sieben bis acht Uhr wahrnehmen.
Die Grenztruppen fanden nichts. Keine Spur eines Fluchtversuchs. Und sie suchten gründlich. Trotzdem. Insgesamt vierzig Kilometer Strand. Zwanzig Kilometer östlich und zwanzig Kilometer westlich von Warnemünde. Danach noch einmal weiter westlich und weiter östlich. Routine. Martina und Hans Sandorn blieben verschwunden. Fünfzehn Jahre lang.
»Hast du schon was gefunden?« Ulrike Leistner, die Wirtin, hat sich erneut vor seinem Tisch aufgebaut.
Berghaus fährt erschrocken hoch. Sie hat sich mit dem »Bergmeister« in den frühen Neunzigern einen Traum erfüllt, eine kleine, schmutzige Kneipe entdeckt, die alten Möbel aufgearbeitet, und zwar so, dass man ihnen ihr Alter noch ansieht. Die Theke und den alten Kachelofen hat sie unbearbeitet belassen und ein wenig moderne Kunst dazugestellt. Das »Bergmeister« sieht aus wie viele andere kulturbeflissene Kleinstadtlokale, hat dieselbe Küche– mediterran angehaucht, aber auch rustikal und regional. Kartoffeln und Fleisch stammen selbstverständlich aus der Region, was hier oben allerdings nicht den kleinen, tierliebevollen Bauern, sondern eine Agrar-AG meint, die am Rande der Stadt riesige Hallen mit Rindern und Schweinen füllt.
»Ähm. Nein, ich glaube…«
»Wir haben heute einen ganz wunderbaren Hirschbraten, frisch vom Bauern aus der Region.«
Die Agrar-AG ist im letzten Jahr auch in die Zucht von Wild eingestiegen und hat dafür einige bislang ungenutzte Wiesen eingezäunt, gleich einige Hektar, damit sich die Investition lohnt.
»Ich weiß nicht«, Berghaus räuspert sich umständlich. »Ich habe, glaube ich, nicht wirklich Hunger.« Noch einmal räuspert er sich. »Oder ich nehme heute einfach die Spaghetti mit Tomatensoße.«
»Pah, die nimmst du doch immer!« Ulrike Leistner lacht.
Es ist eigentlich ein Kindergericht, aber er mag die Soße, und seitdem er festgestellt hat, dass er sie mag, verzichtet er darauf, sich immer wieder neu zu entscheiden.
»Und noch ein Wasser, medium.«
»Wie immer, jaja.«
Berghaus will nicht geduzt werden. Doch offenbar hält man das in diesen Kreisen so. Kreative, Künstler, Alternative, alles Menschen, die Berghaus nicht versteht. Ulrike Leistner ist Gastgeberin eines kleinen Kreises Einheimischer, die Bilder malen und sie gerne anderen zeigen. Manchmal haben sie Künstler von auswärts zu Gast. Ulrike Leistner malt ebenfalls.
Einmal hat er ihre Einladung zu einer Vernissage angenommen. Es konnte ja nicht schaden. Er war eben erst in der Stadt angekommen und kannte hier niemanden. Die Gespräche waren eifrig. Die Farben… und das im Vergleich zum letzten Jahr. Was für eine Entwicklung Ulrike doch gemacht hat. Und immer dieses Duzen. Schrecklich. Und dieser Realismus da, ein bisschen die Neue Leipziger Schule. Arno Rink– so ein tolles Stillleben. War ich doch zum Galerierundgang und habe da einen großartigen jungen Maler entdeckt. Noch ganz unbekannt. Den müssen wir auch einmal einladen. Sie gaben sich kenntnisreich. Fand Berghaus.
Als Professor nahm man ihn hier gerne auf, sah seine Anwesenheit als Bereicherung. Professoren unterstellten sie Weltläufigkeit und einen natürlichen Sinn für Stil und Ästhetik. Leider hatte er keine Ahnung, wovon sie sprachen. Er sah Farben und Formen, die in zufälliger Weise miteinander kombiniert waren. Kunst. Ohne Muster und Struktur. Wer verflucht noch mal war Rink? Welche Schule? Jede Tabelle mit statistisch erhobenen Daten nur zweier banaler Variablen sagte ihm mehr als so ein bemaltes Stück Leinwand. Die anderen waren freundlich. Doch als er ihre Fragen und Kommentare immer wieder mit ratlosem Schweigen beantwortete, wandten sie sich von ihm ab. Irgendwann reagierte er nicht mehr auf die Einladungen, die einen Holzschnitt auf der Stirnseite trugen.
Die Akte wurde erst fünfzehn Jahre später fortgeführt. September 1987. Sie war dazu von der Dienststelle in Rostock an die nun zuständige Dienststelle in Karl-Marx-Stadt am Rande des Erzgebirges geschickt worden. Zwei Hobbybergleute, Jens Richter und Matthias Müller, zweiundzwanzig und dreiundzwanzig Jahre alt, hatten sich illegal Zugang zum sogenannten »Toten Schacht« verschafft. Jens Richter war in den Schacht eingestiegen und hatte dabei die beiden Leichen entdeckt. Sie befanden sich in einem außerordentlich guten Erhaltungszustand und wiesen kaum Verwesungsspuren auf.
Seit dem 11.Juni 1972 hatte von Martina und Hans Sandorn jede Spur gefehlt. Es ließ sich nicht mehr ermitteln, wann genau sie von der Ostsee ins Erzgebirge zurückgekehrt waren. Blieb noch eine Frage zu klären: Konnte es ein Unfall gewesen sein, ein unglücklicher Sturz in die Tiefe? Ein Jahr vorher waren spielende Kinder beinahe in den Toten Schacht gestürzt, weil sie ihm zu nahe gekommen waren. Ein Junge rutschte ab, bekam aber zu seinem Glück noch einen Ast zu fassen und konnte sich wieder nach oben ziehen. Danach hatte man einen Zaun rund um das Loch und die kleine Abraumhalde daneben gezogen, der erst viele Jahre später wieder entfernt wurde, nachdem man den Schacht mit Betonträgern verschlossen hatte.
1972 konnte niemand zufällig in den Schacht stürzen. Man musste über den Zaun klettern, an dem »Lebensgefahr« unter einem gemalten Totenkopf stand. Man musste sich über das Geröll und durch das Gebüsch schlagen. Warum sollten das zwei Menschen tun, die etwas anderes vorhatten, als sich in die Tiefe zu werfen?
Die männliche Leiche hatte Verletzungen am Hinterkopf. Der Schädel war gebrochen und wies einen vertikalen Spalt auf. Das konnte durch den Sturz in den Schacht passiert sein, als Hans Sandorn im freien Fall an die Stollenwand geschlagen war. Die Lage des Spaltes stimmte mit einem schnellen, abwärtsgerichteten Schlag überein. Vielleicht hatte ihn diese Verletzung sofort getötet. In jedem Fall verlor er das Bewusstsein. Die gerade Körperhaltung, in der er gefunden wurde, deutete darauf hin, dass er genau so ins Wasser gestürzt war und sich danach nicht mehr bewegt hatte. Martina Sandorn hingegen wies keine äußerlichen Verletzungen auf. Aus ihrer Körperhaltung konnte geschlossen werden, dass sie ihren Mann gepackt und umarmt hatte. Sie war vermutlich ertrunken. Wie lange mochte es gedauert haben, bis sie schließlich starb? Sie musste ihn bis zuletzt festgehalten haben. Nur so ließ sich erklären, dass die Körper so eng miteinander verschmolzen waren.
Es gab für die Ermittler keinen Grund, an der Selbstmordthese zu zweifeln. »Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen. Martina und Hans Sandorn haben sich in den Toten Schacht gestürzt, um ihrem Leben gemeinsam ein Ende zu setzen.« Lagezeichnung der Fundstelle in der Anlage. Eine These über die Gründe des Suizids stellt die Akte nicht auf. Nur kurz wird darauf verwiesen, dass sowohl Martina wie auch Hans Sandorn eine feindlich-negative Einstellung zum sozialistischen Staat hatten. Das konnte vieles heißen, aber war es Grund genug für einen Selbstmord? Weitere Untersuchungen hielt man damals nicht für notwendig.
Berghaus dreht dieses letzte Blatt um. Ende. Hier brechen die Ausführungen ab. Er ist enttäuscht. Das ist wenig. Sehr wenig. Er gießt den letzten Rest Wasser ins Glas und kippt es in einem Zug hinunter. Es hat schon länger aufgehört zu perlen und schmeckt nur noch wie saures Leitungswasser. Ihm ist übel. Sein Magen dreht sich, und er bekommt die Bilder nicht aus seinem Kopf. Kein Gesicht. Kein Gesicht, nur offener Knochen, bleckende Zahnreihen.
Das Essen lässt er heute stehen. Ulrike Leistner dreht sich eilig nach ihm um, als er geht.
»Jan«, ruft sie ihm nach.
»Hm?« Berghaus drückt die Türklinke herunter und schlüpft schnell in den Türspalt hinein.
»Nächste Woche trifft sich unser Kunstkreisel wieder.«
Er kann leider nicht so tun, als hätte er sie nicht gehört. Ärgerlich.
»Aha.«
»Sagst du Sascha Bescheid?«
»Sascha?«
»Deine Tochter.«
»Ja, meine Tochter, ich weiß. Sascha, so heißt sie.«
Ulrike Leistner lacht kurz. »Im Gegensatz zu dir kommt sie regelmäßig zu uns.«
»Ach wirklich, das wusste ich gar nicht«, sagt er abwesend.
»Du weißt nicht allzu viel von deiner Tochter, nicht wahr? Sie hat Talent…«
Berghaus nickt stumm und drückt die Tür hinter sich zu.
3
Nach dem Essen holt sich Berghaus immer die Tageszeitung und einen Schokoriegel in einem winzigen Lädchen, das nur aus einer Theke mit Zeitungsauslagen und Reihen bunt verpackter Snacks besteht. Im Verkaufsraum haben nicht mehr als drei Kunden Platz. Der vierte muss draußen warten. Hinter der Ladentheke quetschen sich Frau Schmidt, eine kräftige Siebzigjährige in blauer Kittelschürze, aus der ihre nackten Arme quellen, und ihr Mann Heinrich nebeneinander. »Professor Berghaus«, grüßt sie ihn freudig, beugt sich über die Theke und tastet nach der Zeitung und dem Schokoriegel. »Mein Mann fand Ihren Artikel über die Geschichte der Herrenmühle und das Mühlenamt ja so interessant. Das kannte er ja noch gar nicht.«
Ihr Mann Heinrich nickt eifrig.
»Aha«, Berghaus kramt in seiner Geldbörse. Er muss es doch passend haben.
Ihr Mann Heinrich beugt sich vor und fängt wieder an zu erzählen. Er gehört zu einer Gruppe älterer Herren, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, von jedem Haus in der Altstadt die Geschichte aufzuschreiben. Berghaus will sich weder seine neuesten Entdeckungen anhören noch mit dem Alten sprechen.
Gar kein Kleingeld heute? Verdammt, dann muss er länger als nötig hierbleiben. Und dieses Geplapper anhören. Nur einen Euro, keine Centmünzen?
»Ein Euro achtzig, großartig, ich habe es doch passend«, sagt Berghaus triumphierend, wirft das Geld auf die Theke und verschwindet aus dem Laden, während Heinrich gerade einen neuen Satz beginnt.
Heute nimmt er einen kleinen Umweg zurück zum Büro, an der großen Kirche vorbei und dann durch eine gewundene Gasse parallel den Berghang entlang. Links führen die gepflasterten Straßen weiter den Berg hinauf, rechts steil nach unten. Brachflächen wechseln sich mit schmutzig grau verputzten Garagen und Einfahrten aus festgefahrenem Schlamm ab. Bis an den sorgfältig mit Granitplatten belegten Gehsteig heran wuchern Grashalme, Löwenzahn, Kräuter und kleine Büsche. Direkt gegenüber hat man damit begonnen, eine dreigeschossige Werkstatt mit etagenhohen Fenstern und weiten Balkonen zu versehen. Weiter zu vernagelten Fenstern, sorgfältig aufgearbeiteten Haustüren aus dunklem Holz, Bretterzäunen, Gärtchen, einem Gartenzwerg, einem Hund, der wütend anschlägt, einem in den Blockrand gebrochenen Parkplatz aus rechtwinklig verlegten Betonsteinen, einer traurig beigen Fassade mit eingeschlagenen Fenstern und abblätternder Farbe, einem hohen verklinkerten Fabrikgebäude mit seitlich angebautem Fahrstuhl aus Metall und direkt daneben einem einstöckigen Häuschen mit blauen Fensterläden, wild wuchernden Blüten im Garten.
Berghaus geht unschlüssig an diesem Durcheinander von Stadt vorüber. Scheppernd stößt er die Ladentür auf. Albrecht schaut nicht von seinem Schreibtisch auf, der gegenüber dem Eingang steht, und kaut schmatzend an einem Sandwich, das er vom Bäcker nebenan geholt hat.
Gut, dass Stefan gleich vorbeikommt.
Stefan Wimpel gehört die größte Posamentenfabrik im Ort. Es ist die größte Fabrik aus dem kläglichen Rest einer einst stolzen Branche, die in der Stadt viele stolze Bürgerhäuser und Villen mit Säulen und Simsen, geschmiedeten Eisengittern und üppigen Portalen hinterlassen hat. Es gibt noch drei Betriebe, die die kunstvollen Textilien herstellen, Wimpel ist der mit Abstand erfolgreichste. Wenn irgendwo auf der Welt ein opulentes Opernhaus mit schweren samtenen Vorhängen verziert wird, mit Stoffbehängen vor den Wänden, sei es in Russland, Südamerika oder Italien, dann ist Wimpel mit seinen Borten und Quasten dabei.
Sie hieß Martina Sandorn, geborene Wimpel. Stefans Schwester.
Berghaus hatte Stefan Wimpel seinerzeit im örtlichen Mittelstandsclub kennengelernt. Dort hatte er sich nach seiner Rückkehr in die Stadt zuerst vorgestellt, in der Hoffnung, viele angemessene Kontakte zu finden. Berghaus gab einige soziologische Allgemeinposten zum Besten, zur Bevölkerungsentwicklung etwa, die hier oben inzwischen viel diskutiertes Thema war und die Unternehmer unter dem Schlagwort »Fachkräftemangel« aufschrecken ließ. Interessiert hörten sie ihm zu, wie er über Ursachen und Folgen des Einwohnerrückgangs dozierte.
Dass dies gar keines seiner Forschungsthemen war und er sein Wissen aus seltenen Gesprächen mit einem Kollegen namens Selke bezog, dessen Büro an der Universität zwei Türen neben seinem eigenen lag, behielt Berghaus wohlweislich für sich. Berghaus trat auf einer ihrer Versammlungen als Gastredner auf. Er hatte Selkes Vorlesungsskripte vom Institutsserver kopiert und dessen Namen durch seinen eigenen getauscht. Berghaus zeigte bunte Grafiken und Diagramme mit fallenden Linien. Die Zuhörer waren beeindruckt und nickten eifrig.
Der Vorsitzende schritt laut klatschend und mit betroffener Miene nach vorne. So habe man das noch nie gesehen. Man sei sehr froh, dass eine Kapazität wie Professor Berghaus ihnen die Augen geöffnet habe. Im Laufe des Abends erzählten ihm rotgesichtige, feiste Männer mit Schweißperlen auf der Stirn bedeutungsschwer von Schnüren, Maschinenteilen, Solarmodulen, Möbeln, Federn und Batterien für Automobile.
»Autobahnanschluss«, blaffte ihn ein braun gebrannter Vierzigjähriger mit schiefem Mittelscheitel und protziger Uhr an, packte seinen Arm und ließ ihn nicht wieder los. Ein Greis mit akkurat gebundener Fliege und weißem, gestutztem Bart fiel ihm lautstark ins Wort und begann, mit wedelndem Finger zu dozieren. Berghaus hörte noch einmal »Autobahnanschluss«. Der Greis trank aus seinem Weinglas und sprudelte große Tropfen wieder aus. Seine Augen funkelten unter den buschigen Augenbrauen, die karierte Fliege an seinem Hals tanzte und schien ihm die Luft zu nehmen. Eine kräftige Frau mit bunter Bluse, hochgeföhnter Dauerwelle und goldener Brille brach in die Runde ein, schüttelte energisch den Kopf und wiederholte: »Autobahnanschluss.«
»Das war aber nichts wirklich Neues«, hörte Berghaus plötzlich von hinten. Erschrocken drehte er sich um. Dort stand ein Mann mit randloser Brille, dunklen Haaren und grauen Schläfen. Etwa sein Alter, aber größer und er wirkte deutlich jünger. Sportlich. Trainiert. Schmal geschnittener, anthrazitfarbener Anzug. Gestärktes kariertes Hemd, die oberen zwei Knöpfe offen. Braune, sehr teuer aussehende Schuhe, gleichfarbiger Gürtel und eine offensichtlich sehr teure Uhr. Glashütte, Erzgebirge.
Stefan Wimpel hatte während des ganzen Vortrags vorn in der Ecke gesessen, den Blick zum Smartphone gesenkt, manchmal etwas eingetippt. Nur wenn einer seiner Nachbarn sich zu Wort meldete, hatte er kurz aufgeschaut und mal anerkennend, mal gönnerhaft genickt. Es zählte hier offensichtlich etwas, wenn Stefan Wimpel anerkennend nickte. Berghaus riss sich von dem schiefen Mittelscheitel los, der keine Notiz davon nahm und mit dem Greis und der kräftigen Frau immer noch »Autobahnanschluss« wiederholte.
»Nein, war es nicht«, hatte er verwirrt geantwortet. »Natürlich nicht. Das sind Inhalte, die wir an meinem Institut auch unseren Studenten beibringen.«
»Ja«, hatte Stefan Wimpel gesagt. »Aber es hat immerhin gereicht, die Leute hier im Saal zu beeindrucken.« Wimpel deutete auf Berghaus’ halb leeres Weinglas. »Lassen Sie uns gehen, ich weiß, wo wir einen besseren Wein bekommen.«
Stefan Wimpel wurde zu einem der wenigen Menschen in dieser Stadt, mit denen Berghaus sich öfter traf und mit dem er sich irgendwann sogar duzte.
»Herr Wimpel kommt etwas später«, murmelt Albrecht hinter seinem Schreibtisch hervor. Er schaut immer noch nicht hoch und kaut weiter. »Der will es sowieso nicht. Der will seinen Namen nicht in unserem Magazin lesen. Ich sage es Ihnen gleich.«
4
Stefan Wimpel will tatsächlich nichts davon hören. »Es geht um meine Schwester, Jan! Denkst du, wir wollen den ganzen Mist von damals noch einmal durchmachen? Weißt du, wie das damals war, als Martina sich umgebracht hat? Kannst du dir vorstellen, wie unsere Familie gelitten hat?«
Albrecht blickt neugierig hinter seinem Schreibtisch hervor. Er kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Stefan, du verstehst nicht… Ich will doch–«
»Ich verstehe sehr gut. Wenn du den Beitrag machst, sind wir geschiedene Leute. Punkt.«
»Stefan…«
Wimpel hat sich umgedreht. Seine Hände beben. Er steckt sich eine neue Zigarette an. Berghaus umkreist ihn, steht wieder vor ihm.
Wimpel nimmt einen tiefen Zug. »Ich will einfach nicht, dass das Gerede wieder losgeht. Und die Gerüchte«, sagt er. »Es war damals schlimm genug.«
»Gerüchte?«
»Als die Leute glaubten, Martina sei mit ihrem Mann im Westen, da waren sie leise. Aber als man ihre Leichen gefunden hat… da überschlugen sie sich.«
»Welche Gerüchte denn?«
»Hast du nie davon gehört?«
»Nein, Stefan.«
»Dann will ich auch nichts dazu sagen.«
»Aber vielleicht wäre es wichtig?«
»Sicher nicht. Es hat alles noch viel schwerer gemacht nach all den Jahren der Ungewissheit, und dann noch die Blicke. Soll ich dir was sagen, Jan? Für mich waren diese Blicke das Schlimmste. Nicht weil sie tot war. Nein. Eigentlich war es gut, abschließen zu können. Aber diese Blicke. Die Wimpels, die hängen da mit drin, darauf lief es immer hinaus.«
Er hat immer leiser gesprochen. Berghaus hat sich hingegen endlich gefasst. Er ist jetzt wieder ganz ruhig.
»Das sind die Unterlagen?«, fragt Wimpel, dreht sich noch mal um und zeigt auf Berghaus’ Schreibtisch.
»Ja.«
»Kann ich einen Blick hineinwerfen?«
Berghaus zögert kurz. Übelkeit steigt in ihm auf.
»Natürlich.«
Wimpel überfliegt die Texte. Nichts, woran er sich sichtbar länger aufhält. Hat er die Fotos gesehen? Er schweigt eine Weile. Berghaus schaut ihn an.
»Sie war schön«, sagt Wimpel dann. »Wunderschön.«
Dann klappt er die Akte wieder zu.
»Das war sie«, antwortet Berghaus, »selbst auf den Fotos sieht man das noch. Nur ihr Auge ist so…«
»Ja.«
»So…«
»Ich weiß«, seufzt Wimpel und fährt fort: »Eigentlich habe ich sie überhaupt nicht gekannt. Sie war neun Jahre älter als ich. Sie war bereits in der Schule, als ich geboren wurde. Sie hatte ihren ersten Freund, als ich sieben war. Sie ging zum Studium, da war ich gerade neun. Als sie verschwunden ist, war ich siebzehn und hatte meine erste Freundin. Ich habe Martina erst danach kennengelernt, kennenlernen müssen. Meine Mutter erzählte immer wieder von ihr. So als müsse sie sich die Erinnerung an Martina tagtäglich einreden, um sie wachzuhalten. Um sie festzuhalten. Mein Vater hat das nicht ertragen. Er ist kaum noch aus seinem Zimmer gekommen. Er hat sich dort eingeschlossen. Stundenlang. Tagelang. Kam von der Arbeit, ging in sein Zimmer. Kam zum Essen heraus, saß am Tisch und schwieg. Ich kann mich nicht erinnern, dass er nach Martinas Verschwinden überhaupt noch mit meiner Mutter gesprochen hat. Also sprach meine Mutter mit mir. Ich war siebzehn, ich hatte eine Freundin. Ich wollte nicht über Martina sprechen. Ich habe meine Mutter irgendwann angeschrien, dass sie damit aufhören soll. Dass Martina uns verlassen hat, dass sie im Westen ist und uns vergessen hat. ›Sie ist gegangen ohne ein Wort und verschwendet keinen Gedanken mehr an ihre Familie. Also verschwende auch keinen Gedanken an sie!‹«
Wimpel schaut Berghaus tief in die Augen. Wartet auf eine Regung bei ihm.
Berghaus schweigt.
»Verstehst du das?«
»Was?«
»Dass ich so reagiert habe.«
Berghaus schweigt. Er versteht nicht. Er überlegt, was er davon für den Beitrag verwenden kann.
Martina ist in eine Familie geboren worden, die seit mehreren Generationen eine Posamentenfabrik besaß. 1946. Direkt nach dem Krieg. Die Fabrik war heil geblieben, doch viele Arbeiter waren gefallen. Andere suchten sich Arbeit in den Urangruben der Umgebung, die ein Vielfaches an Lohn bezahlten. In Zeiten wie diesen verlangte niemand nach teuren Posamenten. Sie nähten Kleidung aus alten Uniformen und Fallschirmseide. So begann es. Martina ging zur Schule, sie war begabt. Und sie war ein waches Kind, das durch die Fabrik streifte und durch die Stadt, die Felder und Wiesen rundherum. Das Bücher mit sich herumschleppte und oberhalb der Stadt in einer Höhle ein Versteck hatte, in dem sie alle las. Alle, die sie bekommen konnte, und das waren nicht viele in dieser Zeit. Ausgelesene, zerfledderte Klassiker, Abenteuerschmonzetten, Gedichte später. Mehr später. Allein in ihrem Versteck las sie, nach der Schule, manchmal am Wochenende. Nur wenige Freunde. Kaum jemand drang zu ihr durch.
Ist sie jemand, der sich umbringt? Kann man schon in ihrer Kindheit Anzeichen erkennen? Später, sagt Wimpel. Warte noch.
Dass sie Abitur machen durfte, war nicht selbstverständlich. Als Tochter eines Fabrikanten, des Klassenfeindes. Dass sie studieren durfte, noch weniger.
»Sie wollte Lehrerin werden. Immer schon. Und unbedingt, davon ließ sie sich nicht abbringen. Und das hat sie dann auch studiert. Meinem Vater hat das gar nicht gefallen, ihm hat nichts gefallen, was eine Nähe zu diesem Staat bedeutete. Martina aber hatte sich früh engagiert. Pionierorganisation, FDJ. Vielleicht war es auch eine Rebellion gegen den Vater. Die beiden haben sich nie verstanden. Dass sie ein Lehramt studieren durfte, war dennoch ungewöhnlich.«
Berghaus schweigt, wiegt fragend den Kopf.
»Bestechung«, sagt Wimpel, »ganz banal. Mit ein paar teuren Sachen aus dem Werk haben die Genossen ihre Meinung geändert. Vater wollte Martina natürlich im Betrieb haben. Sie sollte das Unternehmen weiterführen. An mich hat er nicht gedacht. Aber er hat sie dennoch unterstützt. Er hat sie vermutlich doch zu sehr geliebt, um ihr den Wunsch abzuschlagen. Den Wunsch, zu studieren.«
»Sie hat aber nie als Lehrerin gearbeitet. Ich habe gelesen, sie war Wäscherin?«
»Martina war aufbrausend, sie war absolut in allem, was sie tat. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich mich nie mit ihr verstanden habe. Sie wollte immer alles richtig machen, immer perfekt sein, gnadenlos gerecht. Mit Kompromissen gab sie sich nie zufrieden. Dann kam Prag. Du weißt, die russischen Panzer sind 1968 auf ihrem Weg über die Grenze durch unsere Stadt gefahren.«
Der Einmarsch der Roten Armee nach dem Prager Frühling, Berghaus nickt.
»Martina war an diesem Wochenende hier, ich war mit ihr zusammen auf der Straße. Ich war damals zwölf oder dreizehn Jahre alt. Ich erinnere mich an den Lärm der Panzer, ihre Ketten, die auf die Pflastersteine schlugen. Eine endlose Reihe von Panzern und Lastwagen. Wie eine Raupe aus Metall. Die ganze Straße brüllte von ihrem Lärm. Ich musste mir die Ohren zuhalten, und ich hatte wahnsinnige Angst. In einem Haus gegenüber hat eine alte Frau das Fenster aufgerissen und die ganze Zeit geschrien: ›Es ist wieder Krieg! Es ist Krieg! Krieg!‹ Ich wollte weglaufen, aber sie hielt mich fest. Martina riss mir die Hände von den Ohren. ›Sieh dir das an! Hör genau hin! So sind sie! Sieh genau hin und schau dir diese Fratze an!‹ Tränen flossen über ihre Wangen. Ihre Wangen wurden ganz nass. Drei Tage später an der Universität ist sie im Seminar aufgestanden. Sie wolle darüber diskutieren. Die Panzer, die durch die Stadt gerollt seien. ›Und wann marschiert Deutschland wieder in Prag ein? Ist es wieder so weit? Früher die Braunen und jetzt die Roten?‹ Panzer seien immer gleich, egal, welche Farbe sie hätten.«
»Damit war ihr Studium vorbei?«
»Ja. Kurz vor ihrem Abschluss wurde sie von der Universität geworfen. Man sagte ihr, sie solle sich in der Produktion bewähren. Dann wolle man weitersehen. Die ›Produktion‹ war die Stadtwäscherei. Den ganzen Tag im Nebel aus Wasserdampf und Chemikalien. Ihre Hände quollen auf, und die Waschfrauen quälten sie. Eine, die nicht zu ihnen gehörte. Eine, die von draußen kam, sich für etwas Besseres hielt. Das wollten sie ihr austreiben. Sie musste die schmutzigsten Arbeiten machen. Die stinkende Krankenhauswäsche, die Vorbehandlung, mit den bloßen Händen in den Dreck.«
»Das Studium konnte sie nicht mehr beenden?«
»Keine Chance. Irgendwann muss es ihr klar geworden sein. Sie konnte dann wenigstens zurück in unseren Betrieb. Sie hat es nie gewollt, aber immerhin war sie aus diesem Waschkeller heraus.«
»Meinst du, das hat sie gebrochen? Hat sie sich deswegen das Leben genommen?«
Stefan schweigt eine Weile. »Kann sein. Ich weiß es nicht. Wir haben damals kaum noch miteinander gesprochen. Sie war aufbrausend, beleidigend. Unglaublich beleidigend. Ich habe sie damals wirklich gehasst. Ich habe mich gefreut, als sie weg war. Kannst du dir das vorstellen, Jan? Damals habe ich mich gefreut.« Wimpel schüttelt den Kopf. Sein Blick sinkt nach unten.
Schade, denkt Berghaus. Das ist alles noch zu vage für seinen Artikel.
»Was ist mit Hans Sandorn?«, fragt er.
»Ihr Mann?« Wimpel überlegt. Sein Gesicht wird gleichgültiger. »Die beiden haben sich kennengelernt, als Martina wieder in unserem Betrieb war. Mitte 1970 muss das gewesen sein. Er ist Posamentierer gewesen. Hat an den Maschinen gearbeitet. Grober Kerl. Aufschneider, aber gut aussehend, groß, blond, kräftig. Fleißig, aber irgendwie roh auch und nicht der Hellste.«
»Das klingt nicht nach jemandem, für den sich Martina interessiert hätte«, sagt Berghaus.
»Nein, eigentlich nicht. Er hat vor ihr viele Beziehungen gehabt, auch im Betrieb. Seine Grobheit wirkte offenbar auf viele Frauen anziehend.«
»Und auf Martina?«
»Er hat es zumindest lange versucht bei ihr. Bestimmt ein Jahr. Erstaunlich, dass einer wie er so viel Geduld hatte. 1971 haben sie dann geheiratet.«
»Und war er auch…? Ich meine, warum hat er sich umgebracht?«