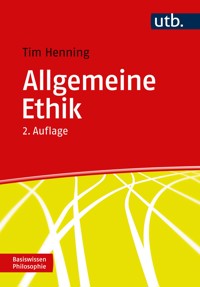7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
»Ist eine Lüge auch dann verboten, wenn sie eine Notlüge ist?« Diese Frage hat sich sicher jeder schon gestellt. Kant hat diese Frage sehr entschieden beantwortet: Um moralische Fragen in strenger und objektiver Weise zu entscheiden, müssen wir nur einen einzigen Grundsatz erfassen, das »Sittengesetz«. Tim Hennings Band entstand aus einer Vorlesungsreihe und führt klar und einfach in Kants Theorie des moralisch Richtigen und Falschen ein, eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte der normativen Ethik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tim Henning
Kants Ethik
Eine Einführung
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
© 2016 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2016
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961085-6
Inhalt
Einleitung
Wir alle sind mit moralischen Fragen vertraut: »Ist eine Lüge auch falsch, wenn sie eine Notlüge ist?«, oder: »Muss ich mich nicht für den Kollegen stark machen, der von den anderen gemobbt wird?« Die normative Ethik ist eine Disziplin der Philosophie, die sich genau mit Fragen dieser Art befasst. Dabei sucht sie erstens ein systematisches Kriterium dafür, welche Handlungen richtig und falsch sind. Zweitens soll eine ethische Theorie aber auch erklären, warum bestimmte Handlungen richtig oder falsch sind. Was z. B. ist falsch am Lügen – was macht Lügen falsch?
Immanuel Kant (1724–1804) hat, neben vielen anderen Errungenschaften, einen wichtigen Vorschlag zu einer solchen Theorie des Richtigen und Falschen vorgelegt. Kant zufolge können moralische Fragen in strenger und objektiver Weise beantwortet werden. Dazu, so Kant, müssen wir nur einen einzigen moralischen Grundsatz erfassen, den er das »Sittengesetz« nennt. (Aus Gründen, die wir später kennenlernen werden, nennt er ihn auch »kategorischer Imperativ«.) Dieses Sittengesetz allein reicht aus, um zu erklären, welche Handlungen richtig und falsch sind und warum sie dies sind. Die Wahrheit des Sittengesetzes lässt sich dabei, so Kant, rein durch vernünftiges Nachdenken erkennen. Das Sittengesetz ist eine Vernunftwahrheit, so wie Sätze der Mathematik.
Ziel dieses Buches ist es, Kants Theorie des Richtigen und Falschen zu erläutern. Es gibt verschiedene Wege, auf denen man sich einer philosophischen Theorie sinnvoll nähern kann. Ein Weg wäre vorwiegend historisch – er würde nachzeichnen, wie sich Kants Ideen aus einer Geschichte von philosophischen Vorschlägen und Problemen entwickelt haben. Ein anderer Weg besteht darin, Kants Ethik primär so zu betrachten, wie er selbst sie verstanden hat – als eine Theorie mit Anspruch auf Wahrheit und Erklärungskraft und als eine Theorie, deren Argumente für sich selbst sprechen sollen.
Diese Einführung muss sich beschränken, und sie legt den Schwerpunkt vor allem auf diese zweite Herangehensweise. Sie soll Kants Argumente und Begriffe genau analysieren und die Implikationen der Theorie auf Plausibilität prüfen. (Freilich werden wir feststellen, dass philosophiegeschichtliche Verweise auch hierbei mitunter hilfreich sein können.)
Der erste Schritt in so einer systematischen Beschäftigung mit einer Theorie muss darin bestehen, zu erklären, inwiefern sie tatsächlich überzeugend ist – also die Gründe aufzuzeigen, die dafür sprechen, diese Theorie für korrekt zu halten. Erst wenn dies geschehen ist, sind wir in der Lage, Einwände und Probleme in ihrer Tragweite richtig einzuschätzen. Diese Einführung soll vor allem bei diesem ersten Schritt der Auseinandersetzung mit Kants Ethik behilflich sein.
Natürlich kommen auch Einwände zur Sprache. Kapitel 14 bis 17 widmen sich einer ganzen Batterie berüchtigter Schwierigkeiten für Kants Ethik. Aber auch diese Kapitel stellen die Probleme nicht nur dar, sondern suchen in Kants Theorie nach geeigneten Ressourcen, dieselben auszuräumen.
Jeder, der sich mit Kants moralphilosophischen Schriften befasst, wird schnell bemerken, dass Kant überaus starke und mitunter haarsträubende Ansichten zur Moral vertritt. Einige von ihnen werden wir kennenlernen – etwa seine Meinung, dass man auch dann nicht lügen dürfe, wenn dies nötig ist, um einen Unschuldigen vor einem Mörder zu schützen. Viele andere – etwa die Ansicht, dass man auch einem unterdrückerischen Staat keinen Widerstand leisten dürfe, oder seine extremen Ansichten zur Todesstrafe – können hier nicht diskutiert werden. Angesichts solcher Passagen ist es jedoch generell wichtig, zu bedenken, dass Kants persönliche Ansichten nicht immer diejenigen sein müssen, die sich aus Kants ethischer Theorie ergeben. Auch der Urheber einer ethischen Theorie kann sich über ihre Implikationen täuschen. Was hier auf dem Prüfstand steht, ist jedenfalls Kants ethische Theorie, nicht seine persönliche Meinung zu vielen ethischen Fragen.
Im Mittelpunkt der Darstellung steht Kants Argumentation in seiner Schrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1785. Diese Schwerpunktsetzung ist nicht ohne Alternative: Kant entwickelt seine Ethik in verschiedenen Werken, neben der Grundlegung vor allem in seiner Kritik der praktischen Vernunft (1788), Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) und schließlich in der späten Metaphysik der Sitten (1797). Zudem gibt es eine Vielzahl relevanter kleiner Schriften Kants und Vorlesungsmitschriften seiner Studierenden. Jeder dieser Texte hat seine Vorzüge. Speziell die späteren Schriften sind in einigen Punkten ausgereifter. Daher werden wir an einigen zentralen Stellen u. a. auf Einsichten aus der Metaphysik der Sitten (z. B. zum Thema unvollkommene Pflichten) und der Kritik der praktischen Vernunft (z. B. zum Verhältnis von Moral und Freiheit) zurückgreifen. Dennoch dient die Grundlegung nach wie vor den meisten Lesern als Einstiegspunkt in Kants Ethik. Und das ist nicht ohne Grund so: Viele seiner entscheidenden Ideen entwickelt Kant vor allem hier. Überdies, so soll dieses Buch zeigen, ist die Argumentation der Grundlegung sehr viel stringenter und überzeugender, als es auf den ersten Blick erkennbar ist.
Eine Einführung wie diese muss sich auch thematisch beschränken. Eine besonders empfindliche Einschränkung betrifft die politische Philosophie und die Rechtsphilosophie Kants. Diese Themen kommen in dieser Einführung fast gar nicht zur Sprache.1 Damit soll nicht etwa angedeutet sein, dass diese Themen weniger wichtig wären. Im Gegenteil, gerade in jüngerer Zeit wird Kants Rechtsphilosophie als ein origineller Beitrag ersten Ranges neu entdeckt (vgl. z. B. die spannenden Arbeiten von Weinrib 1995 und Ripstein 2009). Nur sind diese Themen derart komplex, dass sie einer eigenen Einführung bedürfen. Darüber hinaus ist ihre Beziehung zu Kants Ethik nach wie vor ein sehr umstrittenes Thema (vgl. z. B. Horn 2014).
Gänzlich Neues ist von einem Buch zu Kant natürlich kaum zu erwarten. Dennoch weicht diese Einführung in einigen Punkten von vergleichbaren Werken ab. Zum Beispiel betont sie die Einheitlichkeit und systematische Geschlossenheit der Theorie Kants. So argumentiert sie, im Gegensatz zum gegenwärtigen Mainstream, dass die verschiedenen Formulierungen, die Kant dem Sittengesetz gibt, tatsächlich in einem starken Sinne äquivalent sind (vgl. Kap. 10 und 11). Zudem bietet sie neue Gedanken zur Lösung einiger hartnäckiger Probleme an: So entwickeln Kap. 14 und 15 Lösungen für Schwierigkeiten mit sog. »Rätselmaximen«, Schwierigkeiten, die schon G. W. F. Hegel zu dem Urteil bewegt haben, Kants Ethik sei inhaltsleer. Desweiteren zeigt Kap. 16 schließlich, dass Kants Ethik starke und unmittelbare Pflichten gegenüber nicht-menschlichen Tieren ergibt. Und Kap. 18 zeigt, dass Kants Ethik wichtige Impulse für aktuelle ethische Probleme bietet, die sich z. B. im Kontext der Massentierhaltung, des Klimawandels oder der globalen Wirtschaft zeigen.
Kants Ethik ist kein einfaches Thema. Aber glücklicherweise lässt sich der Grundgedanke dieser Ethik recht einfach an Beispielen verdeutlichen. Bevor wir uns in die Diskussion der Details vertiefen, ist es hilfreich, sich in Kap. 1 einen ersten Eindruck vom sprichwörtlichen Wald zu verschaffen, damit wir ihn später nicht vor lauter Bäumen aus den Augen verlieren.
1 Der Grundgedanke
Ich stehe an der Haltestelle und warte auf die letzte Straßenbahn. Es sind nur ein paar Stationen bis nach Hause, und ich bin sicher, dass keine Kontrolleure mehr unterwegs sein werden. Muss ich wirklich eine Fahrkarte kaufen? Es wird kein nennenswerter volkswirtschaftlicher Schaden entstehen, wenn ich es nicht tue. Und das Restrisiko, doch erwischt zu werden, würde mich nicht schrecken. Trotzdem melden sich Skrupel. Es erscheint mir einfach falsch, schwarzzufahren. Mitten in der Nacht, obwohl mich niemand beobachtet, gehe ich zum Automaten und bezahle.
Niemand von uns ist moralisch perfekt. Wir fahren schwarz, kaufen unfair gehandelten Kaffee, ignorieren Bedürftige – von noch Schlimmerem ganz zu schweigen. Aber es gibt auch kaum jemanden, dem moralische Skrupel ganz fremd wären. Wie sind solche Skrupel zu verstehen? Was sagen sie? Und wer ist das eigentlich, der sich als »Stimme des Gewissens« zu Wort meldet?
Eine Antwort, die vielen von uns heute nahezuliegen scheint, lautet: Es handelt sich um ein moralisches Gefühl, das sich hier Gehör verschafft. In unserer Alltagssprache würden wir sagen: Moral ist eine Sache des »Herzens«, nicht der reinen Vernunft. Ebenso würden viele von uns sagen: Wenn ich »rein rational an die Sache herangehen« würde, würde ich den Fahrschein wohl kaum bezahlen. Natürlich sind moralische Gefühle eine überaus nützliche Sache. Sie machen uns zu kooperativen, sozialen Wesen – Wesen, mit denen man z. B. einen öffentlichen Nahverkehr unterhalten kann. Es ist daher nicht schwer, die Existenz solcher Gefühle zu erklären. Sie dürften ihren Ursprung zum Teil in Erziehung und Sanktionen, aber wohl auch in angeborenen, evolutionär erworbenen Dispositionen haben. Sind meine Skrupel also einfach solche Gefühle?
Kant widerspricht vehement. Moral, darauf besteht er mit Nachdruck, ist eine Sache der Vernunft, nicht des Gefühls. Wer fähig ist, einfach nur vernünftig über seine Vorhaben nachzudenken, kann auch ohne die Hilfe von anerzogenen oder angeborenen Gefühlen einsehen, was richtig oder falsch ist. Moralische Einsicht, so Kant, benötigt überhaupt keine Hilfe von irgendwelchen empirischen oder emotionalen Quellen. Sie ist rein vernunftbasiert, durchaus so wie mathematische Einsicht.
Die nächtliche Episode an der Haltestelle eignet sich gut dafür, zu illustrieren, was er meint. Ich erwäge also schwarzzufahren. Meine Vernunft stellt daraufhin die für sie charakteristische Frage: Gibt es in einer Situation wie dieser wirklich ausreichend gute Gründe, so zu handeln?
Diese Frage klingt unscheinbar, aber sie hat eine wichtige Eigenschaft: Sie ist ganz allgemein. Wenn es in einer Situation wie dieser gute Gründe zum Schwarzfahren gibt, dann gilt das für jeden, der in einer Situation wie dieser ist. (Die Frage ließe sich ebenso gut so formulieren: Würde ein vernünftiger Mensch in dieser Situation so handeln?) Jeder in so einer Situation hätte also gute Gründe dafür, schwarzzufahren. Dass die Vernunft diese allgemeine Frage stellt, ist kein Zufall. Während mein Gefühl mir vorgaukelt, dass ich und meine Anliegen etwas ganz besonderes sind, belehrt mich die Vernunft, dass ich auch nicht anders bin als all die anderen, die in diese Situation geraten. Warum also sollten für mich andere Gründe einschlägig sein und andere Regeln gelten?
So zwingt mich die Vernunft dazu, einen Standpunkt einzunehmen, der umfassender ist als mein eigener. Plötzlich beurteile ich mein Vorhaben als eines, das für vernünftige Wesen generell angemessen sein muss. Ich muss mir also ausmalen, dass es eine allgemeine Regel gibt, der zufolge es für alle Menschen unter Umständen wie diesen vernünftig ist, schwarzzufahren.
Diese Perspektive, so Kant, führt auf ein Problem. Denn es ist nicht nur so, dass mir das Szenario, das ich mir da ausmale, vielleicht nicht gefällt. Der wichtige Punkt für Kant ist, dass ich eine echte Schwierigkeit habe, mir dieses Szenario überhaupt auszumalen. Ich kann mir gar nicht wirklich eine Welt vorstellen, in der alle Menschen jede Gelegenheit zum Schwarzfahren ausnutzen. In so einer Welt könnte es entweder gar keinen öffentlichen Nahverkehr geben, der durch Fahrpreise finanziert wird, oder es müsste so scharfe Kontrollen geben, dass Schwarzfahren unmöglich ist. Ich merke also: Was ich vorhabe, funktioniert nur dann, wenn es nicht alle anderen auch tun.
Kant glaubt, dass diese Diagnose eine doppelte Erkenntnis beinhaltet: Zunächst einmal erkenne ich hier nämlich ein rationales Defizit in meinem Vorhaben. Ich sehe ja: Es ist unmöglich, dass eine Ersparnis, wie ich sie mir gerade sichern möchte, von jedermann als ein hinreichender Grund zum Schwarzfahren behandelt wird. Aber ich kann kaum ernsthaft behaupten, dass meine Ersparnis, bloß weil sie meine ist, schwerer wiegt und daher besondere Maßnahmen rechtfertigt. Vielmehr ist die Ersparnis in meinem Fall natürlich kein besserer Grund als in allen anderen Fällen, und in diesen anderen Fällen kann ich sie nicht generell als Grund behandelt sehen wollen.
Schon der Versuch, mein Vorhaben als gut begründet (und damit allen Vernunftwesen angemessen) auszuweisen, erweist sich also als schwierig. Aber ich stoße noch auf eine zweite, verwandte Einsicht, und diese führt in den Bereich der Moral: Ich merke nämlich, dass ich mir mit meinem Vorhaben notwendig besondere Vorrechte und einen besonderen Status gegenüber allen anderen Menschen einräumen würde. Immerhin stelle ich ja fest, dass dieses Vorhaben nur deshalb möglich ist, weil Andere sich dasselbe nicht erlauben. Ich nutze also aus, dass sie sich mehr einschränken. Außerdem behandle ich dadurch meinen Fall als etwas Besonderes. Ich und meine Ersparnis erhalten einen besonderen Rang, ein besonderes Gewicht gegenüber allen Anderen.
Mit dem zuerst genannten rationalen Defizit geht also zugleich ein moralisches Defizit einher. Indem ich das Gewicht meiner Gründe überschätze, überschätze ich meine eigene Wichtigkeit.
Dies ist ein erster Eindruck davon, wie die Vernunft Kant zufolge unser Handeln ethisch prüft. Dazu bedarf es keiner speziellen Gefühle und keiner speziellen Sozialisation. Es braucht nur die Vernunft, die einfach die ihr eigentümliche Frage stellt: »Gibt es hier wirklich einen hinreichenden Grund, so zu handeln?« Diese allgemeine Frage führt uns unmittelbar auf das Gebot, keine Entscheidungen zu treffen, die man nicht jedem anderen vernünftigen Wesen auch zubilligen kann.
Genau diese Forderung ist, so Kant, der oberste Grundsatz der Moral – das »Sittengesetz«. Sie erfasst nicht nur, dass es falsch wäre, schwarzzufahren. Sie erklärt auch, was daran falsch wäre. Was es falsch macht, wenn ich jetzt schwarzfahre, sind nicht die Konsequenzen dieser einen Handlung. Sondern es ist der Umstand, dass ich mich mit diesem Plan über alle anderen Vernunftwesen erhebe – mir etwas zugestehe, das ich nicht für jeden von uns gutheißen könnte.
Nun ist Kant der letzte, der sich optimistischen Illusionen in Bezug auf unsere Natur hingibt. Wir sind mehr als fehlbar, und viele von uns werden solche Überlegungen gar nicht erst anstellen, oder sie ignorieren und leichten Herzens schwarzfahren (oder Schlimmeres). Und selbst wenn wir nicht schwarzfahren, werden wir es oft aus den falschen Gründen unterlassen (vielleicht deshalb, weil wir es genießen, uns als »gute Menschen« zu sehen). Kant behauptet nicht, wir alle seien gut – ganz im Gegenteil. Er sagt nur: Es gibt die Stimme der Vernunft, und sie sagt uns genau, was zulässig ist. Keiner von uns kann behaupten, er habe es nicht besser wissen können.
2 Das Argument in Abschnitt 1 der Grundlegung – Der erste Schritt
Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, die uns in dieser Einführung besonders beschäftigen wird, besteht aus einem Vorwort, dem drei Abschnitte folgen. Das Vorwort definiert Kants generelles Beweisziel: »die Aufsuchung und Festsetzung des obersten Princips der Moralität« (IV: 392). Die drei Abschnitte sollen diese Vorgabe einlösen. Abschnitt 1 und 2 formulieren Argumente für folgende These: Wenn es eine gültige moralische Forderung gibt, dann muss sie einen ganz bestimmten Inhalt haben. Dieser Inhalt, das Sittengesetz, wird in beiden Abschnitten wiederholt formuliert; wir werden verschiedene Formulierungen kennenlernen. Abschnitt 3 soll dann den möglichen Vorbehalt ausräumen, den der »Wenn«-Satz in der These ausdrückt. Dieser dritte Abschnitt soll also beweisen, dass es gültige moralische Forderungen gibt, dass das besagte Sittengesetz also gilt.
Damit ist Kants Beweisziel zwar umrissen. Aber die Vorrede weist auf eine wichtige Zusatzforderung hin, die Kant selbst an jede adäquate Ethik stellt. Kant glaubt, dass moralische Forderungen strenge Allgemeingültigkeit haben. Sie gelten nicht nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Kulturen. Ja, sie gelten nicht einmal nur für Menschen, sondern schlechthin für alle Wesen, die Vernunft besitzen. Damit wendet Kant sich gegen einen philosophischen Trend, der zu seiner Zeit vor allem im englischsprachigen Raum vorherrscht: Autoren wie Thomas Hobbes (1588–1679) und David Hume (1711–1776) hatten Moral auf ein spezifisch menschliches Bedürfnis nach Sicherheit und Kooperation, sowie (besonders in Humes Falle) auf angeborene menschliche Gefühle wie die Empathie zurückgeführt. Kant ist nun der Meinung, dass so eine Ethik keine allgemeingültigen Forderungen begründen kann. Wenn es Wesen gibt, die unser Bedürfnis nach Kooperation und unsere Empathie nicht teilen, dann würde eine solche Ethik nichts von ihnen verlangen. Kant besteht aber auf Allgemeingültigkeit und lehnt solche Begründungen daher ab.
Daraus ergibt sich aber eine Aufgabe. Wenn ethische Grundsätze nicht von kontingenten Merkmalen der menschlichen Natur abhängen, dann muss ihre Begründung möglich sein, ohne sich auf Information über solche Merkmale zu berufen. Mehr noch: Kant glaubt generell, dass man Aussagen, die strenge Allgemeingültigkeit haben, nur a priori beweisen kann – was soviel heißt wie: ohne empirische Information, durch bloßes Nachdenken. Kant nennt jede Disziplin, die (anders als etwa die Logik) nicht rein formal ist und dennoch in diesem Sinne a priori verfährt, eine »Metaphysik«. Auch die Ethik muss folglich eine Metaphysik sein: eben eine »Metaphysik der Sitten«. Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten soll einen ersten, wichtigen Baustein zu dieser Metaphysik liefern: Sie soll a priori zeigen, dass es ein »oberste[s] Princip der Moralität« gibt, das alle moralischen Pflichten begründen kann.2
Wie könnte man dieses Beweisziel erreichen? Kant verfährt in den ersten beiden Abschnitten der Grundlegung nach eigener Aussage »analytisch« (IV: 445). Das heißt, einfach gesagt: Er setzt bei Vorstellungen an, die unser Verständnis von Moral definieren, und er zeigt, dass der Inhalt dieser Vorstellungen, wenn er richtig analysiert wird, von selbst zeigt, dass die Moral nur einen ganz bestimmten Inhalt haben kann.
Kant formuliert in der Grundlegung mehrere Argumente, die nach dieser generellen Methode verfahren. Wir sehen uns zwei dieser Argumente an: In Abschnitt 1 setzt er bei unserer Vorstellung von etwas Wertvollem oder Gutem an. Und er zeigt in einer Reihe von Beispielen, dass diese Vorstellung Voraussetzungen enthält, die auf ein bestimmtes Moralprinzip führen. In Abschnitt 2 verfährt Kant ähnlich (wie wir in Kap. 5 sehen werden). Dort setzt er beim Begriff einer moralischen Forderung an und zeigt, dass schon dieser Begriff, wenn er analysiert wird, nur einen ganz bestimmten Inhalt für moralische Forderungen zulässt.
Auf diese Weisen, so lautet Kants These also, kann man den folgenden Satz als korrekt ausweisen: Wenn es eine gültige moralische Forderung gibt, dann ist sie keine andere als das Sittengesetz (wie es in den Abschnitten 1 und 2 formuliert wird). Wer also die Idee der Moral nicht von vornherein ablehnt, dem kann man a priori aufzeigen, dass sie das Sittengesetz enthält.
In Abschnitt 1 der Grundlegung finden wir eine erste Herleitung des Sittengesetzes – also ein erstes Argument, das zeigen soll, dass das moralische Gesetz, wenn es denn eines gibt, das Sittengesetz sein muss. Kants Argumentation ist in ihrer Struktur nicht ohne weiteres leicht zu durchschauen. Wenn wir sie jedoch ein wenig aufbereiten, können wir sagen, dass sie auf drei Prämissen beruht:
Moralischen Wert können wir uns nur dort denken, wo Handelnde eine bestimmte Art von Motivation aufweisen, die Kant »guter Wille« nennt.
So ein guter Wille liegt (zumindest im Falle von uns Menschen) genau dort vor, wo wir »aus Pflicht« handeln.
Wenn wir in dieser Weise »aus Pflicht« handeln, dann kann diese Pflicht nur einen ganz bestimmten Inhalt haben – eben den Inhalt des Sittengesetzes.
Wir werden den Inhalt und die Begründung dieser drei Prämissen im Folgenden genauer kennenlernen. Schon jetzt sollte aber erkennbar sein, dass diese Prämissen auf die Schlussfolgerung führen, dass wir uns moralischen Wert in der Sphäre menschlichen Handelns nur dort denken können, wo nach dem Sittengesetz gehandelt wird. Da zur Vorstellung der Moral die Vorstellung von moralischem Wert gehört, würde dies zeigen, dass unsere Vorstellung von Moral selbst das Sittengesetz enthält.
Eine kurze Anmerkung in Bezug auf die drei genannten Prämissen: Wie wir sehen werden, geben diese Prämissen die wichtigen inhaltlichen Schritte des Arguments wieder. Es ist aber zu bedenken, dass Kant selbst sein Argument nicht explizit in dieser Weise strukturiert. Mehr noch: Wie wir ebenfalls sehen werden, führt Kant im weiteren Verlauf eine (verwirrende und unvollständige) eigene Nummerierung von »Sätzen« ein. Unsere obigen Prämissen nehmen eine andere und, mit Verlaub, transparentere Strukturierung vor. (Kants eigene Zählung besprechen wir in Kap. 4.)
Kant beginnt den Abschnitt 1 der Grundlegung direkt mit einer Formulierung seiner ersten Prämisse:
Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkungen für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille (IV: 393)
Wenn es also überhaupt etwas gibt, das ohne Einschränkungen gut ist, dann ist es ein Wille mit einer bestimmten Eigenschaft, ein »guter« Wille. Was ist aber ein guter Wille? Das sagt Kant uns an dieser Stelle noch nicht. Und das aus gutem Grund: Wir wollen ja erst herleiten, was gut ist. Daher kann Kant jetzt nicht so tun, als wüssten wir bereits, wann der Wille eines Menschen moralischen Wert hat. Zunächst einmal behauptet er nur: Manchen Individuen schreiben wir de facto – auf welcher Grundlage auch immer – einen guten Willen zu. Und wenn wir es tun, dann schreiben wir ihnen das einzige zu, was wir ohne Einschränkungen für etwas Wertvolles halten.
Kants weitere Diskussion zeigt, dass er dabei mit »Einschränkungen« Bedingungen meint, die vorliegen müssen, damit etwas gut ist. Seine These ist also: Alles außer einem guten Willen ist, wenn überhaupt, nur dann gut, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Nur ein Wille hängt, wenn er gut ist, in seiner moralischen Qualität nicht von irgendwelchen äußeren Bedingungen ab.
Kant wählt zunächst ein Ausschlussverfahren: Er zählt typische Dinge auf, die wir gewöhnlich wertvoll finden – von »Talenten des Geistes« (wie Verstand), »Eigenschaften des Temperaments« (wie Mut) bis zu »Glücksgaben« (wie Reichtum) und sogar zur »Glückseligkeit« selbst. Nichts davon, so Kant, ist gut, wenn nicht weitere Bedingungen vorliegen.
Nehmen wir zum Beispiel Mut. Mut ist oft eine gute Sache. Aber der Mut, mit dem sich ein Einbrecher am helllichten Tag in eine Wohnung schleicht, ist keineswegs gut. Es ist dabei nicht nur so, dass die Schlechtheit des Einbrechens den Wert des Mutes überdeckt. Unsere Bewertung des Mutes selbst ist nicht positiv. Wir könnten ja sonst durchaus unterscheiden zwischen der schlechten Bewertung des gesamten Vorfalls und der davon unberührten Wertschätzung eines Aspekts, des Muts. Aber wir sagen eben nicht: »Der Einbruch war natürlich eine schlimme Sache. Aber es war doch immerhin erfreulich, wie mutig der Täter war. Wenn schon Einbrüche, dann so!«
Das gleiche gilt für Geld. So begrüßenswert es oft ist – es ist nichts gut daran, wenn ein übler Mensch mehr davon zur Verfügung hat.
Und schließlich gilt dies sogar für das Gut, das viele Menschen für das höchste halten: das Glück. Wenn wir hören, dass ein Naziverbrecher einen glücklichen Lebensabend in Übersee verbracht hat, finden wir nichts Gutes daran. Wir sagen nicht: »Wenn es denn leider Gottes schon Naziverbrecher gibt, dann ist es doch zumindest schön, wenn sie glücklich sind.«
Zu all diesen Gegenständen einer positiven Bewertung können wir uns demnach Bedingungen ausmalen, unter denen sie keinen Wert haben würden. Aufschlussreich ist dabei, dass sich als die relevante Bedingung im Hintergrund immer die richtige Beschaffenheit des Willens der betreffenden Person erweist. Wir mussten nicht von ungefähr an Einbrecher und andere üble Gestalten denken, um den Wert von Gütern wie etwa Mut, Reichtum oder Glück nichtig zu machen.
Ein guter Wille – wie auch immer er genau aussehen mag – erweist sich so Kant zufolge als die Bedingung dafür, dass alles andere wertvoll sein kann. Im zweiten Schritt ist nun zu fragen, ob es denn auch für diesen guten Willen eine weitere Bedingung gibt, ohne die er nicht gut wäre. Das verneint Kant. Die Bewertung eines guten Willens verändert sich auch unter ungünstigen Umständen nicht so, wie es für alles andere gilt:
Wenn gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals, oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur, es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlete, seine Absicht durchzusetzen […], so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Werth an sich selbst hat. (IV: 394)
Auch das ist plausibel. Angenommen, jemand will selbstlos einem in Not Geratenen helfen. (Unterstellen wir, dass wir in diesem Falle von einem guten Willen sprechen würden.) Durch unvorhersehbare Umstände gelingt die Hilfe aber nicht, sondern die Lage verschlimmert sich letztlich noch. In so einem Falle würden wir zwar vermutlich sagen, dass die Dinge ohne diesen Hilfsversuch besser verlaufen wären. Dennoch würden wir dem Akteur kaum verkünden, dass wir angesichts des Resultats nichts Gutes mehr an seinem selbstlosen Tun finden.
In diesem Sinne ist ein guter Wille (was immer genau einen solchen Willen auch auszeichnen mag) das einzige, das in seinem Wert konstant und unabhängig von allen äußeren Bedingungen ist: »Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt, oder ausrichtet, […] sondern allein durch das Wollen, d. i. an sich, gut« (IV: 394). Damit ist Kants Begründung seiner ersten Prämisse komplett: Wir können uns jeglichen Wert nur dort denken, wo jemand einen guten Willen zeigt.