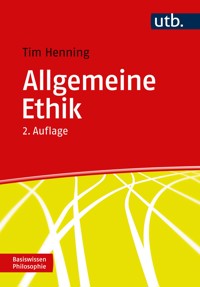25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wissenschaftsfreiheit gilt vielerorts als bedroht von Moralismus, Denkverboten und Cancel Culture. Aber ist moralische Empörung angesichts bestimmter wissenschaftlicher Positionen – etwa zu Genetik und IQ, zu Geschlecht und Biologie oder zu Behinderung und Infantizid – immer ein ideologischer, sachfremder Versuch der Bevormundung? Oder gibt es legitime moralische Kritik an wissenschaftlichen Thesen? Der Philosoph Tim Henning geht diesen Fragen in seinem hochaktuellen und originellen Buch auf den Grund.
Einerseits verteidigt er eine strenge Auffassung von Wissenschaftsfreiheit: Die Wissenschaft ist ein autonomer Bereich und sollte als solcher auch respektiert werden. Sie sollte sich allein an den Kriterien orientieren, die sich aus der immanenten Natur einer systematischen Wahrheitssuche ergeben – an Daten und Belegen, an wahr oder falsch. Andererseits betont er die Möglichkeit einer nichtmoralistischen moralischen Kritik. Ansatzpunkte hierfür finden sich im Inneren des vermeintlich reinen Bereichs wissenschaftlicher Kriterien, wie neuere Analysen aus Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie zeigen. Es sind die praktischen Kosten eines Irrtums, die sich als erkenntnistheoretisch und als moralisch relevant erweisen. Ob eine These wissenschaftlich haltbar ist, kann daher durchaus eine moralische Frage sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
3Tim Henning
Wissenschaftsfreiheit und Moral
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-518-77878-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
5Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
I
. Konflikte
2. Wie sind Konflikte von Wissenschaft und Moral überhaupt möglich?
3. Steine des Anstoßes
4. Der Konflikt mit dem Ideal der Gleichheit
II
. Was ist – oft – falsch an moralischer Kritik?
5. Der moralistische Fehlschluss
6. Wissenschaftsfreiheit und das »Eigeninteresse der Vernunft«
7. Der Evidentialismus
8. Die Autonomie der Wissenschaft
III
. Wider das Reinheitsgebot in der Epistemologie
9. Die Idee und einiges aus ihrer Vorgeschichte
10. Belege und der Standard für Rechtfertigung
11.
Pragmatic Encroachment
12. Aber funktioniert Wissenschaft nicht ganz anders?
IV
. Wessen Kosten?
13. Wessen Kosten?
14. Soziale Metaepistemologie und soziale Kosten
15. Irrtumskosten in der innerwissenschaftlichen Diskussion
V
. Eine interne Konzeption moralischer Kritik
16. Von epistemischen zu moralischen Defiziten
17.
Moral Encroachment
– direkt oder indirekt?
18. Fazit: Wie moralische Kritik mit der Autonomie der Wissenschaft vereinbar ist
VI
. Anwendung
19. Der erste Anwendungsfall: Hautfarbe, Genetik und
IQ
20. Der zweite Anwendungsfall: Biologie und Geschlecht
21. Der dritte Anwendungsfall: Behinderung und Infantizid
VII
. Praktische Konsequenzen
22. Wem wir in der Wissenschaft ein Forum verweigern dürfen
Schluss
Appendix
I
: Kosten und epistemische Standards – eine formale Analyse
Appendix
II
:
Einige Überlegungen zur Präzisierung des Prinzips
Stakeholder
Literatur
Sachregister
Personenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
9Vorwort
Aufklärung verlangt, so Immanuel Kants bekannte Formel, »sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen«.[1] Sie lässt also nur die eigenen Kriterien des Verstandes gelten – gute Gründe und Argumente, keine fremde Autorität.
Hinter diesen Grundgedanken der Aufklärung gibt es kein Zurück. Doch er wirft zugleich Fragen auf, nicht zuletzt: Wo verläuft die Grenze zwischen »guten«, verstandesgemäßen Gründen und fremder Autorität?
Einen wichtigen Teil der Antwort gibt Johann Gottlieb Fichte in der Nachfolge Kants: Der aufklärerische Antiautoritarismus dürfe, so Fichte, auch vor der Moral nicht haltmachen. Weder die herrschenden Moralvorstellungen der Zeit noch die eigene moralische Überzeugung dürften sich anmaßen, der Erkenntnis inhaltliche Vorgaben zu machen. »Materiale Subordination« der Intelligenz unter die Moral lehnt Fichte ab. In seinem System der Sittenlehre von 1798 heißt es: »Ich muss nicht einiges nicht erkennen wollen, nur weil es gegen meine Pflicht laufen möchte.«[2]
Auch Fichtes Plädoyer hat große Überzeugungskraft. Aber sollten wir wirklich sagen, wissenschaftliche Thesen 10und Behauptungen stünden jenseits der Moral? Warum würde ich dann – um mit einem überdeutlichen Beispiel zu beginnen – Anstoß nehmen, wenn eine Historiker:in behauptete, der Holocaust habe nie stattgefunden? Ich würde moralisch reagieren: mit Empörung. Aber wie könnte ich empört sein, wenn ich Fichte zustimme, der doch bestreitet, dass die Moral der Forschung inhaltliche Schranken setzen darf?
Damit ist das Problem umrissen, das dieses Buch lösen soll. Ich bin vielen Menschen Dank schuldig für ihre Unterstützung bei dieser Arbeit. Den Anstoß zu einer Ausarbeitung meiner Ideen gab eine Einladung, einen Vortrag auf dem Kongress der Gesellschaft für analytische Philosophie (GAP) im Herbst 2022 in Berlin zu halten. Mein erster Dank gilt daher Geert Keil und Romy Jaster, die die Einladung ausgesprochen haben und die meine Überlegungen in verschiedenen Stadien mit viel wohlwollender Kritik begleitet haben.
Weiter bedanke ich mich bei den Kolleg:innen, deren Arbeiten mein Interesse an Fragen der Wissenschaftsfreiheit zuerst geweckt haben, unter ihnen Torsten Wilholt und Elif Özmen. Elif Özmen und Julian F. Müller bin ich außerdem dankbar für eine spannende und erhellende Podiumsdiskussion auf dem besagten Kongress der GAP. Und natürlich danke ich allen dort Anwesenden für kritische und konstruktive Fragen, Einwände und Ideen. Ich erinnere mich ganz besonders an hilfreiche Kritik von und Diskussionen mit Daniel James Țurcaș.
Dank gebührt schließlich allen Kolleg:innen und Studierenden, die das Manuskript oder Teile desselben mit mir diskutiert haben. Das gilt vor allem für Christian Nimtz, mit dem ich mich oft über das gesamte Material habe austauschen können. Auch Stephanie Elsen, Samuel Ulbricht und Henning Kirschbaum haben den gesamten 11Text gelesen und ausführlich kommentiert. Mit Maike Albertzart, Dominik Balg, Ralf Busse, Nick Haverkamp, Jan Barbanus, Timo Meier, Hauke Behrendt sowie vielen weiteren Teilnehmer:innen an Forschungskolloquia an der JGU Mainz und an der HU Berlin habe ich ebenfalls Teile des Textes besprechen dürfen. Ihnen allen verdanke ich unzählige Anregungen und Korrekturen. Natürlich bin dennoch ich allein verantwortlich für alle Fehler und Irrtümer in diesem Buch.
Noch bevor die Ideen dieses Buches Gestalt angenommen hatten, habe ich mit Kolleg:innen im Kolloquium des Instituts für Philosophie der Universität Stuttgart an einem Runder-Tisch-Gespräch über Wissenschaftsfreiheit teilgenommen. Ich danke Dirk Lenz, Sebastian Ostritsch und Jakob Steinbrenner, die ebenfalls beteiligt waren. Der Austausch mit ihnen allen hat nicht nur große Freude gemacht, sondern nun schließlich auch Früchte getragen – wenn auch solche, die vielleicht nicht allen von ihnen gleichermaßen schmecken werden.
Neben diesen Dankesworten seien noch einige Bemerkungen zur sprachlichen Form vorangeschickt, speziell zu meinen Versuchen, eine respektvolle Sprache zu finden. Ich gendere Substantive mit dem Doppelpunkt, schreibe also »Philosoph:innen« statt »Philosophen«. Bei Artikeln, Pronomina etc. verwende ich nur die weibliche Form, schreibe also »die Philosoph:in«. Dass diese Eingriffe in gewohnte sprachliche Regeln den Lesefluss stören, wie oft bemängelt wird, und dass ich in vielerlei Hinsicht inkonsequent (ich schreibe nicht: »die Mensch:in«) und anderweitig anfechtbar verfahre, sei hiermit offen zugestanden. Es sollte auch nicht verwundern. Unsere Sprache ist ein Teil einer langen Geschichte, die von Unterdrückung geprägt ist. Es ist nicht zu erwarten, dass sie immer elegante Lösungen anzubieten hat.
12Des Weiteren habe ich mich entschieden, »Schwarze Menschen« und »weiße Menschen« zu schreiben. Zu den Gründen für diese terminologische, orthographische und typographische Konvention verweise ich auf Kristina Lepolds und Marina Martinez Mateos Stellungnahme in ihrem Band zur critical race theory.[3] Ein weiterer Entschluss, den ich in diesem Kontext getroffen habe, muss in besonderem Maße als eine Verlegenheitslösung gelten. Dort, wo im Englischen in unkontroverser Weise von verschiedenen races gesprochen wird, spreche ich von »Hautfarben«. Dieser Ausdruck hat zwar den Vorteil, die direkte Assoziation mit angeblichen »tiefen« biologischen Unterschieden zu vermeiden. Doch zugleich betont er nicht genug, dass Schwarz oder weiß zu sein sehr viel mehr umfasst als die Farbe der Haut, nämlich vielfältige soziale und historische Tatsachen, Erfahrungen von Rassismus, von Privilegien usw. Es wollte mir nicht gelingen (insbesondere, weil es nicht um eine Übersetzung aus dem Englischen geht, die das Wort race unübersetzt übernehmen könnte), einen geeigneteren Ausdruck zu finden.
Die Unzulänglichkeiten all dieser Entscheidungen liegen klar zutage. Das ist mir nicht unrecht, denn ich möchte keineswegs großes Vertrauen in sie demonstrieren. Ich bin unsicher, welche sprachlichen Neuerungen dem moralischen Zustand der Gegenwart gerecht werden, und ob solche Eingriffe überhaupt sinnvolle Maßnahmen sind. Diese Unsicherheit ist aber kein Grund, es nicht auf einige Versuche ankommen zu lassen. Ein selbstsicherer sprachlicher Konservatismus ist nicht das kleinere Übel, schon gar nicht, wenn er kontingente Regeln der Sprache mit 13schützenswerten Kulturgütern oder moralischen Autoritäten verwechselt.
Und so mute ich uns, mir und der Leser:in, diese sprachlichen Versuche zu – selbst auf die Gefahr hin, dass, mit einer Formulierung von Walter Benjamin, mitunter »der Gedanke […] in ihnen daherstolpert«.[4]
141. Einleitung
Kann es berechtigt sein, wissenschaftliche Thesen aus moralischen Gründen abzulehnen? Sind Konflikte möglich zwischen dem, was wissenschaftlich gut bestätigt erscheint, und dem, was zu behaupten moralisch zulässig wäre? Und wenn ja, kann es dann alles in allem richtig sein, der Moral den Vorrang vor der Wissenschaft zu geben?
In diesen Fragen begegnen sich Forderungen, die unvereinbar wirken können. Für den kleinen Mönch, eine Figur in Bertolt Brechts Leben des Galilei, verdichten sie sich sogar zu einer existenziellen Krise. Einerseits verschafft Galileos Fernrohr ihm direkte Evidenz für das heliozentrische Weltbild. Andererseits erklärt ein vatikanisches Dekret dieses Weltbild für »töricht, absurd und ketzerisch im Glauben«.[5] Nach schlaflosen Nächten entscheidet der Mönch, dem obrigkeitlichen Verdikt Folge zu leisten. Aber, so bekundet er, er beuge sich der Autorität keineswegs blind, sondern er sehe »Gründe«, die ihn von der »Weisheit« jenes Dekrets überzeugen.[6] Diese Gründe, die er Galileo darlegt, sind moralischer Art. Sie ergeben sich aus der Sorge um den Lebenssinn der Menschen, besonders seiner bäuerlichen Eltern:
Es ist ihnen versichert worden, daß das Auge der Gottheit auf ihnen liegt […], daß das ganze Welttheater um sie aufgebaut ist, damit sie, die Agierenden, in ihren großen 15oder kleinen Rollen sich bewähren können. Was würden meine Leute sagen, wenn sie von mir erführen, daß sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unaufhörlich drehend im leeren Raum um ein anderes Gestirn bewegt, einer unter sehr vielen, ein ziemlich unbedeutender.[7]
Begeht der Mönch einen Fehler, indem er sich aus moralischen Gründen von Galileos Thesen distanziert, indem er also die Erkenntnis der Ethik, das Wissen dem Gewissen unterordnet? Zugegeben, die moralischen Gründe sind in diesem Falle nicht besonders überzeugend. (Brecht lässt seinen Galileo sogleich anmerken, dass es geeignetere Wege gibt, das Los der Landbevölkerung zu verbessern.) Aber dürfen wir davon ausgehen, dass Konflikte zwischen Moral und Wissenschaft sich immer derart leicht auflösen lassen?
Dieses Buch argumentiert, dass solche Konflikte echt sein können. Das führt auf die Frage des Vorrangs, speziell auf die Eingangsfrage: Können moralische Gründe es rechtfertigen, ein wissenschaftlich gewonnenes Resultat zurückzuweisen?
Dies ist die Frage, die dieses Buch verhandelt. Sie ist zu unterscheiden von anderen Fragen nach »moralischen Grenzen der Wissenschaft« – etwa von derjenigen, welche moralischen Vorschriften für die Verfahren der Wissenschaft (etwa für Tierversuche oder für die Behandlung von Kontrollgruppen mit Placebos) gelten. Ebenfalls unterscheidet sie sich von der Frage, ob die wissenschaftliche Entwicklung bestimmter gefährlicher Technologien oder Geschöpfe (etwa Forschung zur allgemeinen künstlichen Intelligenz oder gain-of-function-Forschung in der Viro16logie) moralisch vertretbar ist. Unsere Frage betrifft Inhalte, also Überzeugungen und Behauptungen und ihre gerechtfertigte Akzeptanz. Damit wirft sie offensichtliche philosophische Schwierigkeiten auf: Kann eine Überzeugung oder Behauptung, die das Resultat einer systematischen Wahrheitssuche ist und sich nur auf Daten und Argumente stützt, überhaupt eine moralische Verfehlung sein? Und wenn ja, sollten wir dies bei ihrer kritischen Beurteilung berücksichtigen? Hieße das im Umkehrschluss womöglich, dass es legitim ist, Thesen in den Wissenschaften auf moralischer Basis zu befürworten? Und käme das nicht schierem Wunschdenken gleich?
Unverkennbar ist, dass sich wissenschaftliche Positionen de facto immer öfter moralischer Kritik ausgesetzt sehen. »Wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll«, so schreibt das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit in seinem Gründungsmanifest vom Februar 2021.[8] Und tatsächlich haben zahlreiche Wissenschaftler:innen für ihre Behauptungen jüngst nicht nur moralische Kritik erfahren, sondern wurden sogar Opfer von Störaktionen, Drohungen und Handgreiflichkeiten.
Drei Fälle solcher Übergriffe sollen schon an dieser Stelle kurz geschildert werden. Dieses Buch illustriert seine Argumente nämlich vor allem anhand dreier Beispiele für kontroverse wissenschaftliche Positionen, und es spricht sich dafür aus, dass moralische Kritik an diesen Positionen gerechtfertigt ist. Es erscheint daher geboten, deutlich zu machen, dass auch und gerade die Wissenschaftler:innen, 17deren Positionen hier diskutiert und kritisiert werden, Zielscheibe teils massiver Proteste und physischer Bedrohungen geworden sind. Das erinnert uns gleich zu Beginn daran, dass neben der Legitimität moralischer Kritik auch die Grenzen derselben geprüft werden müssen.
Charles Murray, ein US-amerikanischer Politologe, hat im Jahr 1994 gemeinsam mit dem verstorbenen Psychologen Richard Herrnstein das Buch The Bell Curve veröffentlicht, das unter anderem die These vertritt, Schwarze Menschen hätten genetisch bedingt einen geringeren durchschnittlichen IQ als weiße.[9] Murray war eingeladen, am 2. März 2017 einen Vortrag am Middlebury College in Vermont zu halten. Wegen der besagten These seines Buches wurde der geplante Vortrag von hunderten Anwesenden gestört, so dass die Veranstaltung in einen anderen Raum verlegt und in Form eines Interviews per Bildschirm übertragen werden musste. Nach Ende des Interviews wurden Murray und weitere Personen physisch bedrängt. Protestierende sprangen auf die Motorhaube ihres Autos, und eine der Veranstalterinnen wurde an den Haaren gepackt und dabei leicht verletzt.[10]
Die britische Philosophin Kathleen Stock vertritt in ihren Veröffentlichungen und medialen Äußerungen die Ansicht, der Begriff der Frau treffe ausschließlich auf Erwachsene mit biologisch weiblichem Geschlecht zu.[11] Studierende ihrer Universität in Sussex haben deshalb in Plakat- und Graffiti-Kampagnen sowie in Online-Protesten 18die Entfernung Stocks aus den Diensten der Universität gefordert. Berichten zufolge hat die Polizei Stock in Anbetracht der aufgeheizten Stimmung zeitweise empfohlen, zu ihrer eigenen Sicherheit dem Campus fernzubleiben. Stock hat mit Verweis auf diese Umstände im Oktober 2021 ihre Professur aufgegeben. Von Protestierenden wurde dieser Schritt auf Instagram mit dem Titel des Songs »Ding-Dong! The Witch is Dead« aus Wizard of Oz kommentiert.[12]
Ein dritter bekannter Fall ist der australisch-amerikanische Philosoph Peter Singer. Wegen seiner Verteidigung der Euthanasie an Neugeborenen mit schweren Behinderungen war er schon seit den achtziger Jahren unzählige Male Opfer von Protesten, besonders im deutschsprachigen Raum. Die zweite Ausgabe der Monographie Practical Ethics dokumentiert dies in einem mehr als zwanzigseitigen Appendix mit dem Titel »On Being Silenced in Germany« (übersetzt etwa: »Wie ich in Deutschland mundtot gemacht wurde«).[13] Das vielleicht eindrücklichste unter vielen Beispielen ist ein Protest gegen einen Vortrag in Zürich im Jahr 1991, bei dem ein Protestierender die Bühne stürmte, Singer die Brille vom Gesicht riss und sie zertrat, während dieser, weil er sich wegen der lautstarken Proteste mündlich kein Gehör verschaffen konnte, gerade versuchte, seine Position schriftlich auf einem Tageslichtprojektor darzulegen.
Solche Angriffe auf Wissenschaftler:innen erregen großes Aufsehen. Doch gerade wegen ihrer exzessiven Natur 19sind die theoretischen Fragen, die sie aufwerfen, nicht sonderlich brennend. Das gilt etwa für ihre rechtliche Einordnung: Nötigung und Bedrohung sind Straftatbestände, und in Deutschland garantiert die Verfassung, in Art. 5 Abs. 3 GG, die Freiheit der Forschung und Lehre in Form eines Abwehrrechts gegen Eingriffe (zumindest solche der staatlichen Obrigkeit). Die moralische Beurteilung fällt womöglich nicht so unmittelbar eindeutig aus; aber dieses Buch wird argumentieren, dass alle beschriebenen Angriffe moralisch ungerechtfertigt sind.
Doch Vorfälle wie diese sind womöglich bloß die sprichwörtliche Spitze eines Eisbergs, der viel größere Dimensionen hat. Viele der öffentlichen Reaktionen machen deutlich, dass sie nur als besonders dramatische Auswüchse einer viel umfassenderen Tendenz angesehen werden, einer Tendenz, die in ihrer Gesamtgestalt als ungemein bedrohlich empfunden wird.[14] Auch jenseits rechtswidriger Eingriffe, so lautet die verbreitete Diagnose, werde die Wissenschaft von einem Klima des Moralismus eingeschränkt – von einer, wie es aktuell oft heißt, »woken« Weltanschauung, die die Wissenschaftsfreiheit mit Denk- und Redeverboten von informeller, ideologischer Art bedrohe.
Auch das bereits zitierte Manifest des Netzwerk Wissenschaftsfreiheit kritisiert eine solche Entwicklung zum Moralismus: »Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele, festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. […] Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden. Auf diese Weise 20wird ein Konformitätsdruck erzeugt, der immer häufiger dazu führt, wissenschaftliche Debatten im Keim zu ersticken.«[15]
Woher rührt dieser Eindruck einer Einschränkung des wissenschaftlichen Diskurses durch die Moral? Zweifellos gibt es mehr als einen Faktor, der ihn erklärt. Aber dieses Buch wird argumentieren, dass – neben vielerlei kontingenten Ursachen – die moralische Kritik selbst Teil des Problems ist. Und damit sind nicht etwa spezielle Weisen gemeint, diese Kritik zu äußern, sondern moralische Einwände als solche. Denn zumindest auf den ersten Blick müssen solche Einwände als sachfremd erscheinen. So nachvollziehbar die Ablehnung sein mag, welche die Thesen Murrays, Stocks und Singers hervorrufen, so wenig ist sie ein Argument gegen die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dieser Thesen. Es scheint sogar eine Art Unabhängigkeit der Maßstäbe zu bestehen: Nichts gibt uns Gewähr, dass deskriptive Thesen, etwa über Genetik, IQ und Hautfarbe, nur dann wahr sein können, wenn sie zu unseren moralischen Überzeugungen passen. Wahrheit aber ist, so soll hier argumentiert werden, die zentrale normative Vorgabe der Wissenschaft. Wenn wir also moralische Einwände gegen wissenschaftliche Thesen vorbringen, muss das wie ein Kategorienfehler anmuten – oder schlimmer: wie eine Bevormundung. Denn wenn Wissenschaftler:innen sich nach moralischer Kritik zu richten hätten, müssten sie sich dann nicht Erwartungen beugen, die der zentralen Zielsetzung ihrer Forschung äußerlich und potenziell hinderlich sind?
Wenn diese Diagnose richtig ist, dann hat die Unversöhnlichkeit in der Debatte nicht nur soziale und kulturelle Ursachen, sondern auch ein Fundament in der Sache. Es 21prallen Anforderungen der Wahrheit einerseits und der Konformität mit unseren moralischen Idealen andererseits aufeinander, die als inkommensurabel erscheinen. Das weckt den Anschein, wir müssten uns in einem blinden Akt der Entscheidung unmittelbar entweder auf die Seite der Wahrheit oder auf die Seite der Moral schlagen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. Januar 2022 verdichtet Autor Axel Meyer diese schlechte Alternative zu der provokanten Überschrift: »Wokeness oder Wahrheit, das ist hier die Frage«.[16]
Wenn Wissenschaft und Moral dergestalt in eine unvermittelte Frontstellung geraten, können beide in ihrer Rolle im öffentlichen Diskurs nur Schaden nehmen. Moral, die dem Anspruch nach (besonders in unserer kantisch geprägten Tradition) als die Stimme der unparteiischen Vernunft auftritt, gerät in den Ruf subjektiver Weltanschauung. Wer stattdessen die Wissenschaftsfreiheit gegen moralische Kritik verteidigt, zieht sich den Vorwurf zu, mit Verächter:innen der Moral gemeinsame Sache zu machen.
Ein Ziel dieses Buches ist es, die beteiligten Positionen dieser Debatte besser verstehen zu lernen. Einerseits spricht es sich für eine sehr starke Auslegung der Wissenschaftsfreiheit aus und stützt damit die Vorbehalte gegenüber bestimmten Formen des Moralismus. Meiner Auffassung zufolge sind nicht nur äußere Beschränkungen oder Übergriffe verfehlt, sondern oftmals schon die moralische Kritik an wissenschaftlichen Thesen als solche. Die Begründung, die ich vorschlage, liegt in einer Idee der Autonomie der Wissenschaft: Die Wissenschaft ist dieser Idee zufolge ausschließlich an denjenigen Maßstäben zu messen, die 22sich aus ihrer eigenen Natur als systematische, um Rechtfertigung bemühte Wahrheitssuche ergeben. Pointiert: In der Kritik der Wissenschaft darf es, wie in der Wissenschaft selbst, nur um wahr oder falsch und um Belege dafür gehen. Ein etwaiger Konflikt mit moralischen Ideen, so zeige ich weiter, ist für diese Kriterien irrelevant. Dies erklärt, worin die sachliche Grundlage für die Moralismus-Debatte besteht: Die Idee der Autonomie der Wissenschaft lässt scheinbar tatsächlich wenig Raum für legitime moralische Kritik.
Vermutlich muss der erste Eindruck sogar sein, dass gar kein solcher Raum bleibt. Wenn es nur um Belege für Wahrheit gehen darf, und wenn diese Belege so restriktiv verstanden werden, dass moralische Vorbehalte nicht zählen – dann scheint die Sache klar. Dies, so denke ich, erklärt zumindest zum Teil, warum die Debatte derart unversöhnlich und polarisiert ist. Wenn es eine echte Unvereinbarkeit zwischen moralischen Einwänden und der Autonomie der Wissenschaft gibt, bleibt Menschen wirklich keine Wahl, als sich durch die schieren intuitiven Anziehungskräfte der beteiligten Ideen in Lager ziehen zu lassen.
Dieses Buch soll zeigen, dass dieser Widerspruch nur scheinbar ist. Obgleich es sich rückhaltlos für die Autonomie der Wissenschaft ausspricht, zeigt es, dass die Unmöglichkeit moralischer Kritik damit nicht besiegelt ist. Tatsächlich argumentiere ich für Folgendes: Es kann legitim sein, Wissenschaftler:innen für ihre Behauptungen mit moralischen Gründen zu kritisieren, sie aus diesen Gründen nicht zu Veranstaltungen einzuladen und unter Umständen auch ihre Artikel, Drittmittelanträge u. a. abzulehnen.
Wie können diese beiden Standpunkte vereinbar sein? Meine generelle Strategie besteht darin, den Zusammenhang zwischen dem wissenschaftlichen Status und dem 23moralischen Status einer These zu überdenken. Wie verhalten sich moralische Haltbarkeit und wissenschaftliche Haltbarkeit zueinander? In der Schilderung der Problemlage bin ich bisher von der erwähnten Unabhängigkeit der Maßstäbe ausgegangen – davon also, dass die Moral sich an Kriterien orientiert, die den Kriterien des Wissens und der Wissenschaft äußerlich sind. Die Auffassung, der zufolge diese Unabhängigkeit vollständig ist, möchte ich hier als eine externe Konzeption moralischer Kritik bezeichnen.
Dieses Buch vertritt eine andere, interne Konzeption moralischer Kritik.[17] Ihr zufolge gibt es Punkte, an denen die Kriterien der Moral und der wissenschaftlichen Geltung koinzidieren. Es gibt also eine Form moralischer Kritik, die sich nur auf Faktoren beruft, die bereits für die erkenntnistheoretische Bewertung einer These einschlägig sind – oder kürzer: für ihren epistemischen Status (vom griechischen ἐπιστήμη, Wissen).
Auf dem Weg zu einer solchen Konzeption wird dieses Buch einige mitunter recht abstrakte Überlegungen anstellen, die in die Epistemologie, Sprachphilosophie und Logik führen. Grundsätzliche Fragen moralischen Begründens werden dabei ebenso berührt wie einige generelle 24Strukturmerkmale der theoretischen Vernunft. Speziell, so wird sich zeigen, haben wir Bedingungen für epistemische Rechtfertigung zu analysieren. Dies ist diejenige Form rationaler Rechtfertigung, die Wahrheitsansprüche stützen kann und die nötig ist, wenn eine Überzeugung eben ein Wissen darstellen soll. Die Bedingungen der epistemischen Rechtfertigung, so zeige ich, umfassen Faktoren, die gleichzeitig moralisches Gewicht haben. Wir können eine These unter Berufung auf diese Faktoren daher zugleich epistemisch und moralisch kritisieren.
Wenn sich solch eine interne Konzeption moralischer Kritik formulieren und verteidigen lässt, winkt mehr als nur philosophische Einsicht. Die vermeintliche Unvereinbarkeit, die den Streit bestimmt, wäre aufgelöst. Wir wüssten: Wer bestimmte Formen moralischer Kritik an der Wissenschaft ablehnt, muss kein Feind der Moral sein. Und wer moralische Kritik übt, kann doch die Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft achten.
Die Idee, die hier verteidigt wird, ist einfach. Epistemische Rechtfertigung kann als ein Produkt zweier Faktoren verstanden werden. Erstens benötigt sie Belege – also Daten oder Argumente, die für die Wahrheit einer Behauptung oder Überzeugung sprechen. Zweitens benötigt epistemische Rechtfertigung einen Standard – also ein Kriterium dafür, wie stark unsere Belege sein müssen, damit sie die These rechtfertigen.
Dieser Standard allerdings, so wird sich herausstellen, ergibt sich nicht allein aus wahrheitsbezogenen Kriterien. Ich werde eine Auffassung verfechten, die in der aktuellen Erkenntnistheorie viel diskutiert wird – die Auffassung, dass es ein »Einschleichen« praktischer Erwägungen in das Hoheitsgebiet der theoretischen Vernunft gibt, ein sogenanntes pragmatic encroachment. Genauer lautet die Idee, dass die epistemische Bewertung einer Überzeugung auch 25praktische Kosten eines Irrtums berücksichtigt. Nicht von ungefähr verlangen wir besonders belastbare Daten, bevor wir uns ein finales Urteil über Kernreaktoren, Impfstoffe oder weapons of mass destruction erlauben.
So lässt sich auch die Moral ins Spiel bringen. Denn die Kosten, die den Standard für Rechtfertigung beeinflussen, sind oft auch moralisch bedeutsam. Eine These zu vertreten, die in Anbetracht der Kosten im Irrtumsfalle nicht gut genug gestützt ist, kann zugleich eine wissenschaftliche und eine moralische Fahrlässigkeit sein.
Diese Skizze meiner Überlegungen kann deutlich machen, wie sich die beiden oben charakterisierten Positionen vereinen und die zentrale Unklarheit ausräumen lässt: Das Ideal der Autonomie der Wissenschaft verwahrt sich mit Recht dagegen, dass moralische Einwände die Rolle von Belegen gegen die Wahrheit deskriptiver Thesen beanspruchen. (Kapitel 5 erläutert, warum ihnen diese Rolle nicht zusteht.) Wann immer wir argumentieren, dass etwas nicht wahr sein könne, weil es nicht wahr sein dürfe, setzen wir uns daher dem Vorwurf des Moralismus aus. Allerdings, und dies ist die Kehrseite, sagt die Autonomie-Idee auch nur dies: dass moralische Überlegungen nicht als Belege behandelt werden dürfen. Zugleich appelliert sie selbst an die Idee, dass Belege als hinreichend beurteilt werden müssen, und sie lässt offen, was die Schwelle für hinreichende Belege definiert.
Moralische Kritik ist also legitim, wenn Belege als hinreichend behandelt werden, die es angesichts der praktischen Tragweite der These nicht sind. Diese Kritik ist intern. Sie misst die Wissenschaft an ihrem eigenen Maßstab: Sprechen die Daten und Argumente für die Wahrheit dieser These, und tun sie es in einem Maße, das die These insgesamt rechtfertigt? Da Rechtfertigung jedoch von praktischen Kosten abhängt, ist diese Frage neben dem epistemischen 26Status auch für den moralischen Status der These relevant. Wir können demnach, so die Pointe, Wissenschaft zugleich als Wissenschaft und moralisch hinterfragen. Noch pointierter: Es gibt einen systematischen Zusammenhang zwischen moralisch kritikwürdiger und minderwertiger Wissenschaft.
Diese Idee hat Vorläufer in der Wissenschaftstheorie, speziell bei Richard Rudner und in nachfolgenden Arbeiten.[18] Auch könnten Leser:innen sich an Diskussionen über die Rolle und die Determinanten eines Signifikanzniveaus in der statistischen Hypothesenprüfung erinnert fühlen. Wie Kapitel 9 jedoch darstellen wird, sind die bestehenden Verteidigungen dieser Ideen in grundsätzlichen Punkten defizitär. Insbesondere genügen sie nicht den Anforderungen an eine interne Konzeption moralischer Kritik, wie sie hier verstanden wird. Sie gehen, kurz gesagt, davon aus, dass wissenschaftliche Kriterien eine Art von Unvollständigkeit aufweisen, die es möglich und richtig macht, zusätzlich moralische Erwägungen heranzuziehen. Meine Ansicht ist eine andere. Eine Analyse epistemischer Rationalität und epistemischer Gründe wird nicht etwa auf Lücken führen, die die Moral besetzen kann, sondern auf positive Faktoren, die sich rein epistemologisch als relevant erweisen lassen, die aber auch in der Moral zählen.
Illustriert wird die Idee dann an den erwähnten Beispielen: kontroversen Thesen aus der Intelligenzforschung (u. a. von Arthur Jensen oder Richard Herrnstein und Charles Murray), aus der Diskussion um die Natur der Geschlechter (u. a. von Kathleen Stock) und aus der ethischen Dis27kussion des Infantizids bei schweren Behinderungen (von Peter Singer).
Abschließend wird sich zeigen, dass eine interne Konzeption moralischer Kritik eine überraschende Stärke aufweist, wenn es um die Frage geht, welche praktischen Konsequenzen aus der Kritik gezogen werden dürfen. Zunächst beschränkt eine interne Konzeption ja, welche Art moralischer Kritik berechtigt und mit dem Respekt vor der Autonomie der Wissenschaft vereinbar ist. Aber weil sich eine Kritik, die dieser Konzeption entspricht, auf Faktoren beschränkt, die zugleich über die epistemische Güte der These mitbestimmen, kann sie in praktischer Hinsicht größere Tragweite beanspruchen.
Denn: Dass Wissenschaftler:innen »nicht alles sagen dürfen«, wie aktuell oft lamentiert wird, ist in Wahrheit gar nichts Neues. Ein Unterschreiten epistemischer Standards wird seit jeher und mit guten Gründen sanktioniert. Wenn Wissenschaftler:innen Behauptungen aufstellen, die sie nur ungenügend belegen können, drohen ihnen nicht nur Kritik, sondern auch eine beschädigte akademische Reputation sowie die Ablehnung von Artikeln und Projektanträgen. Das ist ein legitimer, gut begründeter Verlust an standing im wissenschaftlichen Diskurs. Dieses Buch zeigt, dass die Wissenschaft, die moralische Kritik hervorruft, mitunter zugleich in genau diesem Sinne mangelhaft ist und dass es in diesen Fällen keine illegitime Cancel Culture ist, Wissenschaftler:innen eine Plattform zu verweigern.
Welches Urteil ergibt sich daraus über Brechts Figur des kleinen Mönchs? In einigen Punkten geht er wirklich fehl. Seine Skrupel sind, wie gesagt, nicht sehr überzeugend; wir sind sicher nicht verpflichtet, Illusionen unangetastet zu lassen, die die Menschen mit ausbeuterischen Verhältnissen vorliebnehmen lassen. Zudem ist die Stärke der Belege, die Galileo anbietet, außerordentlich. Schließlich und 28vor allem verneint oder bestreitet der Mönch eine wissenschaftliche These aus moralischen Gründen, und dies ist – wie mein Argument ebenfalls zeigt – ein prinzipieller Fehler. Zulässig ist es allenfalls, bei ungenügender Rechtfertigung die Zustimmung zu verweigern. Einen Vorwurf aber können wir dem kleinen Mönch ersparen: Moralische Einwände gegen wissenschaftliche Thesen sind nicht prinzipiell illegitim, und sie müssen keine Missachtung der Autonomie der Wissenschaft bedeuten.
29I. Konflikte
312. Wie sind Konflikte von Wissenschaft und Moral überhaupt möglich?
Konflikte zwischen Moral und Wissenschaft scheinen möglich zu sein, so viel dokumentieren die einleitend genannten Fälle. Wir haben also allemal den Eindruck, dass manche wissenschaftlichen Positionen, wie Elif Özmen schreibt, »im Widerspruch zu bestimmten ›richtigen‹ politischen und moralischen Normen« stehen.[19]
Doch es ist nicht offensichtlich, dass es sich wirklich so verhalten kann. Wissenschaftler:innen treffen Aussagen über Tatsachen oder vermeinte Tatsachen auf der Basis von Belegen. Wie könnte darin eine moralische Verfehlung liegen? Wie könnte es also dazu kommen, dass eine wissenschaftliche Position in Widerspruch zu einer moralischen Norm gerät?
Die Analyse solcher Konflikte und ihrer Möglichkeit wird weite Teile dieses Buches in Anspruch nehmen. Aber es wird der Klarheit und dem Überblick dienen, die Frage an dieser Stelle vorbereitend in schematischer Form zu erörtern. Ich beschreibe im Folgenden also, wie es sein kann, dass rein deskriptive, also Tatsachen beschreibende Aussagen in Konflikt mit moralischen Normen geraten. Einige Möglichkeiten solcher Konflikte werden anhand vereinfachter Beispiele aus alltäglichen Kontexten typologisiert. Das wird es uns unten erleichtern, die realen Beispiele aus der Wissenschaft zu analysieren.
32Schon zu Beginn erweist sich dabei eine erste Differenzierung als notwendig. Eine berechtigte Frage ist, wie gesagt, ob und wie eine Behauptung deskriptiven Inhalts überhaupt eine moralische Verfehlung sein kann. Eine zweite, für unsere Zusammenhänge noch wichtigere Frage lautet: Kann auch eine deskriptive Behauptung, die sich unserer theoretischen Vernunft als prima facie begründet präsentiert, gleichwohl unmoralisch sein?
Erforderlich ist diese Unterscheidung wegen einiger Fälle, in denen deskriptive Behauptungen ganz offenkundig moralisch problematisch sind: Lügen, in denen eine Sprecher:in etwas behauptet, das sie für falsch hält, mit der Absicht, ihre Hörer:innen zu täuschen, und Bullshit, der Harry Frankfurt zufolge geäußert wird, ohne der Wahrheit irgendeine Orientierungsfunktion zu geben. Dass es sich in diesen Fällen um moralische Verfehlungen handeln kann, ist, wie gesagt, unkontrovers. Zwar wird um die Erklärung ihres unmoralischen Charakters in der Philosophie gestritten.[20] Einigkeit besteht aber darüber, dass die moralische Falschheit wesentlich mit dem Mangel an Wahrhaftigkeit (und im Falle des Bullshits der Orientierung an der Wahrheit) zu tun hat. Damit sind diese Fälle, unerachtet ihrer moralischen und philosophischen Relevanz im Allgemeinen, für dieses Buch aber nicht zentral. Denn hier 33handelt es sich natürlich nicht um Fälle, in denen die Forderungen der theoretischen und der praktischen Vernunft in Konflikt geraten könnten. Im Gegenteil besteht die moralische Verfehlung gerade darin, dass auch die Forderungen der theoretischen Vernunft, die (wie ich hier vorläufig unterstelle) auf Wahrheit zielen, ignoriert werden.
Wir konzentrieren uns daher nun auf Fälle, in denen zumindest prima facie die Möglichkeit eines tieferen Konflikts besteht – Fälle, in denen eine Behauptung einerseits gute Belege für sich zu haben und andererseits dennoch mit der Moral in Konflikt zu geraten scheint. Ich beschränke mich dabei auf inhaltsbasierte Konflikte, also auf solche, in denen nicht bereits jeder beliebige Akt des Behauptens moralisch problematisch ist (weil er etwa ein Schweigegelübde bricht oder eine Beerdigung stört), sondern in denen eine Behauptung aufgrund des behaupteten Inhalts mit den Forderungen der Moral konfligiert. Ich unterscheide dabei kausale, symbolische, logische und epistemische inhaltsbasierte Konflikte. Die zwei ersten Varianten (kausal, symbolisch) werden besonders kurz und summarisch abgehandelt, da ihre Rolle im Zusammenhang meiner Argumentation keine bedeutende ist.
Zunächst zu Konflikten kausaler (gemeint ist: rein kausaler, oder: bloß kausaler) Natur. Hier hat eine Behauptung wegen ihres Inhalts absehbar Effekte, die sie moralisch problematisch machen, ohne dass diese Effekte allerdings in einer Beziehung der rationalen Begründung zum behaupteten Inhalt stehen. Angenommen, ein Lehrer erinnert die Schüler:innen direkt vor der Mathearbeit eigens daran, dass laut der PISA-Studie von 2018 »Jungen weiterhin eine deutlich höhere mathematische Kompetenz als Mädchen« zeigen.[21] Viele bekannte Studien dokumentie34ren, dass solche Äußerungen einen messbaren nachteiligen Effekt (der den Titel stereotype threat trägt) auf die Leistungen von Schülerinnen haben, indem sie ein gesellschaftliches Stereotyp aufrufen, was dazu führt, dass die Betroffenen ihm stärker entsprechen.[22] Dies macht die Äußerung der Lehrkraft, unerachtet ihrer Korrektheit, offenkundig moralisch kritikwürdig.
Ein inhaltsbasierter Konflikt symbolischer Art liegt vor, wenn eine Behauptung neben ihrem Inhalt eine weitere Bedeutung trägt, weil sie z. B. in einem bestimmten historischen Kontext eine charakteristische Rolle gespielt hat. Neben einigen Beispielen, die unten genannt werden, genügt hier vielleicht folgender Fall: In einem Interview berichtet Jan Müller von der Band Tocotronic von einer CD-Kompilation aus dem Jahr 2002, die deutschsprachige Künstler:innen und Songs versammelte und einen Werbesticker mit dem Aufdruck »Deutschland ist erwacht« trug.[23] Dabei ging es keineswegs um rechtsradikale Bands oder einen entsprechenden Musikverlag, sondern, so Müller, um einen ahnungslosen Mitarbeiter in der Werbeabteilung. Der Punkt: Auch dann, wenn wir mit Müller davon ausgehen, dass hier keine fragwürdige bewusste Absicht vorlag, bleibt der Sticker anstößig.
35Diese beiden Konflikt-Typen sind in einer Reflexion über die Wissenschaftsfreiheit keineswegs unwichtig, und sie sollen in diesem Buch Berücksichtigung finden. Trotzdem sind sie für meine Argumentation nicht zentral. Der Grund dafür lautet, dass es kontingente äußere Umstände (in unseren Beispielen etwa die psychischen Auswirkungen sozialer Stereotype, die Verbrechen der deutschen Geschichte) sind, die diese Äußerungen unmoralisch machen. Nicht, dass solche exogenen Merkmale per se irrelevant wären. Aber ich werde argumentieren, dass zumindest der wissenschaftliche Diskurs (als unser Hauptgegenstand) sich mit einiger Plausibilität das Recht nehmen darf, frei von Rücksicht auf solche Umstände zu agieren.
Anders verhalten sich die Formen des Konflikts, auf die ich mich konzentrieren will. Zunächst geht es dabei um Konflikte logischer Art – um solche also, die nicht nur deshalb bestehen, weil eine Behauptung bestimmte kausale Konsequenzen oder eine bestimmte symbolische Dimension hat, sondern rein aufgrund der Implikationen des Inhalts. Es ist also der behauptete Inhalt selbst, der »im Widerspruch zu bestimmten ›richtigen‹ politischen und sozialen Normen« steht (um erneut Özmen zu zitieren). Es geht nun darum, genauer zu verstehen, wie diese Art von Konflikt eigentlich möglich sein soll.
Einfach gesagt, bestehen solche Konflikte darin, dass der Inhalt einer Behauptung einer moralischen Überzeugung widerspricht, die wir für wahr halten. Diese Charakterisierung wirft aber Fragen auf. Erstens fragt sich, inwiefern deskriptive Aussagen überhaupt in Widerspruch zu moralischen Überzeugungen geraten können. Zweitens ist zu klären, warum ein solcher logischer Widerspruch die deskriptive Aussage nicht nur als zweifelhaft oder vielleicht falsch erscheinen lässt, sondern eben als eine moralische Verfehlung.
36Zum ersten Punkt: Es zählt zu den frühen Lektionen eines Studiums der Ethik, dass es keinen direkten logischen Schritt gibt von Aussagen darüber, wie die Welt ist, zu Aussagen darüber, ob die Welt auch so sein soll. Diese logische Lücke zwischen »Sein« und »Sollen«, zwischen Beschreiben und Vorschreiben, erweist sich zwar bei näherem Studium als überraschend diffizile Angelegenheit.[24] Aber die generelle Unabhängigkeitserklärung genießt spätestens seit David Humes wortmächtigem Plädoyer den Status eines Axioms: Es ist eines, die Tatsachen zu schildern, ein anderes, sie als richtig oder falsch zu bewerten. Wer diese Differenz übergeht, zieht sich den Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses zu.[25]
Aus diesem Grund ist die Idee, eine Behauptung könnte auf der Basis ihres Inhalts mit moralischen Überzeugungen kollidieren, so erläuterungsbedürftig. Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Punkt: Sogar dann, wenn Behauptungen über deskriptive Tatsachen mit unseren moralischen Überzeugungen in Konflikt geraten können – wieso sollte so ein Konflikt selbst moralische Signifikanz haben? Wenn ein deskriptiver und ein moralischer Satz sich widersprechen, heißt das, dass mindestens einer von beiden unwahr ist. Aber warum sollte die deskriptive Behauptung nicht nur den Vorwurf der Unwahrheit, sondern den der Unmoral verdienen (wie es eben in den Fällen geschieht, die unser Thema sind)?
Ich beginne mit der ersten Frage: Ich stimme zu, dass 37eine deskriptive Aussage nicht in Widerspruch zu einem rein moralischen Grundsatz stehen kann. Aber viele unserer moralischen Überzeugungen haben keine ersten Grundsätze zum Inhalt, sondern basieren auf einer Kombination aus moralischen und deskriptiven Prämissen. Wenn zum Beispiel eine Sprecher:in mir den Vorwurf der Lüge macht, so beruft sie sich einerseits auf bestimmte deskriptive Tatsachen (etwa: ich habe mit einer Täuschungsabsicht etwas gesagt, das ich für falsch hielt), und andererseits auf moralische Prämissen, die solche Handlungen verurteilen.
In vielen solcher Fälle verhält es sich so, dass wir die relevanten moralischen Prämissen als geteilte Annahmen im Hintergrund voraussetzen. Und wenn dies der Fall ist, dann können rein deskriptive Aussagen vor diesem impliziten Hintergrund eben zugleich moralische Bedeutung haben. Aussagen darüber, ob ich jemanden getäuscht oder verletzt habe, erhalten so eine vermeintlich unmittelbare moralische Signifikanz, denn in Kombination mit den moralischen Prinzipien im Konversationshintergrund haben sie klare Implikationen für die Frage, welche Ansprüche ich habe und welche nicht, und dafür, welche Behandlung mir geschuldet ist und welche nicht. (Im Vorgriff auf unsere Beispiele sei angemerkt, dass etwa Aussagen darüber, wer genetisch bedingt weniger intelligent ist oder wer als Frau gelten darf, Implikationen dafür hat, was jenen Personen geschuldet wird.)
Damit komme ich zur zweiten Frage: Es sind diese moralischen Implikationen, die deskriptive Aussagen zum Gegenstand einer moralischen Verurteilung machen können. Um das zu erkennen, betrachten wir ein weiteres simples Beispiel: Sie vermissen Ihre Geldbörse. Eine anwesende Person zeigt auf mich und behauptet: »Tim hat sie genommen.« Angenommen, die Aussage ist unwahr. Wenn 38dem so ist, dann werde ich sie nicht nur korrigieren wollen, so wie andere faktische Irrtümer. Denn es geht hier um eine moralische Anschuldigung, gegen die ich protestieren werde und die mich empören wird.
Wieso es sich trotz des deskriptiven wörtlichen Inhalts um eine moralisch gehaltvolle Anschuldigung handelt, wurde schon erklärt: Vor dem Hintergrund unserer geteilten moralischen Überzeugungen hätte ich, wenn ich die Börse genommen hätte, falsch gehandelt. Und das hat eben weitere Implikationen: Es bestimmt darüber, welche Handlungen und Einstellungen mir gegenüber angemessen sind. (Ich verdiene Groll und womöglich Strafe.)
Warum aber werde ich die Behauptung und ihre Implikationen nicht nur korrigieren, sondern empört verurteilen – also eine wesentlich moralische Reaktion zeigen? Diese Frage erfährt in der Literatur nicht das Maß an Aufmerksamkeit, das sie verdient. Wir beobachten immerhin oft, dass Diskussionen mit moralischem Thema auch leicht einen moralischen Ton bekommen. (Stellen Sie sich eine Person vor, die die Todesstrafe an Menschen mit schweren kognitiven Behinderungen für zulässig hält. Wenn es Ihnen geht wie mir, würden Sie dies nicht wie einen gewöhnlichen Irrtum behandeln, sondern wie etwas moralisch Abstoßendes.) Warum? Wie gesagt, es gibt zu dieser Frage nach meinem Wissen keine eigene metaethische Debatte. Wir könnten uns freilich einfach damit begnügen, dass moralische Überzeugungen und moralische Implikationen deskriptiver Aussagen eben offenbar selbst moralisch zu bewerten sind. Doch es ist durchaus möglich, hier eine weitere Erklärung zu geben. Ich für meinen Teil sehe mindestens zwei Gründe, warum eine Aussage mit verfehlten moralischen Implikationen unmoralisch sein kann.
Der erste Grund wird von einer Position erfasst, die in der aktuellen Metaethik unter dem Titel motivationaler In39ternalismus firmiert.[26] Sie besagt, dass jedes aufrichtige moralische Urteil mit einer passenden motivationalen Komponente einhergeht. Wenn wir zum Beispiel etwas aufrichtig als falsch beurteilen, dieses Urteil also kein leeres Gerede und kein bloßes Lippenbekenntnis ist, dann empfinden wir es auch als falsch – wir sind abgestoßen und fühlen uns angehalten, uns zu distanzieren oder Kritik zu üben. Da der Internalismus etwas Entsprechendes für jedes aufrichtige moralische Urteil behauptet, ist er nicht unkontrovers. Und obwohl ich selbst ihn für plausibel halte, können wir uns hier mit der schwächeren Ansicht begnügen, dass eine solche motivationale Komponente zumindest so typisch ist, dass wir sie prima facie in jedem Falle unterstellen dürfen. Auch diese schwächere These kann erklären, warum ich mich (im Beispiel) empöre: Nicht nur impliziert das, was jene Person über mich und ihre Geldbörse sagt, dass ich falsch gehandelt habe, Groll verdiene etc. Sondern ich darf unterstellen, dass die Sprecher:in und alle, die ihren Sprechakt akzeptieren, entsprechende Wünsche (etwa nach Bestrafung) und Gefühle (etwa Groll) hegen. Wünsche und Gefühle aber sind allemal legitime Gegenstände moralischer Bewertung. Und da ich in Wahrheit keine solchen negativen Reaktionen verdiene, kann ich sie als unvereinbar mit meiner Würde und mit meinem Status als unschuldige Person verurteilen.
Der zweite Grund liegt im präskriptiven, auffordernden Charakter moralischer Aussagen. Kant beispielsweise nennt moralische Aussagen deshalb »Imperative«, weil sie, wie er sagt, den Charakter einer »praktischen Notwendig40keit« oder einer »Nöthigung« tragen – weil sie uns also etwas abverlangen, das wir als unvollkommene Wesen nicht ohnehin und mit Notwendigkeit wollen.[27] Ebendieser auffordernde Charakter kommt aber natürlich auch in interpersoneller Kommunikation zur Geltung. Wir müssen auch hier keine starke These vertreten – etwa R. Hares Ansicht, dass moralische Aussagen Imperative logisch implizieren.[28] Es genügt vollauf, davon auszugehen, dass dieser Charakter pragmatisch übermittelt ist. Dies erklärt bereits, warum ich eine falsche Anschuldigung als unmoralisch kritisiere. Denn Aufforderungen, ob explizit oder implizit, sind moralisch bewertbar. Und jene Anschuldigung impliziert ja, dass ich bestimmte Formen der Behandlung verdiene und bestimmte moralische Immunitäten nicht genieße, und diese Implikationen haben präskriptiven Charakter. Natürlich werde ich protestieren, wenn zu einer Behandlung aufgefordert wird, die ich nicht verdiene.