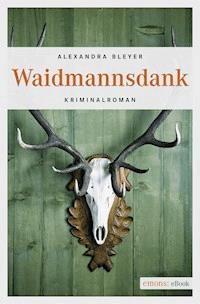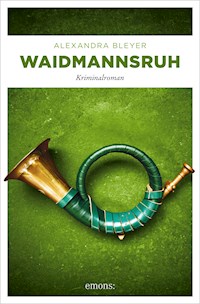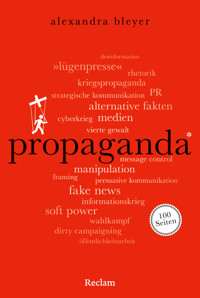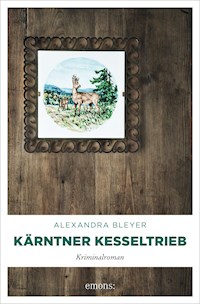
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Sepp Flattacher
- Sprache: Deutsch
Tiefschwarzer Humor aus dem Mölltal. Mit Touristen im Revier hat Aufsichtsjäger Sepp Flattacher seine liebe Not. Und als er mitten im Wald eine stattliche Hanfplantage entdeckt, ist's endgültig aus mit der Gaudi. Denn für ein Drogenkartell hat Sepp fast noch weniger Verständnis als für übereifrige Schwammerlsucher. Entschlossen bläst er zur Jagd auf die Ganoven im Mölltal. Doch die sind durchaus bereit, über Leichen zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Bleyer ist verheiratet (natürlich mit einem Jäger) und lebt mit ihrer Familie am Millstätter See. Die promovierte Historikerin ist Autorin mehrerer populärer Sachbücher. In ihren Jägerkrimis, die in Oberkärnten angesiedelt sind, kann sie ganz ungestraft mörderische Energien freisetzen.
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden und keinesfalls als Abbild der im Mölltal lebenden »echten« Menschen zu verstehen. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind zufällig und unbeabsichtigt; ebenso spiegeln die aus der Perspektive der Romanfiguren geäußerten Vorurteile beispielsweise gegenüber deutschen Nachbarn weder reale Verhältnisse noch die persönliche Meinung der Autorin wider.
Im Anhang findet sich ein Glossar zu Dialektausdrücken und Begriffen aus der Jägersprache.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: margie/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-508-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur für Autoren und Verlage, Aenne Glienke, Massow.
Mit lången Stången Wåssaschlången fången gången.
Prolog
»Wieso nicht?«
Tanja fuhr mit dem Zeigefinger die dunklen Linien des Tattoos nach, das sich über Paulis linke Brust und Schulter bis auf den Oberarm hinab zog. Ein Dämon mit Hörnern und Flammenschwert; das teuflische Gesicht zur furchterregenden Fratze verzerrt. Er erhob sich über bluttriefenden Totenschädeln. Ein Kämpfer. Ein Sieger.
»Bist du wahnsinnig?«, ächzte er.
Wie kam ein Schlappschwanz wie Pauli dazu, sich so ein Tattoo stechen zu lassen? Er war einfach nur erbärmlich.
Sie seufzte laut. »Was bist du nur für ein Mann?«
Pauli kämpfte mit der Bettdecke, die sich um ihrer beider Beine verheddert hatte. Als er endlich stand, beugte er sich über das Bett und fuchtelte mit seinem erhobenen Zeigefinger vor ihrem Gesicht herum. »Pass auf, wie du mit mir redest!«
Langsam ließ sie ihren Blick über seinen schmächtigen Körper gleiten. Was für ein Idiot.
»Zeig gefälligst mehr Respekt! Oder …«
»Oder was?«
Tanja trat die Decke nach unten und wälzte sich auf den Bauch. Sie wusste, dass er auf ihren nackten Hintern starrte und ließ aufreizend ihr Becken kreisen, bevor sie nach dem Handy langte, das inmitten leerer Pizzaschachteln neben ihrem Bett auf dem Boden lag.
»Du hast Schiss.«
»Fick dich!«, schrie er. »Ich habe vor nichts und niemandem Angst!«
»Hast du wohl.«
»Halt dei Goschn, du blöder Trampel!«
Sie checkte ihre Nachrichten und beachtete ihn nicht, während er sich anzog. Sollte sie ihn hinauswerfen aus ihrer Wohnung? Pauli war nicht perfekt, aber sie hätte es schlechter treffen können. Seit etwa drei Jahren führten sie eine Beziehung. Manchmal. Er bezeichnete sie vor anderen als seine Freundin. Für sie war er ein Stecher. Jünger als Tanja mit ihren neunundzwanzig Jahren hatte er noch dieses unreife Etwas an sich. Wenn er so wie vorhin von Respekt quatschte, war ihr nach Lachen zumute. Er war noch mehr Bub als Mann.
Dennoch war sie nicht bereit, ihn ganz fallen zu lassen. Er hatte seine Qualitäten. Nie käme er auf die Idee, ihr tatsächlich eine runterzuhauen, auch wenn er eine große Klappe hatte. Was jedoch das Wichtigste war: Meistens konnte er es ihr besorgen. Das war ihr Stichwort.
»Hey, Pauli.« Tanja ließ das Handy fallen, setzte sich auf und lächelte ihn an. »Hast du was für mich?«
Kurz wirkte es, als ob er böse bleiben und ihr den Stinkefinger zeigen wollte.
Tanja warf den Kopf in den Nacken und reckte ihm die Titten entgegen.
»Hm. Vielleicht.« Er grinste dämlich.
Sie spitzte die Lippen wie zum Kuss.
Pauli trat ans Bett heran, und sie streckte die Hand aus, fasste nach seinem Gürtel und zog ihn näher zu sich heran.
»Ich wette, du hast etwas Gutes für deinen Liebling.« Aufreizend rieb sie über die Vorderseite seiner Hosen, die zu tief auf seinen knochigen Hüften saß. »Gib’s mir!« Tanja leckte sich gierig über die Lippen. Sie konnte es förmlich schmecken. Das Wasser rann ihr im Mund zusammen.
Viel zu langsam für ihren Geschmack fischte Pauli mit zwei Fingern ein kleines Plastiksäckchen aus der Hosentasche.
»Willst du das?«
Sie nickte hektisch. Er gab es ihr. Mit den Zähnen riss sie die Verpackung auf, schüttelte die beiden Pillen in ihre Handfläche und warf sie sich ein. Ohne Getränk in Reichweite brauchte sie zwei Anläufe, sie zu schlucken. Mit einem zufriedenen Seufzer ließ sie sich aufs Bett zurückfallen.
»Und was krieg ich dafür?«, fragte Pauli, und sie spürte, wie seine Hand über ihre bloße Haut kroch.
»Was immer du willst.«
Es war ihr egal.
Alles war egal.
Stunden später wurde Tanja munter. Pauli lag neben ihr. Sie hatten den ganzen Sonntag verschlafen. Na und?
Sie schüttelte ihn an der Schulter, bis er grummelig aufwachte.
»Hörst, ist es dir nicht zu blöd, immer der kleine Handlanger zu sein? Der Boss sahnt so richtig ab, und du? Du lässt dich mit Peanuts abspeisen.«
Dabei könnten sie mehr haben.
Mehr.
Viel mehr.
Wenn Pauli nur nicht so ein feiger Loser wäre.
1
Kennst du den schon? Steigt ein Jäger auf den Hochsitz. Hockt schon ein Pärchen drauf. Sagt der Jäger … Keine Ahnung, was irgendein Jäger drauf sagen würde. Der Sepp Flattacher jedenfalls knurrte böse: »Runter von meinem Sitz!«
»Huch!«, japste die Tschåldra, die offensichtlich nicht damit gerechnet hatte, dass plötzlich ein grantiger Jäger auf der Leiter stehen und seinen rechtmäßigen Platz einfordern könnte.
»Schnacksln könnts meinetwegen in den Brombeerstauden, wenns euch ka Hotel leisten könnts!«, schnauzte er die beiden an.
Was manche Leit an Hochsitzen romantisch fanden, konnte Sepp nicht nachvollziehen. Gut, so eine halb geschlossene Kanzel wie diese mochte lauschige Abgeschiedenheit gewähren; aber dennoch blieb es eng, ungemütlich und nicht ganz ungefährlich. Nur zu leicht konnte man sich beim Herumwetzen einen Špal im Allerwertesten einhandeln. Wenn dann noch so ein liebestolles Pärchen mitsamt Hochsitz fünf Meter zu Boden krachte – die Dinger waren hålt nicht für dynamische Wackelbelastungen ausgelegt, sondern für Waidmänner, die ruhig und still dasaßen –, war Schluss mit sexy. Und wer hatte dann wieder den Ärger? Die Jäger, die einen neuen Hochsitz errichten und sich vielleicht noch rechtfertigen mussten, warum der alte zusammengebrochen war. Also wirklich!
»Wie bitte?«, fragte der Mann begriffsstutzig. »Was meinen Sie?«
»Wir wohnen in der Pension Hanni in Mallnitz«, fügte seine bessere Hälfte gschaftig hinzu.
Oha, mit seinem Verdacht war Sepp wohl falsch gelegen, wie er auf den zweiten Blick feststellte. Das Pärchen mittleren Alters wurde nicht vom zweiten Frühling heimgesucht, sondern saß voll bekleidet – und sichtlich verkrampft – auf dem schmalen Sitzbrett. Kleinkariert und bunt die Hemden, nagelneue Multifunktionsfreizeittreter und zwei Paar Wanderstecken für den zackigen Marsch durch Mutter Natur.
Scheiß Touristengfrasta!
»Das ist kein Aussichtsturm, also runter!«, fuhr er sie mit gedämpfter Stimme an. »A bissl flott – und leise! Im Wald gibt’s ka Gschra!«
Über nichts konnte sich Sepp so sehr ärgern – also gut, abgesehen von Jagdkameraden, die ihm seine Trophäen streitig machten, korrupten Politikern, tepaten Leit im Allgemeinen und seinen Nachbarn Heinrich Belten im Speziellen und so weiter und so fort – wie über Touristen, die im Wald aMetn veranstalteten, dass die Hälfte gnua wäre. Wenn eine Touristenhorde trällernd durch seinen Wald stapfte, keinen Ton traf und das fehlende Talent durch Lautstärke wettzumachen trachtete, griff er schon aus Umwelt- und Tierschutzgründen hart durch. Mindestens genauso schlimm fand er Schwammerlsucher, die sich zum systematischen Abgrasen der Waldhänge trennten und sich dann mit lautstarken Zurufen miteinander verständigten, wenn sie drei verdorrte Eierschwammerln gefunden hatten. Das einzig Gute daran war, dass Waldbesitzer, Jäger und die Bergwacht dadurch genau wussten, wo sich die übereifrigen Sammler befanden, und sie an geeigneter Stelle abfangen konnten. Und wehe dem – egal ob Italiener oder Einheimischer –, der zu viel auf die Waage brachte!
Sein Blick fiel auf den gut gefüllten Korb zu Füßen der beiden Touristen. Ha! Er hasste es, wenn sich Leute in seinem Revier nicht an die Regeln hielten. Und die beiden vor ihm brachen gerade mehr als ein Gesetz.
»Unbefugten ist die Benutzung jagdlicher Einrichtungen verboten, und das sind garantiert mehr Steinpilze als erlaubt!«
Hardigatte, die herbstliche Abenddämmerung brach bereits herein, es begann die beste Jagdzeit des Tages, und er musste sich mit zwei Piefkes herumplagen, statt Anblick zu haben.
»Aber …«
»Jetzt aber runter von meinem Sitz!«
Er bedeutete ihnen unwirsch, in Bewegung zu kommen, aber sie blieben stocksteif sitzen.
»Wollen S’ hier übernachten oder was?«
»Aber die Bären …«, flüsterte die Frau und umklammerte den Arm ihres Mannes. »Hören Sie doch!«
»Was?«
»Na, die Bären! Sie hören sie doch auch, oder?«
Ein dumpfes Röhren klang durch den Wald. Da ging dem Jäger das Herz auf – den beiden Touristen aber rutschte es in die Hochwasserhosen.
»Bären?«
Wollten die ihn verarschen? Nein. Sie sahen ernst und betreten drein; geradezu furchtsam, als ob sie sich gleich anscheißen würden.
»Bären, aha«, murmelte er mehr zu sich selbst und schüttelte den Kopf.
Ob im tiefen Wald oder auf der hohen Alm – da konnte so mancher Bauer, der seine Kühe oben weiden ließ, ein Lied davon singen –, mit den Stadtmenschen hatte man nichts als a Gscher.
»Bitte entschuldigen Sie. Nur deshalb sind wir auf den Hochsitz herauf, verstehen Sie«, erklärte die Frau.
»Wir hörten die Bären und konnten uns gerade noch rechtzeitig retten«, ergänzte der Tschriapl und nickte mehrmals. »Wir haben uns vor dem Urlaub schlaugemacht und gelesen, dass es in Kärnten neben Wölfen auch Bären geben soll. In der Nähe von Klagenfurt wagte sich einer ganz frech an die Siedlung heran, nicht wahr? Gibt es hier im Mölltal denn viele Bären?«
Sepp kratzte sich am Bart. »Oh ja. Viele«, brummte er. »Vor allem Schwarzbeeren.«
»Sind die sehr gefährlich?«
»Hm-hm.«
Wieder erklang ein Röhren.
»Es hört sich an, als hätten sie uns umzingelt«, jammerte die Frau. Sie erhob sich halb und spähte vom Hochsitz hinunter.
Sepp schnaufte ungeduldig über und schickte sich an, die Leiter hinunterzusteigen.
»Warten Sie! Wo wollen Sie denn hin? Sie können doch nicht … und uns hier allein …«
Der Mann machte einen Satz nach vorn und umklammerte beinahe schmerzhaft Sepps Hand, mit der sich dieser am Einstieg festhielt. »Ich heiße Hans-Jürgen. Und das ist meine Frau, die Doris.«
Wen interessierte das? »Sollen wir uns jetzt verbrüdern oder was?«
»Na ja, wir sitzen ja irgendwie … im selben Boot? Die Gefahr … das schweißt zusammen, gemeinsam …«
Die Piefkes hatten doch alle einen gewaltigen Klopfer. Und da hatte Sepp immer gedacht, nur der Belten wäre saublöd.
»Bitte, lassen Sie uns nicht im Stich, Herr …?«, flehte Doris.
»Sepp.« Er seufzte.
Was die heutige Jagd betraf, galt: Der Zug war abgefahren. Verärgert wollte er nur noch eines: Die beiden Deppen aus seinem Revier verjagen. Doch Hans-Jürgen und Doris würden garantiert wie die Trampeltiere durch den Wald hirschen und sich bei seinem Glück in der einbrechenden Dunkelheit verirren und umso lauter um Hilfe schreien. Dann würde die Bergrettung mit großem Tamtam anrücken …
Kruzitürken! Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als die beiden sicher ins Tal zu geleiten. Gut, dass sein Suzuki nur zweihundert Meter entfernt parkte. Er würde sie einpacken und runter nach Mallnitz bringen müssen. Was blieb ihm auch anderes übrig? Die Jagd konnte er für heute vergessen.
»Also gut, wir steigen jetzt –«
»Ich trau mich nicht runter!«, fiel Doris ihm hysterisch ins Wort.
Sepp verdrehte die Augen. Weiber!
»Um Himmels willen, können die Bären zu uns heraufklettern? Sind wir hier oben überhaupt sicher?«
Wenn Hans-Jürgen noch weiter zurückwich, würde er seiner Holden am Schoß hocken vor lauter Angst. Konnten diese Flachländer aus dem Norden nicht einfach bleiben, wo sie waren? Das wäre für alle Beteiligten besser. Dann könnte Sepp in seliger Ruhe die Hirschbrunft genießen, und die beiden könnten … was auch immer.
»Zum Glück haben Sie … hast du ein Gewehr, Sepp.«
»Auch genügend Munition?«, hakte Hans-Jürgen nach.
»Drei Patronen«, antwortete er wahrheitsgemäß.
»Nur drei?«
»Ja, lei drei. Ich geh auf die Jagd und zieh nicht in den Krieg!«
Was glaubten Stadtmenschen eigentlich, was Jäger taten? Blindlings jedes Tier abknallen, das ihnen vor die Büchse kam? Sepp war weder ein Barockfürst noch ein osteuropäischer Diktator, der sich das Wild von seinen Untertanen zutreiben ließ und an einem Tag locker hundert Tiere abschlachtete. Von Jagd konnte da doch keine Rede mehr sein; das war hirnloser Blutrausch. Ganz anders hier im Revier: An neun von zehn Jagdtagen fiel gar kein Schuss; zudem kam Sepp allmählich in das Alter, in dem er schon mal auf Beute verzichtete und einfach zusah, was sich in der Natur abspielte.
Hege und Pflege wurde bei ihm ebenfalls großgeschrieben, und Sepp machte sich schon jetzt Gedanken über den nahenden Winter. Was, wenn dieser so hart und schneereich wurde wie in den letzten Jahren? Was konnten, was durften sie tun, um das Wild über die kalte Jahreszeit zu retten? Darüber wurde nicht nur in der Hubertusrunde, sondern auch in anderen rotwild- und schneereichen Jagdgebieten hitzig diskutiert. An der Frage, Fütterungen ja oder nein, schieden sich die Geister. Sepps Meinung nach nutzte es niemandem, schon gar nicht dem Jäger, wenn die Tiere elendig verhungerten und im Frühjahr haufenweis die Kadaver herausaperten. Wobei das Futter nur einen Teil ausmachte, genauso wichtig war es, dafür zu sorgen, dass das Wild im Winter die notwendige Ruhe fand, damit es – den Stoffwechsel fuhr es ohnehin hinunter – trotz jahreszeitbedingt geringerem Nahrungsangebot überlebte.
Bei der letzten Vorstandssitzung der Hubertusrunde hatte sich auch Sepp dafür eingesetzt, dass sie heuer schon frühzeitig mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – wo Obfrau Irmgard Leitner ja so auf den Austausch mit den Medien und der Bevölkerung stand – begannen, um den Winterfreizeitsportlern klarzumachen, dass sie abseits der präparierten Pisten nichts zu suchen hatten. Die gingen mit ihrem riskanten Quer-über-die-Hänge-und-durch-den-Wald-Teufeln nicht nur den Bergrettern gewaltig auf den Sack, die unter dem Einsatz des eigenen Lebens hirnlose Tourenskifahrer unter den Lawinen herauszerren mussten, sondern trieben auch das Wild in sinnlose, energieraubende Fluchten und damit in den Tod. Das waren echte Probleme eines Jägers.
Zwei Touristen, die seinen Hochsitz blockierten, waren dagegen nur ein Ärgernis. Jetzt fing Doris auch noch zu schluchzen an. Am liebsten hätte Sepp abgepackt und wäre geflohen.
»Unsere Handys haben keinen Empfang. Wir können keine Hilfe rufen«, klagte Hans-Jürgen. »Was sollen wir nur tun? Oh mein Gott!«
Wieder ertönte das dumpfe Röhren, und Sepp verlor endgültig die Geduld. Er hatte doch wirklich Besseres zu tun, als seine kostbare Zeit mit den Touristen zu vergeuden.
»Jetzt kriegts euch wieder ein. Wir steigen runter und gehen –«
»Aber wenn uns diese Bestien jagen …«
»Ich will nicht sterben«, jaulte Doris auf.
Hans-Jürgen schüttelte sie an der Schulter. »Wir müssen stark sein und um unser Leben rennen!«
Wie bitte? Er musterte die beiden. Wie Sportskanonen sahen sie nicht aus. Hans-Jürgen glich mehr einem aufgedunsenen Krapfen, und Doris hatte zwar dicke Stampfer, aber Sepp bezweifelte, dass es sich dabei um Muskelmasse handelte.
»Wie schnell könnts denn laufen?«, fragte er skeptisch.
»Ich … ich weiß nicht, ob ich schneller rennen kann als ein Bär«, antwortete sie verzagt.
»Wurscht. Es reicht, wennst schneller bist als dein Mann.«
»Wie? Wieso?«
»Was meinst du?«
Sepp grinste boshaft. »Den Letzten beißen die Hunde. Oder in diesem Fall die Bären. Und derweil können die anderen … verstehts?«
Es dauerte ein bisserl, bis bei denen der Groschen fiel.
»Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist«, wimmerte Hans-Jürgen, der die kümmerlichen Reste seiner Männlichkeit wohl an der ersten Leitersprosse zum Hochsitz herauf abgegeben hatte. »Da bleibe ich lieber still hier oben und warte auf Hilfe.«
Sepp rieb sich über den struppigen Bart. Der Gedanke, den zwa so einen Graus einzureden, dass sie so schnell keine Exkursionen mehr in den Bergwald wagen würden, hatte etwas für sich. Und mit viel Glück gab es vielleicht noch eine Chance, den Abend und die Hirschbrunft wie geplant zu genießen. Einen Versuch war es wert.
»Also gut. Wir müssen ja nicht alle unser Leben riskieren. Ihr zwei bleibts hier sitzen, und ich versuche, mich ins Tal durchzuschlagen. Aber ihr müssts ganz, ganz leise sein! Damit sie euch nicht hören, die … Bären.«
»Danke! Vielen Dank!« Hans-Jürgen drückte Sepps Hand.
»Sie sind ein wahrer Held!«
»Hm-hm. Die Steinpilze nehm besser ich mit. Die Bären fressen sich gerade ihren Winterspeck an und könnten vom Duft angelockt –«
Fast hätte es ihn rückwärts die Leiter runtergeworfen, so schwungvoll drückte ihm Hans-Jürgen den Korb mit den Pilzen gegen die Brust.
»Da, nimm! Bitte!«
Sepp machte sich an den Abstieg. »Denkts dran: Psssst!«
Der Abend war doch nicht im Arsch. Von einem – zum Glück unbesetzten – Hochsitz ganz in der Nähe aus hatte er den perfekten Blick auf eine Fratn und das Vergnügen, zuzusehen, wie ein kapitaler Platzhirsch seinen Nebenbuhler vertrieb. Hach, das kräftige Brunftgeschrei der Hirsche war Musik in seinen Ohren. Nur Stadtmenschen, die die Natur ausschließlich von TV-Dokumentationen kannten, konnten das mit Bärenrufen verwechseln. Wobei Hans-Jürgen und Doris nicht die Ersten waren, denen das passierte; es betraf zudem keineswegs nur Piefkes. Laut Zeitungsberichten waren auch schon Tschechen und Österreicher – bei der Wienerin hatte es ihn nicht gewundert, aber angeblich war auch einer aus Vorarlberg dabei gewesen – demselben Irrtum erlegen. Deppen gab es eben überall auf der Welt.
Erst sehr viel später, als er längst auf dem Heimweg war, fiel ihm das deutsche Pärchen wieder ein. Unschlüssig trommelte er mit den Fingern auf das Lenkrad. Was sollte er tun? Umdrehen und sie holen? Dazu hatte er keine Lust. Hans-Jürgen und Doris die Nacht über auf dem Hochsitz ausharren lassen? Das würde ihnen recht geschehen! Andererseits hatten sie sich tatsächlich still genug verhalten, um das Rotwild nicht zu vertreiben. Wurde er auf seine alten Tage mild? Gnade vor Recht ergehen lassend, rief er in der Pension Hanni an; der Besitzer war ein Jagdkamerad. »Du, falls dir zwei Flachländer abgehen, ich weiß, wo du sie dir holen kannst.«
Kein Zweifel: Er wurde alt. Martin Schober hielt sich die Hand vor den Mund, um sein Gähnen zu verbergen. Dabei war es noch nicht einmal Mitternacht! Zusammen mit Kerstin war er die überfüllten Parkplätze rund um das Obervellacher Erlebnisbad abgegangen; jetzt warteten sie auf dem Parkplatz vor der Tennishalle auf Kommandant Georg Treichel und Gerhard Koller; auch die aufgrund ihrer jungen Kinder Teilzeit arbeitende Vanessa Liebetegger war heute im Dienst. Laut letzter Meldung kontrollierte sie mit zwei Kollegen vom KKD, dem koordinierten Kriminaldienst, den Campingplatz Pristavec unten an der Möll. Gern hätte Martin mit Vanessa getauscht – denn dort war es gewiss sehr viel ruhiger als hier oben.
Die Obervellacher Tennishalle wurde nicht zum ersten Mal zur Konzerthalle umfunktioniert. Im Frühjahr hatte es unter dem Titel »Sound of Mölltal« ein stimmiges Aufeinandertreffen von Blasmusik und Pop & Rock gegeben. Gar nicht übel. Jetzt jedoch konnte Martin den Stil nicht einordnen. Was war das? Techno? Rave? Auf jeden Fall war es laut, schrill und unverständlich. Mit dieser Art Musik konnte er nicht warm werden, und er empfand sie mehr als Lärmbelästigung – ein Hinweis auf sein fortschreitendes Alter? Da wären ihm sogar schmalzige deutsche Schlager à la Helene Fischer noch lieber gewesen, denn das war – auch wenn es nicht seinen persönlichen Geschmack traf – zumindest als Musik erkennbar.
Vor ein paar Jahren, da war auch Martin noch bei der Wiener Polizei gewesen, hatten zwei der Großstadtkollegen im Dienstwagen ein Handyvideo zu Fischers »Atemlos« gedreht, das überraschend zum großen YouTube-Hit geworden war. Selbst Jahre später redete man noch darüber, und das besagte Video war von der Landespolizeidirektion sogar beim letzten Rundschreiben als Vorzeigebeispiel herangezogen worden, nämlich dafür, wie man die sozialen Medien für positive PR nutzen konnte und sollte. Also keine Videos von peinlichen Polizeieinsätzen oder gar übertriebener Polizeigewalt, wie sie auch aus den USA bekannt waren, sondern lustige Wohlfühlvideos, die die freundliche, menschliche Seite der Polizei zeigten, könnten doch bitte verbreitet werden. Das war freilich keine Dienstanweisung, nein, nur eine Anregung.
Treichel war, nachdem er sich das Video der Wiener Kollegen dreimal angesehen hatte, begeistert auf den Zug aufgesprungen.
»Die singen nicht mal selba!«, trumpfte der Chef auf. »Die bewegen lei die Lippen dazu und fuchteln mit den Händen herum.«
»Wie die großen Stars auf der Bühne«, sagte Kerstin und lachte. »Die kriegen dafür noch richtig viel Kohle!«
»Was die können, können wir schon lang!«
»Was denn? Wir sollen ein Musikvideo machen. Spinnst?«, lieferte Gerhard sofort konstruktive Kritik.
»Zwei Kärntner, ein Gesangsverein, heißt es nicht umsonst!«, beharrte Treichel auf seinem Vorhaben.
Er berief kurzerhand eine außertourliche Dienstversammlung an der Bar der Grillkunst ein. Auf ein passendes Lied konnten sie sich in den folgenden Stunden zwar nicht verständigen, aber sie wurden sich einig, dass man mit trockener Kehle schon gar nicht singen könnte. Bevor der Lokalbetreiber sie zur Sperrstunde hinauswarf, stellte Treichel sein Talent unter Beweis und stimmte die Kärntner Landeshymne an. Es sprach für die edlen Tropfen, die die Grillkunst zu bieten hatte, dass sogar Gerhard Koller einstimmte. Arm in Arm mit dem Chef schmetterten sie die ersten Zeilen, bevor sie – wie ging noch mal der Text?, wurscht! – weitersummten. Oh mein Gott, hatte Martin nur gedacht, wenn der Treichel sich selbst sehen könnte!
Das konnte er am nächsten Tag, denn Kerstin hatte die Szene heimlich mit ihrem Smartphone festgehalten. Treichel war atemlos, Gerhard sprachlos vor Entsetzen.
»Lösch das sofort! Das ist ein Befehl!«
»Blödsinn. Auf YouTube habts bereits fünftausend Klicks«, schmetterte Kerstin die beiden verkannten Popstars an.
So wieselflink bewegte sich der gelassene Treichel sonst selten. Er warf sich vor den nächsten Bildschirm und rief die YouTube-Seite auf. Gerhard pickte ihm förmlich an der Schulter.
»Unter was hast das eingegeben?«, fragte er nervös, während Treichel hektisch mit dem Zeigefinger auf die Tasten einhackte.
»Kerstin? Kerstin!«, brüllte der Chef.
Was Martin bis ins Stiegenhaus hörte, wohin sie ihn gezerrt hatte. Kerstin hielt sich die Seiten vor lauter Lachen und stolperte die Stufen hinab.
»Du hast das aber nicht echt ins Internet gestellt, oder?«
»Selbstverständlich nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde.«
Martin schüttelte den Kopf und lachte, insgeheim froh, dass er sich gestern Abend nicht auf die Trällerei eingelassen hatte und damit Kerstins fiesem Streich entkommen war.
»Ich lade dich auf einen Kaffee ein«, sagte sie und wischte sich die Lachtränen aus dem Gesicht. »Weil der Treichel und der Gerhard, die sind die nächsten Stunden eh mit etwas anderem beschäftigt.«
»Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein kleiner Teufel bist?«
»Oh ja.« Sie wackelte mit den Augenbrauen. »Ich bin ein böses Mädchen.«
Die Kellnerin der Grillkunst grinste, als sie – diesmal in Uniform – das Lokal betraten. »Geht’s euch gut nach dem gestrigen Abend?«
»Uns schon. Aber der Chef hat Kopfweh«, antwortete Kerstin.
»Das hat er sich redlich erarbeitet«, gab die Kellnerin mitleidlos zurück. »Wie wär’s mit hausgemachten Cremeschnitten?«
»Unbedingt! Martin, sündigst mit mir?«
Da Kerstin aber auch lieb und nett sein konnte – tatsächlich! –, nahmen sie ein paar Cremeschnitten mit nach oben. Und irgendwann zeigte sie Erbarmen mit Treichel und verriet ihm, dass sie das Video doch nicht veröffentlicht hatte.
»Das täte ich dir doch nie an, Chef.« Treichel vertrollte sich erleichtert, Kerstin rieb sich die Hände. »Eins sag ich dir, Martin. Das Video wird in ein paar Jahren der Hit auf Treichel seiner Pensionsfeier!«
Martin schmunzelte jetzt noch, als er daran zurückdachte. Treichel hatte das Thema Musikvideo zu PR-Zwecken seither nie, nie wieder angesprochen.
Ma, wie schön wäre es, statt jetzt hier vor der Tennishalle zu stehen, am anderen Ende des Hauptplatzes in der Lounge der Grillkunst zu sitzen oder sogar am Schreibtisch in seiner Kanzlei. Egal, in welchen frühen Morgenstunden er heimkommen würde: Martin war fest entschlossen, seine CD mit den Klassikern von U2 zu hören – und die Lautstärke voll aufzudrehen, um seine Gehörgänge ordentlich durchzuputzen. Kopfhörer hatte er zum Glück, sodass er weder eine Anzeige der Nachbarn noch eine aus seligem Tiefschlaf gerissene Bettina fürchten musste. Sie war zwar kein klassischer Morgenmuffel, sondern als Bauerntochter das frühe Aufstehen von klein an gewöhnt. Auch als Studentin und später als Arztgattin in Graz war sie dem Motto vom frühen Vogel und dem Wurm gefolgt. Wenn Martin Tagdienst hatte und sein Wecker um sechs Uhr klingelte, stand sie meist mit ihm auf, und sie genossen noch ein kurzes, gemeinsames Frühstück. Aber drei oder vier Uhr morgens an einem Sonntag war eindeutig zu früh, und er müsste mit einem grummeligen »Der frühe Vogel kann mich mal« rechnen. Wobei Bettina garantiert nichts dagegen hätte, wenn er sich – nach U2 – zu ihr ins Bett kuscheln und sie in seine Arme ziehen würde. Ganz behutsam würde er sie dann …
»Tolle Stimmung, was?«, brüllte Kerstin ihm ins Ohr.
Sie riss die Arme hoch und machte ein paar Tanzschritte. Mit löchriger hautenger Hose, ärmellosem Top und kurzer Jacke darüber könnte sie mit ihrer zierlichen Gestalt mühelos als Teenager durchgehen. Vor allem, da sie ihr schulterlanges Haar in zwei kecke Pippi-Langstrumpf-Zöpfchen geflochten hatte. Die extra für den heutigen Einsatz eingefärbten blauen Strähnen ließen sich laut ihrer Friseurin mühelos auswaschen. Mal sehen. Jedenfalls konnte man Kerstin ihren Spaß an der Verkleidung ansehen.
So viel Mühe hatte sich Martin nicht gemacht. Er trug seine bevorzugte Freizeituniform, Jeans und ein hellgraues Shirt, und war sich ziemlich sicher, dass Passanten in ihm am ehesten Kerstins Vater sehen würden, was er ihr mitteilte.
»Das, oder sie halten dich für meinen Sugar Daddy«, erwiderte sie und versetzte ihm tanzend einen Rempler mit der Hüfte.
Die fast – aber nur fast! – zehn Jahre, die er ihr voraushatte, wurden ihm schmerzlich bewusst, und sie ließ keine Gelegenheit aus, sie ihm unter die Nase zu reiben. Wie gesagt: Teufelchen! Er fuhr sich über seine Haare; angesichts des jugendlichen Publikums hier fühlte er seine Geheimratsecken auf das Doppelte anwachsen. Hätte er doch eine Baseballkappe aufsetzen sollen wie Gerhard, der in Ermangelung der Dienstkappe darunter seine stoppelkurzen Restkopfhaare verbarg?
»Oh yeah, yeah, yeah!«, sang Kerstin aus voller Kehle.
Dabei übersahen sie, dass Gerhard und Treichel zu ihnen zurückgekehrt waren.
»Wir sind im Dienst«, fauchte Gerhard Kerstin an.
»Aber Undercover! Kannst du dich noch ein bisserl auffälliger unauffällig benehmen, du Grantnzipf?«
»Ha? Was hast gesagt?« Treichel rieb sich über die Ohren und verzog das Gesicht. Er hatte es für eine gute Idee gehalten, kurz in den Konzertsaal hineinzuschauen. »Da wirst ja terisch! Welcher Idiot zieht sich noch Drogen rein, wennst schon von der Musik ganz wurlat wirst im Schädel?«
»Ich sag’s eich glei: Die Aktion ist a voller Griff ins Klo!«
»Gerhard, halt dei …«, polterte der Chef los, bevor er sich fing. »… eh schon wissen.«
Der Einsatz war seine Idee gewesen. Im Vorjahr hatte er bei einer stinknormalen Verkehrskontrolle einen jungen Mann aus der Grazer Umgebung angehalten und war, nachdem dieser das Fenster heruntergelassen hatte, von dem starken Cannabisgeruch fast umgeworfen worden. Bei der freiwilligen Nachschau – »Das Auto gehört meiner Oma!« – fanden sie jede Menge Cannabiskraut; laut den darauf ebenso aktiv werdenden Kollegen in der Steiermark besaß der Täter dort eine Outdoor-Plantage mit fünf Cannabispflanzen.
Was Treichel beinahe zum Explodieren brachte? Die Großlieferung war anscheinend für das Mölltal bestimmt, woraufhin er dem Drogenmissbrauch noch vehementer als zuvor den Kampf angesagt hatte. Aus einschlägigen Cannabiskonsumentenkreisen hörte man, dass der aufsehenerregende Stopp des Steirers und verschärfte Kontrollen durchaus eine abschreckende Wirkung auf andere Zulieferer hätten, und das Mölltal aktuell ein wenig »ausgehungert« wäre. Allerdings war es durch das Darknet relativ leicht, selbst in den hintersten Winkeln der Provinz auch an härtere Suchtmittel zu kommen.
Das wachsende Drogenproblem betraf keineswegs nur größere Städte; ländliche Gemeinden konnten sich ebenso zu wahren Hotspots der Szene entwickeln. Beispielsweise war Radenthein mit seinen paar tausend Einwohnern früher als Drogenhochburg verschrien gewesen. Dort hatten übrigens die Kollegen vom Landeskriminalamt und dem Spittaler Kriminaldienst noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine voll ausgerüstete Indoor-Cannabisplantage mit mehr als hundert erntereifen Pflanzen aufspüren können; bei den Tätern wurden zudem Kokain und Methamphetamine gefunden.
Auf der Polizeiinspektion Obervellach gaben sich Martin und seine Kollegen keinen Illusionen hin: Das Abfangen des Steirers war höchstens ein Etappensieg; weder Drogenhandel noch -konsum wurden dadurch langfristig unterbunden, und es galt, vor allem angesichts der steigenden Zahl Drogentoter, wachsam zu bleiben. Viele junge Leute griffen nicht mehr zur Zigarette als klassischer Einstiegsdroge, sondern gleich zum Joint. Auf die Jugend abzielende Spektakel wie das heutige Musikevent erwiesen sich leider nur zu oft als heißes Pflaster, daher der nächtliche Einsatz.
Martins Handy vibrierte in der Hosentasche.
»Im Bereich der Schießau tut sich was Verdächtiges«, meldete Vanessa.
Das klang vielversprechend! Falls sich heute Nacht illegale Drogengeschichten abspielten, ob Deals oder Konsum, dann im Schatten, abseits des Hauptevents. Viele Konzertbesucher übernachteten am Campingplatz Pristavec, denn obwohl es nachts schon recht frisch werden konnte, luden tagsüber noch spätsommerliche Temperaturen zum Zelten ein. Direkt gegenüber vom Campingplatz befand sich am nördlichen Ufer der Möll der kleine Naturpark Schießau – wie eine Erinnerungstafel festhielt, hatten hier über Jahrhunderte hinweg Schießübungen stattgefunden –, der Jugendlichen als beliebter Treffpunkt galt.
Martin und Kerstin nahmen das Zivilfahrzeug. Sie fuhren bis zum Ende des Hauptplatzes hinauf, statt schon davor abzuzweigen und in den engen Seitengassen Zeit zu verlieren. Zügig steuerte Martin den Wagen an der Feuerwehr vorbei und durch die Unterführung. Er sah im Rückspiegel, wie Treichel mit dem Dienstwagen in den Ortsteil Untervocken abbog, um sich so von Nordwesten her durch die Schrebergartensiedlung der Schießau zu nähern. Martin bog erst kurz darauf unmittelbar vor der Brücke ab und fuhr einen Feldweg direkt der Möll entlang, bis sie an eine von einem Bretterzaun umgebene Weidefläche stießen und das Auto abstellten. Von hier aus ging es auf einem schmalen Pfad – laut Hinweistafel war der Durchgang bis auf Widerruf gestattet – zu Fuß noch etwa hundert Meter weiter.
Martin eilte voran. Telefonisch fragte er nach Vanessas Standort.
»Ich parke am Weg nach Stallhofen, weiter nordöstlich, bei so einem Minibauernhof«, gab sie an.
»Hugo’s Ranch«, riet Martin.
Den Namen würde er so schnell nicht vergessen, da ihm Bettina – als sie auf ihrer Laufrunde dabei vorbeigekommen waren – einen sprachwissenschaftlichen Vortrag zum Thema »Deppenapostroph« gehalten hatte. Während sie ihre Muskeldehnungsübungen vollzogen, hatte sie ihm den McDonald’s-Effekt erklärt, der sich keineswegs nur im Mölltal dramatisch auf den zweiten Fall auswirkte. Bei Personalnamen, die nicht auf »s« endeten, gehörte sich kein Apostroph; das war ein ganz normaler zweiter Fall. Allerdings knickten schon die maßgeblichen Rechtschreibexperten vor der massenhaften, falschen Verwendung des Apostrophs ein; selbst der Duden beugte sich und akzeptierte ihn zur Verdeutlichung der Grundform eines Personennamens wie bei »Andrea’s Blumenecke« oder »Willi’s Würstelstand«. Richtiger wurde es deswegen noch lange nicht.
Wurscht. Wichtig war für Martin nur, zu wissen, wo sich Vanessa aufhielt. Zudem informierte sie ihn über den Standort der beiden Kriminaler.
Vor ihnen leuchtete das fahle Licht einer Campinglampe auf. Ein paar Jugendliche hatten es sich bei der Sitzgruppe aus Naturstein gemütlich gemacht. Sie hatten eine Kiste Bier dabei, verhielten sich aber bis auf ihr johlendes Gelächter nicht weiter auffällig. In einem weiter fortgeschrittenen Grad der Alkoholisierung dürften sich jene Personen befinden, die am anderen Ufer der Möll beim Motorikpark ihre Gaudi hatten und tapfer überprüften, wie kalt denn das Wasser sei. Den entsetzten Schreien und derben Flüchen nach eisig.
Martin und Kerstin beachteten sie nicht weiter, sondern gingen unter den Bäumen weiter Richtung Osten.
»Jö, schau, ein Spanner!«, raunte Kerstin und kicherte.
Hinter einem hüfthohen Mauerrest und einem Gebüsch verborgen, kauerte eine dunkel gekleidete Gestalt, die Kapuze des Shirts über den Kopf gezogen, ein Fernglas ans Gesicht gepresst. Sie schlichen näher heran, bis sie direkt hinter ihr standen.
»Na, wer tuat denn da die Leit ausspechteln?«, sagte Kerstin unvermittelt.
»Shit!« Der Mann sprang auf und wirbelte herum. Vor Schreck glitt ihm das Fernglas aus der Hand; zu seinem Glück hing es an einem Lederriemen um seinen Hals. »Wollts, dass ich an Herzinfarkt krieg?«
Der drahtige Kerl war etwa einen halben Kopf kleiner als Martin. Zottelige Haarsträhnen fielen ihm ins Gesicht; er war unrasiert und die Kleidung schlawuzig. Der erste Eindruck vermittelte ein Bild: Sandler. Was fehlte, war der penetrante Gestank nach Schweiß, Alk und Zigaretten.
»Gibt’s etwas Interessantes zu sehen?«, fragte Martin leise.
Der Mann zerrte sich den Riemen über den Kopf und reichte ihm das Fernglas, das sich als hochwertiges Nachtsichtgerät entpuppte.
»Schau selba. Da vorn, die Typen bei der Mauer.«
Martin spähte in die angegebene Richtung. Weiter vor ihnen ragte eine etwa zweieinhalb bis drei Meter hohe und einige Meter lange Mauer auf, vor der sich sieben Personen aufhielten. Zwei saßen auf der Parkbank davor, die anderen standen im Kreis herum. Die Glut einer Zigarette leuchtete strahlend hell auf. Er fand nichts Ungewöhnliches an der Szenerie.
»Und?« Kerstin, der er das Nachtsichtgerät weitergegeben hatte, konnte ebenfalls nichts entdecken.
»Die Flamme ist größer als bei einem Tschick. Und an Tschick gibt man auch nicht weiter«, erklärte Michl Berger, der auf Suchtgift spezialisierte Kollege vom KKD. Er schnupperte hörbar. »Riechts das? Eindeutig Cannabis.«
Man musste schon eine verflixt gute Nase haben, um auf die Entfernung den Hauch des unverkennbar süßlichen Geruchs wahrzunehmen. Auf Michl traf die Bezeichnung Schnüffler eindeutig zu.
»Ich habe einen Schnupfen«, verteidigte sich Kerstin.
Martin informierte per Telefon die anderen.
»Die schnappen wir uns!«, jubelte Treichel. »Schön umzingeln, dass uns keiner durch die Lappen geht!«
Sie tasteten sich von ihren jeweiligen Standpunkten aus vorsichtig an die Gruppe heran und bezogen in einigem Abstand Position. Dann schlenderte Michl, die Hände lässig in den Hosentaschen vergraben, zu den Verdächtigen. In seiner Aufmachung – so geht Undercover, wie Kerstin sichtlich beeindruckt bemerkte – fiel der beinahe vierzigjährige Suchtgiftexperte unter den jüngeren Leuten gar nicht weiter auf. Bereitwillig machten sie ihm in ihrem Kreis Platz.
»Uh, der Dübel zieht rein«, jubelte ein Halbstarker mit Strickmütze auf dem Kopf. »Hier.«
Michl griff mit der linken Hand nach dem Joint und zog gleichzeitig die rechte aus der Hosentasche. Er hielt ihnen seine Dienstkokarde unter die Nase. »Guten Abend, Polizei«, tat er höflich kund.
Im gleichen Moment aktivierten Vanessa und Gerhard ihre Handsuchscheinwerfer. Perplex verharrten die halb zugekifften Cannabiskonsumenten und schauten blöd; sie brauchten mehr als einen Moment, bis sie schnallten, was los war.
»Scheiße!« Der Kerl mit der Strickmütze fing sich als Erster, machte auf dem Absatz kehrt und sprintete los. Allerdings rannte er geradewegs in den kompakten Treichel hinein und prallte zurück. Wie ein nasser Sack ging er nieder.
»Na, na, wer wird denn weglaufen wollen«, grummelte Treichel und sicherte ihn, da er Anstalten machte, erneut zu fliehen, indem er sich auf ihn draufsetzte. Wirksam.
»Keine Bewegung!«, schrie Gerhard.
Die anderen blieben perplex, wo sie waren, bis auf einen stämmigen Kerl mit einer Wodkaflasche in der Hand.
Er stürmte zuerst auf Gerhard los und schlug dann einen Haken. Vanessa erwischte ihn zwar am Ärmel, aber er haxelte sie und riss sich los, bevor er auf dem schmalen Feldweg zwischen zwei Weidezäunen aus Drahtgeflecht in Richtung Norden lief.
Martin setzte ihm nach. Am Hauptweg angekommen, überlegte der Flüchtende nicht lange; statt nach links zu den Schrebergärten zu laufen oder rechts dem Weg Richtung Stallhofen zu folgen, rannte er geradeaus an einem Hochspannungsmast vorbei und querfeldein über die Wiese.
»Stehen bleiben«, rief Martin. Er stolperte über eine Bodenunebenheit, fing sich aber noch vor einem Sturz. Von der Schießau bis zur Bundesstraße waren es in der Luftlinie vielleicht dreihundertfünfzig Meter. Mist, er musste es schaffen, den Flüchtenden davor zu stellen! Nicht, dass der zwischen den ersten Häusern Obervellachs abtauchte – oder, wenn er Pech hatte, blindlings über die Bundesstraße rannte und wie ein Hirsch von einem Auto erwischt wurde.
Vor einem weißen Haus taumelte der andere eine kurze Böschung hinauf; Martin war ihm knapp auf den Fersen. Schon schmetterte ihnen die Leuchtreklame des direkt an der Bundesstraße gelegenen BILLA ihr grellgelbes Licht entgegen.
Scheiße!
Zugleich flackerte an der Bundesstraße von links kommend blaues Licht auf.
Als Martin zwei Schritte hinter dem Verfolgten den asphaltierten Zufahrtsweg parallel zum BILLA-Parkplatz erreichte, bog der Dienstwagen mit quietschenden Reifen auf diesen ein.
Schlitternd kam der Flüchtende im Scheinwerferlicht zum Stehen und sah sich aus geweiteten Augen panisch um; er torkelte um die eigene Achse.
»Lass das Kasperltheater«, rief Martin ihm zu. »Das bringt doch nichts!«
Treichel und Kerstin stiegen aus. Drohend ging der Chef, die Hand am Holster, einen Schritt auf den Cannabiskonsumenten zu, während Kerstin per Funk das erfolgreiche Ende der Verfolgungsjagd verkündete.
Der Gestellte war im gegenwärtigen Zustand keiner Vernunft zugänglich. Mit einem Aufschrei schleuderte er Treichel die Wodkaflasche entgegen, die aber einen unschuldigen dunklen BMW traf. Mit einem Knirschen zerbrach die Scheibe der Fahrertür und die Alarmanlage schrillte los.
»Na toll«, murrte Martin.
Sachbeschädigung, was bedeutete: mehr zu schreiben.
Der Übeltäter brach zusammen, hielt sich die Ohren zu und leistete keinen größeren Widerstand, als Martin und Treichel ihm die Achter anlegten. Dabei schimpfte er ohne Unterlass vor sich hin. Martin verstand kein Wort. Das war wahrscheinlich besser so.
»Mein Auto!«, kreischte eine Frau.
Sie wechselten über den am Boden Liegenden hinweg einen Blick.
»Das ist was für dich und dein Deeskalarationsseminar«, befahl Treichel.
Mit einem unterdrückten Seufzer stand Martin auf und ging auf die Frau zu, die mit einer, tiefste Empörung ausdrückende, Handbewegung auf das Auto wies.
»Mein BMW!«
Ihr waren drei Männer mittleren Alters gefolgt, von denen Martin nur einen auf Anhieb erkannte: Ex-Bürgermeister Max Müller, der sich naturgemäß sofort in den Mittelpunkt drängte und wichtig die Klappe aufriss.
»Was ist hier los? Ich verlange eine Erklärung!«
Müller spielte sich noch immer gern als Ortskaiser auf, obwohl er bei der letzten Wahl von Veronika Schwarzenbacher klar geschlagen worden war und seither in der Landespolitik – und wer weiß, wo noch – mitmischte.
Er schien Martin zu erkennen, denn er kniff die Augen zusammen. »Sie sind doch von der Polizei! Warum tragen Sie keine Uniform? Was geht hier vor? Wer hat das Kommando?«
»Ich!«
Wie man einen Zwei-Meter-Koloss wie den Treichel übersehen konnte, blieb Martin ein Rätsel. Aber genau das war Müller passiert, der erschrocken zurückwich, als ob der Krampus persönlich vor ihm stand.
»Müller«, knurrte der Chef, der nichts mehr davon wissen wollte, dass Martin für Deeskalation sorgte, sondern den Fall nun persönlich nahm.
»Treichel.«
Bei jeder, aber wirklich jeder Begegnung der beiden, deren Zeuge Martin wurde, erwartete er einen klassischen Showdown. Georg Treichel und Max Müller verband seit Jahren eine intensive Hassliebe, mit der Betonung auf Hass und sehr, sehr wenig Liebe. Zwar rissen sich beide zusammen und versuchten, zumindest bei offiziellen Terminen vor Dritten die Fassade aufrechtzuerhalten, aber meist machten sie keinen Hehl aus ihrer abgrundtiefen Abneigung.
»Wer bezahlt den Schaden?«, ereiferte sich Müller.
Treichel musterte den teuren BMW. »Ist das dein Auto?«, fragte er ihn. »Was ist das für ein Modell?«
»Marke Schwanzverlängerung«, wisperte Kerstin, und Martin hustete in die Faust, um sein Lachen zu verbergen.
Neugierig schlenderte er zum Autoheck. Wow, BMW 7er-Limousine. Wenn das das neue Dienstfahrzeug eines mittelprächtigen Politikers sein sollte, war klar, warum sich Parteien ständig neue Förderungsgelder in unverschämter Höhe genehmigten.
»Hier liegt ein Missverständnis vor«, mischte sich einer der anderen Männer ein. »Der Wagen gehört meiner Frau Tessa.«
Ein gut gekleideter Mann mit auffälligem Schnauzer und Kinnbärtchen streckte Treichel die Hand entgegen. »Gruber, mein Name. Donald. Wie der US-Präsident, da hört die Ähnlichkeit mit dem Trumpel aber auch schon auf, schwöre!«, sagte er mit einem selbstironischen Grinsen und fügte fast entschuldigend hinzu: »Mein Vater war ein Donald-Duck-Fan. Ich bin nur froh, dass ich keine Mickymaus oder ein Dagobert geworden bin.«
Der dritte Mann wurde von ihm als Thomas Schneider vorgestellt, der sich aber im Hintergrund hielt und an seinem Handy fummelte.
»Wer kommt jetzt für den Schaden auf?«, wollte Müller wissen und deutete auf den Verhafteten. »Der da etwa?«
Gute Frage. Der zugedröhnte Täter sah nicht so aus, als ob er den Schaden aus seiner Portokassa zahlen könnte. Gruber dürfte zur selben Einschätzung gelangen. Er seufzte. »Einem Nåckerten kann man nicht in den Sack greifen.«
Seine Frau umklammerte seinen Arm. »Was? Wer zahlt –«
»Schon gut, Tessa-Schatz, kein Grund zur Aufregung«, beschwichtigte er sie, legte ihr den Arm um die Taille und drückte sie an sich. »Lass dir deswegen bloß keine grauen Haare wachsen.«
Sie warf ihre blondierte Mähne zurück und sah den Schuldigen böse an.
»Wenn Sie morgen auf die PI kommen, nehmen wir die Sachbeschädigung auf. Es tut mir leid, dass Sie durch unsere Amtshandlung geschädigt wurden«, entschuldigte sich Treichel.
»Das wird ein Nachspiel haben!«, drohte Müller und stach Treichel den Zeigefinger fast ins Gesicht.
Keine gute Idee. Der Chef war übernächtigt, gereizt durch die Drogengeschichte und jetzt noch mit seinem Erzfeind konfrontiert. Ohnehin nicht gerade für seine Engelsgeduld bekannt, reagierte er entsprechend sauer und packte das provozierende Körperteil. Mit dem Druck seines Daumens bog er Müllers Finger zurück.
»Aua!«
»Mit dem nåckerten Finger zeigt man nit auf angezogene Leit«, tadelte er ihn gespielt oberlehrerhaft.