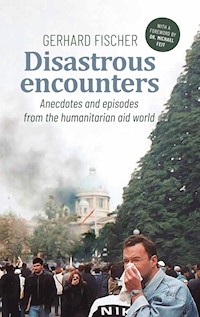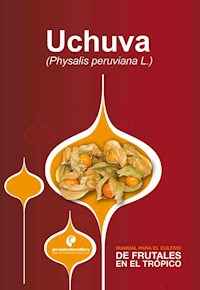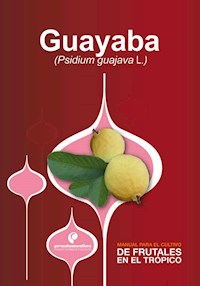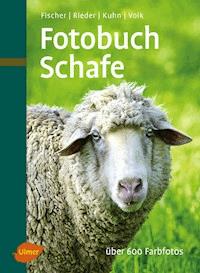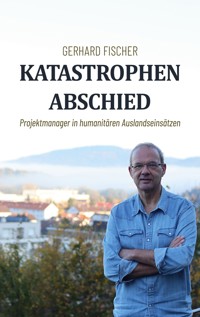
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wann wird humanitäre Hilfe geleistet? Wie unterscheiden sich Hilfsorganisationen? Welche Art von Projekten gibt es? Wie kommen diese zustande und wer führt sie durch? Worauf kommt es in der Zusammenarbeit zwischen dem Projektmanager und seinem Team vor Ort an? Und wie viel verdient er überhaupt? Antworten liefert Gerhard Fischer, der sich nach mehr als zwanzig Jahren von der Auslandstätigkeit im Bereich humanitäre Hilfe verabschiedete. Er zeigt nicht nur wie sein Arbeitsalltag in unterschiedlichen Kontexten aussah, sondern zieht auch Bilanz mit all den Vor- und Nachteilen - manches würde er aus heutiger Sicht nicht mehr genauso tun!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
TEIL I Peilung: Humanitäre Hilfe
1 Der Anfang – am Ende zurück auf Anfang
2 Der Kontext – gebietsweise stürmisch
TEIL II Die Praxis hier und dort
1 Arbeitgeber – organisiert, aber uneinheitlich
2 Die Projekte – logisch: quer und kreuz
3 Teamarbeit – mitunter einsam, meistens gemeinsam
TEIL III Ultimative Grübelei
1 Die eigene Rolle – Mission erfüllt?
2 Im Nachhinein – aus Erfahrung klüger!
3 Fazit – Ende gut, (fast) alles gut!
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Im Jahr 2019 hatte ich lustige und skurrile Erlebnisse meiner bis dahin fast zwanzig Jahre währenden Auslandstätigkeit im Bereich humanitäre Hilfe unter dem Titel ‚Katastrophenbegegnungen – Anekdoten und Episoden von der Helferfront‘* veröffentlicht. Darin ging es im Wesentlichen um Geschichten abseits meiner Arbeit in all den Einsatzländern, obgleich sich ein Kapitel darin auch damit – allerdings nach meinem Dafürhalten und im Nachhinein – zu oberflächlich beschäftigte.
Diese Lücke soll das vorliegende Buch schließen, indem es sich hauptsächlich mit damit verbundenen Aspekten – auch kritisch – auseinandersetzt. Diesmal wollte ich jedoch nicht nur Storys zum Besten geben, die hie und da Lacher auslösen, sondern die Geschichte zu Ende erzählen, die manchmal gar nicht zum Lachen war. Ferner hatte ich häufig den Eindruck, dass zuhause viele zwar begriffen, in welchem Arbeitsfeld ich tätig war, und mich dafür zum Teil bewunderten; was genau ich tat, interessierte jedoch nur ganz wenige.
Die allererste Fassung glich fast einer wissenschaftlichen Abhandlung mit allerlei Definitionen und dazugehörigen Fußnoten, worin ich versuchte, das ganze Spektrum des Hilfsgeschäftes aus meiner Sicht abzubilden. Als aber immer wieder neue Fragen oder Hintergründe auftauchten, sah ich ein, dass ein solch ambitioniertes Unterfangen im Bereich des Unmöglichen lag. Zum einen hätte ich da und dort keine Antworten liefern können, es sei denn, ich hätte mich auf allzu dünnes Eis begeben. Andererseits hatte ich als Praktiker vor Ort, der sich vornehmlich um Mitarbeiter und Projekte zu kümmern hatte, oft gar keinen großen Einblick hinter die Kulissen. Getreu dem Motto: ‚Schuster bleib bei deinen Leisten‘ beschränkte ich mich daher auf meine unmittelbare Umgebung. Da wusste ich wenigstens, wovon ich sprach.
Trotzdem konnte ich nicht umhin, mich aus den ‚Katastrophenbegegnungen‘ zu bedienen. Daher habe ich einige Kapitel daraus überarbeitet und hier, wo es passte, eingefügt. Nun mögen Kritiker mir vorwerfen, es handele sich lediglich um einen aufgepeppten Abklatsch oder alten Wein in neuen Schläuchen. Diesen Vorwurf muss ich mir gefallen lassen.
Aber: nicht nur bin ich davon überzeugt, dass der vorliegende Text nun die nötige Reife hat, indem er sich eingehender mit dem Thema beschäftigt, einschließlich der Bedingungen meiner Arbeitgeber. Sondern, indem ich der Zusammenarbeit besonders mit lokalen Kollegen einen eigenen Abschnitt widme, ich ihnen damit auch die zuvor vernachlässigte Aufmerksamkeit gebe. In diesem Zusammenhang bedeutet die Geschichte zu Ende erzählen jedoch auch, neben den Sonnenauch die Schattenseiten der Kooperation genauer zu beleuchten.
Gleiches gilt für meinen weiteren beruflichen Werdegang nach den ‚Katastrophenbegegnungen‘. Einerseits war mein damaliger Einsatz in der Türkei noch nicht beendet, und deshalb viel zu wenig gewürdigt. Andererseits, folgte daraufhin noch eine Mission, die sich als wirkliche ‚Katastrophenbegegnung‘ entpuppte, deren Geschichte ich ebenfalls zu Ende erzählen werde, und die zu meinem endgültigen ‚Katastrophenabschied‘ führte.
Wie zuvor ist auch diesmal der Titel doppeldeutig zu verstehen. Denn ich habe mich von Katastrophen verabschiedet, die stets die Ursache für meine Entsendung gewesen sind. Gleichermaßen geschah mein Abschied aber auch bisweilen in katastrophaler Art und Weise, indem ich einen Vertrag vorzeitig aus unterschiedlichen Gründen kündigte. Denn die Umstände der Katastrophensituation, in der ich arbeitete, hatten in diesen Fällen eine ganz eigene Dynamik entwickelt, die für mich nur noch als katastrophal zu bezeichnen waren, und ich mich gezwungen sah, einen Schlussstrich zu ziehen.
Allerdings handelt es sich hier weder um eine Schmähschrift oder eine Enthüllungsgeschichte, um Hilfsorganisationen unter Umständen in ein schlechtes Licht zu rücken, noch ist es eine nachträgliche Rechtfertigung oder Glorifizierung meiner Rolle. Vielmehr dient das Buch dazu, dem Leser das Panorama eines nicht alltäglichen Arbeitsgebietes durch meine Brille deutlicher vor Augen zu führen; trotzdem habe ich versucht, so objektiv wie möglich zu bleiben.
Aufgebaut ist das Buch in drei Teile. Zunächst wird nochmals mein Werdegang kurz skizziert, sowie die Kontexte, die ich vor Ort vorfand. Teil II beschäftigt sich ausführlich mit meiner Tätigkeit, in dem die Arbeitgeber, die Hilfsmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Kollegen jeweils in einem eigenen Kapitel beschrieben werden. Teil III stellt mein ganz persönliches Fazit dar. Zunächst gehe ich darin der Frage nach, ob ich tatsächliche Veränderungen bewirkt habe, die allein auf mich zurückzuführen waren. Darauffolgend stelle ich einige Gesichtspunkte vor, die ich nicht noch einmal genauso angehen würde, bevor ich zum Schluss nochmals die Vor- und Nachteile meiner Einsätze in beruflicher und persönlicher Hinsicht aufzeigen werde.
Lange habe ich damit gerungen, ob ich meine Arbeitgeber ausnahmslos beim Namen nennen sollte. Denn es gab neben den vielen positiven auch zahlreiche negative Situationen oder Erfahrungen. Deshalb habe ich beschlossen, die Hilfsorganisationen nur in Teil II namentlich zu erwähnen. Ansonsten sind sie weitgehend anonymisiert, ebenso meine damaligen Arbeitskollegen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden meistens das generische Maskulinum (Mitarbeiter, Kollegen) verwendet; damit sind Personen beiderlei Geschlechts bezeichnet und gemeint.
Besonders danken möchte ich Karin Niesen und Heinz Bitsch für ihre durchaus kritischen Anmerkungen, die mir in dem einen oder anderen Fall eine ganze neue Sichtweise eröffneten. Majed Nasser und Ervin Mandžukić, ehemalige lokale Mitarbeiter, lieferten mir die Neuigkeiten über noch laufende oder abgebrochene Projekte, wofür ich ihnen ebenfalls dankbar bin.
Thomas Kimling, das heißt, Herr Kimling, hatte bereits die ‚Katastrophenbegegnungen‘ als Fachfremder vorab gelesen und mir auch diesmal wertvolle Tipps gegeben. Zudem haben seine Kommentare hie und da zu einem oftmals ernüchternden ‚Aha-Erlebnis‘ geführt – danke dafür.
Mit der überwiegenden Zahl meiner Arbeitgeber habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Bei denjenigen, bei denen das weniger der Fall war, konnte ich trotzdem wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen. Daher möchte ich mich bei ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, mit denen ich in den Einsätzen zusammenarbeitete. Ohne ihr Zutun hätte ich mich sicherlich in professioneller Hinsicht nicht weiterentwickeln können.
Bleiben am Ende die Katastrophen: deren unterschiedlichste Auslöser haben meine berufliche Laufbahn überhaupt erst ermöglicht und mir Zeiten des Frusts, aber auch der Freude bereitet. Dennoch möchte ich mich bei ihnen ausdrücklich nicht bedanken; besser, sie tauchen erst gar nicht mehr auf. Gehorchen werden sie mir jedoch sicherlich nicht.
In diesem Sinne sage ich: ‚Goodbye, Katastrophen!‘ Den Leser lade ich dagegen mit einem ‚Herzlich willkommen‘ ein, mehr darüber zu erfahren.
November 2024
Gerhard Fischer
24. Februar 2022, Tiflis/ Georgien
Wie immer ging ich gegen sieben Uhr nach dem Aufstehen noch im Schlafanzug geradewegs in die Küche, um Kaffeewasser aufzusetzen. Seitlich durch die Balkontür schien die Sonne bereits grell vom wolkenlosen Himmel. Ich öffnete, klare, aber kalte Luft strömte herein. Ich trat hinaus. Unten im Hinterhof sah ich einen im dicken Wintermantel gekleideten Bewohner. Der Wasserkocher schaltete sich aus, ich füllte die French Press, dann eine Tasse und setzte mich wieder hinaus in einen Sessel, um die wohlige Wärme der Sonnenstrahlen zu genießen. Es würde ein herrlicher Tag werden, hoffentlich auch für mich.
Nach der kurzen, lauwarmen Dusche – richtig heiß war sie nie gewesen – setzte ich mich an den Küchentisch und fuhr den Computer hoch, um beim Frühstück die neuesten Nachrichten zu lesen. Fast ist mir der Bissen im Hals stecken geblieben: Krieg in der Ukraine.
Russland hatte in den frühen Morgenstunden den südlichen Nachbarn angegriffen. Noch waren die Hintergründe undurchsichtig, aber wie sich zeigen sollte, markierte dieser Tag eine weltpolitische und weltwirtschaftliche Zäsur, im Allgemeinen – gleichermaßen im Besonderen auch für meine berufliche Biografie. Denn es sollte nicht nur mein letzter Arbeitstag in Georgien werden, sondern ebenfalls mein allerletzter im Bereich humanitäre Hilfe. Mein Koffer war abflugbereit, ich nicht ganz. Noch fehlte die letzte Gewissheit.
Seit knapp zwei Wochen arbeitete ich von zu Hause aus in Quarantäne, da ich unmittelbar nach der Rückkehr aus einem heimatlichen Kurzurlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden war und nun wartete ich auf die Labormitarbeiterin, die gegen 8.30 Uhr zu mir kommen sollte, um den hoffentlich finalen Test an der Wohnungstür vorzunehmen. Ein kostspieliger Luxus, den mein Arbeitgeber übernahm.
Pünktlich klingelte sie und verschwand auch schon wieder. Mit dem Ergebnis könne ich in drei bis vier Stunden rechnen. So war es auch schon an den beiden vorangegangenen Tagen, allerdings musste – positiv der Test, negativ für mich – mein Heimflug zweimal von der Zentrale auf den Folgetag umgebucht werden. Heute war Donnerstag, sodass ich allerspätestens am Freitag fliegen wollte, ja musste. Zum Wochenende wollte ich in jedem Fall daheim in Deutschland sein.
Das übliche Abschlussgespräch am Ende eines Einsatzes sollte deswegen statt in Präsenz, was der Fall ohne Covid gewesen wäre, nun virtuell am frühen Nachmittag geführt werden. Diesmal sogar zwei, weil auch der Vorgesetzte meines Vorgesetzten mit mir reden wollte. Bis dahin sollte feststehen, ob ich flöge oder nicht. Dann wurden auch diese Gespräche abgesagt. In der Zentrale herrsche helle Aufregung wegen vieler Presseanfragen, natürlich wegen der Ukraine und nicht meinetwegen. Die Debriefings würden deshalb später nachgeholt werden. Wann? Wenn ich schon nicht mehr angestellt sei? Das wäre schließlich in fünf Tagen der Fall. Man ließ mich im Unklaren, so wie ich die Vorgesetzten, indem ich mit einem bloßen „Ok“ die E-Mail beantwortete.
Dabei hatte es vor Weihnachten noch ganz anders ausgesehen. Im Neuen Jahr sollte zu meinem Verantwortungsbereich Südkaukasus (Georgien und Armenien) die Ukraine dazukommen, was ich zunächst als nicht allzu viel Mehrarbeit betrachtete, weil mein Kollege im Büro gegenüber das dort laufende Projekt hervorragend leitete. Allenfalls würden einige Dienstreisen für mich zusammen mit ihm anfallen. Firm und erfahren war schließlich er und nicht ich. Meine Rolle wäre als Teamleiter lediglich die des Grüßaugusts gewesen, so sah ich das zumindest.
Am Morgen nach meiner Rückkehr teilte mir mein Vorgesetzter aus der Zentrale telefonisch wie aus heiterem Himmel mit, dass er und seine Chefs entschieden hätten, einem mir unterstellten Mitarbeiter zu kündigen; und zwar aus merkwürdigen, wenn nicht sogar lachhaften Gründen – konkret, „er sei zu qualifiziert (!) für seine Position“ und unkonkret, „er passe nicht zu uns“! Dafür passten die Aussagen in mein Bild von den Chefs.
Statt über dessen beabsichtigten Rausschmiss weiterzureden, machte ich meinem Ärger Luft und sprach unvermittelt meinen Abgang zum nächstmöglichen Zeitpunkt, dem 28. Februar 2022, aus. Trotz hörbarer Verblüffung am anderen Ende der Leitung hielt sich das Lamento (Wirklich? Wieso nur?) sehr in Grenzen. So kann man auch etwas sagen, ohne etwas zu sagen. Keine Minute später war das Gespräch beendet – ich solle lediglich meine Kündigung schriftlich schicken; per E-Mail wäre ausreichend. Selbst in den kommenden Tagen gab es keinerlei Anzeichen seinerseits, mich umzustimmen. Genutzt hätte es sowieso nichts, da vielerlei Gründe bereits das Fass gefüllt hatten, das die kolportierte Entlassung meines Mitarbeiters zum Überlaufen brachte. So hatte ich mich noch vor der Übernahme der Verantwortung für die Ukraine und der sich dort anbahnenden Katastrophe von selbiger verabschiedet.
Erst am späten Nachmittag des 24. Februar wurde mir das negative Testergebnis mitgeteilt, wodurch ich anderntags endlich fliegen konnte. Was für ein Glück, dass in der Zentrale wegen der Zeitverschiebung gerade erst die Mittagspause vorbei und somit keine weitere Umbuchung notwendig war. Abends war ich bei meinen beiden Kollegen zum Abschiedsessen eingeladen, mit denen ich mich bestens verstanden hatte. Ich fühlte mich geehrt, da ich während derer bereits neunjährigen Betriebszugehörigkeit, nach ihrer Aussage, der Erste der Organisation überhaupt war, der von ihnen in ihrem Heim empfangen wurde. Anderen, auch solchen aus der Zentrale, war dieses Privileg nicht zuteilgeworden. Auch das passte in mein Bild.
Während in einigen früheren Einsätzen anlässlich meines Abschieds ein Fest veranstaltet worden war, beschränkte sich jener Abend auf eine geruhsame Dreisamkeit, die wir freundschaftlich genossen, aber frühzeitig abbrechen mussten. Denn von der Straße vernahmen wir eine lautstarke Menge zur Unterstützung der Ukraine, die entlang meines Nachhausewegs zog, durch die ich mich entgegengesetzt durchschlagen musste, weswegen sich meine Gastgeber Sorgen machten; obendrein sei mein Flug in aller Herrgottsfrühe. Wir umarmten uns herzlich, ich dankte ihnen für die Einladung und ihre Unterstützung, wünschte ihnen weiterhin viel Glück und erreichte eine halbe Stunde später ohne Zwischenfall meine Wohnung. Das ließ ich sie per Kurznachricht wissen, woraufhin sie mir erleichtert ebenfalls „alles Gute“ mit auf den Weg gaben.
Ein wehmütiges Gefühl verspürte ich nicht gerade, als ich am nächsten Morgen die Gangway zum Flugzeug entlangging. Das war am Ende vieler vorangegangener Abschiede ganz anders gewesen. Merkwürdigerweise schossen mir plötzlich Bilder meines allerersten aus dem heutigen Serbien mehr als zwanzig Jahre zuvor durch den Kopf: als mich ausnahmslos alle Kollegen zum Flughafen Belgrad begleitet hatten; wie sie meine drei großen und überaus schweren Koffer zum Check-in trugen, wo ich mehr zum Spaß fragte, ob im Flugzeug Rauchen erlaubt sei und mir der Flughafenangestellte, für mich verblüffend, ein energisches „selbstverständlich“! entgegnete und nachher in der Tat, sobald die Anschnallzeichen erloschen waren, die gesamte Kabinencrew geradewegs nach hinten marschierte, um sich erst einmal eine Zigarette zu gönnen. Bei dem Gedanken musste ich schmunzeln. Und doch: Wie gerne hätte ich damals in Serbien weitergearbeitet – ganz im Gegenteil zu diesmal.
Jetzt war der Abschied geräuschlos verlaufen. Mit dem Taxi und lediglich einem großen Koffer war ich zum Flughafen gefahren. Je näher ich nun dem Flugzeug kam, desto mehr fiel die innere Anspannung ab und große, ja sehr große Erleichterung machte sich in mir breit. Als ich auf meinem Platz saß, wischte ich die letzten Gedanken beiseite, ob ich wohl nichts in der Wohnung vergessen hatte – die Schlüssel hatte ich wie verabredet auf dem Küchentisch liegen lassen und meinen Dienstlaptop und das Handy meinem Mitarbeiter am Abend zuvor übergeben. Alles sollte somit erledigt sein. Die Umsteigezeit in Istanbul sollte auch genügen, um nicht unter Zeitdruck zu geraten. Zur Beruhigung steckte ich mir Kopfhörer ins Ohr und schlief bei leiser Musik ein.
Genauso wie damals in Serbien flog ich jetzt von Georgien aus in eine ungewisse berufliche Zukunft. Zweieinhalb Jahre zuvor, als ich die Türkei nach vier Jahren verlassen hatte, war meine Hoffnung noch wesentlich zuversichtlicher gewesen, dass ich schon damals die Auslandsarbeit ein für alle Mal hinter mir gelassen hätte. Durch gesundheitliche Probleme ausgelöst hatte ich den festen Willen, in der Heimat beruflich Fuß zu fassen, um nicht noch einmal im Ausland Ärzten ausgeliefert zu sein, die zwar in ihrer Sprache diagnostizierten, in meiner aber völlig danebenlagen. Eine mehrmonatige Fortbildung im klassischen Projektmanagement sowie rund siebzig erfolglose Bewerbungen später sah ich doch keine andere Möglichkeit, als wieder ins Ausland zu gehen.
Jetzt aber war ich fest davon überzeugt, mich von meiner Auslandstätigkeit und den Katastrophen endgültig verabschiedet zu haben.
Von Tiflis aus hatte ich keinerlei Probleme beim Umstieg in Istanbul, sodass ich planmäßig in Frankfurt landete. Ich war froh, dass ich keine drei großen Koffer, wie seinerzeit in Serbien, dabeihatte, denn die damalige Bahnfahrt vom Flughafen nach Hause geriet beim Umstieg in Mannheim zur Zitterpartie, ob ich den Anschlusszug erreichen würde. Jetzt mit dem einen und meiner Umhängetasche war es ein Kinderspiel. Drei Stunden später hieß mich meine Frau bei einer Tasse Kaffee und zur Feier des Tages einem selbstgebackenen Kuchen willkommen – die Zeichen standen auf Neuanfang, vor allem in beruflicher Hinsicht, aber auch persönlicher, da mein Vagabundendasein der Vergangenheit angehören sollte.
Beim Auspacken bemerkte ich, dass mein Koffer wohl am Flughafen Tiflis geöffnet worden war, und sich ein Mitarbeiter meines Leatherman (Multi-Tool) bemächtigt hatte. Auch das passte zu dem gesamten Einsatz. Die Ironie der Geschichte war, dass mir diesmal sogar eine organisationseigene Verdienstmedaille verliehen worden war!
TEIL I Peilung: humanitäre Hilfe
1 Der Anfang – am Ende zurück auf Anfang
Wie das Ende meiner professionellen Laufbahn kann ich den Beginn derselben auf den Tag genau bestimmen. Es war der 1. August 1999, an dem ich als Projektkoordinator meinen ersten Job im Bereich humanitäre Hilfe bei einer deutschen Hilfsorganisation in deren Zentrale antrat. Bis dahin waren jedoch Jahre vergangen, um meine zunächst vorhandene Orientierungslosigkeit in eine Zielstrebigkeit auf jenen beruflichen Werdegang zu lenken.
Fünf Jahre zuvor war ich zum ersten Mal mit dem Arbeitsfeld in Berührung gekommen, wenn auch nicht in seiner eigentlichen Form. Eher handelte es sich um Sozialarbeit. Damals, als Student der Politikwissenschaft und Geschichte, hatte ich wie üblich nach dem Sommersemester erst zwei Monate in der Fabrik verbracht, um den Arbeitslohn im verbleibenden Ferienmonat irgendwo, zwar nicht komplett, aber zumindest einen Teil davon zu verjubeln. Aber bitte keine Massenziele. Es sollte etwas Besonderes sein, ähnlich wie zwei Jahre zuvor mit der Transsib von Moskau nach Peking und vor Jahresfrist mehrere Wochen per Anhalter im Westen der USA.
Zu Hause beugte ich mich über die Zeitung auf der Suche nach Inspirationen für die kommenden freien Wochen. Eine kleine Anzeige stach mir dabei ins Auge, in der Volontäre für Einsätze in Flüchtlingslagern in Kroatien gesucht wurden. Näheres wurde nicht verlautet, lediglich eine Adresse samt Telefonnummer, an die sich Interessierte wenden könnten. Das klang ungewöhnlich, und da dort in Teilen des Landes Krieg herrschte, auch abenteuerlich. Ganz nach meinem Geschmack.
Meine Aufmerksamkeit war geweckt, obwohl ich mich bis dahin weder durch ehrenamtliche Tätigkeit hervorgetan noch irgendeinen Bezug zu Flüchtlingen, erst recht nicht im Ausland hatte. Ich nahm Kontakt auf, wurde zu einem Vorbereitungsseminar eingeladen und kurze Zeit später fand ich mich zusammen mit fünf anderen Freiwilligen in einem Vorort von Split/Kroatien wieder, wo etwa 250 Kriegsflüchtlinge aus Bosnien in ehemaligen Arbeiterbaracken einer nahegelegenen Zementfabrik untergebracht waren. Instruktionen, was genau wir unternehmen sollten, hatten wir keine bekommen. Eine Frau, die der Vorgängergruppe angehört hatte – jede Gruppe sollte drei Wochen vor Ort verbringen und ich gehörte erst zur zweiten überhaupt – hatte zur Einstimmung lediglich davon geschwärmt, welche Freude vor allem das Lächeln der Kinder einem Freiwilligen bereiten würde. Wie sie das allerdings bewerkstelligt hatte, behielt sie für sich, zumal sie sich, so wie wir, mit keinem einzigen Wort in der unbekannten Sprache artikulieren konnte. Informationen darüber, ob wir überhaupt zur Arbeit befugt oder von örtlichen Behörden dazu autorisiert worden waren, wurden ebenfalls unterschlagen.
Ohne Konzept, ohne Budget und ohne Sprachkenntnisse versuchten wir das Beste aus der Situation zu machen, indem wir im Wesentlichen die Betreuung der Kinder und Jugendlichen übernahmen, mit denen wir uns meist nur mit Händen und Füßen verständigen konnten. Wir spielten Mühle, manchmal Schach, Fußball oder Volleyball und oft genug wurden wir nachher von den Müttern zum Kaffee gebeten - die meisten ihrer Männer arbeiteten entweder im Ausland oder dienten im Kriegseinsatz in Bosnien. Trotz der recht hilflosen Kommunikation gewann ich sehr schnell das Vertrauen der Menschen, weshalb ich mich mehr und mehr mit dem Gedanken anfreunden konnte, nach meinem Studienabschluss in diesem Berufsfeld später tätig werden zu wollen. Allerdings dachte ich nicht an Sozialarbeit, sondern an den humanitären Bereich, ohne noch eine wirkliche Ahnung davon zu haben.
Erst als ich, ebenfalls als Freiwilliger, im Frühjahr 1995, an einem Koordinationstreffen von Hilfsorganisationen in Zenica/Bosnien und Herzegowina (BiH), teilgenommen hatte, bekam ich einen Hauch von Einblick in deren Arbeit. Darin ging es um die Abstimmung, wer wo welche Hilfe leistete, um sichere Transportrouten und nicht zuletzt um die Sicherheit der Helfer selbst. Ich war fasziniert von dem internationalen Umfeld und wohl noch mehr davon, in welch tollkühner Umgebung agiert wurde - immerhin war es Kriegsgebiet. Manche der durchweg sehr jungen Anwesenden sprachen in einer Manier, die mehr nach einem Veteranen klang, was mich merklich beeindruckte. Es fielen viele Namen von Städten und Flüssen, die ich allenfalls in Fernsehnachrichten gehört hatte. Hier ging es um die grausame Realität und wie man sie am besten meistert. Von da an stand mein Entschluss fest.
Gleichwohl entsprang meine Begeisterung für das Arbeitsgebiet sicherlich einer Art Alternativlosigkeit, weil ich keinerlei Plan hatte, was ich mit einem Magisterabschluss hinterher anfangen sollte und wollte. Insofern erwies sich die kleine Zeitungsanzeige geradezu als Glücksfall, da sie mir ein Berufsfeld eröffnete und ich zumindest froh war, nun zu wissen, welchen Weg ich nach dem Studium einschlagen wollte.
Voller Hoffnung hatte ich mehrere Initiativbewerbungen abgeschickt, die allesamt selbst nach Wochen unbeantwortet blieben. Dabei war ich davon überzeugt gewesen, dass ich mit meiner gesammelten Auslandserfahrung offene Türen einrennen würde. Erst nach und nach dämmerte es mir, dass ich wohl allzu naiv vorgegangen war. Eher nebenbei hatte eine ehemalige Freiwilligenkollegin, ebenfalls mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss, das einjährige Aufbaustudium ‚Master in Humanitarian Assistance‘ erwähnt, wofür sie sich bewerben würde, da sie sich damit größere Chancen für den Berufseinstieg ausrechnete. Ich tat es ihr gleich und erhielt einen der zwanzig begehrten Plätze.
Währenddessen hatte ich ein mehrwöchiges Praktikum bei einer deutschen NGO (dt. NRO: Nicht-Regierungs-Organisation) zunächst in deren Zentrale und dann in Sarajevo/(BiH) absolviert. Mittlerweile waren die Kriegshandlungen längst beendet. Vor Ort traf ich mich öfter mit einer anderen Kommilitonin, die ihr Praktikum bei UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, absolvierte und dort komplett vom Tagesgeschäft aufgesogen wurde, wohingegen ich mich mit verwaltungstechnischen Vorgaben für Hilfsprojekte – im Wesentlichen verfasste ich Verwendungsnachweise – im Büro auseinandersetzen durfte. Trotzdem sah ich meine Tätigkeit selbstverständlich als das A und O der gesamten Arbeit an, schließlich müsse die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder nachgewiesen werden, was meine Kollegin mit einem augenaufschlagenden, „wenn du meinst!“, quittierte und mir entgegnete, dass die eigentliche „humanitäre Arbeit“ sicherlich außerhalb von Büros zum Wohle der Menschen stattfinden würde, und das sei zweifellos die ihrige. Viele Jahre später wollte es der Zufall, dass wir beide im Kosovo arbeiteten, sie für die Vereinten Nationen (UN) und ich für eine NGO und über unsere damalige gegenseitige Wichtigtuerei überaus lächeln mussten.
Jedenfalls war ich im Anschluss an das Praktikum davon überzeugt, beruflich auf dem richtigen Weg zu sein. Keine drei Wochen nach Abschluss des Aufbaustudiums, im Sommer 1999, begann meine berufliche Karriere als Projektkoordinator. Ein Jahr später bekam ich die Chance, nach Serbien zu gehen, um für dieselbe Organisation ein Projektbüro als dessen Leiter zu eröffnen, womit meine Auslandstätigkeit ihren Anfang nahm.
Schon nach wenigen Wochen im neuen Job in der Zentrale schien ich einen Masterplan für den beruflichen Werdegang in der humanitären Hilfe gefunden zu haben. Ich wollte irgendwann derjenige werden, der von Hilfsorganisationen unmittelbar nach einer Katastrophe in das betroffene Gebiet entsendet wird, um den Bedarf sowie notwendige Hilfsmaßnahmen zu eruieren und sah mich schon als selbstständigen Experten genau in dieser spannenden und sicherlich abenteuerlichen Rolle, der sich vor lauter Anfragen gar nicht retten kann.
Angefacht hatte dieses Feuer in mir das schreckliche Erdbeben 1999 in der Türkei, das sich kurz nach meinem Berufsstart ereignet hatte, mein Bürokollege sofort dorthin geschickt worden war und ich plötzlich zum verantwortlichen Koordinator für alle dort zu erwartenden Hilfsmaßnahmen ernannt wurde.
Winterfeste Zelte waren bereits auf dem Weg, eine Suchhundestaffel seit Tagen vor Ort. In der Hauptsache war aber die Errichtung von Notunterkünften geplant, die aus dem Ausland hin geliefert und von den üppig eingehenden Spenden finanziert werden sollten. Die genauen Standorte sollte der Kollege vor Ort mit den Behörden bestimmen, um damit den Grundstein für Projekte zu legen, die hinterher von anderen noch einzustellenden Spezialisten durchgeführt würden. Die Stellenausschreibungen liefen bereits parallel, während er mir die Inhalte der Gespräche mit Behörden, anderen Hilfsorganisationen, seine Pläne, seine Planänderungen mehrmals täglich telefonisch mitteilte. Spontanität, Improvisation, Durchsetzungsvermögen aber auch Frustresistenz sowie strategisches Vorgehen waren gefragt, was alles andere als einem geregelten Büroalltag entsprach. Und genau das wollte ich.
Viele Jahre später ging ich tatsächlich vorübergehend den Schritt in die Selbstständigkeit und schaffte mir alle notwendigen Utensilien für ein funktionierendes Büro, einschließlich eines kleinen Notebooks an, das robust genug für die vielen erhofften Reisen sein musste. Die eigens eingerichtete Internetseite würde sicherlich genug potenzielle Auftraggeber auf mich aufmerksam machen. Nunmehr lag mein Schwerpunkt allerdings auf Organisationsentwicklung, Projektmanagement und Evaluation von Hilfsprojekten, schließlich waren diese Bereiche nicht nur wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit bis dahin gewesen, sondern vor allem der Aspekt Evaluation war mittlerweile auch zu einem obligatorischen Instrument im Rahmen von Hilfsmaßnahmen geworden. Meine ursprüngliche Begeisterung als Erster in Krisengebiete zu fliegen, um für Hilfsorganisationen Bedarfe zu ermitteln und Vorbereitungen für die geplanten Projekte zu treffen, war vergleichsweise schnell verflogen; geradeso wie bei einem Kind, das noch am Heiligabend und vielleicht den ersten Tagen danach nur Augen für das neue Spielzeug hat, um es dann in die Kiste aller anderen auf Nimmer-Wiedersehen zu befördern.
Mein Faible hatte sich hin zum Projektmanagement und vor allem der Bewertung von Maßnahmen verschoben. Dafür hatte ich sogar eine entsprechende mehrmonatige Fortbildung auf eigene Kosten besucht und freute mich nachher auf viele Aufträge. Trotz großer Anstrengungen bei der Ausarbeitung zahlreicher Angebote gab ich jedoch mangels genügend ergatterter Verträge ernüchtert nach etwas mehr als einem Jahr auf.
Dieses erfolglose Intermezzo hatte mein ansonsten aus befristeten Verträgen bestehendes stetiges Angestelltenverhältnis unterbrochen, das mich zu insgesamt zwölf Einsätzen in sieben Länder führte (in sieben weitere als Freiwilliger und Selbstständiger), wo ich meistens die Führungsrolle innehatte. Kein einziger Arbeitgeber konnte mir eine langfristige Perspektive bieten, worauf ich zugebenermaßen auch nie insistiert hatte. Gegen Ende hieß es immer, dass sich in naher Zukunft gewiss wieder eine Gelegenheit bieten würde, was mir jedoch zu unsicher war, da ich zwischen Einsätzen oftmals keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hatte. Zwar wurde ich später von früheren Arbeitgebern oder anderen Hilfsorganisationen hin und wieder zu Einsatzmöglichkeiten kontaktiert, allerdings geschah es nur ein einziges Mal, dass ich von einem Einsatz, damals in Sri Lanka, übergangslos zu einer anderen Organisation nach Moldawien wechselte.
Karrieretechnisch hatte ich mir zu Beginn keinerlei Gedanken gemacht. Das Geld spielte ebenfalls keine Rolle. Zuerst stand für mich im Vordergrund, Berufserfahrung zu sammeln. Und zwar bei möglichst vielen Organisationen und am besten in unterschiedlichen Kontexten. Dieser vermeintliche Denkfehler, nämlich über ein Sammelsurium an Kenntnissen zu verfügen, führte dazu, dass ich mich zu einem Allrounder entwickelte, der heutzutage, nach meiner Beobachtung, nicht mehr unbedingt gefragt zu sein scheint. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen: denn ein Professor für Geschichte ist ja auch kein Fachmann für alle Jahrhunderte oder Jahrtausende seines Faches, sondern allenfalls für ein ganz bestimmtes Thema in einer vermeintlich überschaubaren Periode. In der Praxis sammelte ich so immer mehr an Fähigkeiten, beendete meine Laufbahn aber in derselben Position, nämlich als Büroleiter, in der ich sie begonnen hatte. Ein wirklicher Karrieresprung sieht wohl anders aus.
Ein Star in der humanitären Szene bin ich nicht geworden. Wer konnte und kann das schon von sich behaupten? Vielmehr entwickelte ich mich zu einer Art Arbeitsbiene, die die Aufgaben, die anfielen, so gut wie möglich erledigte, und was mir alle Arbeitgeber stets als herausragend bescheinigt hatten. Immerhin, je länger ich im Ausland tätig war, desto mehr schlüpfte ich in die Rolle desjenigen, der jüngere Kolleginnen und Kollegen an die Hand nahm, um mein Wissen und Können weiterzugeben, genauso wie es lokale Mitarbeiter anfangs mit mir getan hatten.
Zudem hatte ich mich zu einer Führungskraft entwickelt, die konstant den Mut hatte, Entscheidungen zu treffen und dafür im Zweifelsfall auch geradestand. Wie oft habe ich andere erlebt, die dazu nicht in der Lage waren, bevor sie sich nicht dreimal abgesichert hatten und selbst dann noch einen hohen Grad an Zögerlichkeit an den Tag legten, der mit Ergebnisorientierung nichts mehr zu tun hatte. Vielmehr schien es darum zu gehen – das kennt man ja in allen Berufssparten – sich selbst keinesfalls angreifbar zu machen: Regeln müssen eingehalten werden, wofür möglichst andere die Verantwortung für mein Handeln übernehmen sollen. Eine denkbar schlechte Voraussetzung für eine Führungskraft. Führen heißt nun mal entscheiden und das erwarteten meine Mitarbeiter von mir, wie auch meine Vorgesetzten.
Dafür sind allerdings zwei Gesichtspunkte von ausschlaggebender Bedeutung: Team- sowie Kommunikationsfähigkeit. Beides ist unabdinglich, um im Ausland erfolgreich Hilfsprojekte durchführen zu können, schon allein mangels der lokalen Sprachkenntnisse. Für mich bedeutete das, ständig mit meinen Mitarbeitern zu sprechen, ihnen keine Informationen vorzuenthalten und sie vor allem auf für mich mutmaßlich kulturell unsicherem Terrain, um Rat zu fragen.
Eigentlich war es mir immer gelungen, selbst nach kurzer Zeit in einem neuen Team nicht nur als ‚Leitwolf‘ akzeptiert zu werden, sondern vor allem einen guten Spirit geschaffen zu haben. Deshalb war ich überzeugt davon, dass besonders Letzteres eine meiner größten Stärken gewesen ist.
Unterschwellig gab es immer den Gegensatz zwischen Zentrale und Feld und obwohl ich, qua meiner Position, die Schnittstelle inmitten beider war, galt meine Loyalität zuerst meinem Team, was nicht selten zu Konflikten mit der Zentrale führte. Allerdings waren es nie schwerwiegende. Trotzdem, so nahm ich zumindest an, sahen meine Kollegen vor Ort in mir einen der ihrigen und nicht den bloßen Repräsentanten derjenigen in den weit entfernten Büros. Obwohl die Arbeit im Feld ebenfalls nicht konfliktfrei war, gelang es mir aber diese stets zu lösen und so bescheinigte ich mir selbst die besten Noten, was interkulturelle Kompetenz, noch mehr aber Führungsstärke betraf. Mit einer Ausnahme allerdings: im Hinblick auf das Team scheiterte ich im Kosovo bei meinem zweiten Einsatz krachend nach zweieinhalb Jahren und kündigte völlig entnervt zum ersten Mal selbst. Davon wird in Teil II ausführlich die Rede sein.
Wenn sich auch das Management von Hilfsprojekten während meiner gesamten Tätigkeit nicht grundlegend änderte, so gab es doch zumindest eine wesentliche Neuerung in der Art der Hilfe, die mir persönlich begegnete. Dabei handelte es sich um die Einführung von Bezahlkarten anstatt der Verteilung von Nahrungs- oder Hygienemitteln. Obgleich ich nie verantwortlich für die Durchführung einer solchen Maßnahme war, hatte ich als selbstständiger Berater einmal ein derartiges Projekt evaluiert. Das wichtigste Ergebnis war, dass damit den Empfängern ein Stück weit ihre Würde zurückgegeben wurde, indem sie ihren täglichen Bedarf selbst bestimmen konnten und dieser nicht in Form von Hilfspaketen von anderen entschieden wurde. Das hatten ausnahmslos alle von mir Befragten betont und bestätigt.
Diesem sicherlich in diesem Fall erzielten positiven Effekt steht die Frage nach der Sinnhaftigkeit und geplanten Wirkung anderer Hilfsmaßnahmen gegenüber. Wenn zum Beispiel Projekte realisiert wurden, die scheinbar aus einem (fiktiven) ‚Handbuch für humanitäre Maßnahmen‘ stammten, wie ich eines in Montenegro von einer anderen Hilfsorganisation kennenlernen durfte. Dort wurde Frauen, die in Flüchtlingsunterkünften wohnten, jeweils eine Handvoll Hühner gegeben, damit sie ein eigenes Einkommen generieren könnten. Für die Haltung der Tiere mussten selbstverständlich bestimmte Standards, wie zum Beispiel eine bestimmte Bodenfläche pro Huhn, eingehalten werden, obwohl die Frauen keinen eigenen Grund und Boden besaßen. Wie man mit ein paar Eiern seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte, erschloss sich mir nie. Trotzdem schlug dieses Projekt mehrere Fliegen mit einer Klappe: Die Zielgruppe ‚Frauen‘ erfüllte das Kriterium ‚Gender‘; Tierschutz mittels der Erfüllung der Standards wurde eingehalten; Einkommensschaffung trug zur Unabhängigkeit der Klientin bei und der Verkauf von Eiern förderte Unternehmergeist. So zumindest die Theorie. In der Praxis hielt ich das Projekt persönlich für kompletten Humbug und wunderte mich, dass eine solche Maßnahme überhaupt gefördert worden war. Es war aber keineswegs das einzige Mal, dass ich die Sinnhaftigkeit von Vorhaben – auch solcher, die ich selbst zu verantworten hatte – infrage stellte.
Die Empfänger der Hilfe taten dies so gut wie nie, warum auch, da sie jede Hilfe dankbar annahmen. In den ersten Einsätzen, als ich meistens einem kleinen Team vorstand, hatte ich sehr viel Kontakt mit ihnen und erfuhr deren Reaktionen unmittelbar und unverblümt. Später reduzierten sich diese Kontakte merklich, da ich meistens im Büro oder in Meetings saß und nur sporadisch meine Mitarbeiter bei Außenterminen begleitete. Unsere ‚Beneficiaries‘ (Hilfsempfänger) in Syrien bekam ich dagegen nie zu Gesicht, da alle Maßnahmen ausnahmslos von Vertragspartnern implementiert wurden.
Allen gemeinsam war allerdings die Tatsache, dass wir, egal wo ich arbeitete, so gut wie nie die Menschen nach ihren ganz eigenen Bedürfnissen fragten. Vielmehr hatten wir stets Projekte entwickelt, von denen wir dachten, dass sie sinnvoll für die direkt Betroffenen seien. Was sie wohl persönlich darüber dachten? Selbst wenn deren Meinung im Rahmen von Projektevaluationen gefragt war, konnte ich davon ausgehen, dass sie mir das mitteilten, was ich hören wollte – und zwar nur Positives gepaart mit einem gehörigen Schuss Dankbarkeit. Denn die meisten werden gedacht haben, dass negative Aussagen womöglich dazu führen konnten, dass sie künftig keine Unterstützung mehr bekommen würden. Gleiches traf sicherlich auch auf institutionelle Partner vor Ort zu. Immerhin waren wir es, die das Geld mitbrachten und ich habe es nur ein einziges Mal erlebt – und zwar in Serbien (siehe Teil II) – dass eine von uns vorgeschlagene und dann vom Geldgeber bewilligte Maßnahme von lokalen Behörden oder anderen Einrichtungen abgelehnt wurde. Ansonsten wurden sogar Projekte akzeptiert, auch wenn wir eine finanzielle Beteiligung von ihnen verlangten. Dahinter stand stets die Absicht, dass nach dem Weggang der Hilfsorganisation, die Maßnahme von dem entsprechenden Partner im Sinne der Nachhaltigkeit weitergeführt werden sollte. Wie genau wir diesen mittlerweile inflationär gebrauchten Begriff verstanden, davon wird ebenfalls in Teil II die Rede sein.
Ausschlaggebend für die Arbeit war immer der jeweilige Kontext, also die Gesamtsituation vor Ort, in der ich als Vertreter einer Hilfsorganisation agierte. Nach ihm richteten sich die von Geldgebern, meistens Regierungen, zur Verfügung gestellten Finanztöpfe. Für Deutschland heißt das zum Beispiel, für humanitäre Hilfe (Nothilfe) ist das Auswärtige Amt (AA) zuständig und für Entwicklungszusammenarbeit das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Das bedeutet, dass sich die zu unterstützenden Zielgruppen sowie geplanten Maßnahmen je nach Geldgeber unterschieden. Gewöhnlich werden in der Nothilfe die „most vulnerable“ (am gefährdetsten) Menschen unterstützt, während in allen anderen Situationen jenen Menschen Hilfe zugutekommt, bei denen es nicht mehr ums Überleben, sondern um eine Perspektive für sie geht.
Meine eigene hatte ich dagegen so gut wie ausgeblendet, obwohl für mich von Anfang an festzustehen schien, dass ich mein Berufsleben nicht ausschließlich im Ausland verbringen mochte. Deshalb hatte ich gelegentlich mit einem Auge auf den hiesigen Arbeitsmarkt geschielt und die eine oder andere Bewerbung abgeschickt. Diejenigen in anderen Branchen erwiesen sich als enttäuschende Misserfolge, da ich zu keinem einzigen Gespräch eingeladen worden war; wenig vielversprechender waren jene bei hierzulande ansässigen Hilfsorganisationen, die wohl eher aus der Not geboren waren. Letztlich wäre damit ein Umzug vonnöten gewesen, weshalb ich gleich im Ausland bleiben konnte. Dort war wenigstens das Gehalt höher und die Lebenshaltungskosten niedriger. Dass ich dann doch einen Schlussstrich gezogen habe, lag in erster Linie an der permanenten Trennung von meiner Frau sowie den damit verbundenen Überdruss, ein Leben in zwei so unterschiedlichen Welten führen zu müssen.
Wenige Monate nach dem in meinen Augen katastrophalen Abschied aus Georgien, fand ich tatsächlich eine Anstellung unweit meines Wohnortes daheim, womit sich der Kreis in mehrfacher Hinsicht für mich, wenn auch unbeabsichtigt, schloss.
Hatte ich noch vor meinem Einstieg nicht an Sozialarbeit gedacht, so bin ich heute genau darin tätig. Dieser Sprung ins kalte Wasser, da es für mich eine völlig neue und andersartige Beschäftigung ist, entspricht jenem, als ich bei meinem ersten Auslandseinsatz von heute auf morgen zur Führungskraft wurde. Schließlich war ich unmittelbar nach dem Ende meiner Auslandstätigkeit zunächst ähnlich ziellos wie zu Beginn. Zwar habe ich nach wie vor keinen langfristigen Plan, dafür weiß ich jetzt, wo mein Platz ist.