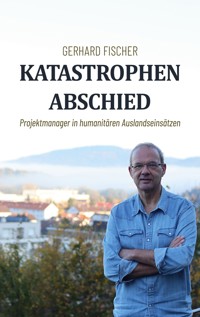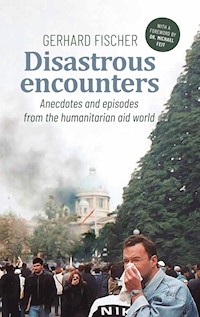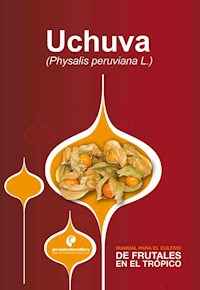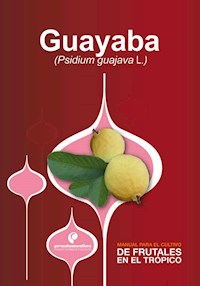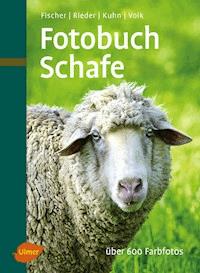Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In den vergangenen zwanzig Jahren ist Gerhard Fischer im Rahmen seiner Tätigkeit für Hilfsorganisationen im Ausland vielen Katastrophen begegnet: Erdbeben, Tsunami und bewaffneten Konflikten. Er erlebte aber auch viele katastrophale Begegnungen, u.a. mit Arbeitgebern, Unterkünften, Handwerkern, Bürokratien bis hin zur Rückkehr aus seinen Einsätzen. Neben seiner Arbeit berichtet er von diesen immer wiederkehrenden Aspekten in zehn Kapiteln. In authentischer Manier und mit viel Witz werden besonders die lustigen, skurrilen sowie dramatischen Anekdoten und Episoden erzählt: in Serbien erhielt er einen Tag in den Pass gestempelt, den es gar nicht gibt, zweimal erlebte er einen sprichwörtlichen Geldregen und wurde Zeuge eines historischen Ereignisses. Im Kosovo erschien ein Handwerker, der ganz ohne Werkzeug auskommen wollte. In Sri Lanka drangsalierte ihn eine ganze Affenhorde und in Inguschetien entwickelte sich ein vermeintlich ruhiger Fußballabend vor dem Fernseher zu einem realen Angriff von tschetschenischen Rebellen. Und Vieles mehr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Kapitel: Arbeitgeberbegegnungen
Kapitel: Identitätsbegegnungen
Kapitel: Kulturbegegnungen
Kapitel: Unterkunftsbegegnungen
Kapitel: Projektbegegnungen
Bilderbegegnungen
Kapitel: Dramatikbegegnungen
Kapitel: Handwerkerbegegnungen
Kapitel: Amtsbegegnungen
Kapitel: Freizeitbegegnungen
Kapitel: Rückkehrbegegnungen
Nachwort
Danksagung
Vorwort
Warum die Geschichten eines humanitären Helfers lesen? Was kann daran interessant sein, was neu, was nicht schon so oft berichtet?
Ich wurde von Gerhard Fischer als ehemaliger Kollege und Vorgesetzter, aber vor allem als Freund gebeten, ein Vorwort für dieses Buch zu schreiben. Ich hatte das Glück mit ihm viele dieser kleinen Anekdoten selber erleben zu können, sei es als Sachbearbeiter in Montenegro, Serbien oder Moldawien, sei es als Direktor der internationalen Zusammenarbeit der Caritas Luxemburg. Nach der Lektüre des ersten Entwurfes fand ich mich so sehr in dem Buch wieder, dass ich die Aufgabe das Vorwort zu schreiben, mit Freude übernahm.
Gerhard Fischer erzählt in diesem Buch nicht nur seine Geschichte, er erzählt vor allem die Geschichten der Menschen, die er getroffen hat. Er berichtet davon, wie die Menschen auf ihn gewirkt haben, wie die Kulturen auf ihn gewirkt haben. Der Witz, die Anekdote entsteht zumeist aus diesen verschiedenen Perspektiven, der des Lesers und der des Betroffenen. Normale alltägliche Dinger werden aus den zwei verschiedenen Perspektiven erlebt, dies macht den Reiz des Buches aus.
Gerhard Fischer hat in seinem bisherigen Leben als humanitärer Helfer sehr viel erlebt, viel Leid gesehen, viel Not gefühlt, viel Gefahr verspürt. Doch was in ihm geblieben ist, sind die Menschen, ihre Geschichten, ihr Lachen, ihre Freundschaft. Davon berichtet er in seinem Buch.
Um diese Geschichten so zu erleben, muss man sich ihnen öffnen. So wie Gerhard Fischer sich öffnete um diese Geschichten dieser Menschen in sein Herz und letztendlich auch in dieses Buch zu lassen, so muss sich der Leser dieses Büchleins auch beiden öffnen, dem Helden der Geschichten, wie auch dem Erzähler, denn nur wenn man beide Seiten versteht, ergibt sich einem der Sinn dieses Buches.
Gerhard Fischer ist aber sicherlich mehr als ein Geschichtenerzähler, er ist ein professioneller humanitärer Helfer, ein zuverlässiger Kollege und ein Rückhalt für viele Menschen in Not.
Ich wünsche ihnen liebe Leserinnen und Leser, dass sie sich von den Geschichten in fremde Welten und Kulturen mitnehmen lassen und selbst in Not und Leid Platz für die Geschichten Anderer finden.
Viel Spaß.
Dr. Michael Feit
Einleitung
Wie heißt es so schön: wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen... Insofern habe ich einen immensen Fundus, aus dem ich schöpfen kann. Denn seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich in den Bereichen Humanitäre Hilfe sowie Entwicklungszusammenarbeit und bin dadurch in verschiedensten Ländern, Regionen und Kontexten tätig gewesen. Ob durch Naturgewalten, kriegerischen Auseinandersetzungen oder schlicht und ergreifend Armut ausgelöst. Allen meinen Einsätzen in diesen Gebieten war gemeinsam, dass die vorgefundene katastrophale Situation die betroffenen Menschen und Gesellschaften in eine Lage versetzt hatten, dass sie entweder unmittelbare Überlebenshilfe oder längerfristige Unterstützung benötigten.
Auf einer Party ist einer wie ich dann zumindest am Anfang der Hit und kann anderen imponieren, sobald ich von meinen Abenteuern erzähle. Denn nicht nur mein Arbeitsalltag sondern auch die Umstände unterscheiden sich doch immens von denjenigen hierzulande. Punkten kann ich vor allem mit lustigen Ereignissen oder Begebenheiten. Und: Allein der Gedanke, in einem Gebiet zu arbeiten, das entweder von einer Naturkatastrophe heimgesucht oder wo ein bewaffneter Konflikt ausgetragen wurde und wird, klingt nach Gefahr und spektakulär.
Gewiss gehört eine Portion Abenteuerlust dazu, warum ich in diesen Bereichen tätig bin; in Ländern oder Regionen, die sicherlich kein normales Urlaubsziel darstellen. Ganz im Gegenteil handelte es sich meistens um Gegenden, vor denen allgemein gewarnt wurde und wird. Wer kann schon von sich behaupten, dass er schon mal in einem Kriegsgebiet gewesen sei oder einen Terrorangriff bzw. die Auswirkungen eines solchen hautnah miterlebt hätte? Oder wer reist schon in Länder, die (zumindest im Deutschen) auf -istan enden? Klingt viel zu sehr nach dunklem Orient, Selbstmordattentäter, oder sonst welchen Gefahren. Ähnliches gilt für Gebiete, die von einer Naturkatastrophe heimgesucht worden sind. Für mich gehörten diese Umgebungen fast schon zum normalen Alltag. Gleichwohl waren sie für mich anfangs immer fremd, manchmal surreal, manchmal aber auch tatsächlich gefährlich. Fast immer standen meine Einsatzgebiete zudem im Fokus internationaler Medien. Wann trifft man schon mal jemanden wie mich persönlich, der einen direkten Bezug dazu hat und der einem Eindrücke oder Geschichten aus erster Hand von dort erzählen konnte? Wie oft habe ich schon den Satz gehört, dass ich zumindest etwas Sinnvolles täte, da ich anderen Menschen helfen würde. Dabei bin ich eher zufällig mit diesem Arbeitsfeld in Berührung geraten. Nämlich im Rahmen eines Aufrufes zu Freiwilligeneinsätzen in Flüchtlingslagern des ehemaligen Jugoslawiens 1994, obwohl ich, damals noch Student der Politikwissenschaft und Geschichte, in der Zeitung eigentlich nach persönlichen Urlaubszielen für die Semesterferien gesucht hatte – welch ein geradezu paradoxer Beginn meiner Helferkarriere. Eigentlich hatte ich mich mehr aus Neugierde beworben, da es auch für mich spektakulär geklungen hatte. Ich wurde ausgewählt und fand mich wenig später zum ersten Mal im Einsatz.
Danach war für mich klar, dass ich nach dem Studium in diesem Bereich beruflich tätig werden wollte. Was ich mit meinem Magisterabschluss hinterher anfangen sollte, darüber hatte ich mir ohnehin nie Gedanken gemacht. Manch einer mag dies als blauäugig bezeichnen, ein anderer planlos. Ich würde es als unvorhergesehene Konzeption bezeichnen: die richtige Eingebung im geeigneten Zeitfenster. Oder Schicksal? Zunächst endete mein akademischer Grad nämlich damit, dass ich mich als Landschaftsgärtner und LKW-Fahrer mehr schlecht als recht durchschlagen musste. Glücklicherweise bekam ich dann einen Hinweis über eine weitere Studienmöglichkeit zum Master in Humanitarian Assistance. Tatsächlich gelang mir nach Abschluss dessen der Einstieg. Keine vier Wochen später startete ich als Projektkoordinator für Auslandshilfe in der Zentrale einer deutschen Hilfsorganisation. Nach einem Jahr wurde ich nach Serbien geschickt, um ein Büro zu eröffnen und meine professionelle Karriere im Ausland nahm ihren Anfang.
Inzwischen habe ich gelernt, dass es durchaus persönliche Annehmlichkeiten im Rahmen einer Tätigkeit in der humanitären Hilfe oder Entwicklungszusammenarbeit im Ausland gibt: ein höheres Gehalt aufgrund der Auslandszulage und eine mitunter exponierte Position, die ich vergleichsweise rasch innehatte, wofür ich zuhause wohl Jahre benötigt hätte. Immerhin startete ich in Serbien als Projektleiter, was einerseits zwar ein ziemlicher Karrieresprung war – denn dort hatte ich plötzlich die verantwortungsvollste Position. Das bedeutete vor allem, dass ich Entscheidungen treffen musste, die ich nicht erst mit Kollegen absprechen konnte. Ich war ja zunächst ganz alleine. Andererseits wusste ich zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht, welche Verantwortung ich damit übernahm. Somit habe ich den Spruch: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre" in umgekehrter Form erfahren. Denn obwohl Chef der Organisation, hat mich ein sehr erfahrener lokaler Kollege, den ich gleich zu Beginn eingestellt hatte, an die Hand genommen und mir viel von dem Handwerkszeug beigebracht, das den Grundstein für mein weiteres berufliches Fortkommen gelegt hatte. Was war ich anfangs unsicher und aufgeregt. Jede noch so kleine Situation schien für mich eine übergroße Herausforderung zu sein. Jetzt war ich plötzlich derjenige, der die Verantwortung trug, angesprochen wurde und Rede und Antwort stehen musste. Bis sich meine eigene Anspannung legte, dauerte es eine Weile. Trotzdem konnte ich sie in der Folgezeit nie ganz ablegen, da ich in den anschließenden Einsätzen für andere Hilfsorganisationen stets in einer neuen Umgebung der Teamleiter gewesen bin. Und so sah ich mich immer wieder als Anfänger. Sicherlich bin ich seitdem beruflich gewachsen und habe mittlerweile eine gewisse Gelassenheit erlangt, durch die ich, aus heutiger Sicht, gelegentlich schmunzeln muss, wenn ich zum damaligen Zeitpunkt in der einen oder anderen Situation gar zu aufgeregt war. Gleichzeitig habe ich für mich selbst herausgefunden, dass mir die Arbeit in dem Bereich richtig Spaß macht und ich persönlich, zumindest in beruflicher Hinsicht, eine Art Erfüllung gefunden habe.
Jedoch sollte es nicht darüber hinwegtäuschen, dass dahinter oft auch gravierende Enttäuschungen oder andersartige Erfahrungen stehen, denen ich im Rahmen von Katastrophen begegnete. Bei aller Hingabe an die Hilfsbedürftigen bemerkte ich im Laufe der Zeit, dass auch Hilfsorganisationen auf dem Markt des Elends konkurrieren und entsprechend unternehmerisch handeln. Meine anfängliche Naivität, dass jeder und alle in diesem Bereich Tätigen allein aus Mitgefühl oder Humanität und vor allem kostenlos (!) zum Vorteil der Hilfsbedürftigen handelten, zerbarst Schritt für Schritt. Immerhin habe ich heutzutage begriffen, dass letztlich immer das Geld zählt. Also reine Profitgier? Sicherlich keineswegs. Denn irgendwie muss die Hilfe ja bezahlt werden. Und zwar nicht nur die Hilfsgüter, sondern auch das notwendige Personal. Dagegen sind auch Hilfsorganisationen nicht gefeit. Trotzdem gab es die eine oder andere Verhaltensweise, die an den Tag gelegt wurde, die ich allenfalls knallharten Geschäftsleuten zugetraut hätte. Anstatt mir Beileid angesichts eines Todesfalles in der Familie auszusprechen, wofür ich, damals in Sri Lanka tätig, zum Beispiel nach Sonderurlaub für die Beerdigung gefragt hatte, bekam ich lediglich die Antwort, man würde mein Ansinnen an die Personalabteilung weiterleiten! Mein Hinweis auf eine mögliche Beileidsbekundung wurde erst später vom Vorgesetzten wahrgenommen. Den Helfer im Einsatz möchte ich treffen, der noch keinerlei frustrierende Momente erlebt hat – bisweilen eben Katastrophenbegegnungen.
Genau davon möchte ich erzählen. Weniger in Form eines Erlebnisberichtes, indem ich beschreibe, was ich nach und nach erlebte (eine Übersicht meiner Einsätze ist auf S. → aufgelistet). Vielmehr schildere ich anhand von immer wiederkehrenden Aspekten, kapitelweise meine Begegnungen in den verschiedenen Ländern. Dabei habe ich mich besonders auf Anekdoten und andere interessante Episoden konzentriert. Denn sie machten nicht nur die Würze meines eigenen Alltags aus, sondern blieben mir stets in besonderer Erinnerung. Ich denke, dass sie es durchaus wert sind, mitgeteilt zu werden. Noch heute muss ich über die eine andere Begebenheit schmunzeln und bemerke dann selbst immer wieder, dass ich in der Tat nicht nur viel erlebt, sondern auch viel von der Welt gesehen habe. Nebenbei sollen sie ein Bild von dem zeichnen, worin meine Tätigkeit bestand. Die einzelnen Abschnitte folgen trotzdem einer Art chronologischem Muster: von der Entsendung bis zur Rückkehr.
Dabei ist der Titel Katastrophenbegegnungen durchaus vielschichtig, aber auch doppeldeutig zu betrachten. Einerseits bilden Katastrophen den Rahmen, in welchem meine unterschiedlichsten Begegnungen stattfanden. Andererseits waren aber auch die Begegnungen, ob mit Menschen, Kulturen oder Gegenständen, bisweilen eine Katastrophe.
Noch bevor ich überhaupt in einen Auslandseinsatz ging, war die Suche nach einem Arbeitgeber, sprich einer Hilfsorganisation, gestanden. Insgesamt war ich für viele verschiedene Hilfswerke im Ausland tätig. Mal länger, bis zu zwei Jahren. Mal kürzer, lediglich einige Wochen. Bereits im Auswahlprozess hatte ich teils, aus meiner Sicht, skurrile Begegnungen. Später in der Praxis musste ich erfahren, durch welch perfide Art, manchmal Hilfe im Ausland geleistet wurde.
Einmal dort ging es häufig um mich als Deutschem im Ausland und der Bewunderung, die mir dadurch häufig zu Teil wurde. Zur Sprache werden einige Eigenheiten kommen, die uns Deutschen vermeintlich als Stereotypen zugeordnet werden. In der Tat konnte ich selbst an mir feststellen, dass diese keineswegs aus der Luft gegriffen waren. Trotzdem wurden mir überraschenderweise auch andere Nationalitäten zugeordnet, die mich stets amüsiert hatten. Problematischer war und ist es, eine genaue Berufsbezeichnung für mich zu benennen.
Ebenfalls nicht immer ganz einfach waren die Begegnungen mit einer mir fremden Kultur und Tradition. Erst mit der Zeit begriff und lernte ich, dass ich meine eigene Denk- und Arbeitsweise keineswegs eins zu eins im Ausland von anderen erwarten konnte. Meinen eigenen Horizont haben sie in jedem Fall erweitert. Einmal, nein zweimal, wurde ich sogar Zeuge eines tatsächlichen Geldregens (!). Wie ich im Einsatz stets untergebracht war, schien mir ebenfalls erwähnenswert. Nicht nur unterschieden sich jene Unterkunftsbegegnungen in puncto Wohnlichkeit, sondern auch hinsichtlich mitunter eigenartiger Vermieter - mancherorts auch allzu exotischer, tierischer Mitbewohner. Zweck aller meiner Auslandseinsätze war in erster Linie, Hilfsprojekte verschiedenster Art durchzuführen. Während jener Projektbegegnungen arbeitete ich mit vielen internationalen und lokalen Kollegen zusammen. Einer verstieg sich gar zu der Aussage, „ich hätte sein Leben verändert."
In unmittelbarer Lebensgefahr bin ich nach eigener Einschätzung zwar nie gewesen. Trotzdem hatte ich allerlei Begegnungen, die meinen Adrenalinspiegel plötzlich in die Höhe schießen ließen und durchaus dramatisch verliefen. Vor allem als ich hautnah einen Terrorangriff erlebte. Derartige Bedenken blendete ich offenbar erfolgreich aus, als ich unmittelbar Zeuge einer echten Revolution wurde.
Zwar waren meine Handwerkerbegegnungen weit weniger spektakulär. Nicht minder aber in Bezug auf Eigentümlichkeit. Gleiches galt für die Bürokratie in den verschiedenen Ländern, die bisweilen für unsereins überraschend praktiziert wurde. Für mich unerwartet, waren auch meine Freizeitbegegnungen. Denn trotz allen Elends hatte ich auch sehr viel Spaß. Besonders dann, wenn ich mit Menschen zusammen war, die nichts mit meiner Arbeit zu tun hatten. In Serbien lernte ich Gleitschirmfliegen, erlebte aber auch einen Absturz. Am Ende schließt sich der Kreis: die Rückkehrbegegnungen nach meinen Einsätzen gestalteten sich nie einfach. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ging ich stets aufs Neue auf Jobsuche. Dabei musste ich lernen, dass ein berufliches Fortkommen in der Heimat aussichtslos war. Nicht nur einmal bekam gerade ich als humanitärer– oder Entwicklungshelfer von der Arbeitsagentur den Satz zu hören: „Herr Fischer, darüber müssen Sie sich im Klaren sein: wir können Ihnen nicht helfen!"
Nach gefühlten unendlich vielen, ergebnislosen Versuchen hierzulande beruflich Fuß zu fassen, ging ich stets wiederum ins Ausland. Aufgrund meiner erlangten praktischen Erfahrung wurde dies einfacher. Immerhin bekam ich so die Chance auf neue Katastrophenbegegnungen.
Ich darf schließlich noch hinzufügen, dass es sich bei dem Folgenden um tatsächlich von mir Erlebtem, in wenigen Einzelfällen auch von anderen mir Erzähltem, handelt. Allerdings möchte ich niemanden bloßstellen: daher werden weder Hilfsorganisationen noch ehemalige Kollegen namentlich genannt.
1. Kapitel: Arbeitgeberbegegnungen
Generell genießen Hilfsorganisationen in der Öffentlichkeit einen guten Ruf. Im Falle von Naturkatastrophen oder bewaffneten Konflikten schicken sie Personal so schnell wie möglich, um Hilfe zu leisten. Ob es sich um ein weit abgelegenes Land oder um Kriegsgebiete handelt, in denen die Waffen keineswegs ruhen: Hilfswerke scheuen weder das eine noch das andere, um die Not der betroffenen Menschen zu lindern.
Bei den meisten Hilfsorganisationen, für die ich im Einsatz gewesen bin, handelte es sich um Nicht-Regierungsorganisationen (NRO), deren englische Übersetzung Non-Governmental-Organisations (NGOs) auch mittlerweile Einzug in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat. Wie der Name sagt, sind sie normalerweise eigenständige gemeinnützige Institutionen, die weder staatlich noch formal mit staatlichen Einrichtungen verbunden sind. Während erfahrenere NROs im Katastrophenfall meistens sofort institutionelle Geldgeber, wie etwa die Vereinten Nationen oder die Europäische Union, ,anzapfen', finanzieren viele vor allem kleinere Hilfsorganisationen ihre Projekte oftmals aus eingesammelten Spenden. Manchmal spielt hier die Konfession eine Rolle, wo bisweilen unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe die Missionierung das eigentliche Ziel ist. Ich selbst sah dies mit eigenen Augen in Flüchtlingslagern in Kroatien im Jahr 1995, wo ich als Freiwilliger gewesen bin. Damals kamen eines Tages junge amerikanische Mennoniten und zeigten den Bewohnern einen Film über das Leben Christi („Darin könnt ihr sehen, wie Jesus gewirkt hat!") und hielten Bibelstunden mit Kindern ab. Der junge Prediger stand dabei vor den auf dem Boden sitzenden jungen Zuhörern, hinter dem Rücken eine Packung Kekse haltend und nur diejenigen bekamen einen, die gut aufgepasst hatten. Geradeso wie im Zirkus – Belohnung gibt's nach vollbrachter Übung. Persönlich fand ich dies ziemlich menschenverachtend. Statt den Menschen zu helfen, wurde ihre Notlage für eigene Ziele missbraucht. Zwar war es für die Menschen im Lager eine willkommene Abwechslung in ihrem ansonsten tristen Alltag, hinterher waren trotzdem alle einigermaßen irritiert. Ein anderer Volontär, ein pensionierter Bundeswehrsoldat, war besonders aufgebracht. Denn er hatte zuhause einen 32jährigen geistig und körperlich behinderten Sohn, der noch nie zu ihm „Papa" gesagt hätte. In einem nahegelegenen Haus wohnte eine muslimische Familie, die eine 10jährige Tochter hatte, die das gleiche Schicksal erlitt. Nicht nur sah sie wie eine Fünfjährige aus, sondern sie konnte sich weder bewegen noch artikulieren. Deshalb bewunderte ich die Art und Weise, wie sich die Familie hingebungsvoll um ihre Tochter und Schwester kümmerte. Sie wohnten zu fünft in einem Zimmer und das Mädchen gab ständig Laute von sich, die ich nie deuten konnte. Die Familie schon. Nach der Filmvorführung ging mein Kollege zu dem Anführer der Mennoniten und schrie laut, so dass es alle umstehenden Flüchtlinge hören konnten, er, der Anführer, solle mit ihm zu dem behinderten Mädchen gehen, um zu sehen, ob sie mit bloßen Gebeten geheilt werden könne. Selbstverständlich handelte es sich dabei um eine Provokation, die ich trotzdem ziemlich cool fand. Hinterher weigerten sich die Mennoniten mitzukommen!
Im selben Jahr 1995 war ich kurze Zeit noch während des Krieges in Bosnien und Herzegowina als Freiwilliger ebenfalls in einem Flüchtlingslager tätig. Ich wurde als Erster der Organisation dahin geschickt, um herauszufinden, ob eine Ausweitung von Freiwilligeneinsätzen dorthin Sinn mache, obwohl zu dem Zeitpunkt die Waffen noch keineswegs ruhten. Später war mein Fazit, dass dies in jedem Fall notwendig sei, obwohl ich mir damals gar nicht bewusst war, was das eigentliche Ziel solcher Einsätze sein sollte. Im Nachhinein stellte ich fest, dass allein meine Anwesenheit als Ausländer den Menschen half. Zuallererst gewannen sie wohl das Gefühl, dass sie in ihrer Not nicht allein gelassen wurden. Darüber hinaus erzählten sie mir, nachdem ich ihr Vertrauen gewonnen hatte, von ihren Problemen und Gedanken, die sie tagtäglich beschäftigten. Untereinander war es für all die intern Vertriebenen schlicht nicht möglich, da sie alle das gleiche Schicksal und ähnliche Geschichten teilten.
Untergebracht war ich dort zusammen mit vergleichsweise moderaten Mennoniten in einem Haus, dessen Besitzer geflohen war und keine Miete verlangte! Gewöhnlich saß ich am Abend mit einer Amerikanerin, ebenfalls Mennonitin, allerdings nicht streng gläubig, auf dem Balkon beim Feierabendbier. Eines Abends unterbrach unser Gespräch ein Kollege von ihr mit den Worten: „Er fände es super hier, denn er könne tagtäglich sehen, was durch Gott möglich wäre." Etwas verdutzt verstanden wir beide nicht, was er meinte, da wir uns über ein ganz anderes Thema unterhalten hatten. Daher entgegnete ich ihm, er solle das am besten einer Frau in der Nachbarschaft mitteilen, die neben ihrem Mann alle drei Söhne im Krieg verloren hatte. Ich würde hoffen, sie würde ihn hochkantig rausschmeißen!
Trotzdem spielt für die überwiegende Mehrheit religiöser Hilfsorganisationen im Katastrophenfall die Konfession oder der Glaube der betroffenen Menschen allerdings keinerlei Rolle.
Darüber hinaus gibt es Hilfsorganisationen, die sich nur auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die vor allem medizinisch tätig sind oder solche, die sich über die Jahre in der Szene in anderen Sektoren, wie Wasser, Hygiene oder der Verteilung von Hilfsgütern einen Namen gemacht und entsprechende Kompetenzen entwickelt haben. Jene verschiedenartigen Ausprägungen von NGOs gelten sowohl für ausländische als auch ortsansässige bzw. lokale Hilfsorganisationen, so dass deren Zahl je nach Einsatzgebiet durchaus mehrere Hundert (!), wie damals in Bosnien und Herzegowina oder dem Kosovo, übersteigen kann.
Ob eine Organisation bereits über Strukturen vor Ort verfügt oder im Katastrophenfall Neuland betritt, spielt oftmals eine nicht unerhebliche Rolle. Einige wenige Wohlfahrtsorganisationen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder Caritas, sind fast überall auf der Welt vertreten, so dass deren Vorteil darin liegt, dass sie in den meisten von Katastrophen heimgesuchten Ländern bereits über Schwesterorganisationen verfügen. So können sie im Ernstfall sofort Informationen einholen, für die andere Organisationen erst einmal Teams entsenden müssen, um sich einen Überblick verschaffen zu können. Darüber hinaus wird häufig lokales Personal für einen Hilfseinsatz zur Verfügung gestellt oder aber bei der Rekrutierung von geeignetem Personal wertvolle Hilfe geleistet. Davon profitierte ich in mehreren Einsätzen.
Andererseits war es häufig der Fall, dass jene Organisationen vor Ort mehr in der medizinischen Versorgung und Pflege oder Seelsorge tätig und nicht unbedingt auf Katastrophenhilfe spezialisiert waren. Gewöhnlich wird dann der Aufbau entsprechender Kapazitäten Teil eines Hilfseinsatzes seitens einer ausländischen Schwesterorganisation sein. Trotzdem erwiesen sie sich zumindest im unmittelbaren Nachgang einer Katastrophe als wertvolle Ressourcen vor allem in logistischer Hinsicht, wodurch sie anderen gegenüber, einen nicht zu unterschätzenden zeitlichen Vorsprung haben, ganz zu schweigen von der Sprache vor Ort. Allerdings kann es auch zu Problemen führen, wie ich selbst mehrfach erfahren musste.
Zum einen wurden seitens des lokalen Partners Forderungen gestellt, die, man verfüge ja über genügend finanzielle Mittel, unbedingt erfüllt werden sollten. In Sri Lanka, zum Beispiel, forderte der einheimische Leiter von mir, ein Rechtsanwalt, dass wir ihm „gefälligst" ein Dienstfahrzeug beschaffen sollten, was ich schlichtweg verweigerte. Zum anderen gingen die lokalen Partner stets davon aus, dass wir deren eigene geplanten Projekte ohne weiteres finanzieren würden. Entweder handelte es sich dabei um Maßnahmen, die lediglich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel nur Katholiken, unterstützen sollten, ohne dass hierfür tatsächlich der Nachweis von besonderer Bedürftigkeit erwiesen war. Oder die geplanten Maßnahmen lagen weit außerhalb von unserem Auftrag, geschweige denn Möglichkeiten. Im Kosovo verlangte der zuständige Projektmanager, wir sollten Firmen aus Westeuropa dazu bewegen, im Kosovo ansässig zu werden. Denn dadurch könnten wir unzählige Jobs schaffen.
Neben den NGOs gibt es zahlreiche sogenannte Regierungsorganisationen, in Deutschland zum Beispiel die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), die langfristige Entwicklungszusammenarbeit betreiben. Mitunter werden auch sie im Katastrophenfall entweder selbst tätig oder fungieren als Geldgeber für andere NGOs.
Gleiches gilt schließlich für die großen internationalen Organisationen der Vereinten Nationen: der Nothilfekoordinator (OCHA), dessen Organisation im Katastrophenfall normalerweise die Hilfe aller Akteure abstimmt; der Hohe Flüchtlingskommissar (UNHCR), das Kinderhilfswerk (UNICEF) oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die ebenfalls in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich neben der koordinierenden Funktion auch selbst oder zusammen mit NGO-Partnern eigene Aktivitäten durchführen.
Am bekanntesten dürften NGOs hierzulande im Rahmen von Spendenaufrufen auf diversen Fernsehkanälen vor allem nach großen Naturkatastrophen oder so manchem bewaffneten Konflikt sein. Oft leisten sie dort bereits Hilfe, wo andere allenfalls einen völkerrechtlichen Eklat – etwa mangels UN Resolution – hervorrufen würden. Zu Beginn des Jahres 2013 waren bereits zahlreiche NGOs in der Türkei ansässig, die von dort Hilfe nach Syrien leisteten. Dagegen hatte die UN zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Mandat und war entsprechend (noch) nicht vor Ort. Generell gilt, dass ein betroffenes Land die internationale Gemeinschaft um Hilfe bitten muss, damit Hilfsorganisationen überhaupt tätig werden können. Das bedeutet aber auch, dass der jeweilige Staat oder staatliche Stellen gewöhnlich die Koordinierung bzw. Entscheidung jeglicher Tätigkeiten übernimmt. Davon war in Syrien nicht auszugehen, da das Assad-Regime wohl kaum Unterstützung für oppositionelle Gebiete zugestimmt hätte, da es sich, nach dessen Meinung, um von Terroristen besetzte Gebiete handelte. Deshalb bildete erst eine Entscheidung des UNO Sicherheitsrates die notwendige Grundlage, um dort tätig zu werden. Nichtsdestotrotz hatten mehrere NGOs sogar Expatriates, also Ausländer, bereits vorher nach Syrien geschickt, um dort mitten im Kriegsgeschehen Hilfsprojekte durchzuführen. Ob dies angesichts der großen Gefahren für die Mitarbeiter immer so sinnvoll ist, sei dahingestellt. Trotzdem ist es genau das, was vor allem die NGOs am meisten ausmacht: sie alle sind nah am Menschen in Not. Sie stehen ihm bei, helfen ihm aus seiner Not unabhängig davon, um wen es sich handelt. Sie sind das Sprachrohr der Kriegs- und Katastrophenopfer, der Armen, der Unterbemittelten, Menschen mit Behinderung sowie insgesamt den Benachteiligten auf der Welt. Zuhause geben sie den Opfern Namen, so dass deren Schicksal nicht mehr eines unter Vielen weit wegbleibt, sondern tatsächlich greifbar wird. Sie treten für deren Unterstützung ein, führen Kampagnen Art durch, sammeln Spenden aller Art und vor Ort versuchen sie zum Wohle der Bedürftigen, ihr Bestes zu geben. Nicht zu Unrecht stellt deshalb so manch bekannter Prominenter oder Politiker einer Hilfsorganisation seinen Namen zur Verfügung, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und Gelder einzusammeln. Da mit an Bord zu sein, ob zu Hause oder vor Ort, gibt jedem, der für eine NGO arbeitet, ein Gefühl tatsächlich Sinnvolles zu tun.
Unzählige Male habe ich genau diesen Satz gehört. Da stehen keine Produkte, Verkaufs- oder Umsatzzahlen im Mittelpunkt. Nein, da geht es um den Menschen, um deren Überleben in einer Notsituation oder ihnen im Nachgang einer Katastrophe wieder auf die Beine zu helfen. Das ist es, was sich die humanitäre Hilfe sowie Entwicklungszusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben haben: die Verbesserung der Lebensbedingungen, die Bekämpfung der Armut, ja ein Stück weit die Welt verändern und verbessern. Wer könnte schon etwas dagegen haben?
Dadurch, dass die überwiegende Mehrzahl vor allem der großen NGOs ihre Hilfseinsätze über staatliche oder Zuwendungen anderer Geldgeber, wie zum Beispiel der EU, finanzieren, sehen sie sich bisweilen allerdings dem Vorwurf ausgesetzt, lediglich als verlängerter Arm der Politik zu fungieren. Denn nur sehr wenige generieren derartig hohe Spendeneinnahmen, dass sie nicht ausschließlich auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Letztere wird oft nur dort vergeben, wofür entsprechende finanzielle Töpfe eingerichtet werden, wo es politisch oder auch wirtschaftlich Sinn macht (oder motiviert ist), wo man letztlich selbst (deutsche Unternehmen?) am Ende profitiert bzw. betroffen sein könnte. Stichwort: Flüchtlingskrise. Auf der Strecke bleiben dabei leider jene Menschen, die durch vergessene Konflikte selbst nach Jahrzehnten ihr Dasein in bitterster Armut fristen - für mich als bestes Beispiel dient der Kongo, obwohl ich nie dort gewesen bin. Gelegentlich berichten die Medien von Auseinandersetzungen in dem Land, allerdings scheint es niemanden zu interessieren, obwohl dort bislang Millionen Menschen wegen Konflikten ums Leben kamen. Eben dort, wo seitens der westlichen Welt offenbar kein unmittelbares geopolitisches Interesse besteht.
In der Praxis heißt das natürlich, dass Hilfsorganisationen keineswegs locker auf einer philanthropischen Sympathiewelle reiten, wo Gelder automatisch dem Sinnvollen und Guten zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr agieren sie auf einem hart umkämpften Markt, auf dem nicht zuletzt das Medieninteresse bzw. Medienaufmerksamkeit nach außen eine große Rolle spielt.
Nach innen haben sich Hilfswerke fachlich und personell professionalisiert, um je nach Kontext einer Naturkatastrophe oder eines bewaffneten Konfliktes intervenieren zu können. Deshalb ist es mittlerweile ungleich schwerer als vielleicht in der Vergangenheit, überhaupt den beruflichen Einstieg in dieses Berufsfeld zu finden.
Wie anderswo auch verläuft das Rekrutierungsverfahren gewöhnlich bei Hilfsorganisationen formal nach den gleichen Regeln ab: Stellenausschreibung, Bewerbung, (hoffentlich) Einladung zum Vorstellungsgespräch sowie Zuoder Absage. Wie gesagt gewöhnlich. Allerdings sind meine eigenen Erfahrungen im Rahmen von Bewerbungen bei NGOs durchweg von Anekdoten gespickt.
Etwa jene, wie ich später erst erfuhr, bei einer auf Missionierung spezialisierten evangelikalen Sekte, die eine durchaus interessante Position ausgeschrieben hatte. Kurze Zeit später wurde ich zum Gespräch eingeladen. Obwohl ich eigentlich zu der Zeit hinsichtlich Interviews erfahren gewesen sein sollte, erinnere ich mich nur zu gut, dass ich mit gemischten Gefühlen dort hinfuhr. Denn meine Recherchen im Internet über den möglichen künftigen Arbeitgeber waren nicht sehr fruchtbar gewesen. Bei dem Vorstellungsgespräch saßen mir dann vier Männer gegenüber: der Präsident der Organisation, der Vize-Präsident, der Leiter für politische Fragen sowie der Geschäftsführer. Bereits als sie sich mit ihren Funktionen vorstellten, musste ich innerlich schmunzeln, denn diese klangen geradeso, als würde ich den Vertretern einer riesigen Organisation gegenübersitzen. Zunächst wurde besonderer Wert auf meine religiöse Einstellung gelegt, was nach gut zwanzig Minuten darin gipfelte, dass der Präsident mich anblaffte, er hätte mich nun permanent danach gefragt, ob ich an Jesus Christus oder die Bibel glaubte, worauf ich noch immer keine eindeutige Antwort gegeben hätte. Nun, die blieb ich schuldig. Wobei ich nach dem Gespräch innerlich nur noch sauer auf mich selbst gewesen war, da ich nicht den Mut aufgebracht hatte, dem Frager mit dem Hinweis entgegenzutreten, ich wäre davon ausgegangen, ich hätte mich für einen Job beworben und nicht fürs Priesterseminar! Stattdessen saß ich den vier Herren weiterhin mit guter Miene zum bösen Spiel gegenüber und versuchte mich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Innerlich war jedoch meine Entscheidung längst gefallen – nämlich, dass dieser Job für mich nicht in Frage kam. Lediglich einmal noch musste ich doch gar zu flapsig antworten. Als ich nämlich gefragt wurde, ob ich an der täglichen Morgenandacht noch vor dem eigentlichen Beginn des Arbeitstages teilnehmen würde. Dem entgegnete ich entschieden: „Nein". Währenddessen könne ich ja eine Zigarette rauchen gehen." Der Clou an der ganzen Geschichte war, dass ich tatsächlich eingestellt werden sollte! Ich lehnte dankend telefonisch ab und konnte die heruntergefallene Kinnlade des Geschäftsführers durch den Telefonhörer förmlich spüren.
Irgendwie muss ich mich mit den Werten eines Arbeitgebers zumindest bis zu einem gewissen Grad identifizieren können. In dem Fall war es für mich unmöglich. Schließlich war und bin ich kein Prediger und schon gar kein religiöser Fanatiker. Denn offenbar war damals ein solcher gefragt.
Zudem machte ich die Erfahrung, dass so manche Organisation mit einem christlichen Hintergrund, vor allem wenn die Konfessionsangabe in einer Stellenausschreibung für eine Position hierzulande ausdrücklich gefordert wurde, das entsprechende Gebetbuch auch verlangte. Bevor ich eine Bewerbung an eine in Deutschland ansässige Organisation schickte, hatte ich es für ratsam gehalten, zunächst telefonisch nachzufragen, ob es Sinn mache, mich auf die ausgeschriebene Stelle zu bewerben, selbst wenn ich nicht die geforderte Konfession besäße. Kurz und knapp bekam ich ein „Nein" zu hören.
Gelegentlich ist es im Katastrophenfall aber auch so, dass Hilfsorganisationen händeringend Personal suchen und aufgrund des Zeitdruckes ein eher verkürztes Bewerbungsverfahren durchführen. Dann wird das Hauptaugenmerk generell auf die Berufserfahrung gelegt und weniger auf spezifische Kenntnisse.
Bei einer kleineren deutschen NGO hatte ich mich für die Stelle des Projektleiters im Nordkaukasus beworben und wurde zum Interview eingeladen. Mein Gegenüber, der Projektverantwortliche in der Zentrale, begann das Bewerbungsgespräch mit dem Satz, „wenn das alles so stimme, was da in meinem Lebenslauf stünde, könne ich die Stelle sofort antreten." Einigermaßen überrascht entgegnete ich, ob er denn glaube, ich würde flunkern. Immerhin hätte ich gute Zeugnisse vorzuweisen, die meine vormaligen Arbeitgeber bestätigen würden. Letztlich ging es lediglich um meine Erfahrung in der Leitung eines Projektbüros und des dazugehörigen Teams. Das Einsatzgebiet und zum Beispiel etwaige Sprachkenntnisse spielten so gut wie gar keine Rolle. Nachdem sich mein Gegenüber für die allzu respektlosen Bemerkungen entschuldigt hatte, bot er mir den Job an. Nachher hatten wir ein kollegiales Verhältnis, wie man es sich nur wünschen konnte. Es kam aber auch vor, dass gänzlich auf irgendwelche Kompetenzen und Qualifikationen als Voraussetzung für eine spezifische Stelle verzichtet wurde, da während des Interviews unverhofft eine ganz andere Position in einem anderen Land aus dem Hut gezaubert wurde.
Ich hatte mich Anfang der 2000er Jahre bei einer französischen Hilfsorganisation für den Job eines Programmkoordinators in Tadschikistan beworben. Weder hatte ich mir Gedanken über das Land, noch den Zuständen dort gemacht. Ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder einen Job finden. Nach einem positiv verlaufenen Telefoninterview wurde ich nach Paris zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Reisekosten würden mir selbstverständlich erstattet werden. Während des Interviews wurde ich dann plötzlich gefragt, ob ich denn auch bereit wäre, nach Afghanistan in eine ähnliche Position zu gehen - das Land war damals noch unter Taliban-Herrschaft. Was ich von dort so gehört hatte, klang nicht gerade nach einer entspannten Tätigkeit. Gleiches galt im Übrigen dann auch für meine eigene Verfassung, als ich nämlich nach dem zu erwartenden Gehalt fragte: etwa 800 Euro brutto (!). Dies sei nun mal das interne Gehaltsgefüge. Ich bedankte mich für das Gespräch, wünschte dem Gesprächspartner viel Glück bei der Personalfindung und verabschiedete mich. Die fälligen Reisekosten habe ich bis heute nicht ersetzt bekommen.
Schließlich ist es mir gewissermaßen als Krönung des Anekdotenschatzes im Rahmen einer Bewerbung passiert, dass ich mittels zuvor einigermaßen veranstalteten Brimboriums in Form von diversen Emails hin und her, zum Interview von einer deutschen Hilfsorganisation eingeladen wurde. Aufgrund des regen Austauschs von Nachrichten war selbstverständlich meine Erwartung geweckt, dass ich unbedingt genommen werden wollte bzw. sollte. Jedoch war ich in Spanien im Urlaub gewesen, so dass ein Ersatztermin angesetzt wurde und ich den Urlaub, früher als gedacht, extra abbrach. Wie besprochen meldete ich mich dann telefonisch und wartete geduldig auf den Rückruf. Wenig später sprach dann zu meiner Verblüffung der Gesprächspartner eine nonchalante Ausladung zum Interview aus. Man hätte im Moment leider keine Zeit und würde sich wieder melden, wenn entsprechende Stellen ausgeschrieben werden würden. Selbstverständlich passieren derartige Geschichten sicherlich auch in anderen Bereichen, trotzdem sah ich mich damals veranlasst, als Antwort auf die nonchalante Ausladung der zuständigen Mitarbeiterin den Hinweis zu geben, dass ich dieser Episode in meinem noch zu schreibenden Buch mit dem Titel ,Professionelle Unprofessionalität' mindestens einen Absatz widmen würde.
Wird man von einer humanitären Hilfsorganisation angestellt, so bekommt man in der Regel einen Vertrag, der entweder zeitlich oder je nach Projektlaufzeit befristet ist. Mit der Zeit hatte ich mich daran gewöhnt, dass ein unbefristeter Vertrag gleichsam eine utopische Vorstellung bleiben würde. Daher hangelte ich mich im Prinzip von Einsatz zu Einsatz. Jedoch gingen diese keineswegs nahtlos ineinander über, so dass mein Rentenkonto einige Pausen aufweist, die ich, so ich denn Anspruch hatte, mittels der Beihilfe der Arbeitsagentur überbrückte – ein unbeschwertes Leben wie ,Florida Rolf' im Alter kann ich mir jedenfalls getrost abschminken. Über ihn hatte die Bild-Zeitung vor Jahren berichtet, wonach er, Rolf, sich trotz geringer Rente einen vermeintlich ausschweifenden Lebensabend in Florida gönnen könnte.
Woran ich mich bei NGOs mühelos von Beginn an gewöhnte, war und ist der eher lockere Umgang unter- und miteinander: Duzen gehörte und gehört zum normalen Umgangston. Es sei denn, man hat einen untersetzten Vorgesetzten, der, obwohl bei weitem mehr intro- und viel weniger extrovertiert, kraft seiner Position und vor allem Führungsfunktion von seinen ihm unterstellten Mitarbeitern auf dem beiderseitigen ,Sie' beharrte. Einmal war ich mit eben jenem Chef auf Dienstreise und traf in Berlin am Flughafen zufällig einen damals in der deutschen humanitären Szene keineswegs unbekannten Direktor einer anderen NGO, bei der ich früher einmal ein Praktikum absolviert hatte. Dieser erkundigte sich, ganz wie es sich im vertrauten Du-Jargon gehörte, nach meinem Befinden inklusive anschließenden Small-Talk. Dann wandte er sich an meinen Vorgesetzten mit der Frage: „Und was machst du so bei dem Verein?" Jener errötete und brummelte etwas verlegen, er sei mein Chef. Daraufhin klopfte besagter Direktor ihm mit einem anerkennenden Lächeln auf die Schulter, so dass mein Vorgesetzter vollends verdutzt dastand.
Generell schaffte eine Atmosphäre, in der man sich duzt, ein heimeliges Gefühl der Vertrautheit und Kollegialität, in der man selbst als Neuling in einer Organisation den Zugang zu Vorgesetzten problemloser fand. Hinzu kam der Dresscode, der hierzulande vor allem bei kleineren Organisationen sehr leger und locker gehandhabt wurde und wird. Meistens entsprach und entspricht er alles andere als einem geschäftsmäßigen Umgang in Anzug und Krawatte bzw. Kostüm. Im Auslandseinsatz wurde das, nach meiner Beobachtung, insbesondere von den jüngeren Helfern noch eine Spur extremer gehandhabt. Häufig genug traf ich entsprechende Zeitgenossen, deren äußere Erscheinung eher der einer alternativ lebenden Kommune als einer ernstzunehmenden Organisation entsprach. Zugegeben, auch ich war und bin noch immer kein Anzugträger. Was ich eben über die jungen Kollegen sagte, trifft wohl noch heute auf mich selbst, zumindest bis zu einem gewissen Grad, zu. Nicht umsonst wurde ich deswegen wohl bisweilen schräg angesehen, als ich für eine Regierungsorganisation in der Türkei arbeitete, in der zur Führungsposition, zumindest für manchem Besucher aus der Zentrale, automatisch das entsprechende Outfit gehörte. In all den Jahren hatte ich lediglich ein einziges Mal (!) eine Krawatte berufsmäßig getragen, die ich mir sogar extra gekauft hatte. Nämlich als ich mich bzw. die Organisation seinerzeit im serbischen Außenministerium vorstellte. Meine damalige Lebensgefährtin meinte hinterher, dass jene Krawatte auf einen besonders „scheußlichen Geschmack" meinerseits schließen ließ!
Die manchmal gar zu offensichtliche Zurschaustellung von Lockerheit und Kollegialität darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst kleine Hilfsorganisationen nach bestimmten Regeln und Hierarchien funktionieren. Meiner Erfahrung nach sind alle prinzipiell gleichermaßen organisiert: während die Zentrale eher für die Administration sowie Kommunikation mit dem Geldgeber zuständig ist, führen die jeweiligen Auslandsbüros die Projekte vor Ort durch. Die Kommunikation läuft daher in der Regel, je nach Organisation, über ein bisweilen ausgeklügeltes Berichtswesen ab, das normalerweise monatlich stattfindet; ich musste allerdings auch zum Teil Wochen- oder Vierzehntägige Berichte abliefern.
Dass diese nicht immer gelesen wurden, sondern bisweilen lediglich in der Schublade landeten, konnte ich gleich bei meinem ersten Auslandseinsatz in Serbien noch unter dem Milošević-Regime erleben. Slobodan Milošević war seit Ende der 1980er Jahre Präsident Jugoslawiens und galt bei vielen aufgrund seines immer stärker hervortretenden Nationalismus als einer der Treiber des Krieges in Bosnien & Herzegowina (BiH). Im Zuge der Revolution in Serbien im Jahr 2000 wurde er abgesetzt und später dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag überstellt. Dort starb er in der Haft 2006.
Monatelang hatte ich in meinen Wochenberichten immer wieder die politische Situation skizziert, worin die Demokratische Opposition Serbiens (DOS) eine tragende Rolle gespielt hatte. Fast täglich waren Demonstrationszüge vor meinen Augen durch Belgrad gezogen. Als ich nach einem Dreivierteljahr, mittlerweile war der Regimewechsel in Serbien vollzogen gewesen, in die Zentrale kam, fragte mich die zuständige Projektkoordinatorin, was denn eigentlich DOS bedeuten würde? Ich war fast versucht, ihr zu antworten, dass es sich dabei um ein Computerprogramm handeln würde.
Die Kommunikation zwischen Feld und Zentrale ist, meiner Erfahrung nach, in jeder Hilfsorganisation ein Problem und davon kann sicherlich jeder humanitäre – oder Entwicklungshelfer ein Lied singen. Die heutigen Möglichkeiten der Kommunikation per Mobiltelefon, Email, Facebook, Twitter, Skype und dergleichen sind wohl nicht ganz unschuldig daran, obwohl man sich fast gar nicht mehr vorstellen kann, wie die Arbeit und Kommunikation vor dem Internetzeitalter abliefen. Ich kann mich jedenfalls noch gut daran erinnern, als man noch nicht permanent online war, sondern sich erst immer ins Netz einwählen musste, um zum Beispiel eine E-Mail zu verschicken. Dokumente hatte man damals gewöhnlich gefaxt und Auslandsgespräche ohnehin auf ein absolutes Minimum reduziert, da die Kosten zum Teil astronomisch waren. In Serbien wurden pro Woche private Telefongespräche bis zu zehn Minuten vom Arbeitgeber übernommen. Heute dagegen ist man gewöhnlich permanent per Mobiltelefon online, sendet wie selbstverständlich alle möglichen Dokumente per E-Mail und führt selbst Telefongespräche oder -konferenzen übers Internet fast zum Nulltarif. Die permanente Erreichbarkeit sowie die viel geringeren Kosten als früher senken natürlich die Hemmschwelle, mal kurz mit dem Feld oder umgekehrt zu kommunizieren. Hinzu kommen die sozialen Netzwerke, wo Hilfsorganisationen sich und ihre Arbeit gleichermaßen fast schon in Echtzeit präsentieren, um ihre Fangemeinde und potentielle Spender zu gewinnen – fehlt nur noch der ,Gefällt mir' Button für Katastrophen!
Insgesamt sind also hier wie dort die Arbeitsaufgaben äußerst vielschichtig. Oft genug mangelte es allerdings an Verständnis der Zentrale für uns, die wir vor Ort unser Bestes gaben. Meiner Erfahrung nach lag das oft daran, dass vor allem das Personal im Feld nicht als gleichwertige Mitglieder oder Mitarbeiter wie diejenigen in der Zentrale angesehen wurden. Auf den ersten Blick war das sogar nachvollziehbar. Denn gewöhnlich wird davon ausgegangen, dass ein Büro im Feld nur für einen bestimmten Zeitraum existiert und daher das Personal ebenfalls nur vorübergehend angestellt wird. Als ich in der Zentrale einer deutschen Organisation arbeitete, meinte mein damaliger Vorgesetzter einmal, dass die Auslandsmitarbeiter, vor allem die deutschen, lediglich „überbezahlte Vagabunden" seien, die den Arbeitgeber wechselten geradeso wie er seine Hemden! Dass sich dadurch kein kollegiales Verhältnis mit ihm entwickeln konnte, war abzusehen. Kurz danach wurde er entlassen.
Zwar habe ich anderswo nie mehr eine ähnliche Aussage gehört, trotzdem fühlte ich mich im Auslandseinsatz oft genug als Fremdkörper, der irgendwie nicht zur jeweiligen Organisation zu gehören schien. Bis ich verstand, wie die Organisation in der Zentrale funktionierte, wer welche Aufgabe hatte, erschloss sich mir meistens erst dann, wenn mein Arbeitsverhältnis fast schon wieder vorbei war.
Einerseits wäre es für mich natürlich wünschenswert gewesen, stets einen längerfristigen Vertrag bekommen zu haben. Damit wäre zumindest mein regelmäßiges Einkommen gesichert gewesen und somit eine längerfristige persönliche Planung ermöglicht worden. Zudem hätte ich die Chance bekommen, mit der Zeit die eine oder andere Organisation besser kennenlernen zu können. Dadurch hätte ich sicherlich, besonders wenn neben akzeptablen Konditionen auch sonst ein gutes Klima geherrscht hätte, eine Identifikation mit dem Arbeitgeber entwickeln sowie auf der Arbeitsebene engere Kontakte knüpfen können. Trotzdem war ich nie jemand, der bei den unterschiedlichen Arbeitgebern lediglich auf Vertragskonditionen bzw. den darin dargelegten Aufgaben gepocht hatte. Sondern ich versuchte immer, mein Bestes zu geben.
Andererseits hatte jenes Hangeln von Einsatz zu Einsatz durchaus positive Seiten. Denn mit den Jahren hatte ich mich daran gewöhnt, stets nur befristet angestellt worden zu sein. Die anschließende Job suche gehörte für mich somit zum Alltag, so dass ich, anders wie vielleicht Angestellte, die Jahrzehnte für eine Firma gearbeitet hatten, plötzlich nach einer Entlassung, in meinem Fall dem Vertragsende, eben keine existentiellen Ängste bekam. Aus heutiger Sicht denke ich, dass es für mich sogar von Vorteil war, verschiedene Arbeitgeber kennengelernt zu haben. Nicht nur konnte ich so einen Blick in unterschiedliche Hilfsorganisationen und deren Arbeitsweisen werfen, sondern mir überhaupt bewusst werden, wie vielfältig die Akteurs-Landschaft war und ist. Allzu häufig sind mir langjährige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen begegnet, die dachten, dass sich die Welt nur um sie und in ihrer Organisation, und zwar in der Zentrale, abspielte - deshalb hatte ich jungen Kollegen stets mit auf den Weg gegeben, dass sie durchaus einmal den Arbeitgeber wechseln sollten.
Deutlich wurde die ,etwas merkwürdige Beziehung' stets bei Besuchen aus der Zentrale. War ich für eine größere Organisation im Einsatz, hatte ich oft das Gefühl, trotz meiner leitenden Position vor Ort, als eine Art Fremdkörper angesehen zu werden. Meine lokalen Kollegen wurden dabei so gut wie nicht wahrgenommen, geschweige denn, dass sie beim Namen genannt werden konnten. Stattdessen sah so mancher Besucher in ihnen lediglich eine Art Dienstpersonal, welches gerade gut genug zum Koffer tragen war. Besonders eklatant erfuhr ich dies in Sri Lanka, wo selbst die Kollegen aus dem Hauptbüro meinten, sie könnten/müssten meine Mitarbeiter ständig herumkommandieren.
Andererseits habe ich vor allem in Montenegro, als ich für eine kleinere Organisation tätig war eine Wertschätzung seitens der Kollegen aus der Zentrale gegenüber meinen Mitarbeitern erfahren, die bis dato einzigartig war und ist.
Insgesamt begegnete ich zahlreichen Arbeitgebern, bei denen ich positive wie negative Erfahrungen gemacht habe. Allerdings trifft dies wohl in jedem anderen Bereich ebenfalls zu. Einzigartig dürften allerdings die Aufstiegsmöglichkeiten sein, die ich erfuhr. Eben noch selbst der Anfänger in der Zentrale einer Hilfsorganisation, wurde ich nach nur einem Jahr der Leiter in einem neu eröffneten Projektbüro im Ausland – zugegeben: außer mir gab es anfangs ohnehin keinen anderen Mitarbeiter. Seitdem hatte ich meistens die Führungsposition inne, einmal sogar ein Team von fast einhundert Mitarbeitern geleitet ohne eigene Sekretärin oder Assistentin! Zuhause würde man möglicherweise jahre- oder jahrzehntelang in derselben Position verharren, bevor man in eine Führungsposition aufsteigt. Jedoch sollte man sich keinesfalls vorstellen, dass dies automatisch bedeutet, man würde ein sehr hohes Gehalt bekommen. Mittlerweile dürften die solch schnelle Aufstiegsmöglichkeiten nur noch bei vergleichsweise kleinen Hilfsorganisationen möglich sein.
Als Fazit kann ich wohl ziehen, dass, je kleiner die Organisation ist, desto höher ist die Wahrnehmung der eigenen Leistung. Gleichermaßen muss man sich allerdings auch mit einer gewissen Unprofessionalität, besonders als Erfahrener, auseinandersetzen. Je größer die Organisation, desto seltener wird die eigene Leistung wahrgenommen. Man ist halt einer von Vielen. Allerdings ist dort die Ausprägung von Professionalität vor allem hinsichtlich aller möglichen Prozesse deutlich sichtbarer; mit anderen Worten die Bürokratie. Letzteres ist insofern nicht unbedingt negativ zu beurteilen, zumal man im einen wie im anderen Fall meistens mit öffentlichen Geldern hantiert, für die man letztlich auch deren ordnungsgemäße Verwendung nachweisen muss. Dabei spielt die Art oder Größe der Organisation keine Rolle. Zwar genoss ich es, auch für kleinere Organisationen zu arbeiten, merkte aber auch, dass größere Hilfsorganisationen bei allen Schwierigkeiten gar nicht schlecht waren. Selbst als ich für eine Regierungsorganisation tätig war, wurde ich einmal als „nicht konform" betitelt, was ich stolz zur Kenntnis nahm. Das bezog sich in erster Linie auf meinen Führungsstil, der mehr flach als hierarchisch war. Hinzu kam wohl mein eigener Dresscode, der nicht dem üblichen entsprach und nicht zuletzt mein Umgang mit Kollegen. Insgesamt schaffte ich es, mich sowohl in kleineren als auch größeren Organisationen zu behaupten. Heutzutage denke ich, dass es wohl besser ist, erst bei kleineren Hilfswerken anzufangen, um zu lernen, mit allen möglichen ,Beschwerlichkeiten', umzugehen. Denn in größeren ist der Anspruch der Mitarbeiter, meiner Beobachtung nach, hinsichtlich eines luxuriöseren Lebens im Ausland ungleich höher. „Ein bisschen Dreck fressen", wie mein Vater behauptete, „hat noch niemandem geschadet."
Selbst wenn sich der Arbeitgeber für mich selbst in gewisser Weise bisweilen als eine Katastrophenbegegnung erwiesen hatte, ändert das nichts daran, dass ich persönlich in jeder Hinsicht profitierte. Schließlich wird man nur aus Erfahrung klug. Verwerflich ist höchstens, wie ich es einmal mit eigenen Augen erlebte, dass die Mitarbeiter einer Hilfsorganisation die Sektkorken knallen ließen (tatsächlich!), als das Spendenkonto im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes rasant anwuchs.
2. Kapitel: Identitätsbegegnungen
Woher komme ich und was tue ich eigentlich? Keine Angst, weder treiben mich Identitätsprobleme an, noch habe ich einen Hang zur Philosophie; weder habe ich meine Herkunft vergessen, noch hinterfrage ich meine Tätigkeit. Ganz im Gegenteil: häufig wurde ich ohne mich überhaupt geäußert zu haben, im Ausland als Deutscher nicht nur identifiziert, sondern meistens auch bewundert. Gelegentlich wurde mir aufgrund meiner Aussprache dagegen vor allem in Serbien eine andere europäische Nationalität zugeschrieben, die mich stets verblüffte. Schließlich ist meine Arbeit so vielschichtig und abwechslungsreich, dass sie mir nach wie vor Spaß macht. Gleichwohl ist es nicht immer ganz einfach, genauer zu erklären, worin meine Tätigkeit eigentlich besteht und als was ich mich selbst bezeichnen würde.
Was hatte man mich gewarnt, bevor ich mich damals im Jahr 2000 alleine zu meinem allerersten Auslandseinsatz mit dem Auto von Deutschland in die damalige Bundesrepublik Jugoslawien, dem heutigen Serbien, auf den Weg machte. „Pass auf, wenn du gefragt wirst, woher du kommst! Sei bloß vorsichtig", war noch harmlos: „Sag auf jeden Fall nie gleich, dass du Deutscher bist!", hatte bei mir schon eher ein mulmiges Gefühl aufkommen lassen; „Sei extrem vorsichtig, denn die Leute könnten sogar handgreiflich werden, sobald sie erfahren, dass du Deutscher bist", versetzte mich dann doch in einen gewissen Angstzustand. Die letzten Tage vor meiner Abfahrt erfuhr ich derart viel Zuspruch, dass ich mir gleichsam als eine Art Held vorkam: ich, derjenige, der sich nun ins Land des Bösen aufmacht; und zwar alleine, da ich dort überhaupt erst einmal ein Projektbüro eröffnen sollte. Immerhin hatte das Jugoslawien Milosevic' großen Anteil am Ausbruch des Balkankrieges Anfang der 1990er Jahre sowie später an der Vertreibung Hunderttausender Kosovaren und diversen anderen Verbrechen. Letztere führten 1999 zur militärischen Intervention der NATO.
In den westlichen Medien jedenfalls war ein entsprechendes Bild gezeichnet worden. Ich kann mich erinnern, dass es Berichte gab, wonach serbische Soldaten vermeintlich Kinder gegrillt und gegessen hätten! Jedenfalls solle ich, da Deutschland an den militärischen Aktionen gegen Serbien direkt beteiligt gewesen sei, ,low profile' zeigen - mich also nicht allzu offen als deutschen Staatsangehörigen ausgeben.
Nun ja, Theorie ist die eine Seite, Realität die andere. Denn, wo immer ich bis zum heutigen Tag in Europa gearbeitet habe, hat man mich fast überall zu hundert Prozent sofort als Deutschen identifiziert. Geradeso als wäre es mir auf die Stirn geschrieben.
Wann immer ich später in Serbien in einem Hotel abstieg, hieß es an der Rezeption: ,,Ausländer! Deutsch, oder?" In der Türkei hatte mich ein Passant angesprochen, der offenbar vor einem Restaurant gerade seine Verdauungszigarette genoss: „Hey Deutscher! Woher?" Ich drehte mich um: „Ja, und wo kommst du her?" „Aus Hesse, das wird man nicht vergesse!" Auch im Kosovo wurde ich meistens sofort als Deutscher erkannt, obwohl ich dort noch nicht einmal für eine deutsche Hilfsorganisation tätig gewesen bin.
Als ich nun also an der Grenze zum heutigen Serbien angekommen war, gingen mir erneut all die Warnungen durch den Kopf und entsprechend mulmig war mir zumute. Allerdings passierte irgendwie genau das Gegenteil von dem, was man mir mit auf den Weg gegeben hatte. Als der Polizist mich nicht nur anhand des Autokennzeichens, sondern auch meines Reisepasses als Deutschen identifizierte, geriet er ins Schwärmen. Dass er mir nicht gleich die Füße küssen wollte, war alles. Diese völlig unerwartete Reaktion ließ mir erst einmal einen Stein vom Herzen fallen. Unterwegs hatte ich mir vorher alle möglichen Szenarien ausgemalt, was passieren könnte: ob ich überhaupt ins Land gelassen werden würde? Wenn nicht, was sollte ich dann tun? Wie reagiere ich, wenn ich allzu unhöflich behandelt werde? Wen kann ich um Hilfe bitten, sollte ich sie benötigen?
Nicht nur bombardierte mich der Polizist mit allerhand Fragen, Serbisch und ein bisschen Englisch gemischt, was ich nur sehr schwer verstand. Sondern er machte seine umstehenden Kollegen gleich lauthals mit einem anerkennenden Augenaufschlag darauf aufmerksam, dass es sich hier um einen Deutschen handeln würde. Interessanterweise hatten nicht nur er, sondern sehr häufig später auch seine anderen serbischen sowie montenegrinischen Kollegen bei meinen zahlreichen Grenzübertritten immer wieder die Frage gestellt, ob ich studiert hätte, was ich bejahte. Und dann: „Wirklich richtig fertig studiert?", was mich stets etwas ratlos werden ließ, zumal es sich lediglich um einen Studienabschluss handelte. Allerdings reagierte der jeweilige Grenzpolizist geradeso erstaunt, als hätte ich kurz vor der Erlangung des Nobelpreises gestanden.
Zurück zum Grenzübertritt. Das Auto war vollgepackt mit persönlichen Sachen, mehr noch mit allerhand sogenanntem Visibility Material (Werbeartikel), wie Kugelschreiber, Aufklebern mit dem Logo der Hilfsorganisation, meinem Arbeitgeber, für den ich im Lande tätig werden sollte. Deshalb fragte mich besagter Polizist, ob ich nicht ein Geschenk für ihn hätte. Ich überreichte ihm einen Kugelschreiber, worauf er mich freundlich strahlend und augenzwinkernd passieren ließ. Stolz wie Oskar und ziemlich erleichtert startete ich den Motor und fuhr los.
So wie hier beschrieben erging es mir im Übrigen unzählige Male während all meiner Auslandseinsätze. Nicht nur ich als Deutscher, sondern Deutschland als Ganzes genoss anderswo ein derart hohes Ansehen, dass es mir bisweilen sogar die Schamröte vor lauter Lobeshymnen ins Gesicht steigen ließ.
Besonders auf dem Balkan bzw. den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens oder der Türkei traf ich quasi an jeder Ecke jemanden, der entweder selbst in Deutschland gewesen war oder dort Verwandtschaft hatte. Meistens reduzierte sich das Bild bei den einen auf simple Plattitüden („Deutschland ist super!"). Andere, die selbst nie in Deutschland gewesen waren, brachten ihre Hochachtung zumindest gegenüber Made-in-Germany-Produkten zum Ausdruck, gegen die kein anderes konkurrieren könne. Deshalb sei man durchaus bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Dass sich dies in Zeiten der Globalisierung wo oftmals nicht mehr das drin ist, was außen draufsteht, nuanciert gewandelt hatte, war mancherorts offenbar noch nicht durchgedrungen – unsere Exportwirtschaft durfte sich freuen.
Ob auf dem Balkan, in Russland oder Moldawien: stets hatte ich dort Zigaretten gekauft zu einem Bruchteil dessen, was sie in Deutschland kosteten. Meine jeweiligen lokalen Raucherkollegen dachten jedoch, ich hätte sie von zuhause mitgebracht. Die „hierzulande verkauften seien ohnehin nur qualitativ (!) minderwertige Kopien, während die nun angesteckte ein ganz anderes Aroma, hätte, das spüre man sofort", hörte ich gar zu häufig – Placebo Effekt der etwas anderen Art.
Einerseits ließen die meisten meiner Gesprächspartner vor allem in Osteuropa stets kein gutes Haar an den Zuständen ihres Landes und noch mehr an ihren Politikern („Alle korrupt!"). Andererseits klang immer wieder ein Nationalstolz durch, der einem Deutschen meiner Generation völlig befremdlich vorkam. Unzählige Male beobachtete ich auf dem Balkan hupende Autokorsos einer Hochzeitsgesellschaft, wo aus dem ersten Wagen immer stolz die Nationalflagge geschwenkt wurde. Wenn ich nach dem Grund fragte, erhielt ich stets als Antwort, dass „die Fahne einfach dazugehöre". Wie das angesichts all der Klagen über sie Zustände zusammenging, erschloss sich mir nie. Dass dies in Deutschland keineswegs Brauch sei, verwunderte die Einheimischen, egal wo, ziemlich. Oder inmitten Dushanbes, der Hauptstadt Tadschikistans. Dort war ein protziger Präsidentenpalast errichtet worden, dem tausende Einwohner mittels Zwangsumsiedlung hatten weichen müssen. Anstatt darüber Klagen zu hören, erwiderten diejenigen, die ich dort darauf ange