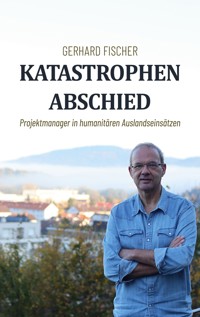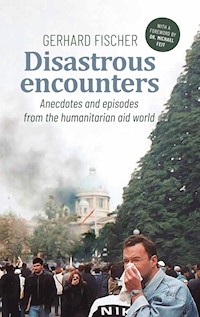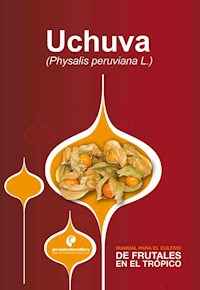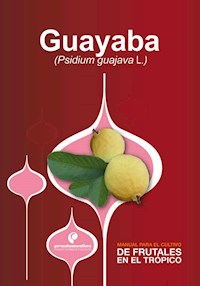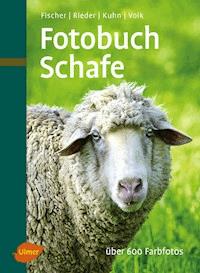Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Begegnungen mit Katastrophen und "katastrophale" Begegnungen: Ein entspannter Fussballabend im Nordkaukasus endet im Angriff tschetschenischer Rebellen, in Sri Lanka gehen Affen zum Angriff über und im Kosovo erscheint ein Handwerker ohne Werkzeug. Diese und viele andere lustige und skurrile, aber auch abenteuerliche und dramatische Erlebnisse erzählt Gerhard Fischer authentisch und mit viel Witz. Es handelt sich um eine komplett überarbeitete Fassung des Buches von 2019, in die der Verfasser weitere Episödchen einfügte und manch andere wegließ.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort 2019
Vorwort zu dieser Ausgabe
22 Jahre professionell – kurz und bündig
1 Fremde Kulturen – Andere Länder, andere Sitten
2 Unterbringung – Gemütlichkeit mit Abstrichen!
3 Amtsstuben – Dienst nach ganz eigener Vorschrift
4 Dienstleistungen – Überraschung inbegriffen!
5 Gefahr? – nicht permanent, aber latent
6 Nach Büroschluss – erst aktiv, zunehmend passiv!
7 Persönliche Begegnungen – mit nachhaltiger Wirkung
Nachwort
Vorwort 2019
Warum die Geschichten eines humanitären Helfers lesen? Was kann daran interessant sein, was neu, was wurde nicht schon so oft berichtet?
Ich wurde von Gerhard Fischer als ehemaliger Kollege und Vorgesetzter, aber vor allem als Freund gebeten, ein Vorwort für dieses Buch zu schreiben. Ich hatte das Glück, mit ihm viele dieser kleinen Anekdoten selber erleben zu können, sei es als Sachbearbeiter in Montenegro, Serbien oder Moldawien, sei es als Direktor der internationalen Zusammenarbeit der Caritas Luxemburg. Nach der Lektüre des ersten Entwurfes fand ich mich so sehr in dem Buch wieder, dass ich die Aufgabe das Vorwort zu schreiben, mit Freude übernahm.
Gerhard Fischer erzählt in diesem Buch nicht nur seine Geschichte, er erzählt vor allem die Geschichten der Menschen, die er getroffen hat. Er berichtet davon, wie die Menschen auf ihn gewirkt haben, wie die Kulturen auf ihn gewirkt haben. Der Witz, die Anekdote entsteht zumeist aus diesen verschiedenen Perspektiven, der des Lesers und der des Betroffenen. Normale alltägliche Dinger werden aus den zwei verschiedenen Perspektiven erlebt, dies macht den Reiz des Buches aus.
Gerhard Fischer hat in seinem bisherigen Leben als humanitärer Helfer sehr viel erlebt, viel Leid gesehen, viel Not gefühlt, viel Gefahr verspürt. Doch was in ihm geblieben ist, sind die Menschen, ihre Geschichten, ihr Lachen, ihre Freundschaft. Davon berichtet er in seinem Buch.
Um diese Geschichten so zu erleben, muss man sich ihnen öffnen. So wie Gerhard Fischer sich öffnete um diese Geschichten dieser Menschen in sein Herz und letztendlich auch in dieses Buch zu lassen, so muss sich der Leser dieses Büchleins auch beiden öffnen, dem Helden der Geschichten, wie auch dem Erzähler, denn nur wenn man beide Seiten versteht, ergibt sich einem der Sinn dieses Buches.
Gerhard Fischer ist aber sicherlich mehr als ein Geschichtenerzähler, er ist ein professioneller humanitärer Helfer, ein zuverlässiger Kollege und ein Rückhalt für viele Menschen in Not.
Ich wünsche ihnen liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich von den Geschichten in fremde Welten und Kulturen mitnehmen lassen und selbst in Not und Leid Platz für die Geschichten anderer finden.
Viel Spaß.
Dr. Michael Feit
Vorwort zu dieser Ausgabe
Liebe Leserin, lieber Leser,
stell dir vor, du würdest einen Freund nach langer Zeit wieder einmal besuchen. Von außen erkennst du das Haus sofort. Nachdem du aber hineingelassen wurdest, merkst du, dass sich einiges verändert hat. Der Flur, die Zimmeraufteilung - manche Wände wurden sogar durchgebrochen, um Räume zu verbinden – der Fußboden wurde erneuert, die Wände sind andersfarbig, hier stehen dir noch altbekannte Möbel, dort fehlen einige, dafür sind andere dazugekommen - irgendwie scheint alles anders zu sein, und trotzdem fühlt es sich vertraut an. Am Hintereingang fragt dich der Freund suggestiv: „Meinst du nicht, dass es jetzt lebenswerter erscheint?“ Ähnlich ist es mit dem vorliegenden Buch; es ist, meiner Meinung nach, noch lesenswerter.
Dessen erste Version hatte ich im Jahr 2019 veröffentlicht (in englischer Version unter dem Titel: ‚Disastrous encounters‘ im Jahr 2022 erschienen). Nachdem ich meine Auslandseinsätze für humanitäre Hilfsorganisationen endgültig beendet hatte, nahm ich mir vor, ein zweites zu schreiben, in welchem ich ausschließlich auf meine Arbeit detaillierter zurückblicken wollte – auch kritisch.
Die hatte ich zwar in den ‚Katastrophenbegegnungen‘ zumindest in einem Kapitel ansatzweise skizziert, aber eben nicht darüber hinaus. Zu meiner Zeit im Ausland gehörten auch die übrigen Anekdoten und Episoden. Daher wäre es logisch gewesen, beide Inhalte in einem Buch zu vereinen. Jedoch barg diese Überlegung die Gefahr, entweder in einer unübersichtlichen Vermischung unterzugehen oder, wie ich nach einem ersten Entwurf feststellen musste, dass die lustigeren Geschichten (Katastrophenbegegnungen) neben der ernsthafteren Darstellung meiner Tätigkeit wie ein Fremdkörper erschienen.
Deshalb beschloss ich, beide Teile wieder voneinander zu trennen. Damit der Titel - genauso wie die ‚Katastrophenbegegnungen‘ – doppeldeutig zu verstehen ist, habe ich das Buch mit dem Fokus auf die Arbeit ‚Katastrophenabschied‘ genannt. Denn, zum einen habe ich mich von den Katastrophen verabschiedet, die der Grund für meine jeweilige Entsendung gewesen sind, andererseits vollführte ich meinen allerletzten Abschied für mich in geradezu katastrophaler Weise, weil ich vorzeitig kündigte. Obendrein soll der Titel ein Hinweis auf die katastrophale Organisation, meinen damaligen Arbeitgeber, sein, wie ich sie empfand, und die keineswegs die einzige in meiner Karriere gewesen ist.
Beim Schreiben darüber fiel mir auf, dass ich unbewusst dazu neigte, auf Episoden aus den ‚Katastrophenbegegnungen‘ zurückzugreifen, manchmal sogar den identischen Wortlaut übernahm. Als ich mir dann in der Vorbereitung einer Lesung die ‚Katastrophenbegegnungen‘ nochmals genauer vorgenommen hatte, kam ich zu dem Schluss, sie erneut zu veröffentlichen, und zwar aus zwei wesentlichen Gründen.
Zuallererst wollte ich, wie ich es im ‚Katastrophenabschied‘ formulierte, die Geschichte zu Ende erzählen. Denn nach meinem Einsatz in der Türkei, währenddessen die ‚Katastrophenbegegnungen‘ erschienen waren, folgte ein weiterer in Georgien.
Außerdem gefiel mir jetzt der damalige Stil nicht mehr. Daher habe ich den Inhalt nahezu völlig entkernt, indem ich einige der ursprünglichen Kapitel entweder in andere einarbeitete oder komplett herausgenommen habe. Zudem habe ich ihnen neue Überschriften gegeben. Alle übrigen Abschnitte habe ich inhaltlich nochmals überarbeitet, zum Teil auch ergänzt. Und zwar dort, wo ich glaubte, näher erläutern zu müssen, wobei mir das eine oder andere zuvor unerwähnte Epi södchen wieder in den Sinn kam. Völlig neu geschrieben habe ich dagegen die Einleitung sowie das Schlusskapitel.
Letzteres entsprang der Aussage eines Lesers der ‚Katastrophenbegegnungen‘. In Anlehnung an den von dem Sportjournalisten Bruno Morawetz geäußerten, berühmt gewordenen Ausspruch: „Wo ist Behle?“, fragte mich ein Freund: „Wo sind die Menschen (in den Katastrophenbegegnungen)?“ Er hätte zwar sehr oft über all die Anekdoten und Episoden lachen müssen, trotzdem bedeute eine Begegnung doch in erster Linie, „dass man Menschen trifft“. Gerade die seien aber höchstens konturenhaft erwähnt.
Das habe ich mir zu Herzen genommen, sodass ich einige Personen inner- und außerhalb meines Arbeitsplatzes näher vorstelle, die mich in der einen oder anderen Art beeindruckt haben, und mir in besonderer Erinnerung geblieben sind.
Komplett verzichtet habe ich hier auf die Fotos aus den ‚Katastrophenbegegnungen‘, weil deren Qualität sehr zu wünschen übrigließ.
Insofern mag der Kenner auf den ersten Blick denken, es handele sich im Folgenden nur um einen kosmetischen Umbau. Ich, dagegen, würde es fast als Neufassung bezeichnen, die in etwa der Grundsanierung einer Wohnung entspricht, die man nach langer Zeit wieder besucht (revisited).
Hereinspaziert, überzeuge dich selbst!
November 2024
Gerhard Fischer
22 Jahre professionell – kurz und bündig
Der letzte Satz in den 2019 veröffentlichten ‚Katastrophenbegegnungen‘ lautete, „dass (…) ich weitere Katastrophenbegegnungen haben werde, ob im Ausland oder daheim.“ Dass sich diese damals floskelhafte Prophezeiung tatsächlich in einem solchen Ausmaß – nämlich in zweieinhalbfacher Hinsicht – bewahrheitete, hätte ich zugegebenermaßen damals nicht für möglich gehalten. Anderthalb von ihnen hebe ich mir für das Nachwort auf, da ich sie nach meiner Auslandstätigkeit hierzulande erlebte, während mir die dritte – chronologisch eigentlich die erste - noch im Ausland widerfahren war.
Irgendwie gleicht es einem Treppenwitz in meiner beruflichen Biografie, dass ich nach mehr als zwanzig Jahren ausgerechnet am 24. Februar 2022 meinen allerletzten Arbeitstag im Ausland im Bereich humanitäre Hilfe hatte; nämlich genau an dem Tag, als Russland seinen südlichen Nachbarn Ukraine völkerrechtswidrig überfiel und damit eine der größten Katastrophen der frühen 2020er Jahre auslöste, die kein Ende zu nehmen scheint.
Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass ich mich, nach meinem Dafürhalten, von jenem letzten Einsatz in katastrophaler Weise verabschiedete, indem ich vorzeitig meinen Vertrag kündigte, da ich meinen Arbeitgeber, eine auf Katastrophen spezialisierte Hilfsorganisation, als bei weitem katastrophalste im Vergleich zu allen vorherigen empfunden hatte – in der Tat eine Katastrophenbegegnung sondergleichen. Die Details darüber habe ich im ‚Katastrophenabschied‘ geschildert. Für den vorliegenden Zusammenhang soll die Erklärung genügen, dass ich die Reißleine aufgrund des Verhaltens des mir übergeordneten Managements zog, und nicht wegen der inhaltlichen Arbeit, und schon gar nicht wegen des georgischen Kontextes.
Nach wie vor genießen Hilfsorganisationen und das Arbeitsfeld humanitäre Hilfe im Ausland hierzulande großen Respekt. Schließlich tue man Gutes und vor allem Sinnvolles; ein Satz, den ich unzählige Male zu Hause von Freunden oder Bekannten zu hören bekam. Unter ihnen hatte ich jedenfalls ein Alleinstellungsmerkmal, womit ich stets nach einigen Augenblicken deren Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. Denn, meine Tätigkeit klang nach Abenteuer, klang nach Gefahr, und klang keineswegs nach einem Alltagstrott – eine nicht alltägliche Geschichte hatte ich immer auf Lager.
Ein Zyniker könnte behaupten, dass der Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren mein Glück war, weil dort meine spätere professionelle Karriere als Projektmanager im Bereich humanitäre Hilfe ihren Anfang genommen hatte. Er könnte sogar so weit gehen und behaupten, ich hätte mit der Not der Menschen meinen Lebensunterhalt verdient – in der „Mitleidsindustrie“, wie die Journalistin Linda Polman ein Buch betitelte.
Jedenfalls behauptete in Sri Lanka ein Deutscher, mit dem ich dort zusammenarbeitete, je länger man in diesem Geschäft tätig wäre, desto zynischer würde man werden. Was genau er damit meinte, verriet er mir nicht. Damals hätte ich ihm sarkastisch entgegnen können, dass er, der meinte, anderen Menschen zu helfen, zuerst einmal selbst Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Die hätte er nämlich bitter nötig gehabt.
Nicht nur, dass er ein schwieriger Charakter war, so wie er sich den lokalen Kollegen gegenüber benahm. Die galten für ihn genau genommen lediglich als Kofferträger. Sondern ich schien auch der einzige Ausländer inner- und außerhalb unserer Organisation gewesen zu sein, der sich gelegentlich mit ihm abgab. Vor allem bei Festlichkeiten am Abend, bei denen stets fast die gesamte Helfergemeinschaft anwesend war, suchte er meine Nähe, folgte mir auf Schritt und Tritt wie ein kleiner Hund, und war kaum abzuschütteln.
Andererseits lieferte er als Projektmanager eines, zugegeben, komplexen Vorhabens – die völlige Neuinstallation der Wasserversorgung in einer Kommune – über Monate keinerlei Ergeb-nisse. Dabei wäre es wegen der ständigen Verzögerungen (angeblich) seitens der lokalen Behörden gerade seine Aufgabe gewesen, diesen permanent auf den Füßen zu stehen. Stattdessen flüchtete er sich in die zweifelsohne zynische Aussage: „Die wollen unsere Hilfe offensichtlich gar nicht!“
Als ich später zusammen mit ihm zu einer Einweihung anlässlich der Beendigung eines Vorhabens in der Nachbargemeinde gewesen bin, versuchten tatsächlich einige Menschen aus ‚seinem‘ Projektort mit ihm über die Wasserleitungen ins Gespräch zu kommen. Er aber wich ihnen allen aus, indem er sich schnellstmöglich auf einen für die Honoratioren reservierten Stuhl setzte, an den sich die gemeinen Einwohner nicht herantrauten. In jenen Momenten gewann der Buchtitel ‚Hilfe, die Helfer kommen‘ eine ganz eigene Bedeutung für mich.
Dass nur er und ich von unserer Organisation zu der Feierlichkeit eingeladen worden waren, lag daran, dass ich der Teamleiter war, und er von einem lokalen Politiker explizit dazu gebeten worden war, weil die Menschen große Hoffnung in sein Projekt gesetzt hatten, und ihm damit eine besondere Wertschätzung vermitteln wollten. Die ganze Zeremonie glich fast einer Satire, zumal mein Kollege, der in den Ansprachen sogar stets als Mr. Soundso beim Namen genannt wurde, und sich entsprechend feiern ließ, obwohl es diesbezüglich gar nichts zu feiern gab. Die Ironie der Geschichte war, dass er sich kurz vor dem ersten Spatenstich für die Wasserleitungen aus dem Staub gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt war mein Einsatz längst beendet. Von ihm gehört habe ich nie wieder.
Warum erwähne ich diese Episode? Zum einen war es in meiner über zwanzig Jahre währenden Auslandstätigkeit das einzige Mal, dass jemand im Zusammenhang mit meiner Arbeit von Zynismus sprach. Den hatte ich keineswegs, wie von ihm behauptet, selbst bei langjährigen, in dem Bereich Tätigen je vernommen. Ganz im Gegenteil: ausnahmslos hatten sie nach wie vor den Willen zu helfen, ohne vom Helfersyndrom befallen gewesen zu sein. Zynismus könnte man allenfalls nach einer Katastrophe jenen Politikern vorwerfen, die großspurig in einer Geberkonferenz hohe Geldsummen versprechen, und sie hinterher dann doch nicht überweisen.
Darüber hinaus birgt die Begegnung mit ihm einige typische Gesichtspunkte der humanitären Arbeit, die sich wie ein roter Faden auch durch meine Karriere zogen, und die ich selbst, mal mehr, mal weniger nuanciert so wahrnahm.
Humanitäre Hilfe wird insbesondere von Hilfsorganisationen unmittelbar nach einer Naturkatastrophe oder einem bewaffneten Konflikt geleistet. Aufgrund der desaströsen Situation kann diese Unterstützung sogar Jahre dauern. Oft genug werden vor allem die internationalen Hilfswerke dann gar als alleiniger Heilsbringer gesehen, die sich den Problemen der Menschen annehmen, während den Politikern und Behörden vor Ort hinter vorgehaltener Hand kein großes Vertrauen geschenkt wird. Trotzdem ist man bei der Realisierung von Hilfsmaßnahmen auf sie angewiesen, sodass selbst vermeintlich einfache Verteilungen zu einem vertrackten Unterfangen werden können.
Dabei sollen die betroffenen Menschen eigentlich im Mittelpunkt stehen, und am Ende drücken sie gewöhnlich ihre Dankbarkeit auch mehr als herzlich aus. Bis dahin werden sie allerdings oftmals lediglich als Statisten gesehen, die bei der Projektplanung, außer bei der Bedarfsermittlung, keinerlei Rolle spielen. Dennoch muss man ihnen Rede und Antwort stehen, und wenn man dazu nicht in der Lage ist, sollte man sie wenigstens respektvoll behandeln.
Eines unserer Projekte in Sri Lanka war die Beschaffung und Verteilung von Fischerbooten an diejenigen, denen der Tsunami 2004 ihre Existenzgrundlage genommen hatte. Um sicherzustellen, dass wir die richtigen Boote beschafften, schlug ich vor, einige der Betroffenen sollten den dafür zuständigen Logistiker im Landesbüro in Colombo zu ausgewählten Lieferanten begleiten. Die Fischer waren begeistert und nahmen gerne die anstrengende achtstündige Autofahrt dorthin in Kauf.
Im Büro angekommen, ließ man sie allerdings erst einmal stundenlang warten und bei Dienstschluss wurde ihnen mitgeteilt, sie sollten am nächsten Tag wiederkommen, jetzt hätte man keine Zeit. Als wäre es für sie ein Leichtes gewesen, so einfach in der Fremde übernachten zu können. Offenbar, so erzählte mir einer von ihnen später, wären sie schüchtern dagesessen und von den herumlaufenden Ausländern mit Handy am Ohr zu beeindruckt gewesen – im Mittelpunkt sind sie jedenfalls nicht gestanden, sondern eher als Störenfriede der ach so wichtigen Arbeit betrachtet worden.
Weiterhin war die Episode ein Fingerzeig auf die Einstellung so manches Ausländers zu sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Kollegen vor Ort. Meistens kann er mangels Sprachkenntnisse gar nicht ohne sie agieren, und am Ende sind es ohnehin sie, die die eigentliche Arbeit verrichten. Wenn ich ihnen daher von Anfang an mit einer gewissen Arroganz begegne, ist vorauszusehen, dass die Kooperation hinterher alles andere als loyal vonstattengehen wird. Neben anderen Faktoren könnte das ein Grund gewesen sein, warum das Wasserprojekt des Deutschen nicht zum Laufen kam. Ich, jedenfalls, vermutete das ganz stark.
Im Hinblick auf sein Sozialverhalten war er schließlich einer der Wenigen, denen ich in all den Jahren begegnet bin, die vor Ort große Probleme hatten, sich zurechtzufinden. Man muss ja nicht gleich von Integration sprechen. Trotzdem musste ich, vor allem wenn ich als einziger Ausländer im Einsatz gewesen bin, selbst schauen, wie und mit wem ich meine Freizeit gestaltete. In den allermeisten Fällen waren es anfangs immer die lokalen Mitarbeiter, die mich zu sich nach Hause einluden, oder mich irgendwohin mitnahmen. Mir erleichterte das die Eingewöhnung ungemein. Dagegen hatte ich bei dem deutschen Kollegen den Eindruck, dass er sich gar nicht eingewöhnen wollte, und ich mich ohnehin fragte, wie und warum er überhaupt dazu kam, in dem Bereich zu arbeiten.
Ich selbst bin durch puren Zufall während meines Studiums dazu gekommen. Im Jahr 1994 hatte ich mich auf eine Zeitungsanzeige gemeldet, in der Freiwillige zur Arbeit in kroatischen Flüchtlingslagern gesucht wurden. Infolgedessen bin ich vor Ort zum ersten Mal mit dem Arbeitsbereich ‚Humanitäre Hilfe‘ in Berührung und zu der Überzeugung gekommen, meine berufliche Zukunft dort zu suchen.
Um den professionellen Einstieg schaffen zu können, schloss ich zunächst noch ein Aufbaustudium ‚Master in Humanitarian Assistance‘ ab und drei Wochen danach begann ich als Projektkoordinator in der Zentrale einer deutschen Hilfsorganisation.
Genau ein Jahr später erhielt ich dankenswerterweise die Gelegenheit, ein Projektbüro in Belgrad, der Hauptstadt der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien, heute Serbien, als dessen künftiger Leiter zu eröffnen, womit meine berufliche Auslandstätigkeit ihren Anfang nahm.
Nach einem Jahr dort war jedoch Schluss, da ich aus arbeitsrechtlichen Gründen keinen weiteren Vertrag bekommen hatte. Auch danach wurde ein stetig befristetes Arbeitsverhältnis zur Normalität für mich, sodass ich bis zum Schluss für sieben Hilfsorganisationen im Ausland tätig war. Die meisten von ihnen waren Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs; engl. NGOs); nur einmal war ich bei einer Regierungsorganisation angestellt. Darüber hinaus hatte ich mich zwischenzeitlich als selbstständiger Berater versucht, und Aufträge für sechs Hilfswerke durchgeführt. Insgesamt waren es aber viel zu wenige, um damit ein stabiles Auskommen bestreiten zu können.
Zähle ich die Freiwilligeneinsätze sowie das eine Jahr in Deutschland dazu habe ich in insgesamt fünfzehn Ländern gearbeitet. Im Kosovo war ich zweimal für denselben Arbeitgeber und in der Türkei ebenfalls zweimal, jedoch für zwei verschiedene.
Außerdem war ich in folgenden Staaten tätig (in alphabetischer Reihenfolge): Albanien, Armenien, Bosnien und Herzegowina (BiH), Georgien, Kroatien, Moldawien, Montenegro, Pakistan, Russland (Nordkaukasus), Sri Lanka und Tadschikistan. Obendrein führten mich Dienstreisen oder Workshops nach Nordmazedonien, Italien, Jordanien und Libanon.
Anders als einige Dozenten während des Aufbaustudiums bin ich allerdings nie als ‚Ersthelfer‘ unmittelbar nach einer Katastrophe entsendet worden. Ich kam immer erst dann, nachdem sich die Lage merklich beruhigt hatte – fragil ist sie trotzdem stets gewesen und geblieben.
Die Auslöser für meine Einsätze waren entweder zurückliegende Kriege, wie etwa im Kosovo, der laufende in Syrien, als ich in der Türkei war, der verheerende Tsunami 2004 in Sri Lanka oder schlicht und ergreifend grassierende Armut. Wenn es sich wie bei der Türkei oder Sri Lanka gemeinhin um Urlaubsziele handelte, so war mein Standort dort alles andere als das. Hingegen glichen sich alle, da ich nirgends die Landessprache konnte, abgesehen von meinen Kenntnissen des Serbo-Kroatischen, das immerhin zu etwas mehr als bloßem Smalltalk ausreichte. Ansonsten verständigten wir uns in den Büros ausschließlich auf Englisch.
So wie ich in Belgrad als Büro- und Projektleiter seinerzeit startete, beendete ich auch meinen Einsatz in Georgien. Dort hieß meine Position jedoch Teamleiter. Anderswo wurde ich als Head of Mission bezeichnet, und nur einmal explizit als Projektmanager. Das Budget jenes Vorhabens in Höhe von etwa fünfunddreißig Millionen Euro erreichten alle anderen zusammengenommen nicht annähernd. Neben der finanziellen beinhaltete meine Verantwortung darüber hinaus das Personal und die Verwaltung der Maßnahmen.
Diese summierten sich auf über 150, für die ich verantwortlich zeichnete. Deren Bandbreite reichte von Hilfsgüterverteilungen, über Wiederaufbauprojekte (besonders in Sri Lanka), der Organisation verschiedenster Fortbildungen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bis hin zur komplexen Ausarbeitung einer Ausschreibung im Kosovo im Bereich Community Development. Obendrein galt es überall entweder Prozesse für die Implementierung zu entwickeln, anzupassen oder zu verbessern, sodass ich neben dem Projektmanagement noch vielseitige Kenntnisse im Hinblick auf Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement erworben habe. Deshalb bezeichne ich mich heute als Managementallrounder.
Dass der Arbeitsbereich humanitäre Hilfe im Vergleich zu anderen ein ausgefallenerer ist, verdeutlicht die mitunter sehr hohe Aufmerksamkeit in den Medien. Dort wird unmittelbar aus Katastrophengebieten berichtet, während laufender Hilfsmaßnahmen sowie nicht selten danach, wenn Journalisten vor Ort reisen, um herauszufinden, was tatsächlich mit den Geldern geschehen ist. Andersherum benutzen Hilfsorganisationen alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel, um zum einen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zur Akquise auf sich zu ziehen, und, zum anderen, der Pflicht des Geldgebers dazu nachzukommen, denn der möchte natürlich ebenfalls, dass der Steuerzahler sieht, wohin seine Abgaben unter anderem geflossen sind.
In der Praxis erhielt ich deswegen sehr oft Anfragen oder verfasste selbst Pressemitteilungen vor allem dann, wenn wir entweder ein neues Projekt starteten oder eines beendet war. Infolgedessen wurde ich besonders in den ersten beiden Einsätzen, in Serbien und Montenegro, sehr häufig interviewt, in Serbien sogar einmal im landesweit ausgestrahlten Morgenmagazin.
In der Anfangszeit ist es mir zweimal gelungen, den Medien in gewisser Weise ein Schnippchen zu schlagen. Das erste Mal war kurz nach dem zweiten Erdbeben in der Türkei im November 1999. Die bereits zuvor terminierte mehrtägige Dienstreise dorthin als zuständiger Koordinator in der Zentrale entwickelte sich zu einem zweimonatigen Dauereinsatz als selbsternannter Logistiker. Zum vereinbarten Radiointerview per Satellitentelefon am Tag meiner Ankunft in Istanbul konnten wir das Epizentrum, etwa zweihundertvierzig Kilometer östlich davon, nicht rechtzeitig erreichen, sodass ich die Fragen der Moderatorin irgendwo im nirgendwo beantwortete, indem ich meiner Fantasie freien Lauf ließ und ein Bild zeichnete, dass sich hinterher als keineswegs so dramatisch herausstellte, wie ich es beschrieben hatte.
Später in Montenegro wollte der stadtbekannte Reporter nicht – wir nannten ihn nur „Whiskey-Journalist“ (warum wohl?) –, dass ich in den von mir verfassten Pressemitteilungen lokale Honoratioren und deren Meinung über unsere Projekte zitierte. Ihn interessiere doch nicht die Ansicht von Menschen, die er kenne. Vielmehr wolle er meine Auffassung hören. Mein Geschriebenes wurde anschließend stets Wort für Wort gedruckt, worin es dann immer hieß, „Herr Fischer, der Projektleiter, ist besonders angetan von dieser Maßnahme…“ und dergleichen. Für uns war das zwar sehr positiv, allerdings war es nach meinem Dafürhalten eine eigentümliche Auslegung von unabhängigem Journalismus.
So häufig wie damals hatte ich später nie mehr persönlichen Kontakt mit Medienvertretern. In der Türkei, bei meinem zweiten Einsatz, war es sogar so, dass wir keinerlei Informationen herausgaben – selbst innerhalb unserer Organisation, und zwar aus gutem Grund. Unsere Maßnahmen in Syrien wollten wir keinesfalls aufs Spiel setzen, sodass es prinzipiell eine sogenannte ‚No-visibility-Policy‘ gab. Das bedeutete, dass wir weder Werbung dafür machten noch beispielsweise unser Logo irgendwo sehen wollten. Zu groß wurde die Gefahr angesehen, dass nach außen dringende Berichte einen negativen Einfluss auf unsere Arbeit haben konnten, womöglich sogar Menschenleben in unserem Zielgebiet in Gefahr brachten.
Neben dem hohen Medieninteresse war vor allem der Aspekt Sicherheit in allen Auslandseinsätzen von besonderer Wichtigkeit, in manchen Ländern sogar oberste Priorität. Im Nordkaukasus gab es deswegen sehr strikt geregelte Ausgangssperren; außerhalb des Büros durften wir Ausländer uns auch nur in Begleitung von bewaffneten Bodyguards bewegen. Dagegen schwelte der ethnische Konflikt in Sri Lanka weitestgehend im Hintergrund unserer Aktivitäten, führte aber dazu, dass wir dort ebenfalls strenge Regularien innerhalb der Organisation hatten.
Da die meisten anderen Hilfsorganisationen in beiden Fällen gleichermaßen davon betroffen waren, schloss uns das fest zusammen, ich kann fast sagen, wir wurden eine verschworene Gemeinschaft. Neben den offiziellen Koordinationsmeetings trafen wir uns am Abend zum Essen, Feiern, Sport treiben oder am Wochenende zu gemeinsamen Ausflügen. Ein Anlass ließ sich immer finden.
In späteren Einsätzen hatte ich solche Gelegenheiten, wenn überhaupt, nur noch vereinzelt zusammen mit anderen Internationalen erlebt – kurioserweise gerade in Ländern und Kontexten, in denen ich mich frei bewegen konnte, und wo es so gut wie keine Sicherheitsbeschränkungen gab. Das lag daran, dass meine Verantwortung im Hinblick auf die Hilfsmaßnahmen zunehmend wuchs, mehr aber an schlichter Trägheit meinerseits, oder anders gesagt, mein persönliches Paradoxon: je mehr Spaß ich abseits der Arbeit hätte haben können, desto mehr schien ich diesen gerade darin gefunden zu haben. Dabei wusste ich, und meine Erfahrung vor allem in Serbien hatte es mir gezeigt, dass ich, um nicht vom Arbeitsalltag komplett aufgesogen zu werden, ich unbedingt einen notwendigen Ausgleich außerhalb des Büros benötigte.
Damals, wie auch beim ersten Einsatz im Kosovo, hatte ich ein Zimmer im Büro. Tagsüber waren wir im Lande unterwegs, sodass ich abends oder am Wochenende die liegengebliebene Büroarbeit so schnell wie möglich erledigen musste. Zumindest war es in der Anfangszeit meine Auffassung von Pflichtgefühl vor allem der Zentrale gegenüber. Mit der Zeit lernte ich aber, dass oftmals deren Pflichtbewusstsein genau bis zum täglichen Büroschluss reichte, von Freitagnachmittag gar nicht zu reden. Und wenn von mir unverzüglich Informationen oder Ähnliches verlangt wurden, geschah es andersherum häufig genug allenfalls im Schneckentempo.
Wohingegen diejenigen, die dort äußerst engagiert waren, und bisweilen sofort antworteten, offenbar davon ausgingen, dass humanitärer Auslandseinsatz automatisch permanente Verfügbarkeit bedeutete. In der Praxis wurde ich manchmal daher, wie selbstverständlich nach meinem Feierabend kontaktiert oder, besonders während wir von dort Besuch bekamen, wollte der eine oder andere Einblicke in mein Privatleben bzw. meine Wohnung vor Ort gewinnen, wo dann allerdings spätestens – bei aller Liebe – meine kollegiale Hilfsbereitschaft endete.
Dagegen waren die meisten meiner lokalen Mitarbeiter voll im Bilde, was meine Umstände oder Beschäftigungen in meiner Freizeit betrafen. Viele von ihnen hatten mich ohnehin anfangs sprichwörtlich an die Hand genommen, um mir die Akklimatisierung in die für mich neue Umgebung zu erleichtern. Zum Teil haben sich daraus Freundschaften entwickelt, die ich noch heute, wenn auch nur sporadisch fernmündlich pflege.
Während unserer Zusammenarbeit haben sie mir jedenfalls viele unterschiedliche Einblicke gewährt, die, zum Beispiel im Hinblick auf und für meine interkulturelle Kompetenz nicht nur sehr wertvoll waren, sondern die eben auch bisweilen diesbezügliche Unterschiede, besonders, was den Geschmack betraf, unweigerlich offenbarten. Als mich meine Freundin einmal vor Ort besuchte - wo genau, verschweige ich hier lieber - bekam sie als Gastgeschenk von der Frau eines Mitarbeiters mintgrünglänzende Unterwäsche (!), sehr wahrscheinlich chinesischer Herkunft, überreicht, die dort möglicherweise als etwas Besonderes angesehen wurde, bei uns dagegen eigentümliche Überraschung hervorrief und daheim in der Mülltonne landete.
Die Vielschichtigkeit von verschiedenartigen Wahrnehmungen solcherart war ohnehin ein Grundmotiv aller meiner Katastrophenbegegnungen in jeder erdenklichen Hinsicht. Innerhalb des Büros bedurfte es stets einer gewissen Zeit, bis ich mich auf die Mentalitäten oder Arbeitsweisen einstellen konnte bzw. musste. Aber selbst dann blieben, aus meiner Sicht, die jeweiligen Perspektiven oftmals eine Kröte, die nur schwer zu schlucken war. Es gab Aufgaben, die ich Mitarbeitern übertrug, die jedoch grenzüberschreitend mit ganz wenigen Ausnahmen dieselben Reaktionen zur Folge hatten. Egal wo ich Mitarbeitern auftrug, zum Beispiel ein Dokument genau zu lesen oder einen Text zu korrigieren, dann war klar, dass die meisten es nicht taten. Und wenn, dann geschah es so oberflächlich, dass ich es besser selbst erledigte. Das Gros von ihnen sah sich eher als Machertypen, wozu bloßes Lesen eindeutig nicht zu gehören schien. In der Folge erntete ich von ihnen stets ein verschmitztes Lächeln, wenn es um gedankliche Aufgaben ging, und das bloße Hochhalten eines Dokuments von mir wurde fast überall zum Running Gag.
Einmal musste ich dann aber doch über die Kollegen laut lachen. In Inguschetien war unser großangelegtes, von ECHO finanziertes Verteilungsprojekt kurz vor dem Ende. ECHO war damals das Büro für humanitäre Angelegenheiten der EU. Die Folgephase war bereits bewilligt, jedoch mussten wir, der Form halber, die Mitarbeiter zunächst offiziell entlassen, wobei klar war, dass sie nachher wieder für die gleiche Position eingestellt würden.
Am Tag, als sie ihren letzten Lohn – stets in bar – bekamen, legte ich deshalb jedem Einzelnen die Kündigung vor, betonte, er solle das Schreiben aufmerksam lesen und unterschreiben. Selbstverständlich nahm sich keiner die Mühe, genauer hinzuschauen. Stattdessen gingen sie freudig lächelnd runter ins Erdgeschoss, und als unsere Verwaltungskraft sie sah, meinte sie: „Dafür, dass ihr eben eure Entlassung erfahren habt, seid ihr überraschenderweise frohen Mutes!“ Sofort kam einer nach dem anderen mit versteinerter Miene zurück. Nachdem ich sie nochmals aufgeklärt hatte, zogen sie erleichtert ab.
Ähnliche lustige oder skurrile Momente erlebte ich in allen Einsätzen innerhalb des Büros im Rahmen der Arbeit, aber auch abseits davon.
Und genau von diesen möchte ich im Folgenden erzählen. Wenn sich auch die Länder und Kontexte zum Teil spürbar unterschieden, so gab es doch immer wiederkehrende Aspekte, denen ich begegnet bin: angefangen bei den fremdartigen Kulturen und Traditionen, meinen diversen Unterkünften sowie Ämtern und Handwerkern. Obendrein fand ich mich hie und da in Gefahrensituationen wieder, die Ausdruck des fragilen Hintergrunds der Arbeit waren, und denen zu Hause stets am aufmerksamsten zugehört wurde.
Trotzdem gab es auch ein Leben nach Büroschluss, sodass ich auch während meiner Freizeitgestaltung, die eine oder andere Überraschung erfuhr. Im Vorwort 2019 hatte Michael Feit zwar davon gesprochen, dass ich die Geschichten der Menschen erzähle, einigen von ihnen habe ich jetzt noch größeren Raum gegeben. Ausnahmslos alle waren bemerkenswert. Denn es waren Begegnungen in der Katastrophe ohne wirkliche Katastrophenbegegnungen gewesen zu sein.
1 Fremde Kulturen – Andere Länder, andere Sitten
Zu den vielen Freiwilligeneinsätzen in Kroatien und BiH zwischen 1994 und 1997 bin ich ausnahmslos immer mit der damaligen Eurobuslinie, meistens von Mannheim bis Split gefahren. Beim Blick aus dem Fenster während der Reise nahm ich vor allem nach jeder Grenzüberquerung gewisse Veränderungen wahr. In Österreich waren es andersfarbige Verkehrsschilder, in Slowenien anderssprachige, und je südlicher es ging, desto ärmlicher war mein Eindruck beim Anblick der Gebäude. Direkt nach der slowenisch-kroatischen Grenze empfand ich den Unterschied noch gravierender, und in BiH fehlten meistens Schilder oder sie waren von Kugeln durchlöchert, ganz zu schweigen von den vielen Kriegsruinen. Abgesehen davon, war deren städtebauliche Anordnung völlig anders als bei uns. Dass es sich um mir fremde Kulturkreise handelte, merkte ich spätestens anhand der vielen Moscheen oder, wie später in Sri Lanka, den zahlreichen buddhistischen Tempeln.
Bei den Menschen auf den Straßen konnte ich das äußerlich am ehesten an der Kleidung erkennen; anderswo an der Hautfarbe. Die mir überall fremde Sprache ließ nicht sofort auf eine andere Kultur schließen, genauso wie Gesten oder Mimik. Erkennbar wurde es erst, davon bin ich auch heute noch überzeugt, wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet. Dann erst wird der Ausländer nach und nach feststellen, wie die Menschen ticken, wie sie miteinander umgehen und mit welchen Traditionen sie behaftet sind.
Wenn daher ein Tourist nach seinem Urlaub vollmundig meint, er hätte viele Einblicke in eine fremde Kultur bekommen, dann hege ich starke Zweifel, weil es sich in den allermeisten Fällen wohl nur um folkloristisches Theater handelte, das dem ahnungslosen Gast vorgegaukelt wurde. Selbst wenn man Kontakt zu Ottonormal-Einheimischen hatte, meinen viele, vorher vorhandene Stereotypen bestätigt vorgefunden zu haben und die nachher oft genug mittels Stammtischplattitüden verbreitet werden: „Die schaffen doch nix!“; „Alles Gauner!“; „Bei denen ist es dreckig und vor allem so laut!“; „Und wie teuer es dort erst ist!“; „Die fahren alle Super-Autos“; „So schlecht kann es denen doch gar nicht gehen!“; aber auch: „Bei denen wird Tradition noch gepflegt“; „Was für schöne Trachtenkostüme die anhaben!“
Andersherum eilten die oft uns Deutschen zugesprochenen Eigenschaften, wie Pünktlichkeit, Direktheit und Fleiß ihrem Ruf weit voraus. Einmal machte mein Arbeitskollege in Montenegro seinem Vater schwere Vorwürfe, dass er in den 1970er Jahren nach nur wenigen Jahren als Gastarbeiter bei uns, plötzlich wieder in die Heimat zurückgekehrt sei. Jetzt könnte die ganze Familie ein „so“ gutes Leben in Deutschland führen. Darauf antwortete der Vater, sein Sohn wisse ja gar nicht, wie es dort zugehen würde: immer nur arbeiten und selbst für ein Tässchen Kaffee sei keine Zeit gewesen. Da sei er lieber wieder ins Land seiner Väter zurückgekehrt, um es etwas ruhiger zu haben. Als ihm sein Sohn dann mitteilte, dass sein neuer Chef ein Deutscher sein werde, gemeint war ich, hätte der Vater „Oh Gott“ aufgeschrien!
Gelegentlich hörte ich im Kosovo von meinen Mitarbeitern, ich würde mich typisch Deutsch verhalten. Worauf jene Aussagen basierten, war mir nie ganz klar geworden. Nur einmal, als ich eine Kollegin fragte, ob sie eine bestimmte Aufgabe erledigen könne, ich also ein klares Ja oder Nein erwartete, antwortete sie lediglich, das sei jetzt aber eine typisch deutsche Frage; weil sie so direkt war.
Denn, ähnlich wie man es aus asiatischen Ländern kennt, lavieren die Kosovaren gewöhnlich herum. Vor allem dann, wenn man keine Antwort auf eine Frage hat, sagt man eben irgendetwas, um das Gesicht nicht zu verlieren. Wenn dann noch die typische Kopfbewegung hinzukommt, nämlich im Gegensatz zu uns: bei Zustimmung ein angedeutetes Kopfschütteln, während Nicken eher einer Verneinung entspricht, ist die Verwirrung ganz perfekt.
Fast noch witziger waren allerdings die Äußerlichkeiten, mit denen vorübergehend heimgekehrte Gastarbeiter das angeblich ‚typische‘ Deutschsein zur Schau stellten, vor allem, da sie, meines Wissens, gar nicht existieren. Die schlenderten in karierten Dreiviertelhosen mit einem Energy-Drink in der Hand durch die Straßen und belehrten ihre Landsleute, in Deutschland würde das jeder deutsche Mann tun! Abends fuhren dann jene Heimkehrer in flotten Schlitten die Straßen rauf und runter, meistens mit aufgedrehter Musik, um den Daheimgebliebenen zu signalisieren, man hätte es im Ausland zu etwas gebracht. Laut einem meiner Kollegen, der früher selbst in Deutschland gearbeitet hatte, waren die meisten ausgeliehen und er fügte hinzu: Ein Audi riecht nach Kredit, ein Mercedes nach Mafia!
Ein weiterer, vermutlich der eigentliche Grund für das Auf- und Abgefahre dürfte gewesen sein, dass die Männer, ähnlich wie im Tierreich das Balzgehabe, mit den dicken Autos versuchten, besonders junge Frauen zu beeindrucken und als künftige Braut gewinnen zu können. Das kennt man ja auch bei uns, dürfte daher wohl nicht gerade als eine kulturelle Eigenheit gewertet werden. Eigen war allenfalls die orientalisch klingende Musik, aber auch die hört man bei uns ja zunehmend.
Im Norden Montenegros, in unserer Projektregion, bot ein alljährlich über die Landesgrenzen hinaus berühmtes Fest auf einem Berg ein in diesem Sinne besonderes Schauspiel, wozu kurzfristig heimgekehrte Gastarbeiter aus aller Herren Ländern extra anreisten. Dort konnten mein Kollege und ich – er nannte das Spektakel den offiziellen Heiratsmarkt – die jungen Burschen zwar nicht in den karierten Hosen beobachten, allerdings herausgeputzt mit ständigem Blick auf vorbeigehende junge Damen gerichtet, die sich ebenfalls in festlicher Montur präsentierten, wohlwissend ihrer ihnen zugeschriebenen Rolle. Ein kurzes Nicken hier, ein angedeutetes Augenzwinkern dort. Man hätte auf den ersten Blick meinen können, es handelte sich um Begrüßungsriten, in Wahrheit waren es ‚versteckte‘ und doch eindeutige Signale. Wir amüsierten uns köstlich über die ganze Szenerie.
Alles andere als amüsant empfand ich gelegentliche Begrüßungen von jungen Männern in der dortigen Region, die mir „Heil Hitler!“ zuriefen. Womöglich wollten sie mir dadurch zu verstehen geben – mich vielleicht sogar damit beeindrucken – sie wüssten, woher ich käme. Welche Reaktion die Worte bei mir auslöste, verstanden sie nicht, erst recht hatten sie sicherlich keine fundierten, historischen Kenntnisse.
Die bewies dagegen ein junger Politikwissenschaftler und Jurist in Pakistan, dem ich neugierig zuhörte. Sein spezielles Steckenpferd sei Militärgeschichte (!), und ganz besonders die deutsche. Wie wir in Deutschland etwa mit Kriegshelden à la Rommel, dem Wüstenfuchs des Zweiten Weltkrieges, umgingen? Ob ihm oder anderen zu Ehren Denkmäler errichtet wurden und werden und ob sie auch heutzutage noch eine wie auch immer geartete Rolle spielen würden? Er selbst sei nie in Europa oder Deutschland gewesen, würde aber gerne einmal vor allem die Kriegsschauplätze besuchen, da sie ihn faszinieren würden.
Zwar unterhielten wir uns recht anregend, allerdings gehörte das von ihm angeschlagene Thema nicht gerade zu meinen Spezialgebieten und allzu beeindruckt dürfte er deshalb auch nicht von meinen spärlichen Antworten gewesen sein. Eine Frage hätte er noch, die ihm auf den Nägeln brennen würde: warum hätte sich nach dem Sieg über Frankreich 1870/71 das Deutsche Reich lediglich Elsass und Lothringen und nicht gleich ganz Frankreich einverleibt! Da hatte er mich als Historiker und Kriegsdienstverweigerer eindeutig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich entgegnete ihm nur lapidar, dass es sicherlich brennendere aktuelle Probleme gäbe, die ihn interessieren sollten. Er ließ aber nicht locker und erwähnte obendrein eine vermeintliche sporthistorische Begebenheit, die mir dort interessanterweise unabhängig voneinander von mehreren Personen bereits zugetragen worden war.
Als ich eines Abends in den Speiseraum meines kleinen Hotels in Islamabad ging, saßen ausnahmslos alle Angestellten gebannt vor dem Fernseher und verfolgten das Prestige Duell zwischen Pakistan und Indien im Cricket. Sofort standen alle auf, um sich zurückzuziehen, woraufhin ich ihnen zu verstehen gab, dass mich ihre Anwesenheit keineswegs störe, da mich das Match ohnehin nur langweilen würde. Abgesehen davon, dass das Spiel mitunter fünf Tage lang dauern könne, hätte ich keine Ahnung von den Regeln und überhaupt sei es doch eine eher eine Randsportart, die in Deutschland mehr oder weniger unbekannt sei. Völlig verdutzt reagierten die Anwesenden, besonders angesichts meines Hinweises, dass die Sportart bei uns weitgehend unbeachtet sei. Wie das denn sein könne, kam es fast unisono, da in Pakistan folgende Geschichte kursiere: in der Vergangenheit, und zwar zu Zeiten Hitlers, hätte die deutsche gegen die pakistanische Cricket-National-mannschaft verloren und hinterher seien alle deutschen Spieler wegen der erlittenen Schmach standrechtlich erschossen worden! Davon hätte ich vorher noch nie gehört, und könne es nicht glauben. „Ja“, „Doch“, „Ganz sicher, so war es!“ schmetterten sie mir entgegen, was ich nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nahm.
In Wirklichkeit dürfte es sich um das sogenannte Todesspiel aus dem Jahr 1942 gehandelt haben, dessen Hintergründe mittlerweile widerlegt zu sein scheinen. Damals hatte eine Betriebsmannschaft in Kiew gegen die der deutschen Flugabwehr Fußball gespielt und 5:3 gewonnen. Hinterher sei die Siegermannschaft von der SS umgebracht worden.
Als wäre es mir auf der Stirn eingebrannt gewesen, wurde ich vor allem in Osteuropa und der Türkei fast immer sofort von mir Unbekannten als Deutscher erkannt oder angesprochen. „Sie kommen aus Deutschland, oder?“ und „Hey, Deutscher!“ hieß es dann sehr häufig. Darüber hinaus meinten viele lokale Kollegen, ich sei typisch Deutsch, andere wiederum, ich sei völlig untypisch für einen Deutschen. Dass ich als solcher identifiziert wurde, führte ich damals in erster Linie darauf zurück, weil ich eine Brille trug. Auffallend war für mich nämlich, dass ich dort vergleichsweise sehr wenige Menschen damit sah. Meine nuanciert andere Kleidung konnte es jedenfalls nicht sein. Erst mit der Zeit lernte ich, dass es auch meine Gesichtszüge sein mussten, weshalb ich heutzutage selbst in der Lage bin – zwar nicht immer, aber sehr oft – mir unbekannte Personen nach Osteuropa verorten zu können.
In Serbien wurden mir, zu meiner Überraschung, dank meiner Sprachkenntnisse (oder auch nicht?) dreimal kurz hintereinander sogar ganz andere Staatsbürgerschaften angedichtet.
Zunächst in einem Restaurant, welches gerade auf der anderen Straßenseite unseres Büros im Zentrum Belgrads lag und wo ich ziemlich häufig aß. Der mir bereits bekannte Ober gab mir eines Tages die Karte in kyrillischer Schrift, woraufhin ich ihn bat, mir die englische zu geben. Denn ich könne jene in meinen Händen nicht lesen. Völlig verwundert antwortete er: „Wie, du als Russe verstehst die Karte nicht!“ Ich hatte die Karte auf Serbisch bestellt und warum er mich mit einem Mal zum Russen deklarierte, konnte ich, nun selbst völlig verdutzt, überhaupt nicht einordnen. Sollte ich das etwa als Kompliment auffassen?
Wenig später hatte ich mir wie üblich ein Taxi genommen, um zu einem Termin innerhalb der Stadt zu fahren. Wie so oft hatte ich dem Fahrer mein Fahrziel nicht mitgeteilt, da nach meiner Erfahrung nur die wenigsten tatsächlich detaillierte Ortskenntnisse hatten. Deshalb informierte ich ihn, dass ich den Weg wüsste, er solle einfach meinen Anweisungen folgen. So kamen wir ins Gespräch und der Fahrer fragte mich, woher ich denn käme; Ausland war ja klar, aber nicht aus welchem Land. Meiner Frage, was er denn raten würde, entgegnete er bestimmt „Frankreich“! Wie er denn ausgerechnet darauf käme? Mein serbischer Akzent wäre eben typisch für einen Franzosen, woraufhin ich lauthals zu lachen anfing. Mir gegenüber hatten Einheimische bereits damals und auch später immer wieder behauptet, ich hätte einen sehr guten Akzent, worauf wohl meine Fähigkeit, das rollende ‚R‘ auszusprechen, hindeutete.
Kurioserweise erlebte ich bei der späteren Rückfahrt in einem anderen Taxi ein Déjà-vu. Denn wie zuvor plauderte ich mit dem Chauffeur. Diesmal stempelte er mich zum Ungar wegen meiner dafür typischen Aussprache. Danach ging ich dazu über, die Frage nach meinem Herkunftsland mit ‚Europäer‘ zu beantworten. Falsch lag ich damit jedenfalls nicht.
Apropos Taxi: nachdem ich bereits monatelang in Belgrad gewesen war und viele Male per Taxi in der Stadt Termine wahrgenommen hatte, bat ich den Fahrer wie üblich am Ende um eine Rechnung. Zwar gab es einen Taxameter, allerdings fragte so gut wie jeder, welchen Betrag er auf den Beleg schreiben solle. Daraufhin sagte ich stets, er solle jenen notieren, der angezeigt sei. Die Fahrer hatten dies immer mit einem grummelnden oder entgeisterten bis hin zu völlig aufbrausenden: „Wie bitte?“, quittiert, was wiederum mich zunächst immer wieder verwirrte. Dass man auf eine solche normale Anweisung derartig erstaunt oder überrascht zu reagieren schien, hielt ich eben für eine kulturelle Eigenheit. Bis zu jenem Tag, an dem mich einer aufklärte. Auf Serbisch heißt schreiben pišati und die Befehlsform pišate, so nahm ich zumindest an. Deshalb sagte ich immer pišate. Allerdings ist die richtige Befehlsform pišete. Demzufolge hatte ich zuvor den Fahrer stets aufgefordert den Betrag zu pinkeln!