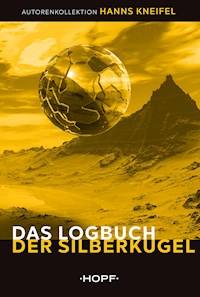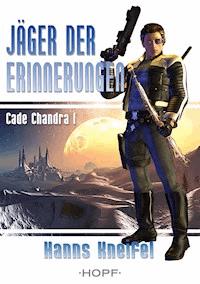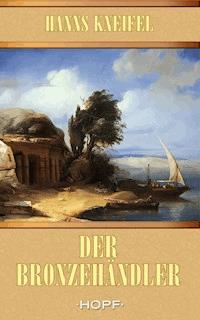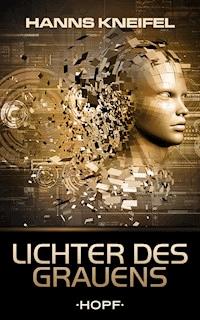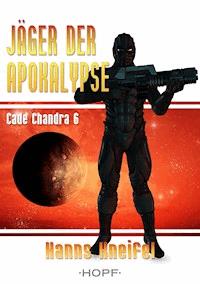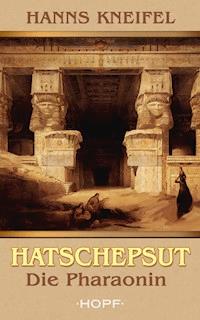Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Peter Hopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Frau des Großfürsten und Thronfolgers Pjotr III. lebt Jekaterina am Hof der Zarin Elisabeth in St. Petersburg wie in einem prunkvollen, goldenen Gefängnis. Ihr Mann wird von Jahr zu Jahr wunderlicher, inszeniert im Bett mit seinen Spielzeugsoldaten heroische Schlachten, statt sich für die weiblichen Reize Jekaterinas zu interessieren und versucht mit seiner neuen Mätresse seine eigene Frau zu verdrängen. Doch Jekaterina ist zäh. In ihren einsamen Stunden liest sie Voltaire, Montesquieu und Tacitus und lernt Russisch. Denn sie hat ein großes Ziel vor Augen: Eines Tages wird sie Zarin werden! Als Elisabeth 1762 das Zepter aus der Hand gibt, stürzt Jekaterina ihren Mann Pjotr vom Thron und lässt sich als Alleinherrscherin vom Volk bestätigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KATHARINA
ZARIN VON RUSSLAND
© Copyright Erben Hanns Kneifel
© Copyright 2016 der eBook-Ausgabe bei Verlag Peter Hopf, Petershagen
www.verlag-peter-hopf.de
Covergestaltung: Thomas Knip, nach einem Gemälde von Fyodor Rokotov
ISBN ePub 978-3-86305-224-9
Folgen Sie uns für aktuelle News auf Facebook.
Alle Rechte vorbehalten
Die in diesem Roman geschilderten Ereignisse sind rein fiktiv.
Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Begebenheiten, mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Das Buch
Als Frau des Großfürsten und Thronfolgers Pjotr III. lebt Jekaterina am Hof der Zarin Elisabeth in St. Petersburg wie in einem prunkvollen, goldenen Gefängnis. Ihr Mann wird von Jahr zu Jahr wunderlicher, inszeniert im Bett mit seinen Spielzeugsoldaten heroische Schlachten, statt sich für die weiblichen Reize Jekaterinas zu interessieren und versucht mit seiner neuen Mätresse seine eigene Frau zu verdrängen. Doch Jekaterina ist zäh. In ihren einsamen Stunden liest sie Voltaire, Montesquieu und Tacitus und lernt Russisch. Denn sie hat ein großes Ziel vor Augen: Eines Tages wird sie Zarin werden!
Der Autor
Hanns Kneifel
KATHARINA - ZARIN VON RUSSLAND
Historischer Roman
1 - Der letzte November
5. (16). November 1796, morgens acht Uhr dreißig. Wieder kroch ein sonnenloser Morgen herauf, wieder begann ein grauer Novembertag, der fünfte dieses kalten Monats. Eine Nebelschicht, aus der reglos kahle Bäume und blattloses Buschwerk hervorragten, lag über dem Schnee, bis hinunter zum Meer. Die Fundamente der Häuser schienen in einem gefrorenen See zu stehen. Die Sonne blieb eine Welle ein glimmender Fleck am Horizont, bis das Grau aufriss; vor dem Streifen leuchtend blauen Himmels streckten sich waagrechte Schatten bis zu den Mauern des Winterpalasts von Zarskoje Selo. Ein einzigartiges Licht fiel über den Ort, eine kurze, irisierende Helligkeit, wie der Regenbogen aus geheimnisvollen Farben und Empfindungen zusammengesetzt. Die Eiszapfen an den Schlagläden begannen zu glänzen, als schmölze sie warmer Wind. Das Licht zeichnete Streifenmuster in die Vorhänge und auf die Bespannung der Wand. Die Helligkeit teilte die Bilder in spiegelnde und matte Hälften und schuf jähen Glanz auf dem Gold und Silber der Rahmen und der Leuchter. Der Tag begann still, kaum war das Ticken der Uhr zu hören. Jekaterina hob, noch halb im Schlaf, die Hand an die Augen und verließ widerwillig die Leichtigkeit des Traums und dessen Sinnlichkeit, die er auch heute in der Stunde vor dem Erwachen geweckt hatte.
Die Bespannung unter dem Laken knarrte in der Ruhe des Schlafgemachs. Ein Rest Wärme und die gewohnten Schlafgerüche hatten sich zwischen den Vorhängen und dem Baldachin des Betts gesammelt. Es roch nach kaltem Rauch. Jekaterina öffnete die Augen, blinzelte und versuchte sich an den Traum des tiefen, langen Schlafs zu entsinnen. Eine fröhliche Plauderei war darin vorgekommen, der schweißnasse Körper eines jungen, gesichtslosen Mannes, der über ihr zuckte, und sie entsann sich seines Keuchens und einer riesigen weißen Fläche, auf der sie mit kratzender Goldfeder geschrieben hatte. Sie erinnerte sich weder an den Inhalt noch an den Empfänger ihres Traumbriefs, aber sie lächelte. Als sie das Knarren der Tür und die leichten Schritte der Hofdame hörte, drehte sie den Kopf und sah, wie die Lichtflut im Schlafgemach versiegte und vom schattenlosen Grau des Tages abgelöst wurde. Eine Uhr schlug mit zirpendem Silberklang.
»Guten Morgen, Eure Majestät.« Jekaterina schmeckte den Geruch frisch gebrühten, starken Kaffees und das Duftwasser, das zusammen mit dem Ruch kalten Schweißes aus den Kleidern der Madame Perekusikina dünstete. »Ihr habt tief und gut geschlafen. Ich hab Euch nicht geweckt.«
Jekaterina richtete sich auf. Jede Bewegung fiel ihr heute unerwartet leicht. Es war, als hätte ihr schwerer Körper in den neun oder zehn zurückliegenden Stunden Schlaf mehr Kraft schöpfen können als in vielen anderen Nächten.
»Ich war schon wach.« Das Kaffeegeschirr klirrte auf dem niedrigen Tischchen, die schwarze Brühe gluckerte in die Tasse. Jekaterina gähnte und rieb sich die Augen. Auf der Zunge und dem Gaumen spürte sie sauren Speichel. »Es war ein guter Schlaf, endlich wieder einmal. Ich fühle mich, als wäre ich zwanzig Jahre jünger.«
Im Nebenzimmer lärmte ein Diener auf den Rosten des Kachelofens, ein anderer legte Holzkohle auf die Glut unter einem Samowar. Als die Kaiserin die Tasse hob, waren ihre Finger ruhig wie die einer Vierzigjährigen. Die Hofdame winkte der Kammerzofe, die schweigend den weißseidenen Morgenmantel am Fußende des Betts ausbreitete. Jekaterina rührte bedächtig Zucker in das Morgengebräu und erwartete die süße Hitze des ersten Schlucks, der den Nachtbelag ihrer Zunge und des Munds vertreiben würde.
Sie blickte, während sie trank, im Schlafraum umher, setzte die Tasse ab und schob einige Haarsträhnen unter die Schlafhaube zurück. Die Dienerin ersetzte heruntergebrannte Kerzen, brach herabgetropftes hartes Wachs ab und entzündete nacheinander zwei Dutzend weiße Dochte. Das Halbdunkel, das die Kaiserin bedrückte, wich den Inseln gelben Lichts, das um die Leuchter waberte. Jekaterina hob das zweite Tässchen und spürte die Schläge ihres Herzens bis in die Schläfen; es schien doppelt stark und schnell zu schlagen als während des Anfalls, der sie heimgesucht hatte.
Sie erinnerte sich an den lautlosen Schlag, der sie vor acht Wochen halb gelähmt hatte; ihr Körper hatte ihn überstanden, ebenso schnell wie jede andere Krankheit. Sie holte tief Luft, schlüpfte in die goldbestickten Pantoffeln und richtete sich auf, die Tasse in den Fingern der rechten Hand.
»Und weil ich mich kräftig, stark und jung fühle«, sagte sie und betrachtete die Flämmchen der Kerzen, »werde ich im Frühling zur Krim reisen, wenn alle Straßen wieder aufgetrocknet sind.«
»Sehr wohl, Eure Majestät«, entgegnete die Hofdame und beugte lächelnd das Knie. »Und wenn man die Brücken wiederhergestellt hat. Das Volk wird Euch zujubeln, so wie es immer entlang Eurer Wege Beifall spendet.«
Kaiserin Jekaterina leerte die Tasse. Der Kaffee rann heiß durch den empfindungslosen Mund, über die pelzige Zunge, durch ihre Kehle, erweckte ihre Lebensgeister, schien ihren Magen zu füllen und vertrieb die Gedanken an Alter, Hinfälligkeit und winterliche Kälte, und im Fell der Pantoffeln begannen sich die Zehen zu wärmen. Die Kaiserin, in wohliger Benommenheit, ließ sich den Morgenmantel umlegen, spürte die Seide auf der Haut, schloss die Knöpfe und stand auf. Madame Perekusikina und die Dienerin senkten die Köpfe, als sie an ihnen vorbeiging. Für einen kurzen Augenblick öffnete die Dienerin ein Fenster, und eisige Luft drang herein. Vor der Kaiserin verließen die Frauen das Schlafzimmer und schlossen leise die Tür.
Jekaterina reinigte und kühlte ihr Gesicht mit einem Stück Eis und trocknete es ab. Dann ging sie mit schwerem Schritt durch den leeren Arbeitsraum, setzte sich an den Tisch und benutzte den Fächer, bis die Brille wieder klar war; ihr Atem hatte die Gläser beschlagen lassen. Sie fing an, den Bericht über den Einmarsch eines französischen Heeres in Italien zu lesen. Am Abend jedoch hatte sie von einem Sieg der Österreicher gehört, und so nahm sie einen leeren Bogen, tauchte die Feder ein und begann nach kurzem Zögern einen Brief. Als sie die erste Zelle beendet hatte, legte sie die Hand unter die linke Brust und wartete, bis unter der Berührung der harte Herzschlag und die Stiche aufhörten. Sie las: »... beeile mich, Ihrer exzellenten Exzellenz zu verkünden, dass die exzellenten Truppen Ihres exzellenten Landes die Franzosen tüchtig verprügelt haben ...«
Vor der Ikone der Muttergottes von Kasan brannte eine frische Kerze. Jekaterina löste den Blick von dem goldumsäumten Antlitz der Madonna, als Platon Subow den ungeheizten Raum betrat. Er war rasiert, roch nach teurer Seife und schien lange und gut geschlafen zu haben. »Was schreibst du, Imperatritsa?« Jekaterina lächelte und legte ihre Hand auf Subows Finger, die ihre Schulter streichelten.
»An Graf Cobenzl. Etwas Scherzhaftes, mein Freund«, sagte sie leise. »Dem Gesandten aus Wien. Ich gratuliere ihm zum Sieg der Österreicher.«
Subow nickte. »Das ist vielleicht etwas voreilig, aber ... ich werde die Schreiber hereinschicken, ja?« »Sie sollen noch ein paar Minuten warten.« Sie sah dem Dreißigjährigen nach, der mit kraftvollen Schritten und klirrenden Sporen den Raum durchquerte und leise die Tür schloss. Aber auch Subow war älter und schwerer geworden. Köstliche, beneidenswerte Jugend!, dachte sie und hob das Vergrößerungsglas ans Auge. Die Kerzenflamme zitterte in der Zugluft. Weniger als eine Stunde später, nachdem die Hofdame frischen Kaffee auf dem Arbeitstisch serviert hatte, war Jekaterina wieder allein und ging ins Schlafgemach zurück.
Durch eine schmale Tür betrat der Kammerdiener Sotow den Arbeitsraum. Sein Gesicht unter der weißen Perücke drückte Missmut aus und, wie meist um diese frühe Zeit, die Erwartung unbestimmbaren Unheils; er blickte sich um und nickte kurz. Die Hofdame und die Dienerin sahen ihn schweigend den Raum verlassen.
Die Kaiserin schloss die Tür des Toilettenkabinetts, raffte Nachthemd und Morgenmantel und setzte sich. Zwischen juwelenumrandeten Spiegeln, goldenen Kämmen und Bürsten, Kristallfläschchen, duftenden Seifenstückchen, mit preußischer Akkuratesse gefalteten Handtüchern und einem Dutzend juwelenverzierter Döschen lag auf einem weißen Seidenkissen eines ihrer Vergrößerungsgläser aus Silber und Porzellan. Jekaterina griff nach einem Buch, zwischen dessen Seiten ein goldbesticktes Bändchen funkelte, hob es vor ihre Augen und begann zu lesen; sie wusste, dass sie zu dieser Stunde nur bedeutungslose Teile des Inhalts zu begreifen imstande war.
Einige Minuten vergingen, zehn, fünfzehn oder mehr.
Sie begann ungeduldig zu werden und warf einen Blick auf die dicken Knie und die faltige, mit Altersflecken übersäte Haut der Oberschenkel. Als die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen, und während sie ihre Gesäßmuskeln spannte, durchzuckte ihren Körper wie ein kalter Blitz ein lähmender Schlag.
Unter der Schädeldecke schien ein mehrfaches Knacken, scharf wie Stahlklingen, ins Bewusstsein zu dringen. Schwärze und schmerzlose Leere brandeten gegen ihre erblindenden Augen. In wirren Schleifen und Verknotungen löste sich ihr Denken und Fühlen auf; ihren Händen entfiel das Buch und klappte auf ihren Knien zusammen. Sie kippte, ohne es zu spüren, seitlich vom Sitz. Ihre Stirn schlug gegen die Wand des Kabinetts, ihre Finger rissen ein Tuch von der silbernen Stange.
Ein letzter Gedanke, dünn wie ein federnder Spinnenfaden, zuckte ihr durch den Kopf. Ich will nicht sterben! Ich hab noch so viel zu tun! Es kann nicht das Ende sein! Nicht so! Niemand herrscht besser über das Land als ich!
Eine dumpfe Woge schwemmte über sie hinweg und löschte ihr gesamtes bewusstes Leben aus: Bilder und Geräusche, Gerüche und Empfindungen, das Tasten der ziellos zitternden Finger und die Feuchte in der Tiefe ihres Schoßes einziges Überbleibsel ihres letzten Traums.
Der Kammerdiener und die Hofdame Perekusikina wechselten einen langen Blick. Sotow kratzte sich unter der Perücke und sah auf die Uhr. Gewöhnlich läutete die Kaiserin täglich vor neun nach ihm. Er zuckte mit den Schultern, wartete eine Weile und klopfte zögernd an die Tür des Schlafgemachs.
»Keine Antwort, Sotow?«, sagte die Kammerzofe, ebenso ratlos wie er. Sotow klopfte ein zweites Mal, stärker. Als er einige Atemzüge lang vergeblich auf eine Antwort der Kaiserin gewartet hatte, drückte er die Klinke hinunter und betrat den Raum. Ein einziger Blick zeigte ihm, dass er leer war. Der Geruch von Jekaterinas Duftwasser hing in der brackigen, kalten Luft. Sotow rief die Hofdame und rannte zur Tür, die den Gang zum Toilettenkabinett verschloss. Er klopfte, wartete, riss sie auf, blieb erschrocken stehen, begann einen Fluch und schlug die Hand vor den Mund.
Kaiserin Jekaterina lag neben dem Sitz auf dem Boden, Nachthemd und Morgenmantel in wirren Falten um ihre Füße, die Haube halb heruntergerutscht. Ihr Gesicht war blutrot. Sotow brüllte nach Hilfe, schrie nach Platon Subow und Doktor Rogerson, die Hofdame begann schrille Entsetzensschreie auszustoßen. Unruhe und Aufregung breiteten sich im Inneren des Winterpalasts aus, blitzschnell, wie die Bruchstücke eines explodierenden Schrapnells. Durch den Korridor und aus einigen Zimmern stürzten Menschen hervor. Türen schlugen gegen die Wand, ein Hund bellte wie rasend, die Vögel im Käfig aus Golddraht hüpften und flatterten zwitschernd gegen die Gitter und Sitzstangen.
Vier Männer schleppten den zuckenden Körper aus dem Nebengelass; in der Enge des Raums behinderten sie sich gegenseitig. Der Körper war zu schwer und zu unbeweglich, um auf das Bett gehoben werden zu können. Sotow breitete ein Laken über eine Ledermatratze, die einige Diener heranzerrten und neben dem Prunkbett zu Boden fallen ließen. Die Kaiserin rang röchelnd nach Luft, ihre Augen waren geschlossen, ihr Körper zitterte und zuckte.
»Die Ärzte! Holt sie, schnell!«, kreischte eine Dienerin.
Die Hofdame, deren Stimme zu versagen drohte, schickte Pagen zum Hauptmann der Palastgarde. Ein Bote sollte Großfürst Alexander holen, ein anderer mit der schrecklichen Nachricht zu Thronfolger Paul Petrowitsch reiten, der sich auf seinem Gut in Gatschina aufhielt, einen halben scharfen Tagesritt von Zarskoje Selo und vom Winterpalast entfernt. Einige Minuten vergingen, dann stürzten die Ärzte ins Schlafgemach und berieten sich aufgeregt; die Achtundsechzigjährige war ohne Bewusstsein nach ihrem zweiten, schweren Schlaganfall.
»Man muss ihren Leibarzt holen«, rief der Kammerdiener. »Und wo ist Subow?«
»Ich bin hier«, sagte der Adjutant der Kaiserin. »Wie kann ich helfen?«
Platon Subow schob sich zwischen Kammerfrauen und Ärzten bis zum Rand der Matratze und kniete sich neben die Zarin. Der alte Kammerdiener redete wild auf ihn ein und wiederholte ständig »Aderlass! Aderlass! Ein Schlaganfall!«
Zwei Dutzend Bedienstete umstanden im dichten Kreis die Ledermatratze, mit aufgerissenen Augen, angstvollen Gesichtern und unfähig, etwas Sinnvolles zu tun. Die Ärzte zogen, zerrten und schoben an Jekaterinas Körper herum, versuchten ihren Oberkörper auf Kissen zu heben und ihre zuckenden Gliedmaßen ruhig zu halten. Subow stand auf und breitete die Arme aus.
»Kein Aderlass!« Seine befehlsgewohnte Stimme drang mühelos durch das Schluchzen und die aufgeregten Gespräche. »Nicht bevor Rogerson hier ist. Habt ihr ihn rufen lassen?«
Die Hofdame nickte und sagte stockend, während ihr Tränen über die Wangen liefen: »Er muss gleich da sein. Ich hab Boten geschickt.«
Subow rannte hinaus. Man sah ihn mit seinem Bruder Nikolai reden, der mehrmals nickte und einen militärischen Gruß andeutete. Mit polternden Schritten eilte er aus dem Arbeitszimmer der Zarin. Subow kam zurück, deutete auf die Ärzte, einige Kammerdiener und auf andere Männer, deren Gesichter er kannte. Seine Worte klangen wie Befehle.
»Vier Mann an jeder Seite! Die anderen zurück. Hebt die Zarin aufs Bett. He, ihr Kammerfrauen, heißes Wasser und Waschzeug. Seht ihr nicht, was ...?«
Jekaterina in den beschmutzten, vom Urin durchnässten Kleidern, wurde nicht ohne Stolpern und mit einiger Mühe aufgehoben. Der schlaffe Körper rutschte und kippte zweimal aus den Armen der Männer. Die Laken auf der Matratze wurden unter Jekaterina gewechselt, und sie blieb zuckend, mit fleckiger Haut, neben dem Bett liegen. Die Feuer in den Kachelöfen loderten, die Kloben knisterten und knackten, und Hitzewellen breiteten sich unter den hohen Stuckdecken der Zimmer aus. Kammerdiener Sotow und der junge Geliebte der Kaiserin trieben mehr als ein Dutzend Palastbewohner aus dem Schlafraum hinaus; der Lärm und das Durcheinander mäßigten sich. Zwei Hofdamen versuchten, den Morgenmantel unter dem schlaffen Körper hervorzuziehen und die Schenkel der Kaiserin zu reinigen. Die Tür flog auf, und Alexander, Jekaterinas Enkel, stürzte mit fassungslosem Gesichtsausdruck und halb offener Litewka herein.
Subow stellte sich, den grässlichen Anblick schirmend, zwischen ihn und das Bett und sagte leise, aber eindringlich: »Großfürst! Eure Großmutter liegt zu Tode krank. Ihr solltet, wenigstens vorübergehend, die notwendigen Befehle geben.«
Alexander starrte ihn an. Er brauchte drei Atemzüge lang, um zu begreifen, dann fragte er heiser: »Sind Boten zu meinem Vater unterwegs, Fürst Subow?«
»Seit einer Viertelstunde.«
Alexander nickte, rannte hinaus und rief einige Befehle. Kurz darauf kam er zurück und sagte zu Subow: »Ich hab zur Sicherheit noch Adjutant Rostoptschin gebeten, zu Vater zu reiten, in kleiner Begleitung. Es wird wohl länger als einen Tag dauern, bis er hier sein kann.«
»Wir tun, was getan werden muss«, entgegnete Platon, »und so schnell und sicher wie möglich. Geht zu Eurer Großmutter, Fürst Alexander. Seht zu, wie die Mutter Russlands stirbt.«
»Und Ihr, Platon?« Fürst Alexander wischte Tränen aus den Augenwinkeln und starrte den Körper seiner Großmutter an, der schutzlos den Blicken der Umstehenden ausgesetzt war.
»Ich werde bei ihr sein, so lange wie nötig.«
Platon zog einen Schemel über die Teppiche, setzte sich schwer und stützte den Kopf in die Hände. Insgesamt eine Stunde dauerte es, bis der schottische Leibarzt kam, einen Aderlass vornahm und Jekaterinas Unterschenkel, Füße und Sohlen mit einer Salbe aus spanischen Fliegen einreihen ließ. Die weiße Haut der Unterschenkel, die unförmig angeschwollen waren, mehr aufgeschwemmt als sonst und voller Druckstellen vieler Finger und Hände, schien unter der Wirkung der Salbe rote Blasen zu werfen. Platon Subow nahm das verzweifelte Treiben um Jekaterina Alexejewna, Zarin des Russländischen Imperiums, mit langsam wachsender Entfremdung wahr. Er begann zu begreifen, widerwillig und verzweifelnd, dass sein Abstieg in die Bedeutungslosigkeit, aus der er gekommen war, in diesen Stunden begonnen hatte, an diesem neblig-frostigen Morgen, nach dem allzu kurzen Licht des Sonnenaufgangs.
Während die Hofdamen, Ärzte, Helfer und Kammerdiener an Jekaterinas Sterbelager ein hilfloses, nun aber leiseres Durcheinander verursachten, flatterten Erinnerungen wie jene erregten Käfigvögelchen durch Platon Subows Kopf. Er entsann sich der Tage, als er, Offizier der berittenen Garde, zum ersten Mal nach Zarskoje Selo beordert worden war; seinen Ruf und etliche Orden hatte er in einer Handvoll harter Gefechte gegen die Schweden redlich erworben. Es war im Jahre 1789, während Jekaterinas genialer und hochfahrender Geliebter – man munkelte, die Zarin und er hätten sich im Geheimen vermählt! – Grigori Alexandrowitsch Potjomkin, Fürst von Tauris, drei wichtige Städte im fernen Türkenkrieg nach kurzer Belagerung eingenommen hatte. Binnen weniger Wochen war Fähnrich Platon Subow von Jekaterina zu ihrem persönlichen Adjutanten ernannt worden.
O Zarin Jekaterina, dachte er und betrachtete die Rücken der Männer und Frauen, die sich um die sterbende Kaiserin scharten, warum musstest du mich verführen? Sie war im einundsechzigsten, er im dreiundzwanzigsten Jahr gewesen, als sie Fürst Mamonow verstieß; der Fürst hatte das Undenkbare gewagt und sich in eine jüngere, schönere Frau verliebt. Wenige Tage später war er, Platon, ihr geachteter, hart arbeitender persönlicher Adjutant in den Tagesstunden und ihr Liebhaber in manchen Nächten. Sie dürstete nach Leidenschaft und wollte geliebt werden. Ihr Körper mit den schweren Hüften und Brüsten war bis zum Bersten mit Sinnlichkeit gefüllt; trotz der Gebärnarben unter der Haut verwandelte sie sich in eine Erscheinung von jugendlicher Herausforderung. Sie wollte das unaufhaltsame Verrinnen der Zeit aufhalten, und scheinbar gelang es ihr auch, mit strahlenden Zähnen und hellen Blicken, im Kerzenlicht und zwischen Gläsern voll Wein oder Champagner. Ihr langes weißes Haar wurde weich, strahlend, war wie aus Fäden gesponnenen Silbers.
So viel kundige Leidenschaft hatte Platon bei keiner seiner jüngeren Beischläferinnen je erlebt. Jekaterina besaß die Erfahrung von vier Jahrzehnten, sie war wie Honig, Wodka und Brennnesseln gewesen.
Gleichzeitig hatte sie ihn verdorben. In bester Absicht. Der Aufstieg in die Gesellschaft des Zarenhofs war schwer gewesen; die Sprossen der langen Leiter starrten von vergifteten Dornen. Er war zu schnell und zu mühelos aufgestiegen, und seine einzige Gönnerin lag jetzt sterbend sieben Schritte vor ihm, die blauen Augen weit aufgerissen.
Wieder sprangen die Türflügel auseinander.
Subow kannte den Mann. Jekaterinas schottischer Leibarzt, Doktor John Rogerson, rannte herein. Er hob, sobald er Jekaterinas mitgenommenen Körper gesehen hatte, den Arm und rief: »Die zweite Apoplexie! Ich lasse sie zur Ader!«
Aderlass oder etwas anderes, dachte Platon, es ist gleichgültig. Sie wird sterben. Sie stirbt, und ich werde – trotz meiner bunten Drachen und dem feinen Violinspiel – einen tiefen Fall tun. Die unschuldigste fiedelnde Seele der Welt, hatte die Kaiserin geschrieben, während sie ihn zwang, zu lernen und neue Aufgaben bei Hofe zu übernehmen. Selbst wenn er mitunter nicht begriff, welche Bedeutung Schriftstücke und Akten hatten, glaubte er, seiner Aufgabe gerecht zu werden. Bald warf man ihm, selbstverständlich zu Unrecht, Arroganz und Hochmut vor und hasste sein zahmes Äffchen. Nun würden ihm alle Minister und Fürsten, die sich vor ihm verbeugt hatten, Unfähigkeit und Anmaßung nachsagen und über ihn siegen.
Eisigkalter Schweiß sickerte zwischen seinen Schulterblättern hinunter; er fühlte sich wie im Morgengrauen vor einer bewaffneten Attacke. Die hohen Türflügel – er saß an der Wand neben dem Eingang zum Schlafraum –, zu denen Jekaterina ihm einen Schlüssel gegeben hatte, wurden abermals aufgerissen und krachten zuschlagend in die klirrenden Schlösser. Zwei Knechte schleppten einen Zuber dampfenden Wassers herein.
Wie eine Fliege im Frühling, hatte Jekaterina unter ihm stöhnend geflüstert, fühle sie sich! Sie schenkte ihm Noten für seine Violine und klatschte, als er in Zarskoje Selos herbstlichen Gärten seine Drachen steigen ließ, zur Freude des kaiserlichen Hofstaats.
Subow hatte auf dem Schlachtfeld viele verwundete Männer sterben sehen, und abseits der Kämpfe auch sterbende Frauen und Mädchen. Er wusste, dass die Kaiserin diesen Schlaganfall nicht überleben würde. Eine Hofdame drehte sich um und sah in sein Gesicht. Der lange Blick schien Bedauern auszudrücken oder einen Anflug von Verachtung. Er gab den Blick zurück, bis sich die Frau wieder der röchelnden Kaiserin zuwandte. Keine Spur mehr von dem Entzücken der Damen über seine breiten Schultern und seine strahlenden Augen. Subow stemmte sich in die Höhe und näherte sich leise dem Kreis aufgeregter Menschen, die auf die Kaiserin hinunterstarrten. Fürst Alexander stand am Fußende der Matratze, hielt die Arme vor der Brust verschränkt und betrachtete aus halb geschlossenen Augen seine Großmutter. Sein Gesicht war starr, aber Subow sah die Tränen in den Augenwinkeln.
Der Körper der Greisin lag still da. In kurzen Abständen zitterten die Finger. Der Aderlass schien geholfen zu haben oder die Zäpfchen, oder die Medizin, die der Schotte ihr fast gewaltsam eingeflößt hatte; das Blut staute sich nicht mehr in Jekaterinas Gesicht. Sie atmete schwer; ihr keuchendes Röcheln unterbrach die lauten Atemzüge. Ihr Blick war zur Decke gerichtet. Es kam Platon Subow so vor, als kämpfte Jekaterina darum, das Bewusstsein wiederzuerlangen. Subow vermochte es nicht zu glauben. Er hörte, wie sich der schottische Arzt mit seinem Nachbarn, einem Palastarzt, murmelnd unterhielt, verstand aber kein Wort. Beide Männer schüttelten die Köpfe. Subow bewegte sich rückwärts zur Tür. Sein Blick umfasste die Bilder, Leuchter, Möbel und das große prunkvolle Bett. Er verließ still das Schlafzimmer und zog die schwere Tür ins Schloss.
Im Korridor, durch dessen ganze Länge eiskalte Luft zog, standen und saßen schweigende und weinende Diener und Beamte. Subow ging zwischen ihnen hindurch, die Treppe hinunter und zu seiner Suite, die zuvor Fürst Potjomkin gehört hatte. Das Äffchen sprang kreischend in seinem Käfig umher und warf mit Gebäckstücken nach Subow. Ohne das Tier zu beachten, durchquerte er den Raum. Auf dem Tisch lagen einige Stapel Schriftstücke. Er setzte sich, blätterte darin, las sie aber nicht. Bis Alexander oder Großfürst Paul ihm neue Befehle erteilte, galten für ihn Jekaterinas Anweisungen.
Um Mittag herum hielt Platon Alexandrowitsch Subow das Alleinsein und die Stille im Winterpalast nicht mehr aus. Die Ungewissheit über sein Schicksal begann seine Gedanken mehr zu beschäftigen als das Sterben der Kaiserin. Sie hatte ihn zu ihrem Geliebten gemacht, dies sah er nun als trostlose Wahrheit, und die Einsicht, dass seine Titel nur von ihrem Bemühen abhingen, ihn an ihrer Seite zu halten, steigerte seine Unruhe. Er sprang auf und ging in seiner Privatkanzlei hin und her; dicke Teppiche dämpften das Hämmern seiner Absätze. Das Äffchen verkroch sich in eine Käfigecke und starrte ihn zähnefletschend an. Ihn, Subow, »der Schwarzhaarige«, wie sein Spitzname lautete, von der Zarin ersonnen, die ihn zum Präsident des Kriegskollegiums, zum Gouverneur der taurischen Provinz, zum Befehlshaber der Schwarzmeerflotte befördert, zunächst gegen Potjomkins Widerstand, der befürchtet hatte, Jekaterina ließe sich von Subow beherrschen und unterwürfe sich seiner Jugend. Und später – Fürst Grigori Potjomkin hatte vor fünf Jahren diese Welt verlassen – sein Nachfolger. Jetzt waren die zärtlichen Namen »das Kind« oder »Potjomkins Fähnrich«, mit denen Jekaterina Subow ausgezeichnet hatte, bedeutungslos geworden.
Subow stieg die Treppe hinauf und betrat den schier endlosen Korridor. Zunächst schien ihn niemand zu erkennen, nach einigen Schritten nickten ihm die Menschen zu. Weinend, schluchzend oder wie erstarrt standen sie an den Wänden oder in kleinen Gruppen zusammen, als müssten sie sich gegenseitig wärmen und trösten. Längst würde es sich in St. Petersburg herumgesprochen haben, dass die Zarin zum zweiten Mal mit dem Tod rang. Subow grüßte zurück, durchquerte das Arbeitszimmer der Zarin und deutete auf die Doppeltür zum Schlafraum. Der Diener öffnete ihm einen Flügel.
Auf Zehenspitzen näherte sich Subow der Kaiserin. Jekaterina, dachte er während einiger beklommener Atemzüge, ist im eigenen Körper lebendig begraben! Wie nach dem ersten Schlaganfall wechselten in ihrem Gesicht und am Hals wieder totenähnliche Blässe und das Rot des Blutandrangs. Die Augen waren geschlossen, der Atem ging langsam und schwer, aber sie stöhnte nicht mehr. Die Mienen und Gesten der Ärzte waren ratlos und hoffnungslos, nur Doktor Rogerson schien sicher zu sein. Der lange Blick, den er über die Kaiserin hinweg auf Subow richtete, drückte aus, was Subow dachte:
Der Todeskampf dauert nicht mehr lange. Sie wird das Bewusstsein nicht wiedererlangen.
2 - Agonie und Erinnerung
Die Finsternis, in der sich Körper und Verstand versteckten wie gelähmte Mäuse in einem tiefen Gewölbe, lastete mit tausend Tonnen auf jedem Teil ihres Körpers. Die Stille schwoll an und löste sich im Klang eines fernen Pochens, das sich in feierlichem Takt wiederholte. Sie versuchte zu atmen und die Finger zu bewegen – sie vermochte es nicht. Es gab nur einzelne Gedanken, die sich qualvoll durch die Schwärze kämpften wie durch gefrierenden Morast. Wo war Jekaterina? In einer Höhle aus Dunkelheit zwischen den Sternen, in der nichts war außer dem Herzschlag eines Riesen? Sie spürte ihren Körper wie eine fremde Last.
Es gab keinen Schmerz, keine andere Empfindung außer der Verwunderung darüber, dass sie wusste, wer sie war, und dass sie sich bewegte wie ein Schmetterling im Windhauch. Irgendwoher ertönte ein einzelner Laut, dann mehrere Stimmen; ein Chor schien sich zu nähern wie Licht in vollkommener Finsternis. Jekaterina, weder blind noch reglos, lauschte dem Klang und den Widerklängen. Sie war plötzlich fähig, zu sehen und zu unterscheiden. Eine Pforte der Wahrnehmung und der Erinnerung öffnete sich. Sie entsann sich in blitzschneller Bilderfolge furchtbarer Albträume nach dem ersten Schlaganfall im September während unheilvoller Tage und Nächte, in denen sie mit rasenden Gedanken mehr gewacht als geschlafen hatte. In jenen Träumen war sie ebenso gelähmt und gefangen gewesen. Machtvoll erklang eine andere Erinnerung – diese Musik! Diese Worte! Welche Worte? Kurz vor Potjomkins Tod, in seinem Taurischen Palais, nach dem Bankett im April vor fünf Jahren, hatten um Mitternacht zahllose Sänger den Choral angestimmt, die Siegeshymne zu Ehren der Kaiserin. Während die Klänge Jekaterina umschwebten und sie in ein Geflecht herrlicher Töne einwoben, strahlte Licht auf, ein Wirbel drehte sich und bildete eine leuchtende Arkade in eine andere Welt. Jekaterina ergab sich dem Sog und dem Zerren des Lichts. Körper und Geist hatten sich getrennt. Der Geist schwang sich in der jubilierenden Musik durch unzählbar viele Funken und verhielt, leicht wie ein Lächeln, über einer erstarrten Szenerie. Sie sah sich selbst, leblos auf einem niedrigen Lager neben dem Bett. Nichts und niemand bewegte sich. Im Schlafgemach hörten weder die Ärzte noch die Hofdamen, Freunde und Kammerdiener die hymnischen Chöre, niemand sah Jekaterina Geist über dem Körper schweben; niemand gewahrte ihre Anwesenheit. Tiefer Friede erfüllte ihren Geist. Ihr geschwächter Körper behinderte sie nicht mehr.
Sie verbrachte eine Zeitspanne von unbekannter Länge über ihrem Lager. Blitzschnell verschlug es ihren Geist zurück in Lautlosigkeit, Finsternis und Starre, in das Gefängnis ihres blicklosen, stummen und tauben Kerkers ihrer Seele. Jekaterinas Kampf war siegreich, ihre Flucht aus dem Körper gelang fast augenblicklich. Flirrende Mosaiksteinchen aus Erinnerungen gliederten sich zu einem farbdurchglühten Gemälde. Musik und das Malmen Dutzender Stimmen vermengten sich. Wieder zuckte die Erinnerung zur nahen Vergangenheit; die Einzelheiten des Gemäldes gewannen plötzlich ihr Eigenleben zurück. Aus den Farbwirbeln schoben sich leuchtende Kerne hervor ...
... die Juwelen und das Gold des Andreasordens, des Wladimirordens und des Georgsordens, die Jekaterina sich an das Brokatkleid hatte heften lassen; im Haar funkelte eine ihrer kleinen Kronen. Heute Abend, einige Wochen nach dem ersten Ball zu Ehren des blauäugigen jungen Thronfolgers Gustav und seiner hundertköpfigen schwedischen Begleitung, war die Kaiserin sicher – ihr Plan, ihre dreizehnjährige Enkelin Alexeja mit Gustav IV. zu vermählen, schien geglückt. Das prunkvolle Fest und die folgenden Abende voll Musik, erlesener Gastmahle und kostbar gekleideter Tanzenden begeisterten Gustav, den Herzog von Södermanland – Bruder des ermordeten Gustav III., dem leiblichen Cousin Jekaterinas –, und Graf Markow nicht weniger als ihr Gefolge; sie waren nordische, lutheranische Kargheit gewohnt.
Jedermann in St. Petersburg, der lesen oder auch nur zuhören konnte, wusste, was die Kaiserin mit der Verlobung und der Hochzeit bezweckte. Sie wollte nicht nur die Macht und die Größe Russlands stärken. Ob ihr Vorhaben glückte, sollte sich heute, am 31. August, endlich entscheiden – hier im heißen, geschmückten Thronsaal. Platon Subow trat ein, gefolgt von Graf Markow, ging zwischen den erstarrten Höflingen zum Thron und flüsterte ins Ohr der Zarin. Graf Markow überreichte ihr ein Schreiben.
Sie faltete den Brief auf und begann zu lesen. Gustav entgegnete als Antwort auf einen Abschnitt des Heiratskontrakts, dass Alexeja in Schweden nicht daran gehindert werden würde, ihren Glauben auszuüben. Gustav gebe sein königliches Ehrenwort; dies aber schriftlich festzuhalten lehne er entschieden ab.
Jekaterina las den Brief, las ihn ein zweites Mal, verstand die Tragweite der Ausführung, und ihr war, als träfe sie ein Blitz.
»Ich werd ihn lehren, diesen Rotzlöffel!«
Sie atmete röchelnd ein, stand mit offenem Mund wie gelähmt da und vermochte weder zu stammeln noch zu sprechen. Sie schwankte und ließ sich in den Sessel fallen, griff zitternd nach einem Glas Wasser, leerte es zur Hälfte und spürte, wie das Blut in ihr Gesicht schoss und ihre Finger kraftlos wurden. Im Inneren ihres Kopfs wütete ein betäubendes Wetterleuchten, grell und lautlos. Sie neigte sich weit nach vorn, ihr Oberkörper zuckte zurück, und ihre Schulterknochen schlugen gegen die Sessellehne. Das Glas zerklirrte auf dem Boden. Die Lichter, die Decke, die Wände, der Boden, die schreckerfüllten und erstaunten Gesichter – alles drehte sich. Als sie die Augen schloss, wirbelten farbige Punkte und Kreise auf den Lidern. Binnen weniger Herzschläge fühlte sie sich in Finsternis, Lautlosigkeit und Starre geworfen. Ihr war, als würden tausend Sprossen den Abgrund ihrer Besinnungslosigkeit von der lebendigen Wirklichkeit trennen.
Eine chaotische Zeitspanne, deren Länge sie nicht abzuschätzen vermochte, verstrich. Als sich Bilder, Farben und das Lärmen wieder geordnet hatten, brachte sie mit schwerer Zunge hervor: »Wir werden versuchen alles zum Besten zu ändern. Entschuldigt die Kaiserin; ein plötzliches Unwohlsein. Es hat nichts zu bedeuten.«
Die Frauen und Männer, die sich in ihrer Nähe befanden, erkannten ihren Zustand. Während ihr Enkel Alexander und die Kammerherren sie stützten und zu ihrem Schlafgemach mehr trugen als geleiteten, verbreitete sich die Schreckensnachricht in den Korridoren, Treppenhäusern und Zimmern des Palasts schneller als die Flammen eines Brands. Prinzessin Alexeja fiel in Ohnmacht und rutschte aus dem Sessel. Es dauerte kaum eine Stunde, bis Petersburgs Bewohner vom Schlaganfall der Zarin erfuhren und Platon Subow händeringend zu beten begann.
Jekaterina ließ sich entkleiden, eine Arznei verabreichen und schlief. Nachdem sie vierzehn Stunden später erwacht war, nahm sie mit aller Kraft den Kampf gegen die Folgen des Anfalls auf und besiegte sie – fast – binnen sechs Wochen.
Huschende, aufblinkende Eindrücke, Erinnerungsbruchstücke, Schwärze, eine Skala ineinander glühender Farben, rauschhafte Klänge mündeten in Lautlosigkeit, mit der bewegte Formen und Farben sich abermals zu einem bedeutungsvollen Bild im juwelenbesetzten Rahmen fügten.
Am 11. September, nach Dutzenden geheimer, kräftezehrender, enttäuschender oder hoffnungsfroher Gespräche, hastigem Schriftwechsel und halb öffentlichen Gesprächen und Verhandlungen zwischen der Kaiserin und den schwedischen Gästen, bot der Thronsaal fast das gleiche Bild wie in der Nacht des ersten Schlaganfalls. Auf einem Tischchen lagen die Verlobungsringe. Zwei Prunkstühle, mit saphirblauem Samt ausgeschlagen, standen neben Jekaterinas leerem Thronsitz, Alexeja saß wartend auf einem der Stühle. Der König von Schweden würde in kurzer Zeit auf dem anderen Platz nehmen und Alexeja verliebt lächelnd in die Augen blicken.
Während sich die Kaiserin für den abendlichen Empfang ankleiden ließ und zu dieser Stunde die Schmerzen in ihren geschwollenen Beinen mit äußerster Willenskraft unterdrückte, bedachte sie – zum sechsten oder siebten Mal – jeden Zug der weißen und schwarzen Figuren, die nicht zu einem Spiel vor dem Kamin gehörten, sondern zum Großen Kaiserlichen Spiel um Sieg oder Niederlage.
Voller Erwartung, tief in Gedanken, hatte sie im Ankleidegemach ihre schönsten Ringe ausgesucht, die sie mit einiger Mühe auf die Finger schob und drehte. Sie fühlte schon die Größe ihres bevorstehenden Triumphs, wusste aber, dass sie den Sieg nicht in der Hand hielt. Noch nicht.
»Diese hartnäckigen Schweden!« Sie legte den Kopf in den Nacken. »Lutheraner! Protestanten! Sein Vater Gustav, mein Cousin, dieser unselige Mann – er hat mir vor Jahren den Krieg erklärt. Und? Man hat ihn ermordet, den größenwahnsinnigen ›Recken Jammer‹. Sein Sohn ist genauso kalt und hartleibig.«
Die Kammerzofe zog schweigend die Bürste durch das schlohweiße Haar der Kaiserin.
Die Kaiserin zwängte ihre Füße in die Schuhe, ließ sich aus dem Sessel helfen und ging mit kleinen Schritten in den Thronsaal. Mit einem Seufzer sank sie auf der erhöhten Plattform in den hochlehnigen Sitz und begrüßte lächelnd, mit einem Kopfnicken, die aufgeregte Alexeja, mit einem zweiten entließ sie die Kammerzofen und stützte die Arme auf das weiche Leder der Armlehnen. Einige Herzschläge lang schloss Jekaterina die Augen. Der Metropolit von St. Petersburg näherte sich, begrüßte sie und setzte sich umständlich. Die Zarin, der Saal voller Höflinge und die junge Braut warteten mit dem Metropoliten auf Gustav IV.
Russland befand sich im Krieg mit Persien. Die Seuche des Jakobinertums, die vor drei Jahren den französischen König gemordet hatte, streckte drohend die Finger nach dem großen Reich aus. Ein Teil der russischen Heere würde, wenn sich die Umstände nicht zum Besseren änderten, in Frankreich einmarschieren, die verhasste und gefürchtete Revolution beenden und Adel und Königtum wieder in ihre gottgewollten Rechte einsetzen.
Hatte sich Thronfolger Gustav IV. von Schweden in die Enkelin der Kaiserin verliebt und würde er Alexeja heiraten – Jekaterina zweifelte nicht einen Atemzug lang daran! –, hätte Russland an seiner Nordgrenze Schweden in seine Einflusssphäre gezogen. Schweden verteidigte dann die Ostsee. Dadurch war die nördliche Flanke geschützt, alle europäischen Staaten würden die Zarin als Retterin feiern, und ein Teil der Heere wäre frei für den Marsch nach Paris – sechzigtausend Mann unter der Führung General Suwarows.
Alexeja sollte als russische Prinzessin dem Vaterland treu und der Kaiserin gegenüber folgsam ins protestantische Schweden gehen, aber bei ihrem orthodoxen Glauben bleiben dürfen. Der Thronfolger und sein Onkel, der Herzog von Södermanland, hatten der Zarin, Alexejas Großmutter, anvertraut, dass seine Untertanen es nicht dulden würden, wenn er, streng lutheranischen Glaubens, eine Frau mit einer anderen Konfession nähme. Jekaterina aber hatte gegenüber Gustav auf ihrer Forderung beharrt.
Die Kaiserin, die Höflinge, der Metropolit, Beamte und Diener warteten jetzt schon länger als eine Viertelstunde. Obwohl kühler Weißwein, kalter Champagner und samtig warmer Rotwein angeboten wurden, stockten die Gespräche, wurden leiser, sanken zu einem zischelnden Flüstern herab. Im Saal entstand erste spürbare Unruhe.
Gustav hatte, wie sich Jekaterina erinnerte, zuerst gesagt, dass er keine Möglichkeit zu erkennen vermöge, dass Alexeja bei ihrem Glauben bleibe.
Jekaterina hatte unnachgiebig auf ihrer kaiserlichen Meinung beharrt. Gustav beteuerte nichts zu tun, was Alexeja verletzen könne. Die Kaiserin hielt diese Aussage für Gustavs königliches Ehrenwort und schlug dem Herzog von Södermanland die offizielle Verlobung vor. Der Herzog redete, sicherlich voll staatstragender Ausgewogenheit, mit seinem Neffen Gustav, und man stimmte schließlich zu. Heirat mit dem Segen der Kirche, nach russischem Ritus! Die Beamten bereiteten die Dokumente vor, die Ringe lagen bereit, und die Kaiserin wartete nun schon länger als eine Stunde. Jekaterinas Enttäuschung und Wut nahmen zu und drohten zu überborden.
Das Schweigen wurde unheilvoll, die Stille schien das Klirren der leeren und den Klang der vollen Gläser in sich einzusaugen wie ein Strudel am Ufer der Newa. Die Zeiger der Uhr deuteten auf die volle Stunde und krochen darüber hinweg. Die Kaiserin betrachtete den leeren Weinpokal mit einem Blick, der verriet, dass sie nahe daran war, das Kristallglas an die Wand zu schmettern, aber sie dachte an die schreckliche Zeit ihrer Ehe mit Zar Peter. Spätestens in jenen Jahren hatte sie lernen müssen, abzuwarten und sich nahezu unmenschlich zu beherrschen. Sie ließ sich ein volles Glas reichen, setzte es an die Lippen – und die Türflügel schwangen langsam, lautlos nach außen auf.
»Endlich!«, flüsterte sie und sah zwischen den Dienern, die sich tief verbeugten ... nicht Thronfolger Gustav, sondern Graf Markow. Er schritt durch die schmale Gasse, die sich in der Menschenmenge bildete, blieb vor der Kaiserin stehen und verneigte sich. Jekaterina stellte das halb geleerte Glas auf das Tablett des Dieners und winkte Markow zu sich heran.
»Sie? Nicht der Thronfolger? Was habt ihr Schweden da wieder ausgeheckt?«
Markow, aschfahl im Gesicht, flüsterte und murmelte: »Majestät! Gustav wagt es nicht. Er ist in heißer Liebe entbrannt ...«, er erlaubte sich ein schräges Lächeln, »... falls ein Lutheraner zu solch feuriger Laune fähig ist. Aber ...«
Er reichte ihr ein gefaltetes Blatt aus schwerem Papier. Jekaterina schlug es auf und las schweigend die wenigen Zellen. Dann hob sie den Kopf und wandte sich an die Versammelten.
»Seine Majestät Gustav IV. ist unpässlich«, sagte sie mit klarer, beherrschter Stimme. »Man wird wohl, leider, die Verlobungsfeier zu einem späteren Zeitpunkt zelebrieren.« Es gelang ihr, sich aufzurichten. Der Metropolit Gabriel senkte den Kopf. Alexeja sprang hinzu und nahm ihren Arm. Die Zarin rang um Beherrschung. Sie kochte vor Wut, und eisige Enttäuschung marterte sie, während sie sich in die kaiserlichen Gemächer begab. Dort verließ sie der letzte Rest ihrer gewaltsamen Zurückhaltung. Sie schrie und verfluchte die Schweden mit Ausdrücken, die einen Moskauer Kutscher hätten anerkennend grinsen lassen. Gustav, den sie noch vor Tagen den »vielversprechendsten Monarchen Europas« genannt hatte, beschimpfte sie als dummen Klotz, steif wie ein Stock, eingebildet und hinterlistig. Die Verlobung war gescheitert, ihre Pläne beschädigt, die Kaiserin gedemütigt.
Jekaterina ließ sich einen starken Schlaftrunk mischen, wartete auf den Schlaf und versuchte sich mit der Dunkelheit zu trösten.
Sie erwachte vor dem Morgengrauen und erkannte trotz der Benommenheit, dass ihr Körper sie im Stich zu lassen begann. Schwäche und Krankheit nisteten in ihr wie sprossendes Unkraut. Schlaflosigkeit, jene furchtbare Feindin, hatte sie häufiger heimgesucht als jemals während der vierunddreißig Jahre seit Peters III. gewaltsamem Tod. Sie streckte die Arme aus, entspannte die zuckenden Muskeln und zwang ihre Gedanken in geordnete Bahnen.
Was auch immer sie versuchte – sie war eine kranke Greisin. Ihre Erinnerungen glitten auf den gleichen zuverlässigen Bahnen wie stets. Sie entsann sich, dass sie viele Mahlzeiten vergessen hatte und an ungewohnten Orten und zu ungewöhnlichen Stunden plötzlich eingeschlafen war, dass sie an Gewicht verlor und neue Falten an ihrem Körper fand. Wachte sie nach den unerwarteten Anfällen tiefsten Schlafs auf, dauerte es lange, bis sie zu sich und in die Wirklichkeit des Winterpalasts zurückfand. Platon Subow, der ihr helfen sollte, war überfordert, ein liebenswerter, hart arbeitender Schwächling, ein Schatten, verglichen mit Serenissimus Grigori Potjomkin, dem Unvergleichlichen. Was vermochte sie, müde und todkrank, noch zu tun? Die letzten Dinge ordnen, bevor auch der Verstand versagte, bevor es zu spät war.
Schlaflosigkeit, Krankheit und Verwirrung kamen und gingen in rascher Folge – Jekaterina erkannte in den Gesichtern ihrer Minister und der Beamten, wie besorgt sie um die hinfällige Kaiserin und die Thronfolge waren. Gleichzeitig schienen sich viele auf die Stunde zu freuen, in der Platon Subow, der unbeliebte Günstling, seinen Platz neben der Kaiserin verlieren würde. Jekaterina zwang sich, Klarheit zu schaffen. Die Sammlung ihrer Bücher und alle Handschriften hinterließ sie ihrem Enkel Alexander, aber Thronfolger Paul Petrowitsch sollte ihre »Memoiren« bekommen, unzählige Seiten voller Erinnerungen, an denen sie länger als ein halbes Jahrhundert geschrieben hatte.
Jekaterinas Wille war stark wie Stahl, und sie kämpfte gegen die Warnung, die ihr das Schicksal erteilt hatte. Sie war sicher, dass die Stunde noch nicht gekommen war, die Freunde und Angehörige vielleicht schon erwarteten, und in der sie mit dem letzten Atemzug ihren letzten Willen aussprechen musste. Und sie wusste auch seit langem, dass der Hofstaat darauf lauerte, dass sie statt Paul, den Ungeliebten, Alexander zum Nachfolger bestimmen würde. Viele Bewohner des Palasts dachten, dass Thronfolger Paul kurz davorstand, enterbt zu werden. Jekaterina aber blieb unschlüssig, während sie die Wohltat des Schlafs herbeisehnte und die endgültige Entscheidung abermals verschob.
Sie hatte längst erfahren, dass Paul Petrowitsch überzeugt davon war, dass seine Mutter ihm den Thron geraubt hatte. Die Zarenkrone sollte eigentlich seinen Kopf schmücken, nicht ihr Greisinnenhaupt. Denn er glaubte, der leibliche Sohn Peter III. zu sein.
Aber die Kaiserin zögerte; statt ihr Machtwort zu sprechen, erteilte sie genaue schriftliche Befehle für alle Umstände ihres Begräbnisses. Sie wusste, dass sich Unordnung in ihrer Umgebung wie in einem Ameisenhaufen ausbreiten würde, wenn sie die Zügel lockerte. Subows und der Minister Unfähigkeit, klare Anordnungen zu geben, steigerte zweifellos die Verwirrung, und während ihrer letzten Atemzüge würde heillose Aufregung ausbrechen. Die Albträume aber während der Pausen der Schlaflosigkeit, aus denen sie nur scheinbar gestärkt erwachte, schienen zu beweisen, dass sie auch diesen Kampf gewinnen würde. Einmal, während sie an der Seite von Frau Naraschkyn im Park hinter dem Palast spazierte, mitten in der Nacht, hob sie den Kopf und sah eine Sternschnuppe in weißer Grelle zwischen den Sternen verglühen. Ein Gedanke voll bitterer Erinnerungen zuckte durch ihren Kopf. Der Wandelstern! Er hatte zu selten über ihr geleuchtet. Sie stützte sich seufzend auf die Schulter ihrer Freundin.
»Die Sternschnuppe – sie bedeutet Tod.«
»Früher haben Eure Majestät nie an Vorzeichen geglaubt.«
»Ja, früher.« Jekaterina senkte den Kopf und ging langsam weiter.
Wieder verließ sie die Welt ihrer Gedanken und Erinnerungen und schlief ein, in Bewegungslosigkeit und Schwärze. Und, danach ...
Sie schwebte im Mittelpunkt huschender, aufblinkender Bilder, Erinnerungsbruchstücken aus einer fernen Zeit, einem doppelten Regenbogen ineinander glühender Farben, rauschhafter Klänge und einem unerwarteten Bild in unirdischem Licht; sie blickte gleichzeitig über die Schulter der fünfzehnjährigen Sophie und betrachtete sich selbst als Zarin, mit goldener Feder auf goldgerändertem Papier schreibend, sie ordnete ihre Gedanken für die Zeilen der Memoiren.
Die lange, beschwerliche Reise, die am 10. Januar 1744 in Zerbst an der Nuthe im Nieselregen begonnen hatte, ging in bitterer Kälte zu Ende. Von Zerbst nach Berlin, zu Friedrich II. in Preußen, danach fünfzig Meilen weit nach Schwedt, wo an der Straße nach Stettin ihr geliebter Vater Fürst Christian August von ihr Abschied nahm. Ostwärts führte die Fahrt der beiden schaukelnden und ruckenden Kutschen auf Straßen in grauenhaftem Zustand durch Danzig und Königsberg nach Mitau. In Mitau ließ sich der Generalgouverneur von Kiew bei Sophies Mutter melden. Er hatte den Befehl über die russischen Truppen in Kurland, war vom Zarenhof verständigt worden und schickte der kleinen Reisegesellschaft reitende Boten voraus nach Riga.
»... auf ausdrücklichen und besonderen Befehl Ihrer Kaiserlichen Majestät habe ich Ihnen mitzuteilen, Madame, dass die erhabene Kaiserin es wünscht, dass Eure Durchlaucht, begleitet von der Prinzessin, Dero ältesten Tochter, sich so bald wie möglich und ohne Zeitverlust in unser Land begibt an den Ort, an dem der Kaiserliche Hof sich dann befinden wird. Eure Durchlaucht sind zu klug, um nicht den wahren Sinn der großen Ungeduld zu verstehen, die Ihre Majestät empfinden kann, Sie bald hier zu sehen, ebenso wie die Prinzessin Tochter ... für diesen Wunsch hat Ihre Majestät sehr wichtige Gründe.«1
Dieser Brief, der kurz nach Weihnachten aus St. Petersburg in Zerbst eingetroffen war, veränderte das Leben der Familie und ließ Prinzessin Sophie von ihrer glanzvollen Zukunft träumen. Je mehr sich ihre Mutter Johanna und sie – ihre Mutter reiste unter dem Namen einer Gräfin von Rheinsbeck – St. Petersburg näherten, desto kühner wurden Sophies Träume.
Gouverneur Wojejkow begleitete die Reisegesellschaft nach Riga. Der Empfang war ungewohnt glanzvoll. Einige Kutschen des Zarenhofs, der kaiserliche Kammerherr Semjon Kirillowitsch Naryschkin, Diener und Köche erwarteten Gräfin Johanna Elisabeth und Tochter Sophie. Selbst der Magistrat von Riga nahm am Empfang teil. Während die Ankömmlinge über die Dûna fuhren, in der Eisschollen trieben, feuerten die Kanoniere Salutschüsse.
Naryschkin überreichte den fröstelnden Frauen knöchellange Mäntel und Kragen aus edlem Zobelpelz.
Von Riga reisten sie in Begleitung von Naryschkin im Schlitten durch kaltes, verschneites Land nach Narwa und weiter nach St. Petersburg zum Zimnj Dworjets, Winterpalast.
»Meine liebe Babette Cardel, teuerste Lehrerin, vor fast einem Monat sagten Sie weinend zu mir: ›Wenn Sie mich lieb hätten, würden Sie mir verraten, wohin Sie reisen.‹ Ich war wie Sie in Tränen gebadet, aber durfte es selbst Ihnen nicht anvertrauen. Doch nun sind wir in Russland, wo Sie nicht Elisabeth, sondern Jelisaweta heißen würden. In dicke Zobelpelze gehüllt, auf weichen Fellen und von pelzgefütterten Lederdecken geschützt, liegen wir in einer Art warmem Häuschen auf einem Schlitten, der uns von Riga nach St. Petersburg bringen soll. Sie haben mir so unendlich viel vorgelesen und mich zehn Jahre lang schreiben und lesen gelehrt, so dass ich verstehe, was mich hier erstaunt, mit tränenden Augen – vor Kälte! – aus dem Pelzkragen und dem Fensterchen blinzelnd, die Füße auf heißen Ziegelsteinen. Man schreibt hier heute den 10. Februar, was bei Ihnen zu Zerbst dem 21. Februar entspricht, denn in Russland gebraucht man noch den Kalender des alten Stils. Die Straße ist eisesglatt, rechts und links der Schneewälle verstecken sich Häuser, Äcker, Wälder und Dörfer unter einer dicken Schneedecke. Wir fahren ununterbrochen dahin, und es ist leicht, vieles zu bedenken, weil man nichts anderes sieht außer Schnee und schwarzen Vögeln. Ich schreibe Ihnen, verehrte und geliebte Babette, nur in Gedanken. In diesen vier Wochen haben wir erfahren, dass ich diesen Brief, stünde er auf Papier, nicht abschicken dürfte, denn wir müssen inkognito reisen – unter dem Namen von Rheinsbeck.
Bolhagen, ein Ratgeber meines Vaters, brachte mir Bücher, las mir vor und predigte mir von Sittenstrenge und christlichen Tugenden. Er sagte mir, sie würden dazu beihelfen, dass ich würdig sei, eine Krone zu tragen. Welches junge Mädchen träumt nicht davon? Dieser Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf, und die Krone Russlands hat mich seitdem viel beschäftigt. Es scheint, als würde sie in St. Petersburg oder Moskau auf mich warten.
Als ich zehn Jahre zählte, lud uns Mutters ältester Bruder Adolf Friedrich von Holstein-Gottorp, Fürstbischof von Lübeck und der Administrator Holsteins, ein. Ich traf dort sein Mündel, den halb verwaisten, blassen Herzog Karl Peter Ulrich von Holstein, den einzig überlebenden Enkel des Zaren Peter des Großen.«
Seine Mutter Anna Petrowna – so erinnerte sich Sophie – war eine Tochter Peter I. und starb drei Monate nach Karl Peters Geburt. Er war ein hübscher, wohlerzogener und liebenswerter Junge, jedenfalls in ihrer Gegenwart. Er ist von der Zarin Elisabeth nach Russland geholt worden, aber eigentlich sollte er später die Krone Schwedens tragen. Die Zarin unterstützte seinen Anspruch auf den russischen Thron, doch er war ebenso lutheranisch erzogen und aufgewachsen wie sie selbst. Zu der Zeit, in der man ihn, nunmehr Großfürst Pjotr Fjodorowitsch, zum russischen Thronfolger machte, schickte Sophies Mutter etliche Bilder nach Moskau; den Namen des Malers, der sie abkonterfeit hatte, hatte sie vergessen. War es nicht Balthasar Denner gewesen? Nun hieß Karl Peter Ulrich wohl längst Peter oder Pjotr Feodorowitsch, hatte sein Glaubensbekenntnis nach dem Ritus der griechisch-orthodoxen Kirche abgelegt und sollte bald verheiratet werden. Damals hatte ihre Umgebung Sophie manchmal mit Karl Peter geneckt, und sie träumte von einer Hochzeit. Ob mit dem jungen Thronfolger oder einem anderen Fürsten – wer weiß es?
»Wir reisten auch nach Berlin. Der junge König Friedrich II. erwies mir die Ehre, bei der Redoute im Opernhaus zu Berlin neben mir zu sitzen. Man hat mir zugeflüstert, dass er sich dafür eingesetzt hat, eine Person an den Zarenhof zu bringen, die seinem Land Preußen wohlwollend gegenüberstand. Eine Zerbster Prinzessin etwa? Er war galant zu mir, fragte mich Tausenderlei, redete von der Oper, der Komödie, von Poesie und Tanz, von Dingen, über die man eben mit einem vierzehnjährigen Mädchen plaudern kann. Anfangs war ich recht schüchtern, aber nach einer Weile unterhielten wir uns recht angeregt, so dass die ganze Gesellschaft große Augen machte, dass Seine Majestät ein Gespräch mit einem Kind führte. Er gab mir eine Schale Süßigkeiten, ließ sie mich einem Hofbeamten reichen und sagte zu ihm: ›Nehmen Sie die Gabe an aus der Hand der Amouren und der Grazien!‹ Wenn es um den Thron Russlands geht, sagt meine Mutter Johanna voll Zuversicht, habe ich wohl einen Verbündeten in diesem bezaubernden König, der eine Handbreit kleiner ist als ich.
Am 3. Februar trafen wir in St. Petersburg ein, der neuen Hauptstadt, die Zar Peter I. gegründet hat. Nun brauchten wir auch nicht mehr inkognito zu sein. Man sagte uns, dass wir drei Tage später nach Moskau weiterfahren würden, denn die Zarin Elisabeth regiert das Land von Zeit zu Zeit von der alten russischen Hauptstadt aus. Man führte uns in das Winterpalais, wir nahmen ein vorzügliches Mahl ein, und die Hofbeamten versprachen uns für die nächsten Tage allerlei Zeitvertreib. Nun waren wir wirklich am Zarenhof, und endlich durfte ich in einem weichen Bett schlafen, in einem Zimmer, das ein mächtiger Kachelofen erwärmte. Draußen klirrt die Kälte. Es würde mich nicht wundern, wenn erfrorene Raben aus den Wolken fielen. Ich habe ein wenig Heimweh nach Zerbst, und ich vermisse Sie sehr, Babette. In Zuneigung, Ihre Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst.«
Nicht länger als die Dauer eines Lidschlags war es Jekaterina, als hüllte sie der eisige Ostwind der Erinnerung in eine schwarze Wolke ein. Im lautlosen Kampf um die Herrschaft über ihren Körper verlor sie ein Gefecht. Jäh schwand ihr Bewusstsein, aber ebenso plötzlich strahlten neue Bilder der Erinnerung auf. Die Gefangene ihres schlaffen Körpers, den, ohne dass sie es spürte, von Zeit zu Zeit wilde Zuckungen peinigten, erkannte augenblicklich Zeit, Ort und Schrecken: der gewaltige Sternenhimmel über Kurland.
Jenseits von Danzig, abseits der Poststraße, hielten die Kutschen vor einem Gasthof. Die schlammbespritzten Pferde ließen die Köpfe hängen, dicker Raureif bedeckte die schwarzen Äste der entlaubten Bäume. Die Sonne, nur ein bedrohlich rötlicher Schein durch den Nebel hindurch, sank hinter den schneebedeckten Ufern der Ostsee. Von Osten kam mit schneidendem Pfeifen eisiger Wind. Der Kammerdiener, gefolgt von einem bärtigen Mann in schmutziger Felljacke, trat auf den Wagen zu.
»Die Pferde haben Platz im Stall«, sagte er zur Gräfin. »Wenn wir nicht erfrieren wollen, müssen wir bei seiner Familie schlafen.«
»Es ist warm drin, Euer Gnaden.« Der Wirt sprach raues, gebrochenes Deutsch, mit Russisch und einigen Brocken Französisch versetzt. »Ich hab gutes Bier und genug zu essen. Einfaches Essen, Euer Gnaden.«
Ein Knecht und drei Kinder in zerlumpter Kleidung begannen die erschöpften Pferde auszuschirren. Der Kammerdiener und der Koch schleppten Gepäck ins Haus, der Wirt half Sophie und ihrer Mutter in der einsetzenden Dunkelheit durch halb gefrorenen Schlamm und zwischen eisbedeckten Pfützen zum Gasthof. Es war ein niedriges, lang gestrecktes Gebäude aus Stein, Lehm und Torf, mit Schilf und Stroh gedeckt. Rauch quoll aus einem Loch im Dach. Auf der Schwelle, einem ausgetretenen Balken, warf Sophie zwischen den Wolltüchern um den Kopf und vor dem Gesicht einen Blick auf die Kutschen. Die Zofen bemühten sich, die Türen der Wagen zu schließen; die Räder begannen im morastigen Grund zu versinken. Hinter den Wagen, zwischen einem Wäldchen aus Krüppelkiefern und dem eisbedeckten Strand, hatte der Wind den Nebel vertrieben. Einige Sterne blinkten über dem Horizont. Die Tür aus Balken, Lederfetzen und Seilen öffnete sich, und zugleich mit der feuchten Wärme prallten Gestank, dumpfer Lärm und flackerndes Halbdunkel gegen die Eintretenden.
Sophie holte erschrocken Luft und blinzelte. In einem großen Raum, dessen Wände und Dach sie nicht sehen konnte, brannten ein Feuer und ein halbes Dutzend Kienspäne. Der Gestank raubte ihr den Atem und würgte sie. Zehn, fünfzehn Stimmen redeten durcheinander. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das flackernde Zwielicht, während in ihrem Rücken die Tür ein Dutzend Mal geöffnet und geschlossen wurde. An einer Feuerstelle, über der ein Kessel hing, stand eine alte Frau und neben ihr ein schwarzhaariges Mädchen in Sophies Alter. An der Wand hockten auf einer langen Stange Hühner. Zwischen kleinen Kindern, die auf dem strohbedeckten Boden schliefen, lagen Katzen, und inmitten des schmutzigen und stinkenden Durcheinanders standen ein Tisch, einige Schemel und eine Wiege.
»Dort hinten, Frau Grafinja«, sagte der Wirt und verbeugte sich, »sind Bänke. Wir machen es Euch so gemütlich wie möglich. Ihr wollt essen?«
Sophies Mutter nickte und wickelte langsam den feuchten Schal von den Schultern. Die Reisenden ließen sich auf die harten Schemel und Bänke fallen und streckten die nassen, halb erfrorenen Füße zum Feuer. Teller und Schalen klapperten, der Wirt warf dünnes Holz in die Flammen, und das junge Mädchen fing an, Brei in die Teller zu schöpfen. Sie musterte Sophie aus großen schwarzen Augen.
Gräfin Johanna rührte in dem Eintopf aus Zutaten, die schwer zu erraten waren. »Das Essen ist schlecht«, sagte sie abfällig. »Wir spülen es mit Bier hinunter.« Sophie lockerte die Verschnürung ihrer Stiefel. Ihre Füße waren eiskalt und schienen geschwollen zu sein. Sie zwang sich, den Brei mit samt den Brocken zu löffeln, und als sie sich gegen die klammen Decken an der Wand lehnte, überschwemmte sie eine dumpfe Woge der Müdigkeit. Die Wirtin zündete einige Kerzenstummel an und heftete sie mit heißem Wachs auf die Tischkanten. Nun vermochte man mehr Einzelheiten innerhalb des lang gestreckten Raums zu erkennen. In einer Ecke drängten sich einige Schafe zusammen, in der anderen hatten sich die Zofen auf einem Strohlager ausgestreckt. Unter den Hühnern liefen graue Ratten auf einem Balken entlang. Ein Sturm heulte um das Haus und wirbelte Schneeflocken durch die Ritzen.
Es war nicht der erste Gasthof dieser Art, in dem sie Quartier genommen hatten. Aber stets hatte es helle Räume gegeben, große, geheizte Kachelöfen und kaum Ungeziefer. Sophie erhielt von der Schwarzhaarigen einen Holzbecher voll warmem Bier und trank mit großen Schlucken. Erst jetzt merkte sie, wie durstig und hungrig sie war.
»Wie heißt du?«, fragte das junge Mädchen und schob das strähnige Haar in den Nacken. Sie trug einen dicken, grauen Wollkittel und Lumpen und Fellstreifen an den Füßen.
»Ich bin Nela.«
»Ich bin Sophie von Rheinsbeck«, sagte Sophie. »Du wohnst hier in der Einsamkeit?«
»Der kurze Sommer ist schön.« Nela nahm einen Kienspan und leuchtete Sophie ins Gesicht. Eine seltsame Stimmung ergriff Sophie. Ihr war, als erlebte sie einen Traum, der sie in ein unvorstellbar fremdes Land versetzt hatte, in eine abscheuliche Umgebung, in der sie im Schmutz festklebte. Nela flüsterte: »Du bist so schön wie der Sommer, Sophie.«
Sie steckte den Span in den eisernen Halter und zog einen Hocker heran. Schweigend und zusammengesackt vor Müdigkeit, halb ohnmächtig von dem Gestank und dem Rauch des Feuers saßen die Gräfin und ihre Begleitung am Tisch. Im kurzen Lichtschein hatte Sophie sehen können, dass Nela ein schmales, schönes Gesicht hatte, das im Halbdunkel zu leuchten schien; würde man sie waschen und frisieren, wäre sie nicht wiederzuerkennen.
»Ich bin nicht schön. Alle sagen's«, murmelte Sophie. Nela nahm den leeren Teller aus Sophies Händen und steckte ihn in ein mit Wasser gefülltes Schaff. Dann bückte sie sich, kniete vor Sophie nieder und begann deren Stiefel auszuziehen. Sie stellte sie ans Feuer, mitten in kalte Asche, und kehrte mit Binden und Fellstreifen zurück.
»Wo kommst du her, schöne Sophie? Ich sehe, dass du auf der Straße zum Glück und zum Reichtum bist«, flüsterte Nela. Ihre Augen funkelten.
Sophie lachte und schüttelte den Kopf. »Ich träume wirklich! Ich bin von Berlin nach Königsberg und Danzig gefahren, und jetzt bin ich hier. Hier, wo ist das?«
Nela nannte einen Ort, dessen polnischen Namen Sophie nicht verstand. Sie redete, als ginge die Umgebung sie nichts an, als wäre sie mit Sophie allein in dem von stinkendem Qualm erfüllten Raum. Während sie sprach, wickelte sie die Streifen um Sophies Füße bis hinauf zu den Knien. Ihr Französisch war viel besser als das des Wirts.
»Deine Mutter, die Gräfin, sie ist noch jung. Von ihr hast du deine Schönheit. Als du gekommen bist, hat der Nebel aufgehört.«
Es ist gespenstisch, dachte Sophie. Viele ausgetretene und schmutzige Stufen führten von dem spiegelnden Boden ihres bisherigen Lebens, auf dem dicke Teppiche jeden Schritt dämpften, herunter in diese Höhle der Abscheulichkeit. Wie passte dieses schöne junge Mädchen in zerlumpter Kleidung hierher?
»Als Vater meine Mutter heiratete, war sie fünfzehn Jahre alt«, sagte sie und spreizte dreimal die Finger der rechten Hand. »Zwei Jahre danach kam ich zur Welt.«
»Du hast Brüder und Schwestern?« Nela zupfte an Sophies Stirnfransen. »Und du bist schwer krank gewesen, nicht wahr?«
Sophie nickte langsam. »Woher weißt du das?«
»Ich weiß das«, raunte Nela und zuckte mit den Schultern. »Du warst eine schwere Geburt, Sophie.«
Ihre Mutter war bei ihrer Geburt fast gestorben, hatte ihr Vater ihr erzählt, und sie schwebte noch lange danach zwischen Leben und Tod. Eineinhalb Jahre nach Sophies Geburt kam der Sohn Wilhelm Christian Friedrich zur Welt, ein Krüppelchen mit kurzem Bein, das ihre Mutter abgöttisch liebte, dreieinhalb Jahre nach dem Verwachsenen wurde Friedrich August geboren, und vor zwei Jahren gebar ihre Mutter eine Tochter, Elisabeth, die in Zerbst geblieben war. Eine andere Tochter lebte nur wenige Wochen; sie starb, als Sophie sieben Jahre zählte. Sophie fühlte sich, seit sie denken konnte, von ihrer Mutter nur geduldet und oft ungerecht, streng und hart behandelt, obwohl auch ihre Mutter sie »Fiekchen« rief, mit ihrem Kosenamen.
»Meine Mutter starb fast, als ich zur Welt kam«, sagte sie verwundert. Sie lachte verlegen. »Vier Jahre lang musste ich ein Korsett tragen, bis zum zehnten oder elften Jahr. Deshalb gehe und sitze ich so gerade. Wie kannst du das wissen, Nela?«
»Ich weiß, dass du deinen Vater liebst.« Nela zog ein dickes Fell vom Rücken eines Schlafenden und hielt es wie einen Mantel in die Höhe. »Und dass über dir ein Wandelstern leuchtet.«
»Ein Wandelstern? Ich versteh nicht, was du meinst.« Sie liebte ihren Vater Christian August, der ihren Ehrgeiz erkannt hatte – ein Fürst, ernst und sittenstreng, in Grundsätzen und Taten ehrenhaft, dem seine Angehörigen und Untertanen mit höchster Achtung begegneten. Seit mehr als einem Jahr war er nach einem Schlaganfall behindert, der für lange Zeit seine linke Seite gelähmt hatte.
»Gleich wirst du sehen, was ich meine«, radebrechte Nela. »Komm mit. Nur für ein paar Augenblicke.«
Sie hängte den Pelz um Sophies Schultern und zog sie zwischen den Schlafenden und Essenden zur Tür und zerrte das Leder zur Seite. Die morsche Tür öffnete sich knirschend, dünne Eisschichten zerbrachen am Stützbalken, und eisige Luft nahm Sophie den Atem. Nela schien die Kälte nicht zu spüren und ging einige Schritte bis zu einer zugefrorenen Pfütze. Sie deutete zum Himmel.
»Dort. Der Schweifstern! Dein Stern, Sophie!«
In der mondlosen Schwärze strahlten die Sterne klar und grell. Sophie erinnerte sich nicht, den Sternhimmel jemals so beängstigend großartig erlebt zu haben. Die Milchstraße leuchtete wie ein Band aus Eiskristallen. Nela legte den Arm um Sophie, drehte sie halb herum und zeigte zum Firmament. Sophie hob den Kopf und schauerte, als sie den großen Stern sah, der einen langen, gekrümmten Schweif zwischen den anderen Himmelslichtern hinter sich herzog. Sie starrte den Schweifstern an und glaubte sehen zu können, wie er sich bewegte – seltsamerweise dorthin, wohin sein Strahlenschwanz deutete. Ihr Herzschlag setzte aus; ebenso wie die bittere Kälte drang aus allen Richtungen eine dunkle Furcht auf sie ein und ließ sie zittern. Ihre Augen begannen zu tränen. Sie warf einen letzten Blick auf die strahlende Degenklinge zwischen den Sternen und hielt das Fell enger vor der Brust zusammen.
»Ich hab den Stern gesehen. Schrecklich!«, sagte sie mit bebenden Lippen. »Wir holen uns den Tod in der Kälte.«