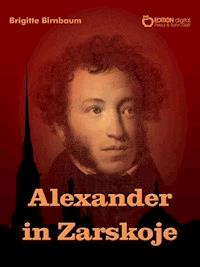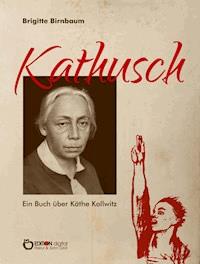
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Schade, dass sie kein Junge ist!“, meinte der Vater, als er die Zeichnungen von Kathusch gesehen hatte. Seine Tochter war begabt, das bemerkte er sofort, und eigentlich gehörte sie auf eine Kunsthochschule, wo ihr Talent gefördert und geformt würde, wo sie lernen könnte. Aber - wo gab es das, eine Malschule für Mädchen? Die Ausbildungsstätten waren den Männern vorbehalten, junge Frauen sollten sich vorbereiten auf Haushaltsführung und Kindererziehung, und sie sollten sich üben in stiller Bescheidenheit. Das alles aber passte nicht zu Kathusch, und der Vater spürte es. Nach langem Suchen und oft enttäuschten Hoffnungen endlich wird in Berlin eine Malschule gefunden, die Mädchen unterrichtet. Kathusch ist glücklich, der Weg scheint frei... Brigitte Birnbaum erzählt von Kindheit und Jugend einer Frau, die ihren Platz als Künstlerin hart erkämpfen muss, ehe sie bekannt und weltberühmt wird als DIE KOLLWITZ. Das Buch erschien erstmals 1986 bei Der Kinderbuchverlag Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Brigitte Birnbaum
Kathusch
Ein Buch über Käthe Kollwitz
ISBN 978-3-86394-071-3 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1986 bei Der Kinderbuchverlag, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Vorbemerkung
Hätten Kathusch und ich zur selben Zeit gelebt, wären wir Nachbarskinder gewesen. Zumindest, wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch weilte. Kathuschs Eltern und meine Großeltern wohnten um die Ecke. Und wenn ich mit Großvaters braunem Dackel Waldi spazieren ging, das heißt, eigentlich ging er mit mir, hätte mir Kathusch bestimmt nachgeguckt. Sie hatte ja keinen Dackel. Ich hätte ihr erlaubt, Waldi zu streicheln.
Aber Kathusch ist lange, lange vor mir über die Königsstraße gelaufen. Meine Großeltern zogen in die Gegend, als Kathuschs Eltern schon gestorben waren, und es war für mich reichlich mühsam herauszufinden, dass Kathusch keinen Dackel hatte und was sie sonst noch alles anstellte.
1. Kapitel
Kathusch wusste, was sie wollte. Lisusch, die jüngere Schwester, zögerte. Es goss in Strömen. Schon den dritten Tag, von morgens bis abends und vom Abend bis zum Morgen. Dem Himmel musste doch schon ganz elend sein, so viel Wasser hatte er hergegeben. Kathusch machte es sich auf einem Schemel vor dem Fenster bequem und ordnete leere weiße Zettel auf ihren Knien. Dieser Platz war nicht nur der hellste in dem nicht allzu großen Zimmer. Von hier aus konnte sie sehen, wenn der Vater kam. Sie erwartete ihn sehnlich. Obwohl sie sich erst vorvorgestern von ihm verabschiedet hatten.
Lisusch schurrte mit einem der sechs Stühle, die sich um den Tisch drängten und von unterschiedlichster Machart waren. Auf welchen sollte sie sich setzen? Auf den einzigen mit rotem Samt gepolsterten oder auf den mit durchgedrücktem Rohrgeflecht? Sie wusste doch, was Kathusch gleich zu ihr sagen würde.
Kathusch aber sagte vorerst nichts. Hinter den Mädchen, gegenüber der Fensterwand, fütterte Minna den Kachelofen, warf ihm Birkenscheite in den gierigen Rachen. Und das mitten im Sommer, im Juli. Genau im Juli 1876. Solange sich Kathusch erinnern konnte, war Minna da gewesen, und stets hatte sie das Richtige getan, nach Mutters leiser Anweisung. Minna war zwar älter als die Mutter. Mutter war eben die Mutter. Was sie verlangte, taten sowieso alle. Jedenfalls die Kinder und Minna. Nur Kathusch manchmal nicht. Doch in diesem gerade begonnenen Lebensjahr wollte sie sich bessern. Das hatte sie fest versprochen. In der vergangenen Woche war sie neun geworden, also ins zehnte getreten. Nun würde sie beim Ballspielen nicht mehr mogeln. Die Neun ist keine gute Zahl, fand Kathusch. Nur an der Neun lag es. Auch, dass es mit manch anderem nicht so recht geklappt hatte. Sie kramte in der Pappschachtel nach einem geeigneten Malstift.
»Gib mir auch einen«, forderte Lisusch, weil die Schwester doch nicht sagte, was sie erwartet hatte, und weil sie sich langweilte.
Kathusch hörte nicht. Ihre Gedanken weilten beim Vater. Ob er schon von Königsberg abgefahren war? Sobald es seine Arbeit zuließ, wollte er nachkommen und wenigstens zwei, drei Wochen Ferien mit der Familie hier im Fischerdorf verbringen. Würde er sich bei solchem Wetter auf den Weg machen?
Der Wind spielte mit der Ofenklappe, und die Fliederbüsche vor dem Haus erschauerten.
»Bitte, Kathusch! Gib mir auch einen, den grünen«, porrte die Kleine eindringlicher und verjagte eine Fliege, die auf ihrem Arm landete.
»Wolltest du nicht Julie Salat pulen helfen?«
»Und du?« Lisusch schob sich näher zum Fenster.
»Ich muss malen«, flüsterte Kathusch ernst.
Unbeeindruckt wischte Lisusch, so weit sie reichen konnte, mit der Hand die von der Zimmerwärme erblindeten Scheiben klar und strich die feuchten Finger am Rock trocken. So waren ihre Schwestern nun mal. Julie, die Große, half am liebsten in der Küche, und Kathusch zeichnete gern. Lise horchte erst auf, als Kathusch scheu sagte: »Wenn Vater kommt, muss es fertig sein.« Weiter erklärte sie sich nicht. Ihr schmaler Körper krümmte sich und richtete sich dann störrisch auf.
Lisusch beobachtete sie. Mit Kathusch war heute wieder mal kein Gespräch zu beginnen. Die Kleine seufzte schwer. Trotzdem wechselte sie nicht zu Julie über. Sie blieb bei Kathusch. Die liebte sie am meisten von ihren Geschwistern. Dennoch versuchte Lisusch, Kathusch zu ärgern: »Du fabrizierst ja doch keinen Hahn, nicht mal’n Hähnchen.«
»Ich mag keine Hähne.«
Was Kathusch nicht mochte, zeichnete sie nicht. Und Hähne mochte sie tatsächlich nicht. Schon gar nicht so ein langbeiniges, triefnasses Ungeheuer, wie es mit vorgereckter Gurgel über den Hof rannte und, durch die Pfützen platschend, einer ebenso pliesrigen Henne nachjagte. Kathusch schüttelte sich.
Doch leider hatte Lisusch recht. Kathusch konnte keine Hähne zeichnen. Noch mehr erboste sie, dass sie mit sich selber nicht fertig wurde, mit ihrem eigenen Gesicht, mit ihrer kleinen Nase und den großen Augen. Deshalb warf sie der Schwester vor: »Kannst es ja selber nicht.«
»Will ich auch gar nicht«, meinte Lisusch gleichmütig. Wozu denn bloß? dachte sie. Das Leben wurde nicht lustiger, wenn man ein Hähnchen zeichnen konnte.
Kathusch wollte es aber können. Für sie war es wichtig. Das nachdenkliche Gesicht zum Fenster gewandt, hockte sie auf dem Schemel und befingerte den Stift. Sie wollte alles zeichnen können, dass es wie lebendig wirkte, wie auf jenen Bildern, von denen der Großvater Rupp eine Mappe voll besaß und die sie nur an Sonntagen ansehen durfte. Das Zeichnen und das Malen muss sich doch erlernen lassen. Konrad, der Älteste und einzige Bruder, hatte gesagt, man kann es studieren. Er will selbst studieren, später nach dem Abiturium. Und wenn Konrad studierte, warum sollte sie es nicht auch, wenn sie alt genug sein wird. Der Vater hatte studiert und der Großvater Rupp ebenfalls. Zwar war von keinem Mädchen in der Familie bekannt, dass es die bunte Studentenmütze getragen hatte. Diese Tatsache schreckte Kathusch jedoch nicht. Vielleicht hatte sie keine gewollt. Nur von der schönen Tante Lina wusste Kathusch gerüchtweise, dass jene sich hatte als Sängerin ausbilden lassen wollen. Das hatte man ihr nicht erlaubt. Sich vor völlig fremde Menschen hinstellen und singen war ja auch etwas ganz anderes als malen! So was getraute sich Kathusch nie.
Sollte sie Tante Lina zeichnen, aus dem Kopf? Nein. Kathusch musste den Vater mit etwas ganz Neuem erfreuen. Vielleicht war es besser, sich mit Konrad in dieser wichtigen Angelegenheit zu besprechen? Wo steckte er eigentlich? Seit dem Frühstück blieb er verschwunden. Kauerte er oben in seiner Schlafkammer und las? Vielleicht unternahm er einen Erkundungsgang durch Scheune und Ställe? Oder begleitete er die Mutter und Frau Schlick zum Brotbacken? Trug ihnen die schweren Teigmollen? Oder angelte er gar am Mühlteich Karpfen?
Es regnete augenblicklich schwächer, so als müsse der Himmel mit seinem Vorrat sparen, damit er noch möglichst lange reiche. Spannte der Vater jetzt zu Hause in der Königsstraße die Füchse an, konnte er in fünf Stunden hier sein. Vorvorgestern waren sie auch fünf Stunden mit Sack und Pack durchs Samland gefahren bis hinauf an die steile Küste ins Fischerdörfchen Rauschen, wo der Vater der Witwe Schlick ihr Gehöft abgepachtet hatte. Kaum waren sie vom Wagen gesprungen, fielen die ersten Tropfen. Hielt das Wetter so an, würden sie heute wieder nicht zum Strand laufen können.
Kathusch guckte derart bekümmert, dass Lisusch fürchtete, sie gekränkt zu haben. Versöhnend schmeichelte sie: »Nimm meinen Stift. Mit dem geht’s leicht.«
Kathusch lächelte wie eine Erwachsene über ein Kind. Ohne länger zu überlegen, setzte sie an. Aus Strichen und Strichelchen erwuchs ein Fluss, der Pregel, und auf ihm ein Schleppkahn, beladen mit Ziegeln, wie er regelmäßig am äußeren Hof bei ihnen anlegte, als sie noch am Weidendamm wohnten. Der Schiffer und Vaters Gehilfen stapelten die Ziegel am Ufer und einen Teil gleich auf schwere Wagen, um sie an Ort und Stelle zu verfrachten, wo der Vater Häuser baute. Lisusch sah ihr aufmerksam über die Schulter und versuchte sich dann am selben Motiv. Auch sie strengte sich an, alles genau wiederzugeben.
Minna wuchtete einen knarrenden Reisekorb vorbei ins hintere Zimmer, das die Eltern zum Schlafen nutzten. Auf ihrem Rückweg kontrollierte sie nochmals den Ofen. Aus der Küche blickte Julie herein. Die beiden ließen sich beim Malen durch nichts stören, schon gar nicht durch Julie. Erst als von der Straße her Fuhrwerkgerassel ertönte und ein Hund wütend bellte, schaute Kathusch hoch.
Der Vater kam am nächsten Tag und mit ihm die Sonne. Wie auf Bestellung brach sie strahlend durch die Wolken, als der Kutscher die Pferde anhielt. Den Wasserlachen ausweichend, schossen Julie und Lisusch auf den schlanken Mann los, der vom Wagen stieg, und ließen ihm keine Zeit, seine steif gesessenen Glieder zu recken. Die Mutter ging ihm gemessen ein paar Schritte entgegen. Sogar Konrad drängte sich an ihr vorbei, als hätte er ein besonderes Anrecht. Nur Kathusch verharrte neben dem Eingang. Ihre Wiedersehensfreude trübte sich sichtlich. Der Vater hatte einen Jungen mitgebracht.
Konrad machte einen Luftsprung und schüttelte dem Neuankömmling kräftig die Hand.
Der Vater lachte und führte den fremden Jungen zur Mutter. »Das ist Karl Kollwitz.«
Karl Kollwitz nahm höflich seine Mütze ab und sagte: »Guten Tag, Frau Schmidt!«
In Königsberg war davon gesprochen worden, dass ein elternloser Klassenkamerad von Konrad eingeladen werden durfte. Konrad sollte nicht nur kleine Mädchen um sich haben. Ihre Spiele reizten ihn nicht mehr. Konrad war immerhin fast dreizehn. Beinah erwachsen.
So sah er also aus, der Schulfreund. Er hatte blondes Haar, wie Stroh, und blaue Augen. Kathusch blickte ihn ängstlich an. Sie fürchtete, er könnte ihren Plan vereiteln.
»Willkommen, Karl«, sagte die Mutter. Leicht mit dem Kopf nickend, bejahte sie ihn und reichte ihrem Mann die Hand.
Lisusch und besonders Julie wollten Karl ebenfalls begrüßen, doch er strebte auf Kathusch zu. Sie lächelte schüchtern. Die Neugier auf den fremden Jungen war in ihr erwacht.
»Käthe«, stellte sie der Bruder vor. »Die Bockigste in unserer Familie. Wirste bald merken.«
Erstaunlicherweise grinste Karl nicht, nicht mal aus Sympathie für Konrad. Er überhörte die Bemerkung und lächelte freundlich zurück.
Unterdessen trugen Minna und der Kutscher allerlei Pacheidel und Paudeln, Kisten und Kasten also, Sachen, die auf der ersten Fuhre zwischen den Kindern, Bettzeug und Hausrat keinen Platz gefunden hatten, ins Haus. Kathusch und die beiden Jungen standen im Weg, und sie war froh, als der Vater sie rief.
»Dir ist’s wohl gar nicht recht, dass ich mich schon eingefunden hab?« Herr Schmidt beugte sich zu seiner Tochter herab. »Oder hast du wieder Bauchschmerzen?«
Kathusch schützte mit den Händen die Augen vor der Sonne und tat den Mund nicht auf.
»Sie muss sich erst wieder eingewöhnen«, half ihr die Mutter.
Das ist es ja gar nicht, dachte Kathusch. Ich hab mich schon an das Fischerhaus gewöhnt, wenn mir auch der große, verräucherte, bis hinauf in die Dachsparren offene Vorraum mit den in den Ecken lagernden, nach Teer riechenden Netzen und Reusen, Aalpricken und Keschern unheimlich ist. Ganz anderes beunruhigte sie. Sie wollte dem Vater etwas zeigen. Der fremde Junge hinderte sie daran.
Auch ohne Karls Anwesenheit hätte Kathusch den Vater nicht für sich allein in Anspruch nehmen können. Nachdem sich Herr Schmidt erfrischt, ein wenig ausgeruht und den Anzug gewechselt hatte, zog die Familie geschlossen zum Strand. Voran Konrad und der Waisenjunge, nach ihnen Kathusch mit Lisusch, und Julie an der Seite der Eltern machte den Schluss. In dieser Reihenfolge spazierten sie dem Meer zu, von etlichen unsichtbaren Augen hinter Gartenhecken aufs Korn genommen. Der Herr Baumeister aus Königsberg. Zugegeben, hätte er der Witwe Schlick nicht das Haus abgepachtet, wäre sie mit ihren beiden Marjellen verhungert. Jewiß, jewiß. Doch was würde er ihnen für neue Moden ins Dorf schlorren? War bereits ein älteres Herrche, der Baumeister, über die Fünfzig hinaus, wie man so hörte, und noch kleine Kinderchen. Das jüngste man eben sechs.
Da in Rauschen nichts passierte, wurde auch das Unbedeutendste registriert. Der rosa Schirm der Frau Baumeister und die Hüte der Töchter. Von den Fischerfrauen bestaunt, von ihren Männern begrient: »Ei der Deiwel!«
Das Geräusch der Mühle und das Gehämmer der Schmiede blieben hinter der Wandergruppe zurück, die sich zwischen wilden Kamillen und regennassen Beifußstauden durchkämpfte, vom Jubel der Lerchen begleitet. Wer wird als erster hinter den windschiefen Bäumen das Meer entdecken?
»Vorsichtig!«, warnte die Mutter. »Kathusch! Konrad! Vorsichtig!« Völlig unnötig hielt sie Julies Hand fester.
Und plötzlich lag vierzig Meter unter ihnen das Meer. Blank und glatt. Allerdings noch nicht voll sichtbar. Trotz des hinderlich langen Rockes lief Kathusch behände oben auf dem Steilufer entlang, Lisusch hinter sich herzerrend, bis sie einen passablen Abstieg fand. Der Mutter schien er viel zu steil, viel zu gefährlich. Doch Kathusch brachte sich und die Schwester geschickt hinunter. Im weißen Sand einsinkend, stampften sie bis an den Rand der Wellen, die sich spielerisch vortasteten und wieder zurückwichen.
»So viel Wasser!«, sagte Lisusch beeindruckt. »Oh!« Sie rückte ihr verrutschtes Hütchen wieder in die Stirn.
Nach und nach kamen auch die übrigen aus der Höhe herab. Vater und Konrad der Mutter helfend und Karl die Julie stützend. Gut, dass ihnen Kathusch den Rücken zukehrte. Es hätte ihr einen kleinen Stich versetzt.
Alle atmeten tief die salzige Kühle ein.
»Kann es woanders schöner sein?«, fragte der Vater.
Die Mutter schüttelte den Kopf.
Kathusch verharrte reglos. Sie kniff ihre dunklen Augen leicht zusammen. Es hatte den Fischer Schlick nicht wieder hergegeben, das Meer. Ein Grab hatte es ihm bereitet. Auch das Läuten der Glocken hatte ihn nicht zurückgerufen. Kieloben trieb sein Boot an Land, dachte Kathusch an das in der Familie viel besprochene, grausige Ereignis. Sie zitterte. Julie glaubte, sie fröre, und knöpfte ihr fürsorglich die Jacke am Hals zu.
»Im Vorjahr war der Strand breiter«, übertönte Konrad die spitzen Möwenschreie. »Weißt du ...«
Karl hörte ihm gar nicht zu. Karl Kollwitz sah zum ersten Mal in seinem Leben die See. Wellen türmten sich auf und vergingen. Ihre gleichmäßig bewegte Ruhe packte ihn, ihre Unendlichkeit. Er stand neben Kathusch, und sie schauten beide dorthin, wo weit, weit hinten der Himmel das Meer berührte.
»Furchtlos und unbesiegbar. Gefährlich, wenn es sich mit dem Wind vereint. Welch ein Bild!« begeisterte sich der Vater erneut. »Kein Maler bringt so etwas zustande.«
»Warum wohl nicht?«, fragte Kathusch und blickte ihn hoffnungsvoll an. Seine Worte machten sie unruhig.
Er hatte sich jedoch zur Mutter gewandt und bedauerte: »Wir hätten Lina mitnehmen sollen. Die Luft hier hätte ihre Nerven gestärkt.«
Frau Schmidt nickte beipflichtend unter ihrem Sonnenschirm.
»Für Olga wäre trotzdem noch ein Schlafplätzchen gefunden worden«, meinte ihr Mann.
»Du glaubst, dass sie es wahr macht?«, fragte die Mutter erschrocken.
Jetzt nickte der Vater, der einen Finger ins Wasser hielt und die Temperatur prüfte. Konrad folgte seinem Beispiel. »Gar nicht kalt«, stellte er fest.
»Hm ... hm ...«, brummte Herr Schmidt, der den Wunsch seines Sohnes nur zu gut erriet. Aber die Mutter erlaubte noch kein Fußbad, nicht einmal den Jungen. Also blieb ihnen nichts anderes, als Jagchen zu spielen. Stolpernd rannten die Kinder hin und her und hetzten sich gegenseitig. Am schwersten war Kathusch einzufangen, am leichtesten Julie. Erheitert beobachtete der Vater das Treiben. Machte Julie es dem Karl Kollwitz absichtlich so leicht? Der Vater schmunzelte. Um diese Tochter würden ihm keine grauen Haare wachsen. Julie ist ein hübsches Mädchen, entschied er, und umgänglich dazu.
Als sie genug hatten, suchten Konrad und Karl heimlich nach Bernstein. Karls im Waisenhaus verbliebene Schwester hatte ihn gebeten, ihr wenigstens ein honiggelbes Klunkerchen mitzubringen. Lisusch wieselte ihnen vor den Beinen herum. Sie wurde aber geduldet, denn auch sie fand kein einziges Splitterchen.
»Kinder«, erinnerte sie der Vater, »wir haben keinen Sammelschein, also auch kein Recht, Bernstein aufzuheben.«
»Er sieht es doch nicht«, maulte Lisusch. Der berittene Strandaufseher war nicht in Sicht.
»Trotzdem. Manche Leute im Dorf verdienen sich damit ihr Brot. Wir wollen es ihnen nicht stehlen.«
Kathusch blieb hinter den anderen zurück. So vernahm sie nicht, dass die Mutter noch einmal auf Olga Ulrich und deren Vorhaben zu sprechen kam. Kathuschs Schatten fiel aufs Wasser, ein vergrößerter Scherenschnitt von ihr. Sie war kein Mädchen mehr, diesem Schatten nach war sie eine Erwachsene. Was würde dann sein, wenn sie erwachsen war? Sie glaubte es zu wissen. Nur noch einwilligen musste der Vater. Der Augenblick schien ihr günstig, mit ihm darüber zu reden. Doch wie anfangen? Sie hob und senkte die Schultern. Auch der Schatten hob und senkte die Schultern. Demnach war er nicht erwachsener als sie, sonst hätte er einen Rat wissen müssen. Unschlüssig wandte sie sich ab und schüttelte den Sand aus ihren Schuhen, obwohl das sinnlos war. Schon beim nächsten Schritt rieselten erneut tausend Körner nach und drückten.
»Es wäre günstiger gewesen, Schnürstiefel anzuziehen«, sagte die Mutter.
Kathusch dachte an Barfußgehen.
Der Vater erkundigte sich, wie sie die Regentage verbracht hatten. Ob Konrad schon gerudert hätte auf dem Mühlenteich?
Nein. Gerudert hatte Konrad noch nicht, aber angeblich eine fündige Angelstelle entdeckt. Aale. An der Schleuse. Und Julie hatte sich einen weißen Kragen gehäkelt, den die Mutter kopfnickend lobte. Kathusch schwieg mit einem Blick auf Karl Kollwitz, was dem Vater entging. Morgen ist auch noch ein Tag, überlegte sie. Aber morgen und an den folgenden Tagen bestimmte das herrliche Wetter das Leben der Schmidt-Familie, und Kathusch vergaß ihr Vorhaben.
Der Vater wunderte sich, dass Kathusch so mithielt. Weder Bauchschmerzen quälten sie noch nächtliche Angstträume. Kathusch saß nicht mürrisch herum und grübelte, wie sie’s mitunter zu Hause tat. Sie wurde nicht müde auf den kilometerlangen Wanderungen, jammerte unterwegs nie über Durst und Hitze. Geschickter als die Jungen kletterte sie über Geröllhalden. Dornengestrüpp überwand sie, ohne dass es ihre Leinenbluse kostete. Kathusch fürchtete sich weder vor Bauernhunden noch vor Kühen. Zu gern wäre sie auch nach Warnicken mitgegangen, durch die Wolfsschlucht, die sie sich tief und dunkel vorstellte. Doch diese Tour wollte der Vater mit Konrad und dem Waisenjungen allein machen. Sie war zu weit für die drei Mädchen, besonders für Lisusch. Und ohne Lisusch ging Kathusch nicht. Oder graulte sie sich doch vor der Wolfsschlucht?
»Da ist’s so finster, da kannste die Wolfsaugen leuchten sehen«, raunte Konrad, der Kathusch nicht unbedingt dabei haben wollte.
»Und wenn’s nur Glühwürmchen sind?«, gab Karl zu bedenken.
»Es werden schon Wolfsaugen sein, wie der Müller sagt«, unterstützte Julie den Bruder, ehrlich davon überzeugt und sich selbst ein wenig fürchtend.
Aber Karl winkte ab. »Na, wennschon.«
Die drei Mädchen blieben bei der Mutter. Vormittags teilten sie sich mit den Staren die letzten Kirschen von den Bäumen im Obstgarten neben dem Haus. Den Nachmittag verspielten sie am Strand, natürlich unter Mutters Aufsicht. Frau Schmidt saß auf einem vom Salzwasser blank gescheuerten Baumstamm, den die See von ferner Küste angeschwemmt hatte, und strickte aus weißem, feinem Garn Strümpfe. Streng und verschlossen saß sie da. Anders kannten Käthe und ihre Geschwister die Mutter nicht. Nie spielte oder lachte sie mit ihnen. Die Kinder erwarteten es auch nicht. Dunkel gekleidet, obwohl es sogar im Schatten, den die hohe Düne hinter ihnen warf, heiß war. Der Sand gloste voller Hitze wie in der Wüste Afrikas, und die Mädchen durften barfuß gehen. Lisusch drückte mit ihren nackten Sohlen Muster in den feuchten Uferstreifen, möglichst dicht neben Kathusch bleibend, die die Gelegenheit nutzte, den Rock ungeniert raffte und bis an die Knie im Wasser watete. Julie traute sich nicht, ihr zu folgen, nicht etwa aus Angst, auf eine scharfe Muschel oder Qualle zu treten. Unweit von ihnen hängte ein Fischer eben gefangene Flundern zum Trocknen auf, um sie nachher über glühenden Kiefernzapfen zu räuchern. Zwei andere und eine krumme Alte entwirrten ein großes Netz und begannen, es mit einer hölzernen Nadel zu flicken. Julie schämte sich, vor den Männern ihre Beine zu zeigen. Kathusch genoss die Kühle und wäre am liebsten bis zum Halse untergetaucht. Einfach die Arme ausbreiten, dachte sie, und sich fallen lassen. Aber sie ließ sich nicht fallen. Sie blieb stehen und kratzte mit dem linken Fuß die rechte Wade. Der leichte Wind zerrte an ihrem Kleid, bauschte die Ärmel und schlug ihr den Kragen in den Nacken. Dann überredete Lisusch sie zum Burgenbau.
»Nein. Keine Burg. Einen Tempel«, bestimmte Kathusch. »Wir wollen unsere schönsten Muscheln Neptun opfern.«
Auch das war der Jüngsten recht. Völlig war Kathusch nicht bei der Sache. Aufmerksam verfolgte sie die Arbeit der Fischer, ihre Bewegungen, mit denen sie das Netz strafften, einstachen und eine neue Masche knüpften, die den Fischen zum Verhängnis werden sollte. Es schien, als sah Kathusch etwas, was nur für sie zu sehen war.
Plötzlich fiel ihr ein, dass sie noch immer nicht mit dem Vater darüber gesprochen hatte.
Als sie vom Strand heimkehrten, waren der Vater und die Jungen noch nicht aus Warnicken zurück.
Voller Schaudern dachte Kathusch an die glühenden Wolfsaugen. Wenn dem Vater etwas zugestoßen war? Nie hatte sie daran gedacht, dass dem Vater etwas zustoßen könnte. Gewiss war es vorhin Sünde gewesen, Neptun zu opfern. Lehrte sie doch Großvater Rupp allsonntäglich, zu Gott zu beten. Wie, wenn sich dieser Gott nun rächte und ihr den Vater nahm? Dieser Gott sollte angeblich alles sehen können, was auf Erden passierte. Deshalb war er ihr unsympathisch. Sie mochte ihn nicht. Und das sah er natürlich auch. Kathusch war nahe daran, in Tränen auszubrechen.
Der Mutter merkte man keinerlei Aufregung an. Seit der kleine Bruder Benjamin gestorben war, merkte man der Mutter keine Aufregung mehr an. Benjamin war das dritte Kind, das die Mutter verlor, das dieser Gott zu sich genommen hatte. Mit welchem Recht eigentlich? Kathusch erinnerte sich gut daran, wie Minna damals ins Zimmer trat und meldete: »Frau Schmidt ...«
Minna trat auch jetzt in die Stube, stellte eine große Schüssel mit Schnittlauch gewürzter Glumse auf den Abendbrottisch und sagte: »Frau Schmidt ... wir werden wohl noch ein bissken lauern müssen ... ich mein man ... die Jungchen werden unterwegs marode jeworden sein.«
Mit zusammengezogenen Brauen hörte Kathusch zu. Konrad war kein Schwächling. Konrad hatte sogar schon nach Amerika auswandern wollen, zu den Indianern. Heimlich. Es hatte nicht geklappt. Aber dieser Waisenjunge hatte vielleicht schlappgemacht.
Karl und Konrad wirkten alles andere als erschöpft. Jeder schwenkte einen Glockenblumenstrauß. Unübersehbar hatte sich ihnen und dem Vater eine Frauensperson angeschlossen; nicht groß, eher klein; weder dünn noch dick; auf dem Rücken eine Art Quersack, an dem seitlich ein Paar Männerschuhe baumelten. Sie marschierte barfuß, stützte sich auf einen derben Wanderstock, der ihr gleichzeitig als Waffe dienen mochte, und war über und über grau mit Straßenstaub eingepudert. Nach der Mutter erkannte auch Kathusch sie sofort an ihrem Hut, der, so wurde erzählt, aus ihrer Jungmädchenzeit stammte: Olga Ulrich.
»Tante Ulrich!« wie die Schmidtkinder sie einstimmig riefen. Nur für Karl war sie das Fräulein Ulrich.
»Die lebt im Stift«, flüsterte ihm der Freund zu, als sie sich am Dorfeingang getroffen hatten.
Die Stiftsdamen, die Karl bisher kennengelernt hatte, waren vornehm. Gesittet. Streng.
Olga Ulrich klopfte sich den Staub vom grob gewebten Streifenrock und überging das leise Missfallen in Frau Schmidts Augen. Vergnügt übers runde Gesicht lachend, erklärte sie in breitem Tonfall: »Hier in Rauschen soll das Sonnche einmalig scheen untergehen. So was muss man jesehen haaben, ehe einen der Deiwel holt.«